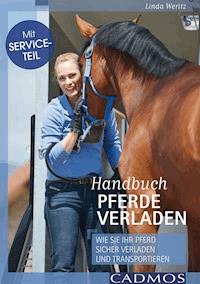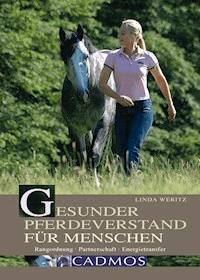
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cadmos Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Mit Pferden kommunizieren
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
´Gegenseitiges Vertrauen und Respekt voreinander sind die Schlüssel zu einer erfüllten und erfolgreichen Freundschaft zwischen Mensch und Pferd. Dieses Buch hilft dem Leser zu erkennen, wie sein eigenes Verhalten auf sein Pferd wirkt und zeigt ihm einfühlsam und sachlich fundiert den Weg zur bestmöglichen Beziehung zu seinem Sport- und Freizeitpartner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © 2006 by Cadmos Verlag, BrunsbekGestaltung und Satz: Ravenstein + Partner, VerdenTitelfoto: Julia WentscherFotos: Reto Boltshauser, Michael Maierhofer,Christiane Slawik, Julia WentscherKonvertierung: S4Carlisle Publishing ServicesAlle Rechte vorbehalten.
Abdrucke oder Speicherung in elektronischen Mediennur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durchden Verlag.
eISBN 978-3-8404-6255-9
Inhalt
Meine Motivation
Was macht einen Pferdeliebhaber zum Horseman?
Sensibilität entwickeln
Soziales Wesen: Das Pferd und sein Verhalten
Das Leben in der Herde
Die Rolle des Hengstes
Die Rolle der Stute
Die Rolle der Fohlen und Jährlinge
Warum Rangordnung sinnvoll ist
Ein Pferdeleben in der Herde – aus gutem Grund
Soziale Organisation der Herde
Soziale Organisation bei Pferden in menschlicher Obhut
Der Hengst in der Obhut des Menschen
Pferd und Mensch in der sozialen Interaktion
Perfekte Manieren bei der ersten Begegnung
Freundliches Leadership von Anfang an
Lösungswege für aggressive Pferde
Lösungswege für ängstliche Pferde
Begrüßung mit Futter
Leadership und Partnerschaft
Realistische „Partnerschaft“ und Freundschaft mit Pferden
Ich bin, wie ich sein will
Authentische Autorität: Der Schlüssel zur Harmonie
Pferdekommunikationswissenschaft
Definition des eigenen Führungsstils
Eine Rangordnung etablieren
Aufmerksamkeit und Bewusstheit
Die Bedeutung der Körpersprache
Freundschaft schließen
Die Individualdistanz
Rangordnungsarbeit
Die ideale Ausrüstung
Erfolg durch Sicherheit
Erfolg durch die richtige Lernatmosphäre
Die richtige Lernatmosphäre für spezielle Charaktere
Nützliche Übungen
Richtiges Führen zum Erhalt der Rangordnung
Anhalten und Stillstehen
Tempovariationen
Seitwärts übertreten lassen
Rückwärtsrichten
Stangen-L
Fahren vom Boden aus
Longieren als Rangordnungsübung
Plädoyer für die Doppellonge
Die Psychologie des Longierens
Die Herausforderung für den menschlichen „Leader“
Stimmungsübertragung
Selbstvertrauen lernen
Mit Energie kommunizieren
Die richtige Energie für nervöse bis hochexplosive Pferde
Die richtige Energie für triebige Pferde
Zum Schluss
Danksagung
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine „Meister“, Kollegen und Schüler – ob zwei- oder vierbeinig.
Sehr bedanken möchte ich mich auch für die hervorragende Arbeit meiner Lektorin Anneke Bosse, der erstklassigen kollegialen Unterstützung von Johan Zagers und seinem Team im Dressurstall Zagers in Düsseldorf und bei den Fotografinnen Christiane Slawik und Julia Wentscher für ihre wunderbaren Bilder.
Vielen Dank auch an meine Familie und meine Freunde für ihr Verständnis dafür, dass ich wenig Zeit hatte, und für ihre geschätzte Unterstützung.
Für Chiron und Paladin
Linda Weritz
Meine Motivation
Foto: Wentscher
Pferdeverstand: das, was Pferde davon abhält, auf künftiges Verhalten der Menschen zu wetten.
Oscar Wilde
In den vielen Jahren, die ich mit Pferdeleuten und Pferden verbracht habe, ist mir eine Sache klar geworden: Es gibt sehr viele Pferdeleute auf der ganzen Welt, die Pferde aufrichtig lieben und schätzen. Doch es gibt nur wenige Menschen, die man als „richtige“ Pferdemenschen bezeichnen kann – als „afficionados“, die mehr wissen (wollen) über das Pferd an sich, darüber, wie es denkt, fühlt und kommuniziert. Diese Menschen schaffen es, die Welt mehr oder weniger durch die Augen des Pferdes zu sehen; sie sind selbst ein Stück weit Pferd geworden. Unter den vielen Menschen in allen möglichen Sparten des Pferdesports sind nur wenige, die das geheimnisvolle Tier, mit dem sie umgehen, wirklich intellektuell und sinnlich erfasst haben und die erfolgreich mit ihm kommunizieren können.
„Problempferd“? Oder eher das Ergebnis einer missglückten Verständigung zwischen Mensch und Tier? (Foto: Slawik)
Seit 6 000 Jahren beschäftigt sich der Mensch mit der Spezies Pferd, und vermutlich hat sich an den Problemen zwischen Mensch und Pferd seit dem Beginn der Domestizierung wenig geändert. Es ist eine beschämende Vorstellung, seit 6 000 Jahren keine wesentlichen Verbesserungen herbeigeführt zu haben. Sicher verfügen wir heute über die modernste Ausrüstung zur Ausbildung des Pferdes, und auch der Tierschutz ist in einem traurigen Moment der Menschheit erfunden worden. Die meisten Menschen und Pferde jedoch leben nicht in einer wirklich glücklichen Beziehung miteinander, und es gibt viel zu viele Pferde, die als „Problempferde“ abgestempelt werden.
Wäre mein persönlicher Pferdevirus nicht so stark gewesen, dann hätte ich mich als junges Mädchen, das sehr viel Zeit in der typischen deutschen Reitschule der Siebzigerjahre mit ihren dunklen Gitterboxen, fehlendem Auslauf und entsprechend mürrischen bis verhaltensauffälligen Pferden verbrachte und zudem von autoritären Reitlehrern zweifelhafter Kompetenz unterrichtet wurde, leicht für immer von den Pferden trennen können. Doch da war zugleich die konkrete Vorstellung, dass es auch irgendwie anders sein könnte. Es gab eine andere Pferdewelt, die meine Liebe zu Pferden und den Wunsch förderte, sooft wie möglich mit ihnen zusammen zu sein.
Die Harmonie zwischen Mensch und Pferd – bei Kindern vorhanden, bei Erwachsenen nicht selten verloren gegangen. (Foto: Wentscher)
Ich hatte das Glück, einen Teil meiner Kindheit in einer ländlichen Gegend verbringen zu dürfen. Auf der anderen Straßenseite meines Elternhauses gab es eine Wiese, auf der eine Herde von etwa 15 Ponys lebte. Mit diesen Tieren verbrachte ich meine gesamte Freizeit. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung von Pferden, aber glücklicherweise auch keine Angst.
Dass alles immer so friedlich und harmonisch schien, ist meine lebendigste Erinnerung. Durch die lang gezogene Wiese floss ein kleiner Bach, und am oberen Ende gab es ein paar Schatten spendende Bäume. Die Ponys grasten, tranken oder wedelten sich gegenseitig die Fliegen aus dem Gesicht, sie dösten, und die Jüngeren tobten manchmal herum. Nach und nach traute ich mich, die kleinen Pferde zu kraulen und zu streicheln, wenn sie zu mir kamen, und niemals vergesse ich, wie sie meinen Geruch aufnahmen und ihre Münder vorsichtig in meinen Haaren versenkten.
Mit dem Umzug in eine Kleinstadt waren diese friedvollen Nachmittage dann abrupt beendet. Aber die Liebe zu den Pferden und die schönen Erinnerungen an die Ponys sind mir auch über die Reitschulzeit hinaus erhalten geblieben. Mein Wunsch, Pferde gewaltfrei und in Harmonie auszubilden, entspringt diesen persönlichen Erlebnissen in der Kindheit. Es ist mein innerster Wunsch, diese Ruhe und Harmonie, die damals auf der Ponykoppel herrschte, in die heutigen Ställe zu bringen, in denen es zu viele mürrische und frustrierte Menschen und Pferde gibt, die längst nicht die Freude an der Sache haben, die sie haben könnten.
Sie und ich haben es in der Hand, und es ist unsere Entscheidung als für uns selbst verantwortliche Menschen, ob wir auch mürrisch und frustriert mit unseren Pferden sind oder Spaß und Freude mit ihnen haben. Sie, lieber Leser, haben bereits einen wichtigen Schritt getan, indem Sie jetzt dieses Buch in den Händen halten und Ihr aktives Interesse daran dokumentieren, in einer glücklichen und harmonischen Freundschaft mit Ihrem Pferd zu leben. Indem Sie mit gutem Beispiel vorangehen, Ihr Pferd konsequent gewaltfrei und mit viel wirkungsvollem Lob trainieren und sich möglicherweise auch gegen übliche Normen in Ihrem Stall auflehnen, machen Sie einen erheblichen Unterschied. Sie bieten anderen Menschen eine echte Orientierungshilfe und verbessern nicht nur die Lebensqualität Ihres eigenen Pferdes, sondern möglicherweise auch das Leben anderer Pferde.
Wir alle wünschen uns sensible, fein zu reitende, gut gymnastizierte Pferde, die möglichst unempfindlich auf Stressfaktoren reagieren und stets willig und freudig mit uns bei der Arbeit sind. Ich verspreche Ihnen, dass dieses Buch Ihnen einen klaren Weg aufzeigt, um diesem Ziel deutlich näher zu kommen!
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.
Albert Einstein
Was macht einen Pferdeliebhaber zum Horseman?
Foto: Wentscher
Und was macht all die passionierten Pferdefrauen zu echten Pferdekennerinnen und erfolgreichen Amazonen?
Um mit Pferden erfolgreich und in größtmöglicher Harmonie zu arbeiten, bedarf es gewisser Fertigkeiten des Trainers. Er sollte sich stets so verhalten, dass die Rangordnung geklärt ist und vom Pferd auch nicht hinterfragt werden muss. Perfektes Timing im Umgang und bei der Arbeit gehören ebenso dazu wie Kenntnisse über spezifische psychologische und kommunikative Prozesse des Pferdes. Erfolg mit Pferden ist planbar – davon bin ich persönlich überzeugt. Aber es gehören auch eine große Passion und Fokussiertheit dazu sowie die Erkenntnis, dass man niemals auslernt.
Ich bin seit vielen Jahren täglich mit Pferden zusammen, habe sie genau studiert und tue dies heute noch ständig. Es gibt für mich kein schöneres Ende eines Tages, als am Rande einer Koppel oder eines Auslaufes zu stehen und eine Gruppe von Pferden zu studieren. Ich sage ganz bewusst „studieren“, denn ich betrachte die Pferde nicht nur, sondern analysiere zugleich, was und warum etwas passiert und was vermutlich als Nächstes passieren wird.
Genauso funktioniert es selbstverständlich auch in Reithallen bei der täglichen Arbeit oder auf Turnieren. Als aufmerksamer Beobachter können Sie an einem einzigen Abend in einer x-beliebigen Reithalle eine Menge über Pferde und ihre Reaktionen erfahren, wenn Sie lernen, die Situation analytisch zu betrachten und Ihr Auge für kleinste Details zu schulen. Immens wichtig ist es, die richtigen Ausbilder zu finden, was an sich schon ein Problem darstellen kann …
Das Beobachten einer Pferdeherde – lehrreich und einfach schön. (Foto: Wentscher)
Bevor es zu so heftigen Reaktionen kommt, haben die Pferde meist schon diverse Signale geschickt, um ihre Not mitzuteilen – doch wahrgenommen wurden sie nicht. (Foto: Wentscher)
In den allermeisten Fällen haben erfolgreiche Reiter eine Menge Zeit und Hingabe investiert, bevor sie sich auf dem Siegertreppchen einfinden konnten. Nehmen wir einen wunderbaren, erfolgreichen Pferdemann wie Klaus Balkenhol. Sie und ich sind uns vermutlich einig, dass sich seine reiterlichen Leistungen nicht daraus ergaben, dass er zweimal in der Woche ausritt und dabei fortwährend mit dem Handy telefonierte.
Sensibilität entwickeln
Pferde sind emotionale Tiere, die vorwiegend nonverbal kommunizieren und keine Zukunftsplanung betreiben. Unser komplexes Denken macht es uns schwer, uns auf die im Vergleich stark limitierten Denkstrukturen des Pferdes einzulassen und uns anzugewöhnen, die Welt mit den Augen des Pferdes zu betrachten. Seit dem Kleinkindalter sind wir daran gewöhnt, unser Hauptaugenmerk auf gesprochene Wörter zu legen; nun sind wir gefordert, den mehr oder weniger subtilen nichtsprachlichen Signalen des Pferdes Beachtung zu schenken. Diese nonverbalen Zeichen wahrzunehmen und richtig einzuordnen ist die wichtigste Voraussetzung dafür, mit Pferden erfolgreich kommunizieren zu können und sie verstehen zu lernen.
Im Grunde bin ich froh über die ganzen „Problempferde“, die ich kennen lernen darf, denn sie zeigen mir, dass es Pferde gibt, die lebendig in ihrer Ausdrucksweise bleiben und nicht abstumpfen und resignieren – von diesen Exemplaren gibt es leider ebenfalls eine riesige Anzahl.
Die so bezeichneten „Problempferde“ haben oft eine große Anzahl kommunikativer Signale und Gesten vorausgeschickt, mit denen sie sich mitgeteilt haben. Doch die Menschen haben diese feinen Zeichen nicht erkannt und dementsprechend auch nicht darauf reagiert. Infolgedessen war das Pferd gezwungen, immer „lauter“ zu werden, um schließlich doch gehört zu werden – zum Beispiel durch Beißen, Steigen, Buckeln, Auskeilen, vermehrtes Scheuen, gesteigerte Nervosität, Aggressivität oder diverse „Unarten“.
Für viele Menschen sind dies Gründe, sich von dem „Problempferd“ zu trennen und es durch ein neues, „besseres“ Pferd zu ersetzen. Nur allzu wahrscheinlich werden nach einer Weile erneut ähnliche Frustrationen und Missverständnisse entstehen …
Ein perfekt funktionierendes Pferd gibt es ebenso wenig wie einen perfekten Menschen. Jedes Pferd bringt aufgrund seines spezifischen Charakters seine eigenen Herausforderungen mit, auf die der Mensch in versierter und verständiger Form eingehen muss. Für echte Pferdeliebhaber ist es unumgänglich anzuerkennen, dass Pferde ehrliche, direkte und „redliche“ Geschöpfe sind, die bei selbstkritischer Betrachtung unsererseits stets einwandfreie Gründe für ihr Verhalten nennen könnten.
Wenn Sie jetzt innerlich protestieren, möchte ich Ihnen nachhaltig versichern, dass Sie niemals das „Opfer“ in der Beziehung zu Ihrem Pferd sind. Bei einer solchen Einstellung übertragen Sie Ihre eigene Kraft und die Verantwortung für sich selbst auf Ihr Pferd. Solange Sie sich in der „Opferrolle“ gefangen halten, werden Sie keine Verbesserungen in Ihrer Beziehung zu Pferden erreichen können.
Zehn Leitsätze für den Umgang mit dem Geschöpf Pferd
1. Jedes Pferd, das jemals geboren wurde, ist ein perfektes Pferd. Kein Pferd wurde jemals dazu geboren, Menschen zu frustrieren, zu ärgern oder zu verletzen.
2. Es ist einzig und allein der Einfluss des Menschen und die Reaktion des Pferdes auf die jeweilige Behandlung, die das Pferd nötigen, Widerstand zu zeigen, kein Vertrauen zu haben oder Menschen nicht zu mögen.
3. Es gibt kein einziges böses oder charakterlich schlechtes Pferd. Es gibt viele sensible Pferde, die sich zu gewissen Dingen nicht zwingen lassen wollen. Es gibt misshandelte Pferde, die gelernt haben, Menschen zu meiden, und große Angst vor ihnen haben. Es gibt Pferde, die ihrem Besitzer in Fragen des Überlebens nicht vertrauen und sich deshalb nicht von ihrer Herde trennen lassen. Es gibt Pferde, die die Spannung(en), die ihre Besitzer ausstrahlen, nicht ertragen können und sich gegen sie wehren. Es gibt Pferde, die niemals gelernt haben, dass sie einem Menschen so trauen können wie einem Freund.
4. Alle Pferde sind verschieden. Es gibt keine zwei Pferde, die dieselben mentalen Möglichkeiten, dieselbe emotionale Vorbildung oder Persönlichkeit besitzen. Aber jedes Pferd benutzt ungefähr die gleichen Mechanismen, um vertrauensvolle, intime und harmonische Beziehungen zu anderen Pferden und Menschen zu entwickeln.
5. Wenn man seine Vorstellungen über das soziale Leben der Pferde auf Dominanzverhalten, hierarchische Ordnung und Unterwürfigkeit limitiert, beschränkt man seine eigene Persönlichkeit in der Arbeit und generell im Umgang mit Pferden.
6. Die Schlüssel zu einer wahrhaft erfolgreichen Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd sind der Respekt vor dem Pferd und das Verständnis für die Emotionen und Instinkte, die das Leben des Pferdes bestimmen.
7. Ein Pferd kann niemals unser „Ein und Alles“ sein, Pferde bleiben bei aller Liebe zu Menschen trotzdem immer nur Pferde mit ihren ureigensten spezifischen Bedürfnissen. Sie können niemals erfolgreich Ersatz für Kinder oder Lebenspartner sein – in dieser Rolle sind sie überfordert, und sie wird ihrer Persönlichkeit auch nicht gerecht.
8. Wenn wir ein Pferd als Sklaven unserer Eitelkeiten und Bedürfnisse behandeln oder betrachten, als ein Objekt, das gemäß unseren Ansprüchen zu agieren hat, dann eliminieren wir den ursprünglichen Zauber und die Faszination dieser noblen Spezies und unserer gemeinsamen Bindung.
9. Wenn die Arbeit und das Zusammensein mit dem Pferd keine Freude mehr bereiten, ist es ratsam, die Situation zügig zu evaluieren und alle Aspekte in Erwägung zu ziehen, die helfen könnten, den Zustand zu verbessern, bevor die Beziehung zum Pferd ernsten Schaden nimmt oder die frustrierte Stimmung chronisch wird.
10. Pferde sind zu wertvolle Freizeit- und Sportkameraden, als dass man sich dazu herablassen sollte, im Umgang oder Training mit ihnen Gewalt anzuwenden.
Soziales Wesen: Das Pferd und sein Verhalten
Foto: Slawik
Die soziale Interaktion zwischen Pferden ist in den letzten Jahren Gegenstand einiger wissenschaftlicher Studien geworden – zum Glück für unsere Pferde, die von unserem neu gewonnenen Wissen über die sozialen Kompetenzen und Ansprüche des Pferdes profitieren. Menschen lernen, wie sie Pferde besser verstehen und sich besser mit ihnen verständigen können.
Bilder wie diese gibt es immer noch – aber sie werden zum Glück immer seltener. (Foto: Wentscher)
Kenntnisse über die Natur der sozialen Hierarchie bei frei lebenden Pferdeherden, Effekte der Domestizierung und über die spezifischen sozialen Bedürfnisse des Pferdes sind vertieft worden und haben dazu beigetragen, dass sich die Haltungsbedingungen der Pferde in menschlicher Obhut immer mehr verbessern.
Das Leben in der Herde
Es bestehen mindestens zwei verschiedene Formen möglicher Konstellationen innerhalb von Pferdeherden in der freien Wildbahn. Die eine Gruppe ist die Familiengruppe, die uns am besten vertraut ist. Sie besteht aus einem Leithengst und zumeist nicht mehr als zwei bis drei Mutterstuten mit ihrem Nachwuchs aus den letzten Jahren. Eine der Altstuten, die Leitstute, hat die meiste Erfahrung, kennt üblicherweise die besten Futterplätze, Wasserstellen, Mineralaufnahmequellen und Wälzplätze und bestimmt, wann, wo und wie lange gegrast und Wasser aufgenommen wird. Durch ihre ranghohe Position kann sie die anderen, rangniedrigeren Stuten, die zur selben Zeit paarungsbereit sind, vom Hengst abschirmen und so als Erste wieder trächtig werden. Durch diesen Vorzug bei der Paarung mit dem Hengst erreicht sie, dass sie das erste Fohlen im Frühjahr bekommt, das dann in seiner Entwicklung einen Vorteil gegenüber den später geborenen Fohlen hat.
In größeren Herden gibt es statt einer feststehenden Hierarchie zwischen den einzelnen Mitgliedern häufiger auch Kleingruppen, die entweder einen höheren oder niedrigeren Status innerhalb der Gesamtherde bekleiden, deren Mitglieder aber untereinander nur minimale bis gar keine Statusunterschiede haben.
Ist die Gruppe durch Raubfeinde oder andere Hengste in Gefahr, übernimmt der Leithengst die Aufgabe, seine Herde zu beschützen, indem er sie wegtreibt. Ganz bewusst ist hier von Leithengst die Rede, da es gar nicht so selten vorkommt, dass die Herde insgesamt größer ist und sich zwei Hengste in einer Herde befinden, zwischen denen aber eine eigene, klare Rangfolge besteht. Dabei wird der Leithengst die meisten Stuten dieser Herde decken und allgemein mehr für ihren Schutz sorgen, wohingegen der andere Hengst die rangniedrigeren Stuten deckt und sich mehr um die Erziehung des Nachwuchses bemüht als der Leithengst. Es gibt Studien, die zeigen, dass Stuten eher eine Herde verlassen, in der es nur einen Hengst gibt, und dass der stabilste Herdenverband durch mehrere Hengste in der Gruppe erzeugt wird.
Der zweite Herdentypus, die sogenannte Bachelor- oder Junggesellengruppe, setzt sich aus den Junghengsten und Hengsten zusammen, die noch keine eigene Herde haben. In ihrer ursprünglichen Familienherde wurden sie vom Leithengst nicht mehr akzeptiert, oder sie verlassen einfach deshalb den Herdenverband, weil sich in der Bachelorherde viel mehr potenzielle Spiel- und Raufpartner befinden. Auch für ehemalige Herdenanführer, die ihre Stuten an einen anderen Hengst verloren haben, bietet die Junggesellengruppe Schutz und soziale Interaktion.
In wild lebenden Pferdeherden bestimmt die Leitstute den „Alltag“, während der Leithengst die Aufgabe hat, die Herde zu beschützen. (Foto: Slawik)
Diese Junggesellengruppen leben zumeist in enger räumlicher Nähe zu Herden mit Stuten und warten so ständig auf die Gelegenheit, streunende Stuten zu erobern oder sie, während der Leithengst abgelenkt ist, heimlich zu decken oder sogar aus der Herde zu entführen. Daher sind diese Gruppen vor allem während der Paarungszeit einer hohen Fluktuation unterworfen.
Die sogenannte Junggesellengruppe gibt jungen Hengsten Schutz und Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu trainieren. (Foto: Slawik)
Die Rolle des Hengstes
Die Hauptaufgabe eines Hengstes in der Familiengruppe besteht im Zusammenhalten der Gruppe durch permanentes Überwachen der Stuten und des gemeinsamen Nachwuchses. Zum einen will er verhindern, dass er Stuten verliert, die einfach abwandern; zum anderen verteidigt er seine Gruppe gegenüber Raubfeinden und anderen Hengsten, die Stuten stehlen oder sich heimlich paaren, wenn der Hengst abgelenkt ist. Sein Erfolg als Leithengst besteht in der Fähigkeit, diese heimlichen Kopulationen zu verhindern. Dafür umkreist er seine Herde in einem Abstand von etwa zehn bis fünfzehn Metern, und in seinen Ruhepausen fällt er selten in den Tiefschlaf, sondern döst meist nur. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Herdenmitglieder limitiert, denn je größer die Herde ist, desto schlechter kann sie erfolgreich gegen andere eindringende Hengste verteidigt werden. Vor allem während der ersten Rossigkeit der Stuten, etwa sechs bis zwölf Tage nach dem Abfohlen (Fohlenrosse), versucht der Hengst, seine Stuten von anderen Herden fernzuhalten, da die Stuten jetzt besonders fruchtbar sind.
Der Hengst treibt seine Stuten im Allgemeinen von hinten oder schräg hinten, während die Leitstute die Gruppe anführt. Beim Treiben trägt der Hengst Kopf und Hals tief und nimmt die Nase nach oben, sodass Hals und Kopf eine fast waagerechte Linie bilden. Vom Hals ausgehend bewegt er seinen Kopf nun schlängelnd von einer Seite zur anderen oder auch von oben nach unten. Durch die nach hinten angelegten Ohren entsteht ein mäßig bis sehr aggressiver Eindruck. Die hohe, hengsttypische Knieaktion bleibt trotz des tief gehaltenen Kopfes erhalten. In dieser sogenannten Treibhaltung treibt der Hengst die Stuten bei Gefahr voran. Die Treibhaltung wird auch benutzt, um die Richtung zu verändern oder um eigene jugendliche Nachkommen oder unerwünschte Eindringlinge von der Herde zu vertreiben. Wird eine neue Stute oder werden gleich mehrere Stuten neu in die Herde integriert, treibt der Hengst sie auf diese Weise für die Dauer von bis zu drei Tagen vor sich her, um seine „Besitzansprüche“ und die Rangfolge klarzustellen, während die Stuten, die bereits zu seiner Herde gehören, unbehelligt weitergrasen können. Auch Fohlen, die den Herdenanschluss verpasst haben oder von der Herde ausgebüxt sind, holt der Hengst mit der Treibhaltung zurück.