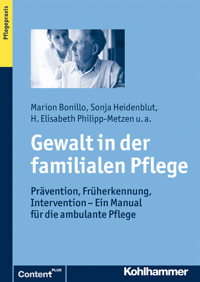
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Pflege alter Menschen wird zu einem großen Teil durch Angehörige geleistet. Die damit verbundene Belastung kann zu Aggression und Gewalt führen. Ambulante Pflegedienste, die nicht selten mit solch schwierigen Situationen konfrontiert sind, sollten hier eingreifen bzw. präventiv tätig werden. Das vorliegende Manual vermittelt Hintergründe zum Thema Gewalt und ein Assessment zur Gewaltprävention in der Praxis. ContentPLUS beinhaltet u. a. Checklisten und ein Ablaufschema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Pflege alter Menschen wird zu einem großen Teil durch Angehörige geleistet. Die damit verbundene Belastung kann zu Aggression und Gewalt führen. Ambulante Pflegedienste, die nicht selten mit solch schwierigen Situationen konfrontiert sind, sollten hier eingreifen bzw. präventiv tätig werden. Das vorliegende Manual vermittelt Hintergründe zum Thema Gewalt und ein Assessment zur Gewaltprävention in der Praxis. ContentPLUS beinhaltet u. a. Checklisten und ein Ablaufschema.
Prof. Dr. Susanne Zank und Prof. Dr. Claudia Schacke sind Psychologinnen mit gerontologischem Schwerpunkt. Sie leiten u. a. das Projekt 'Potenziale und Risiken in der familialen Pflege alter Menschen' (PURFAM) in Köln und Berlin. Dr. Marion Bonillo, Sonja Heidenblut, Dr. H. Elisabeth Philipp-Metzen, Susanna Saxl, Constanze Steinhusen und Inka Wilhelm sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Projekts.
Marion Bonillo, Sonja Heidenblut, H. Elisabeth Philipp-Metzen, Susanna Saxl, Claudia Schacke, Constanze Steinhusen, Inka Wilhelm, Susanne Zank
Gewalt in der familialen Pflege
Prävention, Früherkennung, Intervention - Ein Manual für die ambulante Pflege
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Definition
Fallbeispiel
Gesetzestext
Merke
Warnung
1. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Umschlagabbildung: © Yuri Arcurs – Fotolia.com Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-022488-9
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-024026-1
epub:
978-3-17-027996-4
mobi:
978-3-17-027997-1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
I Theoretischer und empirischer Hintergrund
1 Zur Situation der familialen Pflege
1.1 Statistische Angaben und gesellschaftliche Relevanz
1.2 Belastung pflegender Angehöriger
1.3 Potenziale der häuslichen Pflege
1.4 Zusammenfassung
1.5 Konsequenzen für PURFAM
2 Gewalt in der familialen Pflege
2.1 Einleitende Erläuterungen
2.2 Definition und nähere Präzisierung
2.3 Formen von Gewalt gegenüber Älteren
2.4 Prävalenzen
2.4.1 Misshandlung und Vernachlässigung älterer Menschen generell
2.4.2 Gewalt gegenüber pflegebedürftigen Älteren
2.5 Das Belastungsparadigma als Erklärungsansatz für Gewalt in der familialen Pflege
2.5.1 Verschiedene Erklärungsansätze für Gewalt gegen Ältere generell
2.5.2 Befunde der LEANDER-Studie zu Gewaltphänomenen in der familialen Pflege
2.5.3 Ergebnisse der PURFAM-Experteninterviews zur Gewaltbegünstigung durch Überlastung in der Pflege
2.5.4 Auswirkungen von Angehörigenbelastung auf die Situation nach der Pflege
2.6 Weitere Gewalt begünstigende Faktoren
2.7 Zusammenfassung
2.8 Konsequenzen für PURFAM
3 Rechtliche Aspekte
3.1 Grundlegende Rechte
3.2 Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit
3.3 Garantenpflicht
3.4 Schutz der Privatsphäre
3.5 Gesetzliche Betreuer
3.6 Freiheitsentziehende Maßnahmen
3.7 Exkurs: Häusliche Gewalt in zwei weiteren Handlungsfeldern
3.7.1 Kinder- und Jugendhilferecht
3.7.2 Frauen (und Männer) als Opfer von häuslicher Gewalt
3.8 Zusammenfassung
3.9 Konsequenzen für PURFAM
4 Ansätze zur Prävention
4.1 Richtungsweisende Befunde aus der Literatur
4.1.1 Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention
4.1.2 Nationale Befunde
4.1.3 Ein Präventionsbeispiel aus der internationalen Literatur
4.2 Präventionsansätze aus dem Feld internationaler und nationaler Best-Practice
4.2.1 Hinweise zu Best-Practice
4.2.2 Beispielhafte Ausführungen der WHO
4.2.3 Bewährte Verfahren in den USA bei Gewalt in der familialen Pflege
4.2.4 Deutsche Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
4.2.5 Übersicht: Relevante Aspekte aus Best-Practice-Modellen zur Gewaltprävention
4.3 Diskurs zur Gewaltprävention durch Früherkennungsmaßnahmen
4.3.1 Ausführungen der WHO
4.3.2 Stehen pflegende Angehörige nun unter Generalverdacht?
4.3.3 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsstrategien
4.4 Zusammenfassung
4.5 Konsequenzen für PURFAM
II Gewaltprävention in der Praxis
5 Die Rolle ambulanter Pflegedienste in der Gewaltprävention
5.1 Gewaltprävention als Leitlinie für das Pflegeteam
5.2 Festlegung des Gewaltbegriffs im Team
5.3 Zusammenfassung
6 Ablaufschema für Pflegesituationen mit Gewaltverdacht
7 PURFAM-Assessment
7.1 BIZA-D-PV/ PURFAM
7.2 PURFAM-Checkliste: Pflegekraft
7.3 PURFAM-Checkliste: Team
7.4 Zusammenfassung
8 Interventionsmöglichkeiten
8.1 Beratungsgespräche im Kontext problematischer Pflegesituationen
8.2 Konkrete Entlastungsangebote
8.3 Strukturierung von Interventionen mithilfe des BIZA-D-PV/ PURFAM
8.4 Zusammenfassung
9 Anwendung des PURFAM-Assessments am praktischen Fallbeispiel
Fazit und Ausblick
Glossar
Literatur
Literaturauswahl für die Praxis
Stichwortverzeichnis
Anhang
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie zu diesem Manual gegriffen haben, haben Sie möglicherweise bereits selbst Erfahrungen mit Gewalt in familialen Pflegesituationen gemacht. Aus den vielen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ambulanten Pflege und anderen im Versorgungsnetzwerk Tätigen geführt haben, wissen wir, dass solche Situationen im Arbeitsalltag nicht selten und für den Einzelnen belastend sind.
Dieses Manual und die darin enthaltenen Assessment-Instrumente sollen dabei helfen, die Gefahr von Gewalt in der informellen häuslichen Pflege frühzeitig zu erkennen, sich im Team darüber auszutauschen und gemeinsam Handlungsstrategien zu erarbeiten.
Das Assessment wurde im Rahmen des Projekts »Potenziale und Risiken in der familialen Pflege« (PURFAM) unter der Leitung von Claudia Schacke (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) und Susanne Zank (Universität zu Köln) entwickelt. Die beiden Psychologinnen arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren an dem Thema der Angehörigenbelastung in der Pflege von Menschen mit Demenz, unter anderem in dem Projekt LEANDER (Längsschnittstudie zur Belastung pflegender Angehöriger von demenziell Erkrankten). Sowohl das dreistufige Projekt LEANDER als auch das Projekt PURFAM wurden ermöglicht durch die Finanzierung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Besonderer Dank gilt dabei Petra Weritz-Hanf und Margret Schulz vom Referat »Gesundheit im Alter, Hilfen bei Demenz, Conterganstiftung für behinderte Menschen«, die die Durchführung der Projekte kontinuierlich betreut und unterstützt haben.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern1 der Fortbildungen, die im Rahmen von PURFAM durchgeführt wurden. Mit ihrer engagierten Beteiligung und konstruktiven Kritik haben sie wesentlich dazu beigetragen, dieses Handbuch so praxisnah zu machen, wie es Ihnen jetzt vorliegt. Den Fachleuten aus Forschung und Praxis, die in Experteninterviews und einer internationalen Tagung ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilten, sei an dieser Stelle ebenfalls herzlich gedankt.
Folgende Zusatzmaterialien erhalten Sie online im Buchshop des Verlags unter ContentPLUS. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der vorderen Umschlaginnenseite.
PURFAM-Ablaufschema für Pflegesituationen mit Gewaltverdacht (
►
Abb. 6.1
)
Übersichtsschema PURFAM-Assessment (
►
Abb. 7.1
)
Kurzinformation zum PURFAM-Assessment (
►
Anhang
)
BIZA-D-PV/ PURFAM (
►
Anhang)
BIZA-D-PV/ PURFAM: Auswertungsblatt für den Pflegedienst (
►
Anhang
)
PURFAM-Checkliste: Pflegekraft (
►
Anhang
)
PURFAM-Checkliste: Team (
►
Anhang
)
Filmausschnitt aus »Darüber spricht man nicht. Schattenseiten häuslicher Pflege«
1 Im Folgenden wird die weibliche und männliche Form in der Regel abwechselnd verwendet. Grundsätzlich sind immer Männer und Frauen gleichermaßen gemeint.
Abkürzungsverzeichnis
BIZA-D-PV/PURFAM
Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung Praxisversion PURFAM
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGHSt
Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BMFSFJ
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMG
Bundesministerium für Gesundheit
BMJ
Bundesministerium der Justiz
GewSchG
Gewaltschutzgesetz
GG
Grundgesetz
ICN
International Council of Nurses
INPEA
International Network for the Prevention of Elder Abuse
LEANDER
Längsschnittstudie zur Belastung pflegender Angehöriger von demenziell Erkrankten
MILCEA
Monitoring in Long-Term Care Pilot Project on Elder Abuse
PDL
Pflegedienstleitung
PURFAM
Potenziale und Risiken in der familialen Pflege alter Menschen
SiliA
Sicher leben im Alter
StGB
Strafgesetzbuch
SGB VIII
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz
SGB XI
Sozialgesetzbuch XI, Soziale Pflegeversicherung
WHO
Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization)
Einleitung
Die familiale Pflege alter Menschen ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit steigender Lebenserwartung insbesondere hochaltriger Menschen von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Pflege durch Familienangehörige stellt die Hauptsäule in der häuslichen Pflege dar. Die anhaltend hohe Bereitschaft, Pflegeaufgaben zu übernehmen, ist ein großes gesellschaftliches Potenzial und ist aus psychologischer, sozialer, ethischer und ökonomischer Perspektive außerordentlich bedeutsam. Die meisten Pflegebedürftigen werden im häuslichen Rahmen gut versorgt. Dennoch birgt die familiale Pflege auch Risiken sowohl für die pflegenden Angehörigen als auch für die Pflegebedürftigen. Die Betreuung chronisch kranker alter Menschen kann bei den pflegenden Angehörigen zu erheblichen negativen psychischen, sozialen, materiellen und gesundheitlichen Konsequenzen führen. Das Risiko für die Pflegebedürftigen besteht in Misshandlung und Vernachlässigung durch die pflegenden Angehörigen (vgl. Thoma et al. 2004). Die Ursachen hierfür sind vielschichtig und komplex. Genaue Zahlen zur Häufigkeit von Misshandlung und Vernachlässigung gibt es nicht, es wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet. Das liegt zum einen daran, dass es sich meist um isolierte, schwer zugängliche Pflegesituationen handelt. Zum anderen unterbleiben häufig Anzeigen aus Schamgefühl, komplizierten Abhängigkeitsverhältnissen, Hilflosigkeit usw. Auch fehlt bei den Beteiligten oft die Sensibilität dafür, wann Gewalt beginnt (vgl. Görgen 2010). Nationale und internationale Studien (u. a. Biggs et al. 2009; Görgen 2010; Zank et al. 2006) haben den Versuch unternommen, hier genauere Einblicke zu erhalten. Unter anderem hat sich gezeigt, dass ambulante Pflegedienste oft als einzige Außenstehende von Konflikten zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen erfahren, sei es durch die Beteiligung an der Pflege, sei es durch die Beratungsgespräche nach § 37 (3) SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz). Um Gewaltprävention leisten zu können, benötigen Pflegedienste allerdings zum einen ein Altenhilfesystem, dessen Akteure bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und damit einen reibungslosen Handlungsablauf zu gewährleisten. Zum anderen brauchen sie verbindliche Leitlinien zur Gewaltprävention in der Pflege alter Menschen, wie sie in der Bundesrepublik bisher nicht existieren.
Erste Bemühungen zur Entwicklung eines Standards zur Gewaltprävention in der Pflege alter Menschen hat das europäische Projekt MILCEA (Monitoring in Long-Term Care Pilot Project on Elder Abuse) unternommen. Auf deutscher Ebene hat das Projekt SiliA (Sicher leben im Alter) in Kooperation mit Pflegediensten in Nordrhein-Westfalen eine Präventionsmaßnahme ausgearbeitet. In der Längsschnittstudie zur Belastung pflegender Angehöriger von demenziell Erkrankten (LEANDER), die das Belastungsparadigma zugrunde legt, wurde der Fragebogen BIZA-D (Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung bei Demenz) entwickelt, der das subjektive Belastungsempfinden pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz ermittelt.
PURFAM »Potenziale und Risiken in der familialen Pflege alter Menschen« hat sich als Nachfolgeprojekt von LEANDER zum Ziel gesetzt, das Praxishandeln von Pflegekräften in der ambulanten Pflege durch Gewaltprävention, Früherkennung und Ressourcenstärkung zu optimieren. In Anlehnung an das Prozedere bei Kindeswohlgefährdung wurde u. a. ein Handlungsablauf bei Gewaltverdacht in der familialen Pflege entwickelt, dessen Kernstück ein Assessmentverfahren bildet. Die Anwendung der Präventionsmaßnahme wurde in zielgruppenspezifischen Fortbildungen 2011/2012 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ambulanter Pflegedienste vermittelt. Insgesamt konnten bundesweit 455 Mitarbeitende aus 170 ambulanten Pflegediensten geschult werden.
Dieses Manual führt in die Umsetzung der PURFAM-Präventionsmaßnahme ein. Im ersten Teil werden die theoretischen Hintergründe zum Thema Gewalt in der familialen Pflege alter Menschen aufgezeigt. Im zweiten Teil wird dann systematisch in den Handlungsablauf und das PURFAM-Assessment sowie seine praktische Anwendung eingeführt. Der Interventionsbereich legt dem Belastungsparadigma folgend dabei den Schwerpunkt auf die Entlastung der Pflegesituation mit besonderem Fokus auf die Ressourcenstärkung pflegender Angehöriger. Das Manual eignet sich sowohl für Fort- und Weiterbildungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege, und hier im Speziellen der ambulanten Pflege, als auch für den Forschungs- und Lehrbereich.
ITheoretischer und empirischer Hintergrund
Der erste Teil dieses Buches führt in die Gesamtthematik ein. Hierzu werden zentrale theoretische und empirische Hintergründe erläutert, welche die Grundlage für die Entwicklung des PURFAM-Präventionskonzepts darstellen.
1 Zur Situation der familialen Pflege
1.1 Statistische Angaben und gesellschaftliche Relevanz
Nach den Angaben der Pflegestatistik waren im Dezember 2009 in Deutschland 2,34 Millionen Menschen pflegebedürftig (vgl. Statistisches Bundesamt 2011a, S. 6). Dabei wird Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) definiert, sodass Personen erfasst werden, denen nach den Paragrafen 14 und 15 SGB XI eine Pflegestufe von I bis III zugeordnet wurde.
§ 14 SGB XI Begriff der Pflegebedürftigkeit
»Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15 SGB XI) der Hilfe bedürfen« (SGB XI – Soziale Pflegeversicherung 2008, S. 13).
Von diesen 2,34 Millionen pflegebedürftigen Menschen wurden 69 % (1,62 Millionen) zu Hause versorgt. Ausschließlich Pflegegeld erhielten 1.066.000 Pflegebedürftige, welche in der Regel alleine durch Angehörige oder weitere nahe Bezugspersonen betreut wurden, d. h. dass eine sogenannte Angehörigenpflege bzw. familiale Pflege im weiteren Sinne vorlag. Bei 555.000 pflegebedürftigen Personen erfolgte die Pflege entweder teilweise oder vollständig durch ambulante Pflegedienste (vgl. Statistisches Bundesamt 2011a, S. 6). Die hohe Quote der häuslichen Versorgung deckt sich mit dem Leitziel der Pflegeversicherung, die die ambulante Pflege priorisiert.
§ 3 SGB XI Vorrang der häuslichen Pflege
»Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können« (SGB XI – Soziale Pflegeversicherung 2008, S. 13).
Nach Angaben der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder wird eine Zunahme von pflegebedürftigen Menschen auf 3,37 Mio. im Jahr 2030 erwartet (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010, S. 29).
Diese Eckdaten belegen den hohen sozialpolitischen Stellenwert ambulanter Pflege. Menschen, denen bislang keine Pflegestufe zugeordnet wurde (beispielsweise mit demenziellen Erkrankungen), sind hierbei noch nicht berücksichtigt.
Von den insgesamt 555.000 pflegebedürftigen Personen, welche durch ambulante Pflegedienste versorgt wurden, waren im Jahr 2009 55 % der Pflegestufe I zugeordnet. Der Anteil mit Pflegestufe II betrug 34 % und weitere 12 % erhielten Pflegestufe III (Statistisches Bundesamt 2011b, S. 7).
Soziodemografische Merkmale pflegebedürftiger Menschen in Privathaushalten nennt der Bericht zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz. Beispielsweise liegt das Durchschnittsalter in dieser Gruppe bei 71,9 Jahren, knapp die Hälfte von ihnen ist 80 Jahre alt und älter. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Privathaushalten sind Frauen. Der Familienstand stellt sich wie folgt dar. 36 % aller Pflegebedürftigen in der privaten Häuslichkeit sind verheiratet, 41 % verwitwet, 7 % geschieden und 16 % ledig. Ein hoher Prozentsatz (79 %) hat Kinder, alleinlebend sind 34 %, der größte Teil (39 %) lebt in einem 2-Personen-Haushalt (vgl. BMG 2011, S. 16).
Wer pflegt?
Nur bei 7 % der pflegebedürftigen Menschen in Privathaushalten ist keine weitere Person an der Versorgung beteiligt. In fast einem Drittel der Fälle pflegt eine Person, in 26 % pflegen zwei Personen und in 37 % drei oder mehr Personen einen pflegebedürftigen Menschen. ►Tab. 1.1 zeigt die Verwandtschaftsbeziehungen der Hauptpflegepersonen.
Die Gruppe der informell (das heißt nicht professionell) Pflegenden setzt sich aus nahen Familienangehörigen, sonstigen Verwandten und Nachbarn sowie Bekannten zusammen. Die Hauptverantwortung in der pflegerischen Versorgung wird überwiegend von engen Familienangehörigen übernommen. In etwas mehr als einem Drittel der Pflegesituationen wird jeweils vorrangig durch eigene Kinder oder im Rahmen von Ehe bzw. Partnerschaft gepflegt. Der Anteil der Söhne hat sich dabei im zeitlichen Vergleich seit 1998 verdoppelt. Zwei Drittel aller Hauptpflegepersonen leben mit den pflegebedürftigen Menschen in einem Haushalt (vgl. BMG 2011, S. 27).
Tab. 1.1: Verwandtschaftsbeziehungen der Hauptpflegeperson zur pflegebedürftigen Person (Studie zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – TNS Infratest Sozialforschung 2010, in: BMG 2011, S. 27)
Verwandtschaftsbeziehungen der Hauptpflegeperson zur pflegebedürftigen Person 1998 und 2010 (%)
Basis: Hauptpflegepersonen Pflegebedürftiger in Privathaushalten
1998
2010
Verwandtschaftsverhältnis
(Ehe-)Partnerin
20
19
(Ehe-)Partner
12
15
Tochter
23
26
Sohn
5
10
Schwiegertochter
10
8
Schwiegersohn
0
1
Mutter
11
10
Vater
2
1
Sonstige Verwandte
10
4
Nachbar/innen/Bekannte
7
6
Wohnort
Gleicher Haushalt
73
66
Getrennter Haushalt
27
34
Tab. 1.2: Soziodemografische Merkmale der Hauptpflegepersonen (BMG 2011, S. 27)
Soziodemografische Merkmale der Hauptpflegepersonen (%)
Basis: Hauptpflegepersonen Pflegebedürftiger in Privathaushalten mit pflegebedürftiger Person
1998
2010
Geschlecht
Männlich
20
28
Weiblich
80
72
Alter
unter 20 Jahre
0
-
20–39 Jahre
15
8
40–54 Jahre
28
33
55–64 Jahre
25
26
65–79 Jahre
27
24
80 Jahre und älter
5
9
Familienstand
Verheiratet
80
74
Verwitwet
8
6
Geschieden
4
10
Ledig
8
10
Mit Kindern
unter 6 Jahren
6
5
von 6–13 Jahren
10
10
von 14–17 Jahren
10
10
ab 18 Jahren
66
69
ohne Kinder
16
18
Die Geschlechterverteilung in der Gruppe der Hauptpflegepersonen zeigt mit 72 % nach wie vor überwiegend Frauen als Pflegepersonen, jedoch ist der Anteil der Männer seit 1998 deutlich gestiegen. Bei der Altersstruktur wird deutlich, dass ein Drittel der Altersgruppe von 40 bis 54 Jahre angehört, weitere 26 % sind 55 bis 64 Jahre alt. Somit sind 59 % aller Pflegenden im erwerbsfähigen Alter und möglicherweise mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf konfrontiert. Ungefähr ein Drittel ist 65 Jahre und älter, hiervon 9 % selber schon hochbetagt (80 Jahre und älter). Von den Hauptpflegepersonen sind 74 % verheiratet und weitere 26 % verwitwet, geschieden oder ledig (►Tab. 1.2). Eine potenziell weitere Vereinbarkeitsproblematik besteht durch familiale Sorgeleistung in zweifacher Hinsicht: Ein Viertel der Personen hat zusätzlich zur Pflegeverantwortung Kinder im Alter von 17 Jahren und jünger (vgl. BMG 2011, S. 27).





























