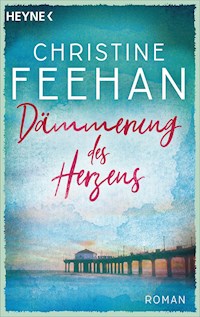8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Drake-Schwestern
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Über die Magie der Liebe
Libby, die Heilerin unter den Drake-Schwestern, schenkt dem reichen und unnahbaren Tyson nach einem Unfall das Leben wieder. Als er sich in seine Retterin verliebt, geraten die beiden immer wieder in lebensbedrohliche Situationen. Libby spürt die gefährlichen Schwingungen und kann ihnen mit Hilfe ihrer Schwestern begegnen. Aber was steckt hinter diesen Anschlägen auf ihre Liebe und auf ihr Leben?
Der dritte Roman der erfolgreichen Serie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die hübsche, aber etwas schüchterne Libby ist die vierte unter den sieben zauberkräftigen Drake-Schwestern. Sarah, Kate, Abigail, Libby, Hannah, Joley und Elle stehen sich sehr nahe und helfen einander mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten aus jeder Notlage. Libby ist von Beruf Ärztin, hat aber auch die magische Gabe zu heilen, indem sie Krankheiten und Schmerzen anderer auf ihren eigenen Körper überträgt und sie so bekämpft.
Als sie nach einem Unfall ihre Fähigkeit bei dem herrischen Biochemiker Tyson anwendet, verliebt sich dieser unsterblich in sie. Libby ist glücklich, da sie den unnahbaren Tyson schon seit Jahren heimlich liebt, aber dann stoßen ihr und Ty mysteriöse Dinge zu: Sie werden von einem Auto abgedrängt, in Tysons Labor kommt es zu einer gefährlichen Explosion, bei der Libby schwer verletzt wird. Libby kann zwar mit Hilfe ihrer Schwestern ihr Leben retten, aber was geht hier vor? Und welche Rolle spielt Sam, der charmante, aber Besitz ergreifende Cousin von Tyson?
»Christine Feehan ist die Königin des übersinnlichen Liebesromans. «
»Aufregend und unterhaltsam«
Publishers Weekly
Booklist
Die Autorin
Christine Feehan, die selbst in einer großen Familie mit zehn Schwestern aufgewachsen ist, lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Kalifornien. Sie hat bereits eine Reihe von Romanen veröffentlicht und wurde in den USA mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Ihre Bücher sind auf den amerikanischen Bestsellerlisten ganz oben vertreten und sie hat bisher über fünf Millionen Bücher weltweit verkauft.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Romane finden sich auf ihrer Website www.christinefeehan.com
Weitere Bücher von Christine Feehan:
Zauber der Wellen
Dieses Buch liegt mir ganz besonders am Herzen,weil ich es für meine kleine Schwester Nanci Goodcaregeschrieben habe.Zu einer Zeit, als die wenigsten Menschen glaubten,meine Bücher könnten jemals veröffentlicht werden,hat sie mich nicht nur ermutigt, sondern mir außerdem auchnoch geholfen und meine mit der Hand geschriebenen Geschich-ten bis spät in die Nacht auf einem uralten Computer abgetippt.Sie ist eine wunderbare Mutter und eine hervorragendeKrankenschwester, aber in erster Linie verkörpert sie das,worum sich diese Bücher in Wirklichkeit drehen –die Liebe zur Familie, die Stärke und Magie von Schwesternund die bedingungslose Unterstützung, wenn man sie geradeganz besonders nötig hat.
1.
Dass ich nicht lache, Libby«, sagte Sarah Drake zu ihrer jüngeren Schwester. »Du kannst überhaupt nicht gemein sein. Selbst wenn du dich noch so sehr anstrengen würdest, könntest du kein böses Mädchen sein.«
Libby sah Sarah finster an und blickte dann verdrossen in den Kreis von Gesichtern, die sie umgaben. »Ich bin nicht das tugendhafte Mädchen, für das ihr mich alle haltet.«
»Ach, wirklich?« Joley Drake, die sich auf dem Fußboden räkelte, zog eine Augenbraue hoch. »Nenne mir eine einzige Person auf Erden, die du auf den Mars wünschen würdest. Jemanden, den du aus tiefster Seele verabscheust.«
Gelächter schallte durchs Wohnzimmer. »Das ist ganz ausgeschlossen. « Hannah beugte sich zu Libby vor, um ihr einen Kuss auf die Schläfe zu drücken. »Wir haben dich alle schrecklich lieb, Schätzchen, aber die Anlagen zum bösen Mädchen hast du einfach nicht. Ganz im Gegensatz zu mir — oder Joley.« Sie sah ihre jüngste Schwester an. »Oder Elle.«
Das Gelächter nahm zu, und Elle zuckte die Achseln. »Das muss wohl an meinen roten Haaren liegen. Ich übernehme keine Verantwortung für meine … äh … interessante Persönlichkeit. «
»Es macht viel mehr Spaß, böse zu sein«, sagte Joley ohne eine Spur von Bußfertigkeit. »Niemand erwartet von einem, dass man das Richtige tut, und man handelt sich auch nie wirklich Ärger ein. Mom und Dad haben niemals von mir erwartet, dass ich höflich und zuvorkommend bin, als wir noch Kinder waren. Sie haben mir nur ständig damit in den Ohren gelegen, dass ich aufpassen soll, was ich sage.« Sie griff nach einem Plätzchen und setzte sich auf, um ihren Tee zu trinken. »Ich habe immer wieder versucht, ihnen zu erklären, dass ich bereits Selbstzensur übe und dass ich, wenn mir fünf Dinge gleichzeitig durch den Kopf schießen, jeweils das herauspicke, was am wenigsten ungehörig ist, aber auch das hat sie nicht gerade begeistert.«
Elle grinste Joley über den Rand ihrer Teetasse an. »Sie haben sich mit der Zeit daran gewöhnt, in die Sprechstunde des Direktors bestellt zu werden. Ich war echt froh, dass ich nach euch gekommen bin. Ihr habt mir den Weg geebnet. Ich habe mich ständig wegen Gott weiß was mit den Lehrern angelegt, und die Schulpsychologin hat gesagt, ich hätte Probleme mit Autoritätspersonen.«
»Mich konnten sie nie wirklich bei etwas erwischen«, sagte Hannah, während sie mit einem Ausdruck von Zufriedenheit auf ihre Fingernägel hauchte und sie frisch lackierte. »Ein oder zwei von den Lehrern hatten den Verdacht, ich hätte etwas damit zu tun, dass Scharen von Fröschen aus den Pulten von Mädchen gesprungen sind, die nicht nett zu mir waren, aber keiner konnte es mir tatsächlich nachweisen.«
Libby seufzte. »So möchte ich auch sein. Ich finde es abscheulich, immer nur das brave Mädchen zu sein.«
»Aber das bist du nun mal«, hob Kate hervor und tätschelte Libbys Knie. »Du kannst nichts dafür. Schon in jungen Jahren wolltest du anderen immer helfen. Du konntest dir keine Schwierigkeiten einhandeln, weil du alle Hände voll damit zu tun hattest, die Welt zu retten. Dagegen kann man doch nichts sagen.«
»Und du denkst auch nicht schlecht über andere, Libby«, fügte Abigail hinzu. »Das liegt dir einfach nicht.«
»Du bist verantwortungsbewusst«, sagte Sarah. »Das hat doch etwas für sich.«
Libby, die im Schneidersitz auf dem Boden saß, schlug sich die Hände vors Gesicht und stöhnte laut, als sie sich umkippen ließ und mit dem Kopf auf Hannahs Schoß landete. »Nein, eben nicht. Es ist langweilig. Ich bin schlicht und ergreifend langweilig. Ich möchte schlecht bis ins Mark sein. Wild. Unberechenbar. Alles andere als die gute alte zuverlässige Libby.«
»Ich färbe dir die Haare, Lib«, erbot sich Joley. »Die Spitzen in einem knalligen Pink und viele rosa und lila Strähnchen.«
Libby lugte um ihre Finger herum. »Ich kann unmöglich mit rosa und lila Strähnchen und Haarspitzen in einem knalligen Pink rumlaufen und erwarten, dass ich ernst genommen werde, wenn ich im Krankenhaus zur Arbeit erscheine. Könnt ihr euch die Reaktion meiner Patienten vorstellen?«
Joley sah sie finster an. »Das ist es ja gerade, Lib. Schlag die Vorsicht und den gesunden Menschenverstand in den Wind. Wenn du dir die Haare färbst, macht dich das noch lange nicht zu einer schlechteren Ärztin. Du bist so hoch angesehen, wie es sich ein Arzt nur wünschen kann.«
Libby ließ die Hände von ihrem Gesicht sinken und griff nach einem Plätzchen. Sie brauchte dringend Trost. »Ich bin für eine Gruppe Ärzte ohne Grenzen eingeteilt. Ich kann nicht mit knallrosa gefärbten Haaren nach Afrika gehen.«
» Klar kannst du das. Die Kinder werden begeistert sein«, beharrte Joley.
»Bei dir ist das etwas anderes, Joley. Du bist Musikerin. Von dir erwarten die Leute, dass du wild und verrückt bist. Ich kann nicht so rumlaufen, wie es mir gerade einfällt.«
»Und warum nicht?« Der Teller mit den Plätzchen war leer, und Joley wedelte mit der Hand. Wie auf ein Stichwort erhob sich der Teller in die Luft und segelte in Richtung Küche. Von dort kam der Duft nach frisch gebackenen Plätzchen ins Wohnzimmer geweht.
»Joley spielt sich auf«, sagte Elle. »Sie hat ewig gebraucht, um das zu lernen.«
Joley versetzte Elle einen Klaps mit einer zusammengerollten Zeitung. »Stimmt doch gar nicht. Das konnte ich schon, bevor du überhaupt geboren wurdest. Schweif nicht ab, du gemeines Miststück, wir versuchen gerade, Libby beizubringen, wie man ein böses Mädchen ist.«
» Von wegen gemeines Miststück! Das trifft doch wohl eher auf dich zu«, brachte Elle zu ihrer Verteidigung vor. »Heute Morgen habe ich versucht, dich zu wecken, und du hast unflätige Geräusche von dir gegeben und mir angedroht, mich von einem Turm in ein Meer voller Haie zu werfen.«
Joley versetzte Libby einen Rippenstoß. »Siehst du, Schätzchen? So benimmt sich ein ungezogenes Mädchen. Bin ich etwa aufgestanden und habe mir den Staubsauger geschnappt, wie Ihre Majestät es wollte? Nein, ich habe mich gründlich ausgeschlafen, und sie hat mir die Arbeit abgenommen.«
»Das glaubst auch nur du«, schnaubte Elle. »Als ob ich so was täte. Libby hat dir die Arbeit abgenommen, damit du den Schlaf nachholen konntest, den du gar nicht bräuchtest, wenn du nicht die ganze Nacht auf den Beinen wärest.«
Ein kollektives Stöhnen stieg aus allen Kehlen auf. »Sag, dass das nicht wahr ist, Libby.« Joley bemühte sich, enttäuscht zu wirken, doch sie erstickte fast an ihrem eigenen Gelächter.
Libby zog den Kopf ein, und das schwarze Haar fiel ihr in einer Wolke ums Gesicht und um die Schultern. »Ich dachte mir, du brauchst bestimmt noch ein paar Stunden Schlaf. Das war doch nicht der Rede wert.«
Sarah umarmte Libby. »Du bist einfach unglaublich, und es ist dir noch nicht einmal bewusst.«
»Nein, das bin ich eben nicht«, beharrte Libby. »Ich möchte gemein sein. Aber die Haare will ich mir trotzdem nicht färben. Tut mir Leid, Joley. Ich weiß, dass du es lieb gemeint hast, aber pink ist nichts für mein Haar.«
Joley lächelte sie an. »Du versuchst schon wieder, meine Gefühle nicht zu verletzen. Wir brauchen einen Lehrgang für ungezogene Mädchen. Das wäre dann das einzige Mal in deinem Leben, wo du keine Eins bekommst.«
Libby reckte ihr Kinn in die Luft und funkelte ihre jüngere Schwester finster an. »Und ob ich eine Eins im Kurs für ungezogene Mädchen bekommen könnte! Ich bekomme immer nur Einser.«
Joley zuckte die Achseln. »Ich habe mein Bestes getan, um keine guten Noten zu bekommen. Wenn man damit nämlich erst mal anfängt, wollen die Eltern gleich, dass es so weitergeht. Dann hat man den Salat.«
Hannah stieß Joley mit ihrem Fuß an. »Eine gute Philosophie. Ich wünschte, darauf wäre ich von selbst gekommen.« Sie wedelte in Richtung Küche. »Und du bleibst nie bei der Sache. Ohne Plätzchen werden wir alle noch zugrunde gehen.«
»Hast du die Plätzchen mit dieser köstlichen cremigen Füllung gemacht, Hannah?«, fragte Kate. »Die mag ich ganz besonders gern.«
»Für dich, ja.« Hannah lächelte Kate an, doch dann bedachte sie Sarah mit einem harten Blick. »Aber nicht für dich. Du hast dich gestern Abend auf Jonas Harringtons Seite geschlagen, als es um diesen Film ging. Du kriegst nur Plätzchen ohne Füllung.«
»Also, wirklich, Hannah«, protestierte Sarah. »Du kannst mich doch nicht dafür bestrafen, nur weil mir ein Film gefallen hat, der dir nicht gefällt.«
»Ich bestrafe dich nicht, weil dir der Film gefallen hat, du treuloses Weibsstück, sondern weil du es in Gegenwart dieses Höhlenmenschen zugegeben und sein Ego aufgebläht hast.«
»Ich bin ganz sicher, dass Sarah sich nicht auf die Seite von Jonas schlagen wollte«, mischte Libby sich ein.
Wieder brach Gelächter los. »Du bist ein hoffnungsloser Fall, Lib«, sagte Hannah. »Ich zeige dir, wie man richtig schön gemein ist, und du begreifst noch nicht einmal den Grundgedanken. «
Ein Windstoß fegte durch das Haus, als die Wohnzimmertür aufgerissen wurde und einen großen Mann mit breiten Schultern einließ. Jonas Harrington, der Sheriff des Bezirks, knallte die Tür hinter sich zu und trat ein, als gehörte ihm das Haus.
Hannah stöhnte. »Wenn man vom Teufel spricht. Ich schwöre es euch, man braucht seinen Namen bloß zu flüstern, um ihn herbeizurufen wie einen Dämon aus der Hölle.«
Joley versetzte Libby einen Rippenstoß. »Siehst du, das nenne ich Selbstzensur. Sie hat viel Schlimmeres über ihn gedacht, stimmt’s, Hannah?«
Hannah nickte. »Das kann ich dir versichern.« Sie spürte, wie sich das Kräftegleichgewicht im Raum augenblicklich verschob und ein subtiler Energiefluss in ihre Richtung gelenkt wurde. Ihre Schwestern standen ihr automatisch bei, um ihr das Sprechen zu erleichtern oder sie vor einer ihrer Panikattacken zu bewahren, die sie schlicht und einfach deshalb bekam, weil jemand bei ihnen war, der nicht zur Familie gehörte.
»Zuckerpüppchen«, sagte Jonas zur Begrüßung zu Hannah, um sie bewusst mit einem ihrer verhassten Spitznamen zu provozieren. »Es ist ganz ausgeschlossen, dass du Libby Gemeinheit beibringen kannst. Im Gegensatz zu dir, ist sie die Güte in Person.« Er nahm eine Hand voll Plätzchen, als der Teller an ihm vorbeischwebte, und warf mit einer geübten Bewegung seine Jacke auf das Sofa.
»Warum beißen ihn deine widerwärtigen Wachhunde eigentlich nicht?«, fragte Hannah Sarah. »Das nächste Mal, wenn einer von ihnen Futter will, werde ich sie daran erinnern, dass sie bei ihrer wichtigsten Aufgabe versagt haben.«
Sarah zuckte die Achseln. »Sie mögen Jonas.«
»Sie haben eben Geschmack«, sagte Jonas mit einem hämischen Lächeln. Er setzte sich auf den Fußboden und zwängte sich zwischen Hannah und Elle. »Rück rüber, Sahnestückchen. « Er stieß mit seinem Bein fest gegen Hannahs Oberschenkel. »Heute Abend bin ich beim Familienrat dabei.«
Hannah machte den Mund auf, schloss ihn jedoch sofort wieder und musterte die grimmigen Furchen, die sich um seine Mundwinkel herum eingekerbt hatten. Sie nahm auch wahr, dass sein Lächeln nicht ganz bis zu seinen Augen reichte. Sie wusste ebenso gut wie ihre Schwestern, dass Jonas, wenn bei seiner Arbeit etwas schrecklich schief ging, Trost bei den Menschen suchte, die er als seine einzige Familie ansah. Hannah schwenkte anmutig ihre Hand, beschrieb ein kompliziertes Muster in der Luft und augenblicklich pfiff der Wasserkessel.
»Libby möchte ein böses Mädchen sein«, teilte Sarah Jonas mit.
Seine Augenbrauen schossen in die Höhe. Ein bedächtiges Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Libby, Schätzchen, es ist ganz ausgeschlossen, dass es dem Rest deiner Schwestern gelingt, dich zu verderben. So reizend, wie du bist, kann daraus nichts werden.«
Libby sah ihn finster an. »Ich bin nicht reizend. Hör bloß auf. Du könntest mir wenigstens ein bisschen helfen, Jonas. Ich bin durchaus fähig, genauso gemein zu sein wie der Rest meiner Familie.«
»Hört, hört«, sagte Elle. »Das hast du schön gesagt, Schwester. Ein wahrhaft löblicher Vorsatz.«
Joley nickte zustimmend. »Es ist zwar nicht wahr, aber der Vorsatz ist löblich«, schloss sie sich der Jüngsten an.
Hannah hob ihre Hand, und ein Becher mit dampfendem Tee schwebte aus der Küche auf den Kreis der Schwestern zu. Sie griff ihn vorsichtig aus der Luft, pustete hinein, bis sich die sprudelnden Blasen beruhigten, und reichte ihn Jonas.
»Warum willst du eigentlich ein böses Mädchen sein?«, fragte Jonas.
»Mein Leben ist so langweilig. So schrecklich langweilig«, klagte Libby. »Ich möchte Spaß haben. Ich habe keine Lust mehr, immer die Verantwortungsbewusste zu sein.«
»Dann steigst du also bei Ärzte ohne Grenzen aus und lässt Rettet die Wale und die Projekte zur Unterstützung von Großkatzen sausen?«, fragte Jonas. Er schnalzte mit den Fingern. »Und du musst natürlich auch aufhören, den Müll zu trennen. Die Aktivitäten zum Umweltschutz, an denen du dich jedes Jahr beteiligst, solltest du auch bleiben lassen.«
»Warte«, fügte Joley hinzu. »Die Rettung des Regenwaldes kannst du dir auch gleich abschminken. Dann solltest du jede Menge Zeit haben, um ein böses Mädchen zu werden.«
Libby trat ihre Schwester mit auffallender Behutsamkeit. »Das ist gar nicht nett von dir und von dir, Jonas, auch nicht. Ihr macht euch über mich lustig.«
»Nein, überhaupt nicht«, stritt Joley augenblicklich ab. »Ich mag dich genau so, wie du bist. Du musst dich lediglich damit abfinden, dass du keinen Funken Gemeinheit im Leib hast. Deshalb fällt dir auch niemand ein, den du gern in eine Rakete stecken und zum Mars schicken würdest.«
»Jonas, zum Beispiel«, sagte Hannah. »Weil er so herrisch ist.«
»Hannah«, konterte Jonas, »weil sie immer im Mittelpunkt stehen will und sich deshalb für jeden Knülch auszieht, der ihren Körper sehen will.«
»Ich bin Model, du Giftzwerg«, sagte Hannah. »Ich stelle meinen Körper nicht zur Schau, ich führe Kleider vor.«
»Und das machst du ganz ausgezeichnet«, sagte Kate und warf ihr eine Kusshand zu. »Ich bin auch dafür, Jonas auf den Mars zu schicken, weil er gemein zu Hannah ist.«
»Ich finde es ungerecht, dass ihr euch gegen mich verbündet«, protestierte Jonas. »Sie hat mit den Gemeinheiten angefangen. «
»Und du hast mitgemacht«, hob Kate hervor.
»Jackson Deveau.« Elle nannte einen der Deputies des Sheriffs. »Weil er mich immer ärgert.«
»Ilja Prakenskij«, fügte Joley im nächsten Moment hinzu. »Weil er dringend von diesem Planeten entfernt werden sollte und weil er mir absolut nicht geheuer ist.« Sie rieb ihre Handfläche, als juckte sie immer noch.
»Frank Warner, weil er Inez das Herz gebrochen hat«, sagte Sarah.
»Sylvia Fredrickson kann ich eigentlich nicht anführen, weil sie sich neuerdings von einer ganz anderen Seite zeigt«, sagte Abigail. »Also werde ich mich in dem Punkt wohl Joley anschließen müssen.«
Alle sahen Libby an. Sie seufzte, als sie die Blicke ihrer Schwestern auf sich fühlte. »Nicht Jonas. Er ist zwar herrisch, aber in Wirklichkeit liegen ihm unsere Interessen am Herzen.«
Hannah verdrehte die Augen, als Jonas ihr einen Rippenstoß versetzte.
»Jackson schon mal ganz bestimmt nicht. Ehrlich wahr, Elle, wie kann er jemanden ärgern, wenn er doch nie etwas sagt, der arme Kerl. Ilja Prakenskij hat uns geholfen, Joley, und Frank sitzt im Gefängnis und büßt für seine Verbrechen. Inez ist unglücklich darüber, das schon, aber sie ist eine starke Frau, die versteht, dass Menschen Fehler machen.«
»Wen würdest du denn auf den Mars schicken?«, hakte Joley nach.
»Ich bin noch am Überlegen.« Libby trank mit gerunzelter Stirn einen Schluck von ihrem Tee. »Es gab mal eine Krankenschwester, die sich immer über mich lustig gemacht hat. Sie hat behauptet, ich sei flachbrüstig und nicht im Geringsten attraktiv.«
Hannah bog ihren Rücken durch. »Wer war das? Die bekommt etwas von mir zu hören.«
Plötzlich war eine Spannung im Wohnzimmer zu spüren, und der Tee brodelte in den Tassen.
Libby schüttelte den Kopf. »Nein, bloß nicht. Das arme Ding hat es ohnehin schon so schwer gehabt im Leben. Sie hat so viele Probleme. Es ist wirklich kein Wunder, dass sie nicht besonders nett zu ihren Mitmenschen ist. Sie hat mir Leid getan. «
Die Drake-Schwestern pusteten in ihren Tee, bevor sie Blicke miteinander austauschten, aber Libby konzentrierte sich so sehr, dass sie die Stirn in Falten zog. »Mir wird schon noch jemand einfallen.«
»Finde dich damit ab, Lib. Dir fällt einfach niemand ein.«
Libby zog den Kopf ein. »Oh, doch, jetzt weiß ich jemanden. Er ist eine Zeit lang mit mir zur Schule gegangen und hat an allen Programmen für überdurchschnittlich begabte Schüler teilgenommen. Er war sogar gleichzeitig mit mir in Harvard.« Sie blickte zu ihren Schwestern auf. »Er hat bessere Noten bekommen als ich.«
Jonas grinste sie an. »Ich wette, das hat dich wirklich auf die Palme gebracht.«
»Es war nicht nur das, Jonas. Er glaubt nicht an Magie. Er ist der Meinung, dass wir lügen, was unsere Gaben angeht. Er hält meine Angehörigen für Hochstapler und Scharlatane. Er ist sehr arrogant und überheblich.«
»Dann setzen wir seinen Namen auf die Liste derer, die wir mit einer Rakete auf den Mars schießen«, sagte Elle ermutigend.
Libby seufzte. »Es ist nur so, dass er unglaublich intelligent ist. Die Welt braucht ihn wirklich. Für seine medizinischen Forschungen hat er bereits den Nobelpreis bekommen. Er ist sehr begabt. Aber seine Beweggründe sind nie die richtigen.«
»Er ist auf Ruhm versessen?«, fragte Kate.
»Nein, um Berühmtheit geht es ihm eigentlich gar nicht. Er ist der reinste Laborfreak. Ihn interessiert nichts anderes als seine Wissenschaft. Nun ja, die Wissenschaft und das Adrenalin. «
»Du sprichst von Tyson Derrick«, vermutete Jonas. »Er ist verrückt. Wenn er sich gerade mal nicht im Labor einschließt, dann arbeitet er für das Forstamt. Er ist ein absoluter Adrenalinjunkie. Skydiving, Autorennen, Motorräder, Wildwasserrafting – was auch immer angeboten wird, er ist sofort dabei.«
»Er hat kein Recht, sein geniales Gehirn zu gefährden«, sagte Libby.
»Du hast ihn nicht in die Rakete gesteckt«, hob Joley hervor.
Libby errötete. Erst wurde sie scharlachrot, dann purpurrot. Das war eine Schwäche, mit der sie leben musste. Das und ihre Flachbrüstigkeit.
»Oho«, sagte Joley. »Ich glaube, dein Tyson Derrick ist ein scharfer Typ. Das stimmt doch, oder, Jonas?«
»Woher zum Teufel soll ich das denn wissen?«, sagte Jonas. »Ich sehe diesen Kerl nur an, wenn ich ihn wegen Geschwindigkeitsübertretung anhalte und ihm einen Strafzettel gebe.«
»Er hält sich nicht ans Tempolimit?«, fragte Libby, die sich einbildete, sie könnte sich unauffällig Luft zufächeln.
»Weder auf seinem Motorrad noch in seinem Wagen. Der Mann kennt nicht einmal die Bedeutung der Worte ›das Tempo drosseln‹.«
»Er sieht gut aus, das ist schon wahr«, gab Sarah zu, »aber er ist nicht auszuhalten. Dieser Mann kennt keine normalen Umgangsformen. Ich habe einmal erlebt, wie er mitten im Gespräch aufgestanden ist, als er gemeinsam mit seinem Cousin eine Verabredung mit zwei Frauen hatte. Er ist ohne ein Wort der Erklärung fortgegangen und hat Sam mit zwei sehr aufgebrachten Frauen sitzen lassen. So etwas ist ihm ganz egal.«
»Wenn er den Mund hielte, wäre er ein scharfer Typ«, meinte Libby. Sie dachte gar nicht daran, noch mehr von sich preiszugeben. Denn immer dann, wenn Tyson Derrick in der Nähe war, spielte ihre Libido verrückt. Dagegen war nichts zu machen. Daher kam es auch überhaupt nicht in Frage, dass sie ihn mit einer Rakete auf den Mars schießen würde. Jedenfalls nicht, bevor sie Gelegenheit gehabt hatte, mit ihm zu schlafen. Dazu würde es jedoch niemals kommen, weil er ein widerlicher Kerl und viel zu sehr von sich selbst eingenommen war. Nie im Leben würde sie jemandem gestehen, dass sie von ihm träumte. Es war beschämend, dass sie sich zu einem Mann hingezogen fühlte, der sie so miserabel behandelte. Er war das absolute Gegenteil von allem, wofür sie eintrat und was sie zu schätzen wusste.
»Was ist heute Abend vorgefallen, Jonas?« Elle wechselte abrupt das Thema. »Was hat dich derart aus der Fassung gebracht? «
Das Lächeln auf dem Gesicht des Sheriffs verblasste. »Ihr wollt doch sicher nicht, dass ich über meine Arbeit rede.«
»Es gibt keinen besseren Ort dafür.«
Er seufzte und trank einen Schluck von dem Tee, der ihn immer zu beschwichtigen schien. Aber vielleicht waren es auch die sieben Schwestern, die diese Wirkung auf ihn hatten. »Wir sind heute Abend einem Anruf nachgegangen. Eine Frau hat gemeldet, sie hätte in der Nachbarschaft Schreie gehört. Ein Mann von vierzig Jahren sorgt für seine Mutter, die offenbar sehr krank ist. Er löst die Schecks ein, die sie erhält, aber er hat sie hungern lassen und wir können mit Sicherheit sagen, dass er sie geschlagen hat, wenn sie ihm zur Last gefallen ist. Er hat sich ein Heimkino der Spitzenklasse eingerichtet und seine Mutter im Hinterzimmer untergebracht, mit schmutzigem Bettzeug und ohne Essen oder Wasser. Ich hätte ihn am liebsten …« Er ließ seinen Satz abreißen und sah sich im Zimmer um. »Tut mir Leid. Ich weiß, dass ihr alle fühlen könnt, was ich empfinde, und deshalb versuche ich, es für mich zu behalten, aber…« Er deutete ein Achselzucken an.
Hannah und Elle legten ihm jeweils eine Hand aufs Knie. Libby beugte sich vor und folgte ihrem Beispiel. Sarah und Kate berührten seine Schultern, während Abigail und Joley ihre Finger um seine Arme schlangen. Augenblicklich spürte er eine Flut von Wärme und das Gefühl von Zugehörigkeit.
»Ihr braucht das nicht zu tun«, wehrte er ab. »Ich bin nicht hergekommen, damit ihr meinetwegen eure Energien verausgabt. Ich wollte nur einfach bei euch sein. Ich hatte gehofft, eure Eltern und Tante Carol wären wieder da.«
»Nein, sie haben beschlossen, sich ein paar Tage Zeit für eine Rundreise durch die Weinbaugebiete zu nehmen. Im Napa Valley ist es um diese Jahreszeit so wunderschön, und sie dachten sich, das nutzen sie aus, um sich dort einiges anzusehen«, erklärte Kate.
»Wahrscheinlicher ist, dass sie ein paar Tage Erholung von uns brauchten«, sagte Joley. »Tante Carol hat Zeitschriften mitgebracht, du weißt schon, die mit den neuesten Sensationsmeldungen über Joley Drake, die wilde Sängerin. Ich glaube, diese Woche bin ich angeblich in einer Entzugsklinik.«
»Das war letzte Woche«, verbesserte Elle ihre Schwester. »Diese Woche bist du verhaftet worden, weil du ein Hotelzimmer zertrümmert hast.«
»Ach, wirklich?« Joley wirkte erfreut. »Ich möchte auch ein Hotelzimmer zertrümmern«, sagte Libby. »Nein. Vielleicht doch nicht. Eigentlich liegt es mir nicht, anderer Leute Eigentum zu zerstören.«
»Bin ich immer noch im Gefängnis?«, fragte Joley hoffnungsvoll.
»Nein. Dein neuester Liebhaber hat dich gegen Kaution rausgeholt. Nur für den Fall, dass du dich nicht an ihn erinnerst – er hat längere Haare als du und einen schmuddeligen Bart, und er spielt bei einer Heavy Metal Band.«
»Ich bin ihm nicht persönlich begegnet«, sagte Joley, »aber wir waren etwa fünf Minuten lang im selben Hotel. Er muss scharf rangehen und das Vorspiel weglassen.«
»Die Zeitschriften haben es in der letzten Zeit wirklich auf dich abgesehen, Joley«, sagte Sarah.
Joley seufzte. »Ich weiß. Hoffentlich legt sich das bald.«
»Ich habe nie verstanden, warum du diese Schreiberlinge nicht verklagst, wenn sie so viele Lügen über dich verbreiten«, sagte Jonas. »Mich ärgert das.«
»Anfangs war ich wütend und verletzt und besorgt darüber, dass meine Familie diese hässlichen Lügen über mich lesen muss und vielleicht sogar interviewt wird und Fragen über mich beantworten soll. Aber inzwischen habe ich gelernt, damit zu leben. Es laufen so viele Verrückte durch die Gegend, Jonas, aber das weißt du vermutlich längst.«
»Bedauerlicherweise. Ich habe mit Douglas über die Sicherheitsvorkehrungen bei deinem letzten Konzert geredet«, fügte Jonas hinzu. »Sie haben zugelassen, dass jemand die Bühne gestürmt hat. Ich konnte es einfach nicht fassen. Wenn das einer von denen gewesen wäre, die es darauf abgesehen haben, dir etwas anzutun, dann wäre nichts mehr zu machen gewesen.« Seine Stimme klang jetzt wieder grimmig.
»Das war doch nur ein übereifriger Fan, Jonas«, beschwichtigte ihn Joley. »Die Sicherheitskräfte haben ihn von der Bühne geschleift und mir ist nichts passiert.« Der Vorfall hatte sie erschüttert, aber sie hatte nicht die Absicht, es ausgerechnet Jonas gegenüber zuzugeben. Vor dreißigtausend Menschen zu singen, fiel ihr leicht, aber mit Stalkern und durchgeknallten Fans und den Paparazzi fertig zu werden, war nervenaufreibend.
»Das war aber noch nicht alles, was in der Zeitschrift stand.« Elle zögerte und biss sich auf die Unterlippe. Sie sah Libby an. »Erinnerst du dich noch an den Zwischenfall vor ein paar Monaten, als du dieses Kind geheilt hast und die Eltern ihre unglaubliche Geschichte einem Reporter erzählt haben?«
Libby nickte. Die Zeitschrift hatte ein ganzseitiges Bild von ihr veröffentlicht. Zum Glück war der Artikel so theatralisch abgefasst gewesen, dass man davon ausgehen konnte, die meisten Leute würden ihn als blanken Unsinn abtun.
»Ein anderer Reporter hat die Eltern interviewt und nicht so leicht lockergelassen. Er hat ein bisschen recherchiert und weitere Patienten von dir ausfindig gemacht, die bereit waren, ein Loblied auf dich zu singen. Eine dieser Patientinnen war Irene Madison.«
»Ausgeschlossen«, sagte Sarah. »Irene würde Libby niemals hintergehen.«
»Sie war sehr aufgebracht, als wir das letzte Mal nach ihrem Sohn gesehen haben, Sarah«, hob Hannah hervor. »Sie hat darauf bestanden, dass Libby Drews Leukämie heilt. Libby hat sein Leben verlängert, aber Irene will, dass er geheilt wird.«
»Die Zeitschrift hat sie dafür bezahlt«, sagte Elle.
»Woher weißt du das?«, fragte Jonas.
Elle sah ihn einfach nur an.
Jonas hob die Hände als Zeichen seiner Kapitulation. »Tut mir Leid, dass ich überhaupt gefragt habe.«
Libby rieb ihre Schläfen, die plötzlich pochten. »Ich hätte es wissen müssen. Heute hat mich jemand während meiner Arbeit im Krankenhaus aufgesucht. Er trug einen gut geschnittenen Anzug, war eindeutig nicht von hier und wollte ein Treffen mit seinem Boss arrangieren.«
Jonas rückte näher zu ihr. Jede Spur von einem Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden. »Wer war das?«
»Das ist es ja gerade. Der Name von seinem Boss war mir bekannt. Edward Martinelli. Er hat sich einen großen Namen in der Pharmaindustrie gemacht. Über ihn und die Leute, die seine Firma unterstützen, sind ständig wüste Gerüchte im Umlauf. Ich habe seinem Abgesandten gesagt, ich sei zu beschäftigt. Der Mann hat mir nicht gedroht, aber ich habe mich bedroht gefühlt. Er hat meine Familie erwähnt, insbesondere Hannah, und wie schön und wie bekannt sie ist.«
»Verdammt noch mal, Libby, wieso hast du mir nicht längst etwas von diesem netten kleinen Plausch erzählt?«, fauchte Jonas sie an. »Du hättest mir augenblicklich Bescheid geben sollen.«
»Ich habe den Sicherheitskräften des Krankenhauses diesen Vorfall gemeldet – und meine Schwestern informiert«, sagte Libby. »Er hat mir schließlich nicht gedroht – und Hannah auch nicht. Was hätte ich der Polizei denn sagen sollen?«
»Nicht der Polizei – mir«, verbesserte Jonas sie. »Mir sollst du es sagen.«
»Solche Dinge passieren doch ständig«, verteidigte sich Libby. »Die Käseblätter bringen liebend gern Artikel über ›Gesundbeter‹ oder ›Wunderheiler‹, wenn sie gerade nichts Besseres zu berichten haben.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch das dunkle Haar, das ihr wie eine Wolke ums Gesicht fiel. »Ich hatte nur gehofft, es würde so schnell nicht wieder passieren.«
»Martinelli stammt aus einer Sippe von Verbrechern, die in Chicago sitzt. Er ist jetzt schon seit ein paar Jahren in San Francisco, und seine Firma ist angeblich blitzsauber, aber gegen seine Familie ist schon zahlreiche Male ermittelt worden.«
»Vielleicht führt er seine Firma tatsächlich korrekt«, sagte Libby. »Wenn ihm niemand etwas anhängen konnte, dann ist er eventuell ein einwandfreier Geschäftsmann, der einfach nur das Pech hat, aus einer nicht ganz sauberen Familie zu stammen. Wir alle haben Leichen im Keller.«
»Warum sollte er dann jemanden zu dir schicken, der Hannah bedroht, wenn du dich nicht auf eine Zusammenarbeit einlässt?«
»Er hat sie nicht bedroht«, wiederholte Libby. »Ich war müde, Jonas. Ich hatte eine Schicht von achtzehn Stunden hinter mir, und es hat mir gar nicht gefallen, dass ein Fremder auf mich zukommt und von mir verlangt, ich soll mich mit seinem Boss treffen. Er wollte mir nicht sagen, was Martinelli von mir will, aber als ich gesagt habe, dass ich keine Versuchsreihen durchführe, hat er gesagt, es hätte nichts mit seiner Firma zu tun. Vielleicht war ich derart übermüdet, dass ich ihn falsch verstanden habe.«
»Ich werde diesen Martinelli ganz genau unter die Lupe nehmen. Er hatte keinen Grund, Hannah zu erwähnen. Hast du jemals die Liste von Bekloppten gesehen, die ihr Drohbriefe schreiben? Hinter ihr sind genauso viele Verrückte her wie hinter Joley, wenn nicht sogar noch mehr.«
»Da kann ich mich ja glücklich schätzen. Und wie bekommst du diese Briefe überhaupt zu sehen?«, fragte Hannah.
»Da ich genau weiß, wie stur du bist und dass du sie mir nicht aushändigen würdest, habe ich eine Abmachung mit deinen Sicherheitskräften und mit deinem Agenten getroffen.«
»Na, toll. Hast du schon mal was vom Recht auf Privatsphäre gehört?«
»Schmink dir das ab, Puppengesicht. Ich werde niemals politisch korrekt sein. Wenn ich es für notwendig halte, eine von euch zu beschützen, dann bekommt ihr Schutz, ob es euch passt oder nicht.«
Die Drake-Schwestern sahen einander lächelnd an.
»Ich schwöre es dir, Jonas«, sagte Joley, »es haut mich fast um, wenn ich sehe, wie du dir auf deine breite männliche Brust trommelst.«
»Das höre ich gern.« Jonas schloss die Augen und ließ sich von den Frauen, die um ihn herumsaßen, nicht im Geringsten einschüchtern.
Hannah wedelte mit einer Hand, um die Lichter auszuschalten und die Kerzen anzuzünden. »Du bist so arrogant, Jonas. Wird dir das nicht manchmal selbst zu blöd?«
»Nein. Schließlich habe ich euch alle sieben am Hals, und irgendjemand muss ja für euch denken.«
Sarah schlug ihn mit einem Kissen. »Du kannst froh sein, dass wir dich mögen, Jonas. Sonst hätten wir Hannah längst erlaubt, dich in eine Kröte zu verwandeln.«
»Das hat sie bereits versucht, aber es hat nicht geklappt. Wo stecken denn die unglückseligen Männer heute Abend überhaupt? «, fragte Jonas. Er faltete die Hände hinter seinem Kopf und ließ sich zurücksinken. »Sind sie in die Berge geflohen?«
»Heute ist Frauenabend«, sagte Sarah mit einem hämischen Lächeln. »Keine Verlobten. Nur Schwestern.«
Jonas stöhnte und öffnete seine Augen gerade weit genug, um finster zu blicken. »Das hättet ihr mir auch gleich sagen können. Das wird mir noch lange nachhängen. Sie werden mich gnadenlos damit aufziehen.«
»Und du wirst es voll und ganz verdient haben«, sagte Hannah. »In Wirklichkeit bist du heute Abend nämlich nur gekommen, um uns zu piesacken und uns die Plätzchen wegzuessen. «
»Wie wahr«, stimmte er ihr zu. »Das tut mir immer wieder gut. Aber Kate hat das letzte Plätzchen mit Füllung gemopst. Wann findet eigentlich diese Hochzeit statt? Allmählich glaube ich, in Wirklichkeit werdet ihr gar nicht heiraten. Ihr wollt nur in Sea Haven bleiben, um mich zu ärgern.«
»Das ist mein Lebensinhalt«, stimmte ihm Hannah zu.
»Aleksandr will mit mir durchbrennen und heimlich heiraten«, gestand Abigail. »Er will nicht auf die Hochzeit des Jahrhunderts warten. Er findet das bescheuert und meint, wir sollten in aller Stille heiraten.«
»In aller Stille?« Jonas gab einen rüden, spöttischen Laut von sich. »Die Hochzeit des Jahrhunderts wird ein Riesenrummel. Ist ihm denn nicht klar, dass die ganze Stadt eingeladen werden muss, weil man die Gefühle der Leute andernfalls verletzen könnte?«
»Deshalb will er doch ausreißen.«
»Ich glaube, du bist hier diejenige, die heimlich heiraten will«, vermutete Sarah. »Menschenmassen hast du noch nie gemocht, Abbey.«
Abigail zog den Kopf ein. »Mom und Dad wären ja so enttäuscht. Sämtliche Verwandte kommen von überallher geflogen, und es wird ein gewaltiges Ereignis.«
Kate legte Abigail eine Hand auf den Arm. »Das spielt keine Rolle. Es ist deine Hochzeit. Wenn du sie im kleinsten Kreis feiern willst, können wir heimlich einen Geistlichen holen und die Trauung hier im Haus vollziehen lassen. Nur Mom, Dad, Tante Carol und wir werden da sein.«
Jonas hob eine Hand. »Wenn ihr mich nicht einladet, mache ich Aleksandr die Hölle heiß, Abbey, aber ansonsten bin ich voll und ganz dafür. Ihm behagt eine große Hochzeitsfeier genauso wenig wie dir.«
Abigail stieß die Luft aus, die sie angehalten hatte. »Was glaubt ihr, werden Mom und Dad mir böse sein?«
Elle drehte sich auf den Bauch und streckte sich neben Jonas aus. »Mom weiß bereits, dass du dir keine große Hochzeit wünschst. Ich bin sicher, dass sie es Dad gegenüber zur Sprache gebracht hat. Sie wünschen dir alle beide, dass du an einem so wichtigen Tag in deinem Leben glücklich bist, Abbey, und nicht, dass du dich elend fühlst. Das solltest du eigentlich selbst wissen.«
»Ja, schon, aber Mom scheint es so große Freude zu machen, die Hochzeiten zu planen.«
»Für Damon ist es die reinste Folter«, sagte Sarah. »Aber da muss er durch, weil ich mir schon immer eine große Hochzeit gewünscht habe und weil er begreifen muss, dass mir die Einwohner von Sea Haven wichtig sind.«
»Dir macht es Spaß, ihn aus Prinzip zu quälen«, bemerkte Jonas. »Was ist mit Matt, Kate? Ist ihm die große Hochzeit recht?«
Kate lächelte matt. »Seine Mutter schwebt auf Wolken. Und sie will sofort Babys. Sie hat uns gesagt, wir sollen fruchtbar sein und uns mehren. Möglichst schnell. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so begierig darauf ist, Enkelkinder zu bekommen. Sie hat bereits einen Spielplatz hinter ihrem Haus anlegen lassen. Ich würde ihr diesen großen Augenblick nicht nehmen wollen, und Matt will es auch nicht. Bei dir ist das etwas ganz anderes, Abbey, denn du brauchst niemand anderem eine Freude zu machen. Ich finde, du solltest dich hier im Haus in einem kleinen privaten Kreis trauen lassen. Wir können es geheim halten.«
»Ich steuere die Musik bei«, erbot sich Joley.
»Ich kann das Backen übernehmen, die Hochzeitstorte inbegriffen«, sagte Hannah. »Dann wird niemand, der nicht zur Familie gehört, merken, was hier vorgeht.«
»Ich schmücke das Haus«, sagte Kate. »Matt wird mir dabei helfen.«
Abigail strahlte über das ganze Gesicht. »Seid ihr sicher, dass Mom und Dad mir nicht böse sein werden?« Sie sah Elle an, als sie diese Frage stellte.
Die jüngste Drake-Schwester zuckte die Achseln. »Sie rechnen damit, dass du ihnen sagst, du wünschst dir eine kleine private Trauung. Mom und Tante Carol besitzen schließlich auch Gaben. Das dürft ihr nicht vergessen.«
Die anderen Schwestern nickten verlegen.
»Mom besitzt sämtliche Gaben«, rief Elle ihnen mit leiser Stimme ins Gedächtnis zurück.
Joley schnitt eine Grimasse. »Das kannst du laut sagen. Mom wusste immer schon, dass ich mich aus dem Haus schleichen würde, bevor ich es auch nur versucht habe. Sarah, du wirst dich glücklich schätzen können, wenn du später einmal Kinder hast. Die werden sich überhaupt keinen Unsinn erlauben können. Meine würden so wie ich, und deshalb kommt es für mich überhaupt nicht in Frage, mich fortzupflanzen. Dem wäre die Welt nicht gewachsen und ich selbst schon gar nicht.«
»Du wirst Kinder haben, Joley«, sagte Sarah.
»Wie sollte das gehen? Ich habe nicht vor, mich von irgendeinem Idioten an sich binden zu lassen.« Joley schüttelte unnachgiebig den Kopf. »Ich ertrage die Rechthaberei dieser Kerle nicht und ihre Bevormundung schon gar nicht. Und die Jasager langweilen mich so sehr, dass ich laut schreien könnte. Und Zwischenlösungen kommen für mich nicht in Frage. Ich bin zwangsläufig dazu verdammt, allein zu bleiben.«
Jonas schnaubte höhnisch. »Darüber scheinst du keineswegs unglücklich zu sein.«
»Würdest du etwa mit jemandem wie dir leben wollen?«, fragte Joley.
»Ich bin unfehlbar«, verkündete Jonas.
»Ein mannhafter Mann«, spottete Sarah.
»Du hast’s erfasst, Süße.«
»Ich verwandle dich in eine Kröte«, sagte Hannah. »Niemand könnte deine Arroganz, deine herrische Art und deine Rechthaberei auf die Nähe aushalten. Deine bedauernswerte Ehefrau würdest du einschüchtern und deine Kinder würden fortlaufen.«
»Meine bedauernswerte Ehefrau würde vor anderen Männern und der Welt im Großen und Ganzen ihre Kleider anbehalten und sich nur für mich ausziehen«, sagte er.
»Warum behauptest du so beharrlich, ich zöge mich vor aller Welt aus? Ich ziehe mich an, um Kleider vorzuführen, das ist mein Job.«
»Inez führt sämtliche Zeitschriften, auf deren Titelseite du abgebildet bist, Zuckerpüppchen. Ich bin nicht sicher, ob ich das, was du die meiste Zeit trägst, tatsächlich als Kleidungsstücke bezeichnen würde. Wann suchst du dir endlich eine richtige Arbeit?«
Hannah wandte ihr Gesicht von Jonas ab. Elle und Libby legten augenblicklich ihre Hände auf sie, und sie spürte Wärme und Energie in sich hineinfließen. Sarah versetzte Jonas einen Tritt. »Geh nach Hause. Jetzt hast du es geschafft, dass wir alle sauer auf dich sind. Und du weißt genau, dass du es nicht gebrauchen kannst, dir den Zorn von uns allen zuzuziehen. «
Jonas zog sich mit einer geschmeidigen Bewegung auf die Füße. »Ihr beschützt also mal wieder die Barbie-Puppe. Damit tut ihr Hannah keinen Gefallen. Sie kann nicht ewig Kapital aus ihrem Aussehen schlagen.«
Hannah zuckte sichtlich zusammen. Ihre Hände zitterten so sehr, dass sie die Finger zu Fäusten ballte.
Elle stand auf, und ihre zierliche Gestalt wirkte neben dem großen, kräftigen Sheriff noch kleiner als sonst. »Hör zu, Jonas, wenn ich nicht über dich wüsste, was ich über dich weiß, nämlich, dass du wirklich nur die besten Absichten hast, dann würde ich dir persönlich einen Tritt in den Hintern geben. Verschwinde. Und zwar sofort.« Ihr rotes Haar war derart mit Elektrizität geladen, dass es knisterte, und in dem verdunkelten Zimmer schien ihr Körper Licht abzustrahlen, als suchte die gesamte Energie in ihrem Innern einen Weg nach draußen. Die Mauern des Hauses dehnten sich aus und zogen sich wieder zusammen, und der Fußboden verschob sich ein wenig unter ihren Füßen.
Jonas sah sie finster an, ohne sich einschüchtern zu lassen. »Mir ist ganz egal, was du weißt, Elle. Und droh mir bloß nicht.«
»Ich drohe dir nicht. Wenn ich das täte, stündest du jetzt nicht hier, sondern würdest um dein Leben laufen. Falls du noch nicht dahintergekommen bist, es ist nicht leicht, so zu sein, wie ich bin. Glaubst du etwa, ich will tatsächlich wissen, was jeder in jedem beliebigen Moment denkt oder fühlt? Stellst du es dir etwa einfach vor, so launisch und aufbrausend zu sein wie der Rest der Welt und gleichzeitig so gefährlich, dass ich es nicht wage, meine Wut auszuleben?«
»Im Moment tust du es.«
»Ja, aber ich mag dich und würde dich niemals auch nur versehentlich verletzen. Ich mag aber nun mal nicht jeden, du Idiot. Verschwinde, bevor das Haus bebt, bis es auseinander bricht und Mom und Dad tierisch sauer auf mich werden.«
»Kannst du das tun? Das Haus einstürzen lassen?«
»Sieht es etwa so aus, als könnte ich das nicht?«, entgegnete Elle und wies auf die Wände.
Ihre Schwestern waren aufgesprungen und drängten sich um sie. Libby legte ihrer jüngeren Schwester die Hände auf die Schultern, um sie mit ihrer heilenden Wärme zu besänftigen. Elle ließ sich an sie sinken, und Libby schlang ihre Arme um sie.
»Es fällt dir zunehmend schwerer, stimmt’s?«, flüsterte Libby.
Elle nickte und drehte sich in ihren Armen um, damit sie ihr Gesicht an Libbys Schulter schmiegen konnte. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Jonas trat näher und riss beide Schwestern in seine Arme. »Es tut mir Leid, Elle. Ich würde dir niemals absichtlich das Leben schwer machen. Aber ich kann nichts daran ändern, dass ich so bin, wie ich bin, auch wenn ich deinetwegen wünschte, ich könnte es.«
Elle schenkte ihm ein kleines Lächeln. »Ich weiß, dass du das für mich tätest, Jonas. Ich bin sehr froh, dass du zur Familie gehörst.«
Libby rieb den Rücken ihrer Schwester, während sie zusah, wie Jonas zur Tür hinausschlüpfte. Wind strömte herein, als er die Tür öffnete, und daher tanzten die Flammen der Kerzen, flackerten wüst und warfen Schatten auf die Wände. Libby gefiel nicht, wie die Schatten emporsprangen, es war als griffen sie nach den Drakes und streckten ihre Krallenhände nach ihnen aus. Sie warf einen besorgten Blick auf Sarah, die Älteste, und sah in deren Augen dieselbe Erkenntnis. Libby schloss Elle fester in ihre Arme und hielt sie eng an sich geschmiegt.
2.
Der Blick des siebzehn Jahre alten Pete Granger glitt über das Meer, als er plötzlich jemanden sah, der sich im Nieselregen auf den steilen Klippen über der Seelöwenbucht voranbewegte. Das Herz machte einen Satz in seiner Brust, als er auf die Bremse seines zerbeulten alten Lastwagens trat. Zum Glück war niemand hinter ihm. Er schaute auf die steil abfallende Felswand, die sich über dem brodelnden Ozean erhob, und schluckte schwer, denn die Furcht schnürte ihm plötzlich die Kehle zu.
Instinktiv griff er nach seinem Handy. Doch als er es ans Ohr hielt, fiel ihm wieder ein, dass der Empfang an der Küste stark eingeschränkt war und er sich nicht auf der einen Klippe befand, die es ihm gestattete, einen Anruf zu tätigen. Frustriert und mit pochendem Herzen setzte er den Lastwagen wieder in Bewegung und raste über den Highway, bevor er auf die unbefestigte Straße abbog, die zu den Klippen führte. Fast hätte er beim Parken vergessen, die Handbremse zu ziehen.
Der Wind schlug ihm kräftig entgegen, als er die Tür aufriss und über den schlammigen Boden zur Spitze der Klippe rannte. Seine Mütze wurde ihm vom Kopf geweht, und der Wind zog an seinem Hemd. Ohne den niedrigen Zaun und die Schilder zu beachten, die davor warnten, sich dem abbröckelnden Ende der Klippe zu nähern, ließ er sich fallen, presste sich flach auf den Boden, kroch bis an den äußersten Rand und lugte darüber.
»Drew!« Der Name ging im Tosen des brodelnden Meers unter. Pete hielt seine Hände wie einen Trichter vor den Mund und probierte es noch einmal mit aller Kraft. »Drew! Ist alles in Ordnung?« Er bezweifelte, dass sein Freund die Worte hören konnte, doch dann erweckte etwas Drews Aufmerksamkeit —vielleicht war es das Rieseln des Lehms, den er gelockert hatte –, denn Drew blickte nach oben und wandte Pete sein Gesicht zu.
Drew Madison hing ein bis zwei Meter tiefer an der schlammigen Felswand. Fast dreißig Meter unter ihm krachte die Brandung auf große, zerklüftete Felsen und ließ weiße Gischt hoch in die Luft aufsprühen. Das gewaltige Tosen des Meeres wurde von der steilen Felswand zurückgeworfen. Der stetige Nieselregen tauchte alles in ein nasskaltes Silbergrau und erschwerte es Pete, Drews starres weißes Gesicht im Auge zu behalten.
Drew wirkte klein und hilflos, und sein Gesicht war mit Schlamm verschmiert. Er schüttelte den Kopf, um Pete abzuwimmeln, und krümmte sich gegen die aufsprühende Gischt, als eine Welle auf die große Felsformation direkt unter ihm schlug. Pete konnte Schlitterspuren im Schlamm erkennen, wo Drews Körper über den Abgrund geglitten und an der Felswand hinabgerutscht war, bis er auf den kleinen Vorsprung traf, an den er sich jetzt klammerte.
Pete hielt sein Handy hoch und beschrieb mit einer Geste das Auswerfen eines Seils. Zu seinem Erstaunen schüttelte Drew noch heftiger den Kopf. Der Regen, der stetig hinunterprasselte, kam Pete in die Augen, und er musste seine Knöchel benutzen, um das Wasser fortzuwischen. Dabei verlor er Drews verzweifeltes weißes Gesicht einen Moment lang aus den Augen. Als Pete wieder klarer sehen konnte, schlug ihm das Herz in der Kehle. Drew war verschwunden.
»Drew!« Pete schrie den Namen, bis er heiser war. Er bewegte sich Zentimeter für Zentimeter weiter voran, bis er im Schlamm selbst ins Schlittern kam und seine Stiefel in den Zaun haken musste, um nicht den Halt zu verlieren. Verängstigt lugte er in das tosende Wasser mit den weißen Schaumkronen hinunter, in die Gischt, die über die Felsen sprühte und brodelnd auf die Felswand traf. Es schien ganz ausgeschlossen, dass jemand diesen Sturz überlebt haben konnte.
Tränen verschleierten seine Sicht. Er starrte so lange auf die Spitze der Felsformation, bis es ihm erschien, als bewegte sich dort etwas in Zeitlupe. Er wischte sich die Augen und sah noch einmal hin. Etliche Felsvorsprünge behinderten seinen Ausblick, und daher bezog er einen anderen Posten, um seinen Blickwinkel zu verändern. Jetzt konnte er auf den Felsen, die sich vor den Klippen aus dem Meer erhoben, sofort Drew erkennen, ein in sich zusammengesacktes Häufchen Elend, doch es bewegte sich! Pete bildete aufgeregt einen Trichter mit seinen Händen.
»Drew!«
Er erhielt keine Antwort, aber er wusste, dass Drew am Leben war. Er schien zwischen zwei Felsbrocken eingezwängt zu sein, die aus dem Meer aufragten und einen Teil des Zugangs zu den Höhlen bildeten, der unter dem Wasserspiegel lag. Es schien unmöglich zu sein, dass er noch lebte, aber er bewegte sich ganz eindeutig.
»Ich hole Hilfe. Sie werden kommen und dich retten, Drew!«
Pete krabbelte rückwärts wie ein Krebs, bis er den Zaun erreicht hatte und darunter durchgekrochen war. Er rannte zu seinem Lastwagen zurück, um dann ein kleines Stück bis ans andere Ende der Bucht zu fahren, wo das Handy funktionieren würde. Er rief im Büro des Sheriffs an und schaffte es, trotz der immensen Anspannung, unter der er sich befand, die Einzelheiten durchzugeben.
Dann kehrte er um und hatte die Klippen beinah erreicht, als er das Heulen der Sirenen hörte und wusste, dass Jonas Harrington und Jackson Deveau, der Sheriff und sein Deputy, auf dem Weg waren. Er sackte vor Erleichterung zusammen und wartete auf das Eintreffen des Streifenwagens.
»Ty schottet sich ab und tut so, als wären wir gar nicht da«, teilte Sam Chapman der Runde von Feuerwehrmännern mit, die am Tisch saßen und Karten spielten. »Versteht ihr, das ist nämlich sein Urlaub. Er verbringt Wochen, manchmal sogar Monate, eingeschlossen in seinem Labor bei BioLab Industries. Er isst nicht, er schläft nicht, und er vergisst alles andere, während er gebannt in ein Mikroskop schaut. Er redet mit keiner Menschenseele, sondern starrt die ganze Zeit nur kleine Würmer an, die auf einem Dia tanzen.«
»Hier redet er auch nicht gerade viel«, sagte Doug Higgens.
»Es gelingt ihm jedes Mal wieder, für neunzig Tage eine neue Bescheinigung zu bekommen, die ihm die Tauglichkeit für Hubschrauberrettungseinsätze bestätigt«, sagte Sam, »aber das tut er nur, weil er den Stress mag, nicht uns.«
»Ich mag dich auch nicht besonders, Sam«, sagte Jim Brannigan, der Pilot des Hubschraubers. »Du hast mir beim letzten Kartenspiel mein gesamtes Geld abgeluchst.«
Tyson Derrick nahm so gut wie nichts von den ständigen Hänseleien der anderen Feuerwehrmänner in der Feuerwache Helitack wahr. Es stimmte schon, er vergaß häufig, etwas zu essen und schlief oft tagelang nicht, weil er sich derart auf seine Forschungen konzentrierte, dass er die Welt um sich herum vergaß. Diese Arbeit hier zu der Jahreszeit, in der die Waldbrände Hochsaison hatten, bot ihm ein klein wenig Abwechslung und Gelegenheit mit anderen Menschen zusammen zu sein. Außerdem liebte er die Adrenalinschübe, die er auch außerhalb des Labors brauchte. Und doch schien sich selbst das nicht mehr zu bewähren. Etwas fehlte. Er musste dringend sein Leben ändern.
»Wach auf, Ty.« Sam Chapman klopfte ihm auf den Rücken. »Du hast bestimmt kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe.«
»Ich habe jedes Wort gehört«, entgegnete Tyson. »Es war nur keine Antwort wert. Außerdem habe ich dir doch schon oft genug gesagt, Sam, dass du beim Kartenspiel immer schlechte Chancen hast. Im Moment stehen deine Chancen zweihundertzwanzig zu eins. Es sieht nicht gerade besonders gut für dich aus. Sean hat mit dreiundvierzig Komma zwei zu eins viel bessere Chancen.«
»Herzlichen Dank für diese kleine Lektion«, sagte Sam und warf seine Karten auf den Tisch. Er sah grinsend in die Runde. »Ty hat mir gestern Abend erzählt, dass er jetzt bereit sei, mit der perfekten Frau einen Hausstand zu gründen. Jetzt muss er nur noch eine Frau finden, der es nichts ausmacht, dass er für Wochen oder Monate spurlos untertaucht, wenn er in seinem Labor arbeitet und sich zwischendurch zum Skydiving, Parasailing oder zum Bergsteigen absetzt. Ihr wisst schon, eine Heilige.«
Schallendes Gelächter brach auf Tysons Kosten aus. Er war nicht so umgänglich und unkompliziert wie sein Cousin Sam. Sam fügte sich überall blendend ein und besaß die angeborene Gabe, andere zum Lachen zu bringen. Ty rang sich ein mattes Grinsen ab. »Darüber sollte ich mir wirklich Gedanken machen«, stimmte er seinem Cousin zu. »Aber es sieht ganz so aus, als könnte ich nicht abschalten. Eines der Projekte bei BioLab geht mir einfach nicht aus dem Kopf.«
Sam stöhnte. »Ich dachte, du hättest deine Projekte und alles, woran du sonst noch gearbeitet hast, vor den Ferien abgeschlossen …«
»Das stimmt nicht ganz, denn es handelt sich um ein laufendes Projekt zur Identifizierung einer Reihe von hochwirksamen In-vitro-Hemmstoffen …«
»Hör bloß auf, Ty.« Sam fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Sonst bist du schuld daran, wenn wir alle Kopfschmerzen kriegen. Kein Wunder, dass du mit dem Gedanken spielst, einen Hausstand zu gründen. Sich Tag und Nacht Sorgen um solche Dinge zu machen, das hält doch kein Mensch aus. Die Hälfte von dem Kram, mit dem du dich beschäftigst, könnte ich wahrscheinlich nicht mal richtig aussprechen.«
Ty zuckte die Achseln, und sein Gesicht verfinsterte sich. »Es geht nicht um mein Hepatitis-C-Projekt. Vor einiger Zeit hat die Firma begonnen, ein neues Medikament zu entwickeln. Es beruht auf den grundlegenden Erkenntnissen der Studie zur Zellregeneration bei äußeren Verletzungen, die ich vor ein paar Jahren vorgelegt habe. Man glaubt, man habe unter Umständen ein Medikament zur Krebsbekämpfung gefunden. Aber irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass daran etwas nicht stimmt. Ich habe mich in meiner Freizeit noch mal drangesetzt und selbst ein bisschen nachgeforscht…«
»Ty.« Sam schüttelte den Kopf. »Wenn du hierher kommst, dann tust du das, um all das hinter dir zu lassen. Du hast beschissen ausgesehen, als du zu den Übungseinsätzen erschienen bist. Du lässt dich derart von dieser Arbeit in Anspruch nehmen, dass du ebenso gut im Gefängnis sitzen könntest.«
»Es ist nur so, dass dieses Medikament ein sehr reales Potenzial besitzt, vielen Krebspatienten zu helfen. Harry Jenkins hat die Leitung des Projekts übernommen, aber er ist nicht so gründlich, wie es erforderlich wäre. Er neigt dazu, Verfahren abzukürzen, weil ihm mehr an der Anerkennung liegt als daran, zum richtigen Ergebnis zu kommen.« Plötzlich wurde ihm überdeutlich bewusst, dass alle anderen um ihn herum schwiegen. So ging es ihm immer. Er konnte sich nirgends einfügen, auch dann nicht, wenn er sich noch so sehr anstrengte. Die meisten Gespräche erschienen ihm banal, weil sein Verstand selbst dann, wenn er sich bemühte abzuschalten, unablässig damit beschäftigt war, ein Problem zu knacken, und daher wäre es ihm viel lieber gewesen, einfach weiterzuarbeiten.
»Dieses Medikament fällt doch noch nicht mal in dein Ressort, oder?«, fragte Sam. »Ich wette, der alte Harry kann dich nicht besonders gut leiden, stimmt’s?«
»Nein, eigentlich nicht«, gab Ty widerstrebend zu. Harry konnte ihn nicht ausstehen. Allerdings bezweifelte er, dass es viele Menschen gab, die ihn gut leiden konnten. Er wünschte, es wäre ihm wichtig, aber für ihn zählte nur Sam. Er ließ Sam nicht gern im Stich. »Aber es geht ja schließlich nicht um einen Beliebtheitswettbewerb. Dieses neue Medikament könnte Leben retten. Und es basiert auf meiner früheren Arbeit über die Zellregeneration. Wenn sie es nicht richtig hinkriegen, würde ich mich dafür verantwortlich fühlen.«
»Na, toll. Dann wirst du deinen Urlaub also in diesem behelfsmäßigen Labor in unserem Keller verbringen?«, fragte Sam. »Und ich hatte außer dem Parasailing auch noch Wildwasserrafting und ein paar Touren zum Klettern an der Steilwand mit dir geplant. Ich kann dir nur raten, mich nicht schon wieder im Stich zu lassen.«
Ty lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und musterte das gut geschnittene Gesicht seines Cousins. Sam gelang es manchmal, beleidigt zu wirken. Ty kannte keinen anderen Mann, der eine beleidigte Miene aufsetzen konnte und trotzdem noch anziehend auf Frauen wirkte. Sam war charmant. Ty wünschte sich oft, er besäße ein klein wenig von dem, was Sam an sich hatte, was auch immer das sein mochte. Sam kam gut mit Leuten aus. Er konnte prächtig blödeln, und alle mochten ihn.
Ty wusste, dass er Sam im Lauf der Jahre mehr als einmal mit seiner schroffen, abweisenden Art in Verlegenheit gebracht hatte. Wie oft hatte er einen Ausflug oder eine Unternehmung sausen lassen, die Sam geplant hatte, weil ihm die Zeit zwischen den Fingern zerronnen war und er es viel aufregender fand, die Einwirkung eines Hemmstoffs auf die T-Zellen zu verfolgen. Im Grunde genommen spielte es wohl überhaupt keine Rolle, wie hoch sein IQ war. Er fühlte sich nun mal in Gegenwart anderer Menschen unbehaglich, und so würde es wahrscheinlich auch immer bleiben, weil er sich nicht genügend für seine Mitmenschen interessierte.
Es war jedes Mal wieder eine große Umstellung für ihn, drei Monate im Jahr bei Sam zu wohnen. Ida Chapman hatte ihrem Sohn Sam und ihrem Neffen Tyson ihr Haus hinterlassen, als sie vor fünf Jahren gestorben war. Ty freute sich immer darauf, Sam zu besuchen, doch der erste Monat gestaltete sich regelmäßig schwierig. Ty war es gewohnt, allein zu sein und mit keinem Menschen zu reden, und Sam unterhielt sich gern. »Ich drücke mich doch gar nicht vor unseren Ausflügen«, sagte Ty. Die Falten in seiner Stirn wurden tiefer, als Sam nichts dazu sagte. »Oder doch?« Er rieb sich den Nasensteg. Wahrscheinlich hatte er sich schon davor gedrückt, und zwar nicht nur einmal. Und Sam ein weiteres Mal enttäuscht.
Sam zuckte die Achseln. »Das spielt keine Rolle, Ty. Ich mache dir nur das Leben schwer. Du bist Biochemiker. Die spinnen alle.«
»Und Hubschrauberbesatzungen spinnen nicht?«
Schallendes Gelächter brach aus. Sam hob die Hände, um zu kapitulieren. »Schon gut, du hast mich erwischt.«
»Ich möchte mehr über Tys Heilige hören. Ist sie blond und gut gebaut?«, fragte Rory Smith. Er rieb sich die Hände. »Da wird es doch erst wirklich interessant.«
»Das ist deine Vorstellung von der idealen Frau, Rory«, sagte Doug Higgens und boxte den Arm des Feuerwehrmannes. »Und eine Heilige willst du schon mal ganz bestimmt nicht. Wie sieht sie aus, Ty? Hast du sie schon gefunden?«
Sam presste die Lippen zusammen. »Er glaubt, sie gefunden zu haben.«
Ein Bild zog vor Tys innerem Auge vorüber, bevor er es unterdrücken konnte. Ihr Gesicht. Blass. Tiefschwarzes Haar. Große grüne Augen. Ein Mund, für den es sich zu morden lohnte. Ty schüttelte den Kopf. »Sie muss intelligent sein. Ich halte es nicht länger als ein paar Minuten mit jemandem aus, der ein Idiot ist.« Und genau das war das Problem und würde es auch immer sein. Er wollte über die Dinge reden, für die er sich begeisterte. Er wollte seine Probleme bei der Arbeit mit jemandem besprechen. Nicht einmal Sam hatte den leisesten Schimmer, wovon er überhaupt redete, und Sam ließ sich wirklich viel von ihm gefallen. Die Augen der meisten Frauen wurden einfach nur noch glasig, wenn er zu sprechen begann. Und wenn eine Frau anfing, über Haare und Nägel und Make-up zu reden, war bei ihm der Ofen aus.
»Meine Güte, Ty. Was zum Teufel ist los mit dir? Bei dir stimmt doch etwas nicht. Wen interessiert es schon, ob Frauen Verstand haben? Du tust anscheinend die falschen Dinge mit ihnen«, sagte Rory. »Gib den Versuch auf, mit ihnen zu reden, und komm zur Sache. Du brauchst Hilfe, Mann.«
Wieder brach schallendes Gelächter aus.
Drei Töne zerrissen die Luft, und die Männer verstummten augenblicklich. Die drei Töne erklangen noch einmal, und sie sprangen auf. Das Funkgerät knisterte, und die Einsatzzentrale meldete einen verunglückten Kletterer auf den Klippen der Seelöwenbucht südlich von Fort Bragg.
Ty und die anderen schnappten sich die Rettungsausrüstung und luden sie so schnell und so systematisch wie möglich in den Huey.
»Ben, du fährst zuerst zur Einsatzzentrale in Fort Bragg, aber ich will dich möglichst nah am Unfallort haben«, sagte Brannigan, der Pilot, zum Feuerwehrmann. Ben würde das Versorgungsfahrzeug fahren, das den Treibstoff für den Hubschrauber und zusätzliche Rettungskörbe beförderte, in die sie die Verunglückten packten – und alles andere, was im Notfall erforderlich sein könnte. Er würde den sperrigen Wagen über die bergige Strecke fahren müssen, um nach Fort Bragg zu gelangen, und das würde ihn mindestens eine Stunde kosten, wenn nicht mehr. Der Hubschrauber würde in vierzehn Minuten dort sein.
Ben nickte und rannte zu seinem Fahrzeug. Der Hubschrauber brauchte viel Sprit, und sie brachen nie ohne das Versorgungsfahrzeug auf.
Das Adrenalin strömte auf vertraute Weise durch seinen Körper und gab Ty das Gefühl, wieder am Leben zu sein. Genau das brauchte er – das Abenteuer und sogar die Kameradschaft der Feuerwehrleute. Er nahm gemeinsam mit den anderen vier Feuerwehrmännern seinen Platz hinten im Hubschrauber ein, während der Mannschaftskapitän und der Pilot vorn Platz nahmen. Sein Helm war mit einem Funkgerät ausgestattet, und die gewohnte Checkliste wirkte auf alle beruhigend.
»Intercom-Check«, sagte Brannigan in sein Mikrofon.
Der Mannschaftskapitän antwortete, gefolgt von allen Mitgliedern der Mannschaft.
»ICS-Check«, kündigte Brannigan an.
Hinten überprüfte Ty gemeinsam mit den anderen seine Intercom-Box, und sie schalteten sämtliche Funkgeräte aus, um sich von jedem unnötigen Geschwätz abzuschotten. Während des Rettungseinsatzes war es unbedingt erforderlich, dass sie sich von nichts ablenken ließen.
Sean Fortune, der Mannschaftskapitän, antwortete: »ICS okay.«
»Pilot ist auf Kanal zwanzig. Alle Kanäle bis auf Kanal zwanzig unterdrückt. Alle beweglichen Gegenstände in der Kabine.«
»Gesichert«, antwortete Sean.
Ty fühlte die vertraute Anspannung in seinem Magen. Er liebte die Gefahr, und er lechzte nach Abenteuer. In wenigen Minuten würden sie sich in der Luft befinden.
»Türen.«
Sean inspizierte die Türen. »Rechte Tür offen und gesichert. Linke Tür geschlossen und verriegelt.«
»Sicherheitsgurte.«
»Angelegt«, bestätigte Sean.
»Einsatzleiter und Mannschaftskapitän Rettungsgurt überprüfen. «
Sam und Sean überprüften den Rettungsgurt sehr gründlich. »Mannschaftskapitän angeschnallt. Einsatzleiter angeschnallt. «
»Rettungswinde.«
Sam trat vor, um die Winde zu inspizieren, hob die Daumen und gab Sean sein Okay. »Geprüft.«
»PFDs«, setzte Brannigan die Checkliste fort.
Die Spannung im Hubschrauber nahm merklich zu. Sie würden über Wasser fliegen, und daher war es erforderlich, dass der Pilot und der Mannschaftskapitän Schwimmwesten und kleine Sauerstoffflaschen trugen, da der Pilot am ehesten im Hubschrauber eingeklemmt würde, falls er über dem Wasser abstürzen sollte.
»Angelegt«, lautete die Antwort.
»H.E.E.D.S. und Druck. H.E.E.D.S. des Piloten aktiviert, Druck dreitausend.«
H.E.E.D.S. war das Helicopter Emergency Evacuation Device, ein winziger Scubatank mit einem Zweistufenregler.
»H.E.E.D.S. des Mannschaftskapitäns aktiviert, Druck okay.«
Auch Sam antwortete. »H.E.E.D.S. des Einsatzleiters aktiviert, Druck okay.«
»Karabinerhaken.«