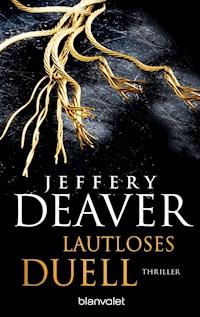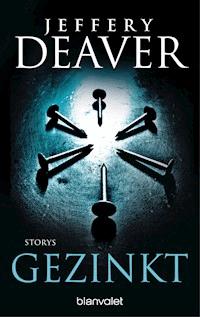
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
16 packende Stories vom Meister der intelligenten Thriller-Spannung!
Die sechzehn packenden und abgründigen Kurzgeschichten beweisen einmal mehr, mit welcher Meisterschaft Jeffery Deaver das Thriller-Genre beherrscht. Egal ob es um einen wohltätigen Millionär geht, der im Schlaf erschossen wird und dessen Frau dem Mörder angeblich nur ganz knapp entgehen konnte … oder um ein junges Mädchen, das in einem Stollen unter der Erde gefangen ist, und zu dem sich zwei Männer trotz aller Gefahren – und aus sehr unterschiedlichen Gründen – vorkämpfen … oder ob von einem Krimiautor die Rede ist, dessen gewalttätige Geschichten ganz plötzlich bittere Realität werden … In Jeffery Deavers doppelbödiger Welt voll atemberaubender Spannung und überraschender Wendungen gibt es letztlich nur zwei Gewissheiten: Nichts ist wie es scheint, und einer spielt immer mit gezinkten Karten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Ähnliche
Buch
Die sechzehn packenden und abgründigen Kurzgeschichten beweisen einmal mehr, mit welcher Meisterschaft Jeffery Deaver das Thriller-Genre beherrscht. Egal ob es um einen wohltätigen Millionär geht, der im Schlaf erschossen wird und dessen Frau dem Mörder angeblich nur ganz knapp entgehen konnte … oder um ein junges Mädchen, das in einem Stollen unter der Erde gefangen ist, und zu dem sich zwei Männer trotz aller Gefahren – und aus sehr unterschiedlichen Gründen – vorkämpfen … oder ob von einem Krimiautor die Rede ist, dessen gewalttätige Geschichten ganz plötzlich bittere Realität werden … In Jeffery Deavers doppelbödiger Welt voll atemberaubender Spannung und überraschender Wendungen gibt es letztlich nur zwei Gewissheiten: Nichts ist wie es scheint, und einer spielt immer mit gezinkten Karten …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Gezinkt
Stories
Deutsch von Fred Kinzel
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »More Twisted« bei Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
E-Book-Ausgabe 2016
Copyright der Originalausgabe © 2006 by Jeffery Deaver
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Arcangel Images/Roy Bishop
ISBN 978-3-641-19608-0V001
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Von Zeit zu Zeit tue ich etwas, das noch beängstigender ist, als kranke und verdrehte Geschichten und Romane zu schreiben: Ich schnappe mir ein Mikrofon und stelle mich in einen Raum voller Menschen.
Nein, ich spreche nicht von American Idol; es geht darum, dass ich Schreiben unterrichte.
Eine der am häufigsten gestellten Fragen, wenn ich Professor spiele, ist folgende: Soll ich damit anfangen, Kurzgeschichten zu schreiben, und mich dann zu Romanen hocharbeiten? Meine Antwort lautet: Nein. Es ist nicht so, als würde man mit Dreiradfahren beginnen und allmählich zu einem Fahrrad aufsteigen. Verzeihen Sie meinen unbeholfenen Metaphernmix, aber Romane und Kurzgeschichten sind nicht einmal wie Äpfel und Birnen; sie sind wie Äpfel und Kartoffeln.
Romane wollen den Leser auf allen Ebenen emotional gefangen nehmen, und um dieses Ziel zu erreichen, muss der Autor seine Figuren ausführlich und in die Tiefe gehend entwickeln, er muss realistische Szenarien erschaffen, umfangreiche Recherchen betreiben und ein strukturiertes Erzähltempo einschlagen, das zwischen nachdenklichen und aufregenden Passagen wechselt.
Eine Kurzgeschichte ist anders. Wie ich in der Einleitung zu meiner ersten Sammlung von Geschichten schrieb, liegt der Witz bei einer Kurzgeschichte nicht in einer Achterbahnfahrt voller überraschender Wendungen, mit Figuren, über die der Leser mit der Zeit einiges erfahren hat und die er liebt oder hasst; es geht auch nicht um spezielle Schauplätze mit sorgfältig beschriebener Atmosphäre. Kurzgeschichten sind wie die Kugeln eines Heckenschützen. Schnell und vernichtend. In solch einer Geschichte kann man aus dem Guten Böses und aus dem Bösen noch Böseres machen, und was am meisten Spaß macht: aus wirklich Gutem wirklich Böses.
Für mich ist es das überraschte »O mein Gott«, worauf es bei Kurzgeschichten ankommt. Vor ein paar Jahren schrieb ich ein Buch über einen psychotischen Zauberkünstler [»Der faule Henker«], und ich erkannte, dass das Buch in gewisser Weise von mir handelte (als Autor, wie ich rasch anfügen darf, nicht als Psychopath oder Zauberer). Bei der Recherche zu dem Buch lernte ich viel über Fingerfertigkeit, Irreführung, Ablenkung und Illusion, und mir wurde klar, dass ich mich seit Jahren genau solcher Tricks bedient hatte, um meine Leser einzulullen und sie dann – peng – aufzuschrecken, wenn sie es am wenigsten erwarten.
Während sie meine linke Hand beobachten, holt die rechte zum Schlag aus.
Seit jene erste Sammlung 2003 veröffentlicht wurde, habe ich mir weiter schuldbewusst das Vergnügen gemacht, hin und wieder ein, zwei Tage freizunehmen, um weitere Geschichten zu schreiben, die allesamt dieser oben beschriebenen Philosophie anhängen: Alle Moral und alles Gefühl über Bord zu werfen, um auf die Wendung hinzuarbeiten, die einem das Blut gerinnen lässt.
Wie in meiner ersten Sammlung finden Sie auch in dieser Geschichten der unterschiedlichsten Art, die alle meine Lieblingsthemen zum Inhalt haben: Rache, Wollust, Psychosen, Verrat und Gier, zusammen mit einer (wenn man so sagen darf) gesunden Dosis an zerrütteten Familienverhältnissen. Eine Geschichte spielt in Italien, eine andere im viktorianischen England. Eine hat einen aalglatten Anwalt in einer kleinen Stadt zum Helden, und eine andere entdeckt leichtgläubige Touristen in einer großen. Sie sehen Voyeure, ruchlose Mörder, meine Version des Da Vinci Code und sogar eine Geschichte über einen – wer hätte es gedacht – Krimiautor.
Und für alle, die gern einen Einblick in handwerkliche Kniffe gewinnen möchten, habe ich ein kurzes Nachwort zu einer der Geschichten (»Angst«) in den Band mit aufgenommen, das illustriert, wie ich die Idee der Angst in meine Geschichten einbaue. Ich habe es ans Ende gesetzt, um keine Überraschungen zu verraten.
Zu guter Letzt ein Wort des Dankes an alle, die mich ermutigt haben, diese Geschichten zu schreiben, vor allem an Janet Hutchins und ihr unschätzbares Ellery Queens Mystery Magazine, an Marty Greenburg, Otto Penzler, Deborah Schneider, David Rosenthal, Marysue Rucci und, wie immer, Madelyn Warcholik.
Also, lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie das Buch – und schauen Sie, ob Sie schlauer sind als ich. Lassen Sie meine rechte Hand nicht aus dem Auge.
Oder war es die linke?
Kapitel und Vers
»Reverend … Darf ich Sie ›Reverend‹ nennen?«
Der rundliche Mann mittleren Alters mit dem Priesterkragen lächelte. »Das geht schon in Ordnung.«
»Ich bin Detective Mike Silverman vom Büro des Bezirkssheriffs.«
Reverend Stanley Lansing nickte und betrachtete prüfend den Ausweis und die Dienstmarke, die ihm der fahrige, dünne Detective mit dem schwarz-grau gesprenkelten Haar entgegenstreckte.
»Ist etwas passiert?«
»Nichts, was Sie betrifft, Sir. Nicht direkt, meine ich. Ich habe mir nur gedacht, Sie könnten uns vielleicht bei einem kleinen Problem helfen.«
»Ein Problem, soso. Na, dann kommen Sie doch bitte herein, Officer.«
Die Männer gingen in das Büro, das sich an die First Presbyterian Church of Bedford anschloss, ein malerisches weißes Gotteshaus, an dem Silverman auf dem Weg zur Arbeit und zurück schon Tausende Male vorbeigekommen war, ohne je einen Gedanken daran zu verschwenden.
Bis zu dem Mord von heute Morgen.
In Reverend Lansings Büro war es muffig, und ein Staubschleier bedeckte die meisten Möbel. Er wirkte verlegen. »Ich muss mich entschuldigen. Meine Frau und ich waren letzte Woche in Urlaub. Sie ist immer noch droben am See. Ich bin zurückgekommen, um meine Predigt zu schreiben – und sie natürlich meinen Schäfchen am Sonntag zu halten.« Er lachte sarkastisch. »Falls sich überhaupt jemand in der Kirche einfindet. Merkwürdig, wie die Religiosität um Weihnachten herum immer ansteigt und zur Urlaubszeit einen Tiefpunkt erreicht.« Der Geistliche sah sich stirnrunzelnd in seinem Büro um. »Ich fürchte, ich kann Ihnen gar nichts anbieten. Die Sekretärin hat ebenfalls frei. Obwohl Sie, unter uns gesagt, nichts versäumen, wenn Sie ihren Kaffee nicht kosten.«
»Danke, ich brauche nichts«, sagte Silverman.
»Und was kann ich nun für Sie tun, Officer?«
»Ich halte Sie nicht lange auf. Ich benötige religiösen Sachverstand bei einem Fall, den wir gerade bearbeiten. Ich wäre ja zum Rabbi meines Vaters gegangen, aber meine Frage hat mit dem Neuen Testament zu tun, und das ist mehr Ihr Gebiet als unseres, nicht wahr?«
»Nun ja«, sagte der freundliche, grauhaarige Reverend, wischte sich die Brille am Revers seiner Jacke ab und setzte sie wieder auf. »Ich bin nur ein Kleinstadtpastor und wohl kaum ein Experte. Aber wahrscheinlich dürfte ich mich mit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes besser auskennen als der Durchschnittsrabbi. Sagen Sie mir, wie ich helfen kann.«
»Sie haben bestimmt schon vom Zeugenschutzprogramm gehört, oder?«
»So wie in Goodfellas? Die Sopranos?«
»Mehr oder weniger, ja. Das Bundesprogramm wird von den US-Marshals geleitet, aber wir haben im Bundesstaat unser eigenes Zeugenschutzsystem.«
»Tatsächlich? Das wusste ich nicht. Aber es ist sicherlich vernünftig.«
»Ich bin hier im Bezirk für das Programm zuständig, und eine der Personen, die wir beschützen, soll demnächst bei einem Prozess in Hamilton als Zeuge erscheinen. Unsere Aufgabe ist es, ihn sicher durch das Verfahren zu bringen, und nachdem wir – hoffentlich – eine Verurteilung erwirkt haben, besorgen wir ihm eine neue Identität und schaffen ihn aus dem Staat.«
»Ein Mafiaprozess?«
»Etwas in der Art.«
Silverman durfte nicht genauer auf die Einzelheiten des Falles eingehen – dass der Zeuge Randall Pease, ein Schläger des Drogendealers Tommy Doyle, gesehen hatte, wie sein Boss einem Rivalen eine Kugel in den Kopf schoss. Obwohl Doyle dafür bekannt war, dass er rücksichtslos jeden umbrachte, der eine Bedrohung für ihn darstellte, hatte sich der wegen Körperverletzung, Drogen- und Waffenvergehen angeklagte Pease bereiterklärt, im Gegenzug für Strafmilderung gegen ihn auszusagen. Der Staatsanwalt hatte Pease aus Sicherheitsgründen in Silvermans Zuständigkeitsbereich verlegt, hundert Meilen von Hamilton entfernt. Es gab Gerüchte, dass Doyle alles tun und jeden Preis bezahlen würde, um seinen ehemaligen Handlanger zu töten, da Peases Aussage ihm die Todesstrafe oder eine lebenslängliche Haft einbringen konnte. Silverman hatte den Zeugen in einem sicheren Haus nicht weit vom Büro des Sheriffs untergebracht und ließ ihn rund um die Uhr bewachen. Der Detective schilderte dem Reverend in groben Zügen, was passiert war, ohne Namen zu nennen, und sagte dann: »Aber es gab einen Rückschlag. Wir hatten einen V-Mann, einen vertraulichen Informanten …«
»Das ist ein Verräter, richtig?«
Silverman lachte.
»Das habe ich aus Law and Order. Ich schau es mir an, sooft ich dazu komme. CSI ebenfalls. Ich liebe Krimis.«
»Jedenfalls hatte der Informant handfeste Informationen darüber, dass ein Profikiller angeheuert wurde, um unseren Zeugen vor dem Prozess nächste Woche zu töten.«
»Du meine Güte.« Der Reverend runzelte die Stirn und rieb sich den Hals unter dem steifen, weißen Priesterkragen, der zu scheuern schien.
»Aber die Verbrecher enttarnten unseren Verbindungsmann und ließen ihn umbringen, ehe er uns Einzelheiten über die Identität des Killers und darüber, wie er meinen Zeugen zu töten beabsichtigte, verraten konnte.«
»Ach, das tut mir sehr leid«, sagte der Reverend teilnahmsvoll. »Ich werde für den Mann beten.«
Silverman brummte einen blutleeren Dank, aber in Wirklichkeit dachte er, dass der miese kleine Schnüffler verdientermaßen zur Hölle fuhr – nicht nur, weil er ein hoffnungsloser Versager und Süchtiger war, sondern auch dafür, dass er gestorben war, ehe er dem Detective Einzelheiten über den möglichen Anschlag auf Pease nennen konnte. Detective Mike Silverman teilte dem Priester nicht mit, dass er in letzter Zeit selbst Ärger in seinem Job hatte und nach »Sibirien« – zur Zeugenbewachung – verbannt worden war, weil er seit geraumer Zeit keinen größeren Fall mehr zum Abschluss gebracht hatte. Dieser Auftrag musste reibungslos über die Bühne gehen, und er konnte es sich auf keinen Fall leisten, dass Pease getötet würde.
»Hier kommen Sie ins Spiel, wie ich hoffe«, fuhr der Detective fort. »Als der Informant erstochen wurde, starb er nicht sofort. Es gelang ihm noch, eine Nachricht zu schreiben – über eine Bibelpassage. Wir halten es für einen Hinweis darauf, wie der Auftragsmörder unseren Zeugen zu töten beabsichtigt. Aber es ist wie ein Rätsel, wir können es nicht lösen.«
Das Interesse des Reverend schien geweckt. »Etwas aus dem Neuen Testament, sagten Sie?«
»Ja«, antwortete Silverman. Er öffnete sein Notizbuch. »Die Nachricht lautete: ›Er ist auf dem Weg. Passt auf.‹ Dann schrieb er einen Vers und ein Kapitel aus der Bibel hin. Wir glauben, dass er noch mehr schreiben wollte, aber es nicht mehr konnte. Er war Katholik, wir nehmen also an, dass er sich ganz gut in der Bibel auskannte – und um eine Besonderheit dieser Stelle wusste, die uns verraten sollte, auf welche Weise der Killer sich an unseren Zeugen heranmachen würde.«
Der Reverend drehte sich um und hielt nach einer Bibel auf seinem Regal Ausschau. Schließlich entdeckte er eine und schlug sie auf. »Welcher Vers?«
»Lukas zwölf, fünfzehn.«
Der Geistliche fand die Stelle und las. »›Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er Güter im Überfluss hat.‹«
»Mein Partner hat eine Bibel von zu Hause mitgebracht. Er ist Christ, aber er ist nicht wirklich religiös, keiner, der mit der Bibel unterm Arm herumläuft … äh, ’tschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen.«
»Das haben Sie nicht. Wir sind Presbyterianer, bei uns klemmt sie auch nicht unter dem Arm.«
Silverman lächelte. »Mein Partner hatte keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Mir fiel Ihre Kirche ein, sie ist die nächstgelegene vom Revier, und ich dachte, ich schau mal vorbei und frage, ob Sie uns helfen können. Sehen Sie irgendetwas in dieser Stelle, aus dem sich schließen ließe, wie der Angeklagte unseren Zeugen vielleicht töten lassen will?«
Der Reverend las noch ein wenig in den hauchdünnen Seiten. »Es ist ein Abschnitt aus den Evangelien, in denen verschiedene Jünger die Geschichte Jesu erzählen. Im zwölften Kapitel des Lukasevangeliums warnt Jesus die Menschen vor den Pharisäern und drängt sie, nicht sündig zu leben.«
»Wer genau waren die Pharisäer?«
»Sie waren eine religiöse Sekte. Im Wesentlichen glaubten sie, dass Gott existiert, um ihnen zu dienen, nicht andersherum. Sie hielten sich für besser als alle anderen und erhoben sich über die Menschen. So hieß es zu ihrer Zeit jedenfalls – man weiß natürlich nie, ob es stimmt. Damals wurde schon genauso viel politisch verdreht wie heute.« Reverend Lansing wollte die Schreibtischlampe einschalten, aber sie funktionierte nicht. Er fummelte an den Vorhängen herum, öffnete sie schließlich und ließ mehr Licht in das düstere Büro. Er las die Passage noch einige Male, kniff vor Konzentration die Augen zusammen, nickte. Silverman schaute sich in dem trüben Raum um. Bücher hauptsächlich. Es sah mehr nach dem Arbeitszimmer eines Professors als nach einem Kirchenbüro aus. Keine Bilder oder persönlichen Gegenstände. Man sollte meinen, dass selbst ein Geistlicher Bilder von Angehörigen auf dem Schreibtisch oder an den Wänden hatte.
Schließlich blickte der Mann auf. »Bis jetzt springt mir eigentlich nichts ins Auge.« Er wirkte frustriert.
Silverman ging es genauso. Seit der V-Mann am Morgen erstochen aufgefunden worden war, hatte sich der Detective mit den Worten des Evangeliums nach Lukas abgemüht und versucht, ihre Bedeutung zu entschlüsseln.
Seht zu …
»Aber ich muss sagen, die Vorstellung fasziniert mich«, fuhr der Reverend fort. »Es ist genau wie in Der Da Vinci Code. Haben Sie es gelesen?«
»Nein.«
»Sehr unterhaltsam. Es geht die ganze Zeit um Geheimcodes und verborgene Botschaften. Wenn Sie einverstanden sind, Detective, würde ich gern noch ein wenig nachforschen und mich weiter mit der Sache befassen. Ich liebe Rätsel.«
»Das würde ich sehr begrüßen, Reverend.«
»Ich werde tun, was ich kann. Sie lassen diesen Mann gut bewachen, nehme ich an?«
»Oh ja, darauf können Sie wetten. Aber es wird riskant, ihn zum Gericht zu bringen. Wir müssen herausfinden, wie sich der Killer an ihn heranmachen will.«
»Und je früher, desto besser, nehme ich an.«
»Richtig.«
»Ich mache mich sofort daran.«
Dankbar für die Hilfsbereitschaft des Mannes, aber auch entmutigt, weil er keine schnellen Antworten parat gehabt hatte, ging Silverman zurück durch die stille, verlassene Kirche. Er stieg in seinen Wagen und fuhr zu dem sicheren Haus, um bei Randall Pease nach dem Rechten zu sehen. Der Zeuge war ekelhaft wie immer und beschwerte sich pausenlos, aber der Beamte, der auf ihn aufpasste, berichtete, er habe keinerlei Anzeichen von Gefahr im Umkreis des sicheren Hauses bemerkt. Der Detective fuhr ins Revier zurück.
Im Büro tätigte Silverman ein paar Anrufe, um zu hören, ob einer seiner anderen Informanten etwas von einem angeheuerten Killer gehört hatte; es war nicht der Fall. Sein Blick kehrte immer wieder zu der Bibelpassage zurück, die vor seinem Schreibtisch an der Wand befestigt war.
»Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er Güter im Überfluss hat.«
Eine Stimme schreckte ihn auf. »Wie sieht’s mit Mittagessen aus?«
Er blickte auf und sah seinen Partner Steve Noveski im Eingang stehen. Der junge Detective mit dem angenehmen, runden Babygesicht schaute demonstrativ auf die Uhr.
Silverman, der noch immer in seine Bibelpassage versunken war, starrte ihn nur an.
»Mittagessen, Kumpel«, wiederholte Noveski. »Ich bin am Verhungern.«
»Nö, ich muss erst aus der Sache hier schlau werden.« Er klopfte auf die Bibel. »Ich bin irgendwie davon besessen.«
»Wie, du denkst nach?«, sagte der andere Detective und packte so viel Sarkasmus in seine Stimme, wie nur darin Platz hatte.
Während des Abendessens zu Hause mit seiner Familie war Silverman die ganze Zeit geistesabwesend. Sein verwitweter Vater aß mit ihnen, und der alte Herr war nicht erfreut darüber, dass sein Sohn so zerstreut war.
»Und was liest du da so Wichtiges? Das Neue Testament?« Er zeigte mit einem Kopfnicken zu der Bibel, über der er seinen Sohn vor dem Essen hatte brüten sehen. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich an seine Schwiegertochter. »Der Junge war seit Jahren nicht im Tempel und würde die Thora, die ihm seine Mutter und ich geschenkt haben, nicht finden, wenn sein Leben davon abhinge. Und jetzt schau sich einer das an, er liest über Jesus Christus. Was für ein Sohn.«
»Ich brauche es für einen Fall, Vater«, sagte Silverman. »Ich muss noch arbeiten. Wir sehen uns später. Tut mir leid.«
»Sehen uns später, tut mir leid«, murmelte der Alte. »Hast du nicht mehr Respekt …«
Silverman schloss die Tür zu seinem Arbeitszimmer, setzte sich an den Schreibtisch und hörte seinen Anrufbeantworter ab. Der forensische Wissenschaftler, der die Nachricht des ermordeten Informanten mit der Bibelpassage untersucht hatte, berichtete, auf dem Zettel seien keine erkennbaren Hinweise zu finden, und weder Papier noch Tinte könnten zurückverfolgt werden. Ein Handschriftenvergleich ließ vermuten, dass das Opfer die Nachricht geschrieben habe, aber er sei sich nicht hundertprozentig sicher.
Und während die Zeit verrann, hatte Reverend Lansing noch nichts von sich hören lassen. Silverman seufzte, streckte sich und betrachtete erneut die Bibelworte.
»Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er Güter im Überfluss hat.«
Er wurde zornig. Ein Mensch war gestorben und hatte ihnen diese Worte hinterlassen, um sie zu warnen. Was versuchte er zu sagen?
Silverman nahm vage wahr, dass sich sein Vater verabschiedete, und noch vager, dass ihm seine Frau später gute Nacht sagte. Die Tür des Arbeitszimmers schloss sich abrupt hinter ihr. Sie war wütend. Aber das kümmerte Michael Silverman nicht. Im Augenblick zählte nichts anderes, als die Bedeutung dieser Botschaft zu entdecken.
Etwas, das der Reverend am Nachmittag gesagt hatte, kam ihm in den Sinn. Der Da Vinci Code. Ein Code … Silverman dachte an den Informanten. Der Mann war kein Akademiker gewesen, aber schlau auf seine Weise. Vielleicht hatte er mehr im Sinn gehabt als die wörtliche Bedeutung der Passage; konnte es sein, dass die genaueren Angaben seiner Warnung irgendwie chiffriert in den Buchstaben selbst steckten?
Es war schon bald vier Uhr morgens, aber Silverman ignorierte seine Erschöpfung und ging online. Er fand eine Website über Wortspiele und Rätsel. In einem Spiel bildete man so viele Wörter wie möglich aus den ersten Buchstaben eines Sprichworts oder Zitats. Okay, das konnte es sein, dachte Silverman aufgeregt. Er notierte die ersten Buchstaben aller Wörter aus Lukas 12:15 und begann sie neu zu ordnen.
Er erhielt Dutzende von Wörtern: Radar, Dübel, Rübe, aber er entdeckte keine klare Bedeutung in den einzelnen Begriffen und in keiner Kombination von ihnen.
Welche anderen Codes konnte er noch versuchen?
Er probierte es mit einem naheliegenden und ordnete den Buchstaben Nummern zu: A für 1, B für 2 und so weiter. Aber am Ende hatte er nur eine Unmenge von zufälligen Zahlen. Hoffnungslos, dachte er. Als versuchte man ein Computerpasswort zu erraten.
Dann fielen ihm Anagramme ein, wo man die Buchstaben eines Wortes oder Satzes neu ordnet, um neue Wörter zu bilden. Nach kurzer Suche im Web fand er eine Seite mit einem Anagramm-Generator, einem Programm, das einen ein Wort eintippen ließ und ein paar Sekunden später alle Anagramme ausspuckte, die sich daraus bilden ließen.
Stundenlang tippte er jedes Wort und Kombinationen von Worten aus der Bibelpassage ein und studierte die Ergebnisse. Um sechs Uhr morgens wollte Silverman zu Tode erschöpft schon aufgeben und ins Bett sinken. Aber als er die ausgedruckten Seiten mit den Anagrammen ordnete, fiel sein Blick zufällig auf die Anagramme, die das Wort Habgier ergab: Gib, bar, Bahre …
Bahre? Moment mal, dachte er.
Er nahm sich das Wort Überfluss vor: Fusel, übel …
Fusel, übel, Bahre …?
Ha, dachte er triumphierend. Ich hab’s!
Detective Mike Silverman feierte seinen Erfolg, indem er am Schreibtisch einschlief.
Eine Stunde später wachte er auf und ärgerte sich über die laute Maschine, die in der Nähe ratterte – bis er begriff, dass das Geräusch sein eigenes Schnarchen war.
Der Detective machte den ausgetrockneten Mund zu, zuckte zusammen, weil ihn der Rücken schmerzte, und setzte sich auf. Dann massierte er sich den steifen Hals und taumelte nach oben ins Schlafzimmer, wo ihn das Sonnenlicht blendete, das durch die Balkontür fiel.
»Bist du schon auf?«, fragte seine Frau benommen aus dem Bett, als sie ihn in Hemd und Hose im Schlafzimmer stehen sah. »Es ist noch früh.«
»Schlaf weiter«, sagte er.
Nachdem er rasch geduscht hatte, zog er sich an und raste ins Büro. Um acht Uhr stand er mit seinem Partner Steve Noveski im Büro ihres Captains.
»Ich hab’s«, sagte er.
»Was?«, fragte sein Vorgesetzter, ein Mann mit Hängebacken und schütterem Haar.
Noveski sah seinen Partner ebenfalls fragend an. Er war gerade eingetroffen und hatte Silvermans Theorie noch nicht gehört.
»Die Nachricht, die wir von dem toten Informanten bekommen haben – wie Doyle Pease zu töten gedenkt.«
Der Captain hatte von der Bibelpassage gehört, sich aber noch nicht groß damit befasst. »Und wie?«, fragte er skeptisch.
»Medizinischer Notfall«, verkündete Silverman.
»Hä?«
»Ich glaube, er wird über einen Arzt versuchen, an Pease heranzukommen.«
»Erzählen Sie.«
Silverman erklärte ihm die Sache mit den Anagrammen.
»Wie Kreuzworträtsel?«
»In gewisser Weise.«
Noveski sagte nichts, aber auch er schien der Idee skeptisch gegenüberzustehen.
Der Captain legte sein langes Gesicht in Falten. »Jetzt mal langsam. Sie wollen also sagen, da liegt unser Informant, man hat ihm die Halsschlagader durchgeschnitten, und er verfasst Wortspiele?«
»Das Gehirn arbeitet oft komisch, es sieht und reimt sich die merkwürdigsten Sachen zusammen.«
»Komisch«, murmelte der Vorgesetzte. »Klingt alles ein bisschen, wie sagt man, konstruiert, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Er musste uns die Nachricht zukommen lassen, aber Doyle durfte nicht ahnen, dass er uns alarmiert hat. Er musste so subtil vorgehen, dass Doyles Jungs nicht merkten, was er wusste, aber nicht so subtil, dass wir es nicht erraten konnten.«
»Ich weiß nicht.«
Silverman schüttelte den Kopf. »Ich glaube, es kommt hin.« Er erklärte, Doyle habe schon oft enorm hohe Honorare an brillante, skrupellose Killer bezahlt, die in der Maske einer anderen Person auftraten, um an ihre ahnungslosen Opfer heranzukommen. Silverman spekulierte, dass sich der Killer einen Arztkittel und einen falschen Ausweis besorgen würde, dazu ein Stethoskop oder was Ärzte heutzutage so mit sich herumtrugen. Dann würden ein paar von Doyles Handlangern einen halbherzigen Anschlag auf das Leben von Pease unternehmen; sie konnten ihm in dem sicheren Haus nicht so nahe kommen, um ihn tatsächlich zu töten, aber einen medizinischen Notfall verursachen – das war immerhin möglich. »Vielleicht eine Art Vergiftung.« Er erklärte die Anagramme mit Fusel und übel. »Oder vielleicht sorgen sie auch für einen Brand oder ausströmendes Gas, oder was immer. Der als Mediziner verkleidete Auftragskiller würde dann ins Haus gelassen und Pease dort töten. Oder das Opfer wird rasch ins Krankenhaus geschafft, und der Mann erledigt ihn in der Notaufnahme.«
Der Captain zuckte die Achseln. »Sie können es ja überprüfen – vorausgesetzt, Sie vernachlässigen Ihre eigentliche Arbeit nicht darüber. Wir können es uns nicht leisten, die Sache zu vermasseln. Wenn wir Pease verlieren, kostet es uns den Arsch.«
Die Pronomen in diesen Sätzen mochten erste Person Plural gewesen sein, aber was Silverman hörte, war ein eindeutiges »Sie« und »Ihren«.
»Einverstanden.«
Auf dem Rückweg in sein Büro fragte Silverman seinen Partner: »Wen haben wir für das sichere Haus als medizinische Bereitschaft?«
»Ich weiß nicht, ein Team vom Forest Hills Hospital vermutlich.«
»Was, wir wissen es nicht?«, brauste Silverman auf.
»Ich weiß es nicht, nein.«
»Dann find es heraus! Danach rufst du im sicheren Haus an und sagst dem Babysitter, falls Pease irgendwie krank wird, eine Medizin braucht oder auch nur ein gottverdammtes Pflaster, sollen Sie mir sofort Bescheid geben. Sie dürfen absolut kein medizinisches Personal zu ihm lassen, bevor es eindeutig identifiziert ist und ich persönlich mein Okay gegeben habe.«
»In Ordnung.«
»Dann rufst du den Direktor in Forest Hills an und bittest ihn, es mich unverzüglich wissen zu lassen, falls irgendwelche Ärzte, Sanitäter oder Schwestern nicht zur Arbeit erscheinen oder sich krank melden, oder wenn sich irgendein Arzt herumtreibt, den er nicht kennt.«
Der junge Mann verschwand in seinem Büro, um zu tun, was ihm Silverman befohlen hatte, und der Detective kehrte an seinen eigenen Schreibtisch zurück. Er rief einen Kollegen im Sheriffbüro von Hamilton an, erzählte ihm, was er vermutete, und fügte hinzu, sie müssten auf alle Leute aus dem medizinischen Bereich aufpassen, die Pease nahe kämen.
Dann lehnte sich der Detective zurück, rieb sich die Augen und massierte seinen Nacken. Er war mehr und mehr davon überzeugt, Recht zu haben mit seiner Vermutung, dass die geheime Botschaft auf einen Killer in der Maske eines Mitarbeiters des Gesundheitswesens deutete. Er griff erneut zum Telefon. Mehrere Stunden lang drängte er Krankenhäuser und Ambulanzen im County dazu, sich zu vergewissern, wo alle ihre Leute und Fahrzeuge steckten.
Als es auf die Mittagszeit zuging, läutete sein Telefon.
»Ja?«
»Silverman.« Die Stimme des Captains riss ihn aus seiner durch Schlafmangel bedingten Benommenheit; er war sofort hellwach. »Es hat gerade einen Anschlag auf Pease gegeben.«
Silvermans Herz hämmerte. Er beugte sich vor. »Geht es ihm gut?«
»Ja. Jemand hat aus einem SUV heraus dreißig, vierzig Schüsse auf die Vorderfront des sicheren Hauses abgefeuert. Stahlmantelgeschosse, die durch das Panzerglas drangen. Pease und sein Bewacher bekamen ein paar Splitter ab, aber nichts Ernstes. Normalerweise würden wir sie ins Krankenhaus schicken, aber ich musste daran denken, was Sie darüber gesagt haben, dass der Killer ein Arzt oder so was sein könnte, deshalb hielt ich es für besser, Pease direkt hierher zu bringen, in die Arrestzelle. Ich lasse die beiden von unseren Medizinmännern durchchecken.«
»Gut.«
»Wir behalten sie ein, zwei Tage hier, dann schicken wir sie hinauf in das Camp von Ronanka Falls.«
»Und lassen Sie jemanden zur Notaufnahme von Forest Hills hinüberfahren und die Ärzte überprüfen. Doyles Auftragskiller rechnet vielleicht damit, dass wir ihn dorthin schicken, und wartet.«
»Habe ich bereits veranlasst«, sagte der Captain.
»Wann wird Pease hier sein?«
»Er müsste jeden Moment kommen.«
»Ich lasse die Arrestzelle frei räumen.« Er legte auf und rieb sich wieder die Augen. Wie zum Teufel hatte Doyle herausgefunden, wo das sichere Haus war? Es war das bestgehütete Geheimnis der ganzen Dienststelle. Doch da bei dem Angriff niemand ernsthaft verletzt worden war, klopfte er sich im Geiste ein weiteres Mal selbst auf die Schulter. Seine Theorie wurde bestätigt. Der Schütze hatte Pease gar nicht zu töten versucht, sondern wollte ihn nur aufscheuchen und dazu bringen, dass er das Krankenhaus aufsuchte – wo er direkt Doyles Killer in die Arme laufen würde.
Er rief den Leiter des Untersuchungsgefängnisses an und veranlasste, dass die derzeitigen Insassen der Arrestzelle vorübergehend in das städtische Polizeirevier verlegt wurden, dann bat er den Mann, die Wachen zu unterrichten und ihnen einzuschärfen, nur einen Arzt, den sie kannten, zu Pease und seinem Leibwächter zu lassen.
»Schon erledigt. Wegen dem, was der Captain gesagt hat.«
Silverman wollte eben auflegen, als sein Blick auf die Uhr fiel. Es war Mittag, Schichtbeginn der zweiten Wache. »Haben Sie dem Personal der Nachmittagsschicht die Lage erklärt?«
»Oh, hab ich vergessen. Ich mach es sofort.«
Silverman legte verärgert auf. Musste er denn an alles selbst denken?
Er war auf dem Weg zur Tür und wollte zum Aufnahmebereich des Zellenblocks, um Pease und seinen Bewacher zu treffen, als sein Telefon erneut läutete. Der Sergeant vom Empfang sagte, er habe einen Besucher. »Ein gewisser Reverend Lansing. Er sagt, er müsse Sie unbedingt sehen. Ich soll Ihnen ausrichten, er hat die Nachricht entschlüsselt. Sie wüssten schon, was er meint.«
»Ich bin sofort bei Ihnen.«
Silverman verzog das Gesicht. Sobald der Detective heute Morgen hinter die Bedeutung der Bibelpassage gekommen war, hatte er vorgehabt, den Geistlichen anzurufen und ihm zu sagen, dass seine Hilfe nicht mehr benötigt würde. Aber er hatte es völlig vergessen. Verdammt … Na ja, er würde dem Mann eben irgendeine Freude machen – vielleicht Geld für die Kirche spenden oder ihn zum Lunch einladen, um ihm zu danken. Ja, Lunch wäre gut. Sie könnten sich über Fernsehkrimis unterhalten.
Der Detective begrüßte Lansing am Empfangstisch und zuckte leicht zusammen, als er sah, wie erschöpft der Mann aussah. »Haben Sie letzte Nacht überhaupt geschlafen?«
Der Geistliche lachte. »Nein. Genauso wenig wie Sie anscheinend.«
»Kommen Sie mit mir, Reverend. Erzählen Sie mir, was Ihnen eingefallen ist.« Er führte ihn den Flur entlang in Richtung Aufnahme. Er würde sich einfach anhören, was der Mann zu sagen hatte. Das konnte nicht schaden.
»Ich glaube, ich habe die Antwort.«
»Erzählen Sie.«
»Nun ja, ich dachte mir, dass wir uns nicht auf Vers fünfzehn allein beschränken sollten. Dieser ist nur eine Art Einleitung zu dem Gleichnis, das folgt. Ich glaube, das ist die Antwort.«
Silverman nickte und rief sich in Erinnerung, was er in Noveskis Bibel gelesen hatte. »Das Gleichnis von dem Bauern?«
»Genau. Jesus erzählt von einem reichen Bauern, der eine gute Ernte hat. Er weiß nicht, was er mit dem überschüssigen Getreide tun soll. Er überlegt sich, dass er größere Scheunen bauen und für den Rest seines Lebens genießen wird, was er sich geschaffen hat. Was aber passiert, ist, dass Gott ihn straft, weil er gierig ist. Er ist materiell reich, aber geistig verarmt.«
»Okay«, sagte Silverman, der noch keine Botschaft erkennen konnte.
Der Reverend spürte die Verwirrung des Polizisten. »Der entscheidende Punkt in der Geschichte ist Gier. Und ich glaube, das könnte der Schlüssel zu dem sein, was dieser arme Mann Ihnen mitteilen wollte.«
Sie erreichten die Aufnahmerampe und schlossen sich einem bewaffneten Wärter an, der auf die Ankunft des gepanzerten Wagens mit Pease wartete. Wie Silverman erfuhr, waren die aktuellen Gefangenen noch nicht alle in dem Transportbus, der sie ins Stadtgefängnis bringen sollte.
»Sie sollen sich beeilen«, befahl er und wandte sich wieder dem Geistlichen zu, der mit seinen Erklärungen fortfuhr.
»Ich habe mich also gefragt, wie Gier heutzutage aussieht. Und kam zu der Antwort, dass sie uns in Gestalt von Enron und Tyco, von Vorstandschefs und Internet-Mogulen begegnet … Und von Cahill Industries.«
Silverman nickte langsam.
Robert Cahill war der Kopf eines riesigen Agrarwirtschaftskomplexes gewesen. Nachdem er diese Firma verkauft hatte, hatte er sich dem Immobiliengewerbe zugewandt und Dutzende von Gebäuden im Bezirk errichtet. Soeben war der Mann wegen Steuerhinterziehung und Insiderhandels angeklagt worden.
»Erfolgreicher Farmer«, überlegte Silverman. »Erzielt enorme Gewinne und gerät in Schwierigkeiten. Klar. Genau wie in dem Gleichnis.«
»Es kommt noch besser«, sagte der Priester aufgeregt. »Vor ein paar Wochen stand in der Zeitung ein Leitartikel über Cahill – ich habe danach gesucht, ihn aber nicht gefunden. Ich glaube, der Verfasser hat ein paar Bibelstellen über Gier zitiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche, aber ich wette, Lukas 12:15 war dabei.«
Von der Rampe der Aufnahme aus beobachtete Silverman, wie der Wagen mit Randy Pease eintraf. Der Detective und der Wärter hielten sorgfältig nach Anzeichen für Gefahr Ausschau, während das gepanzerte Fahrzeug rückwärts rangierte. Alles schien in Ordnung zu sein. Der Detective klopfte an die Hecktür, und der Zeuge und sein Leibwächter eilten auf die Laderampe. Der Wagen fuhr fort.
Pease fing sofort an, sich zu beschweren. Er hatte bei dem Angriff auf das sichere Haus eine kleine Schnittwunde auf der Stirn und eine Prellung an der Wange davongetragen, aber er stöhnte, als wäre er eine zweistöckige Treppe hinuntergefallen. »Ich brauche einen Arzt. Sehen Sie sich diesen Schnitt an. Er ist bereits entzündet, ich spüre es. Und meine Schulter bringt mich um. Was muss man eigentlich noch tun, damit man hier anständig behandelt wird?«
Polizisten entwickeln viel Geschick darin, schwierige Verdächtige und Zeugen zu ignorieren, und Silverman bekam kaum etwas von dem Gejammer des Mannes mit.
»Cahill«, wandte er sich wieder an den Priester. »Und was, glauben Sie, bedeutet das für uns?«
»Cahill besitzt überall in der Stadt Hochhäuser. Ich habe mich gefragt, ob die Route, auf der Sie Ihren Zeugen zum Gericht fahren wollen, an welchen vorbeiführt.«
»Schon möglich.«
»Dann könnte also ein Scharfschütze auf einem von ihnen sitzen.« Der Reverend lächelte. »Darauf bin ich eigentlich nicht allein gekommen. Ich hab es einmal im Fernsehen gesehen.«
Silverman lief es kalt über den Rücken.
Ein Scharfschütze?
Er hob den Blick. Hundert Meter entfernt stand ein Hochhaus, von dessen Dach ein Scharfschütze freie Schussbahn auf die Laderampe hatte, wo Silverman, der Priester, Pease und die beiden Wächter im Augenblick standen. Es konnte durchaus ein Cahill-Gebäude sein.
»Nach drinnen!«, rief er. »Sofort.«
Alle eilten in den Korridor, der zur Arrestzelle führte, und Peases Babysitter schlug die Tür hinter ihnen zu. Mit klopfendem Herzen, weil sie möglicherweise nur knapp davongekommen waren, griff Silverman zu einem Telefon auf dem Schreibtisch und rief den Captain an. Er erzählte ihm die Theorie des Reverends. »Ich verstehe«, sagte der Captain. »Sie ballern auf das sichere Haus, um Pease aufzuscheuchen, und setzen einen Scharfschützen auf das Hochhaus, weil sie sich ausrechnen, dass wir ihn hierher bringen. Ich schicke ein Einsatzkommando rüber, damit es das Gebäude durchkämmt. Ach ja, und bringen Sie diesen Priester vorbei, wenn Sie Pease sicher verwahrt haben. Egal ob er Recht hat oder nicht, ich will ihm danken.«
»Wird gemacht.« Silverman war leicht gekränkt, weil seinem Vorgesetzten diese Idee besser zu gefallen schien als die Anagramme, aber er akzeptierte jede Theorie, solange sie Pease am Leben erhielt.
Während sie in dem schlecht beleuchteten Korridor warteten, bis die Zelle geleert war, begann sich der dürre Pease mit seinem strähnigen Haar wieder zu beschweren. »Soll das heißen, da draußen war ein Scharfschütze und ihr Penner habt nichts von ihm gewusst, verflucht noch mal? Oh … entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Hochwürden. Hört zu, ihr Arschlöcher, ich bin kein Verdächtiger, ich bin der Star in diesem Stück, ohne mich …«
»Halten Sie endlich den Mund«, fuhr ihn Silverman an.
»Sie können nicht mit mir reden, als ob …«
Silvermans Handy läutete, und er entfernte sich ein Stück, um das Gespräch anzunehmen. »Ja?«
»Gott sei Dank gehst du ran«, sagte Steve Noveski atemlos. »Wo ist Pease?«
»Direkt vor mir«, antwortete Silverman seinem Partner. »Es geht ihm gut. Ein Team sucht in dem Hochhaus die Straße entlang nach Scharfschützen. Was ist los?«
»Wo ist dieser Reverend?«, fragte Noveski. »Er hat sich am Empfang nicht wieder ausgetragen.«
»Er ist hier bei mir.«
»Hör zu, Mike, ich habe mir überlegt – was, wenn gar nicht der Informant diese Nachricht aus der Bibel hinterlassen hat?«
»Wer dann?«
»Der Killer, den Doyle angeheuert hat.«
»Der Killer? Warum sollte der einen Hinweis hinterlassen?«
»Es ist kein Hinweis. Denk mal nach. Er hat diesen Bibelkram selbst aufgeschrieben und bei der Leiche hinterlassen, als ob es von dem V-Mann stammte. Der Killer ist davon ausgegangen, dass wir uns an einen Priester wenden werden, der uns helfen soll, daraus schlau zu werden – aber nicht an irgendeinen Priester, sondern an den von der Kirche, die dem Polizeirevier am nächsten liegt.«
Silvermans Gedanken gelangten im Eiltempo zu einem logischen Schluss. Doyles Auftragsmörder tötet den Priester und seine Frau in ihrem Ferienhaus am See und verkleidet sich als Reverend. Der Detective erinnerte sich nun daran, dass es in dem Kirchenbüro nichts gegeben hatte, was den Priester identifizieren konnte. Tatsächlich schien der Mann Schwierigkeiten zu haben, eine Bibel zu finden, und er hatte offenbar nicht gewusst, dass seine Schreibtischlampe ausgebrannt war. Und die ganze Kirche war menschenleer und voller Staub gewesen.
Er spann den logischen Fortgang der Ereignisse weiter: Doyles Männer beschießen das sichere Haus, die Polizei bringt Pease zum Revier, und gleichzeitig taucht der Reverend mit einer Geschichte über Gier, einen Immobilienhai und einen Scharfschützen auf – nur um nahe an Silverman heranzukommen … und an Pease!
Er verstand plötzlich: Es gab keine geheime Botschaft. Er ist auf dem Weg. Passt auf – Lukas 12:15. Es war bedeutungslos. Der Killer hätte jede Bibelpassage auf den Zettel schreiben können. Es ging nur darum, dass die Polizei mit dem falschen Reverend Kontakt aufnahm und ihm Zugang zum Arrest verschaffte, wenn Pease zur gleichen Zeit dort war.
Und ich habe ihn direkt zu seinem Opfer geführt!
Silverman ließ das Handy fallen und zog seine Waffe aus dem Holster. Dann rannte er den Flur entlang und stürzte sich auf den Reverend. Der Mann schrie vor Schmerz auf und schnappte nach Luft, als er zu Boden ging. Der Detective stieß ihm den Lauf seiner Waffe an den Hals. »Keine Bewegung.«
»Was tun Sie da?«
»Was ist los?«, fragte Peases Bewacher.
»Er ist der Killer! Er ist einer von Doyles Leuten!«
»Nein, bin ich nicht. Das ist verrückt!«
Silverman legte dem falschen Priester unsanft Handschellen an und steckte seine Pistole in den Holster. Er filzte ihn und fand keine Waffe, dachte sich aber, dass er vermutlich beabsichtigt hatte, einem der Polizisten die Waffe abzunehmen, um Pease und alle anderen zu töten.
Dann zerrte der Detective den Geistlichen auf die Beine und übergab ihn dem Aufnahmebeamten. »Bringen Sie ihn in einen Vernehmungsraum. Ich bin in zehn Minuten dort. Sorgen Sie dafür, dass er gefesselt bleibt.«
»Jawohl.«
»Das können Sie nicht tun!«, schrie der Reverend, als er fortgezerrt wurde. »Sie machen einen großen Fehler.«
»Schaffen Sie ihn raus«, bellte Silverman.
Pease sah den Detective verächtlich an. »Er hätte mich töten können, du Arschloch.«
Ein zweiter Wärter kam von der Aufnahme in den Korridor gelaufen. »Gibt es ein Problem, Detective?«
»Alles unter Kontrolle. Aber sehen Sie nach, ob die Arrestzelle endlich frei ist. Ich will den Mann hier so schnell wie möglich da drin haben.« Er zeigte mit einem Kopfnicken auf Pease.
»Wird gemacht«, sagte der Wärter und eilte zur Sprechanlage neben der Sicherheitstür, die in den Zellenblock führte.
Silverman schaute in den Korridor zurück, wo der Geistliche und sein Bewacher gerade durch die Tür verschwanden. Die Hände des Detective zitterten. Mann, das war knapp gewesen. Aber wenigstens war der Zeuge jetzt sicher.
Genau wie mein Job.
Natürlich würde er eine Menge Fragen beantworten müssen, aber …
»Nein!«, schrie eine Stimme hinter ihm.
Ein scharfer Klang, als würde eine Axt in einen Baumstamm fahren, hallte durch den Gang, dann ein zweiter, begleitet vom beißenden Geruch verbrannten Schießpulvers.
Der Detective fuhr herum und schnappte nach Luft. Entsetzt starrte er auf den Aufnahmebeamten, der gerade zu ihnen gestoßen war. Der junge Mann hielt eine Automatikpistole mit Schalldämpfer in der Hand und stand über den Leichen der beiden Männer, die er soeben getötet hatte: Randall Pease und der Beamte, der bei ihm gewesen war.
Silverman griff nach seiner eigenen Waffe.
Aber Doyles Killer, der die perfekt nachgemachte Uniform eines Arrestwärters trug, richtete seine Pistole auf den Detective und schüttelte den Kopf. Verzweifelt erkannte Silverman, dass er zum Teil Recht gehabt hatte. Doyles Leute hatten das Haus tatsächlich beschossen, um Pease aufzuscheuchen – aber nicht, damit er ins Krankenhaus geschickt wurde. Sie wussten, dass ihn die Polizei zur sicheren Verwahrung ins Gefängnis bringen würde.
Der Killer blickte den Korridor entlang. Keiner der anderen Wärter hatte die Schüsse gehört oder sonst etwas bemerkt. Der Mann zog mit der linken Hand ein Funkgerät aus der Tasche, drückte einen Knopf und sagte: »Alles erledigt. Ihr könnt mich abholen.«
»Gut«, ertönte die blecherne Antwort. »Genau im Zeitplan. Wir treffen uns vor dem Revier.«
»Verstanden.« Der Mann steckte das Funkgerät weg.
Silverman öffnete den Mund, um den Killer anzuflehen, sein Leben zu schonen.
Doch er verstummte und stieß ein schwaches, verzweifeltes Lachen aus, als sein Blick auf das Namensschild des Killers fiel. Denn in diesem Moment begriff er endlich die Wahrheit: Die Nachricht des toten Informanten war gar nicht so geheimnisvoll gewesen. Der V-Mann hatte ihnen schlicht mitgeteilt, dass sie auf einen Killer aufpassen sollten, der sich als ein Wärter tarnte, dessen Namen Silverman nun mit offenem Mund auf dem Plastikschild des Mannes las: »Lukas.«
Und was das Kapitel und den Vers anging – nun, das war ebenfalls ziemlich einfach. Die Nachricht bedeutete, dass der Killer kurz nach Beginn der zweiten Schicht zuschlagen würde, sodass ihm noch eine Viertelstunde Zeit blieb, um herauszufinden, wo der Gefangene festgehalten wurde.
Genau im Zeitplan …
Die Uhr an der Wand zeigte exakt 12:15.
Der Pendler
Der Montag fing schlecht an.
Charles Monroe hatte wie üblich den Zug genommen, der um 8.11 Uhr von Greenwich abfuhr. Er balancierte seine Aktentasche und den Kaffee – der heute lauwarm war und verbrannt schmeckte – auf den Knien, während er sein Handy herauszog, um einige seiner morgendlichen Telefonate vorneweg zu erledigen. Im selben Moment plärrte das Gerät lautstark los. Das Geräusch erschreckte ihn, und er goss sich ein großes Komma aus Kaffee über seine braune Anzughose.
»Verdammt«, flüsterte er, klappte das Handy auf und knurrte: »Hallo?«
»Schatz.«
Seine Frau. Er hatte ihr eingeschärft, ihn nur in Notfällen auf seinem Handy anzurufen.
»Was gibt es?«, fragte er und rieb wütend an dem Fleck, als könnte ihn sein Zorn allein zum Verschwinden bringen.
»Gott sei Dank habe ich dich erwischt, Charlie.«
Hatte er eine zweite Hose im Büro, Himmel noch mal? – Nein. Aber er wusste, woher er eine bekam. Er vergaß die Hose, als ihm bewusst wurde, dass seine Frau zu weinen begonnen hatte.
»Na, nun beruhige dich mal, Cathy. Was ist los?« Sie ärgerte ihn auf vielerlei Weise – mit ihrer endlosen Freiwilligenarbeit für wohltätige Einrichtungen und Schulen, weil sie Billigklamotten für sich selbst kaufte und ihm ständig zusetzte, er solle zum Abendessen nach Hause kommen – aber Weinen gehörte nicht zu ihren üblichen Lastern.
»Sie haben noch eine gefunden«, sagte Cathy und schniefte.
Was sie allerdings oft tat, war, so unvermittelt loszulegen, als müsste er genau wissen, wovon sie sprach.
»Wer hat noch eine von was gefunden?«
»Noch eine Leiche.«
Ach, das. In den letzten Monaten waren zwei Bewohner ihres Wohnortes ermordet worden. Der South Shore Killer, wie ihn eine der Boulevardzeitungen getauft hatte, erstach seine Opfer und weidete sie dann mit einem Jagdmesser aus. Sie wurden aus völlig nichtigem Anlass getötet. Eines offenbar im Anschluss an eine kleine Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Das andere, weil sein Hund nicht zu bellen aufhörte, wie die Polizei vermutete.
»Und?«
»Schatz«, sagte Cathy und hielt den Atem an, »es war in Loudon.«
»Das ist meilenweit entfernt von uns.«
Obwohl er es auf diese Weise abtat, spürte Monroe ein leichtes Frösteln. Er fuhr jeden Morgen auf dem Weg zum Bahnhof in Greenwich durch Loudon. Vielleicht war er direkt an der Leiche vorbeigefahren.
»Aber damit sind es jetzt drei!«
Ich kann selbst zählen, dachte er, sagte aber: »Cathy, Schatz, die Chance, dass er sich an dich heranmacht, ist eins zu einer Million. Vergiss es einfach. Ich verstehe nicht, weshalb du dir Sorgen machst.«
»Du verstehst nicht, weshalb ich mir Sorgen mache?«, fragte sie.
Natürlich wusste er es nicht. Als Monroe nicht antwortete, fuhr sie fort: »Deinetwegen. Was glaubst du denn?«
»Meinetwegen?«
»Die Opfer waren alle Männer in den Dreißigern und wohnten in der Nähe von Greenwich.«
»Ich kann schon auf mich aufpassen«, sagte er geistesabwesend und blickte aus dem Fenster auf Schulkinder, die aufgereiht an einem Bahnsteig warteten. Sie sahen mürrisch aus. Warum freuten sie sich nicht auf ihren Ausflug in die Stadt?
»Du kommst immer so spät heim, Schatz. Ich mache mir Sorgen, wenn du vom Bahnhof zum Wagen gehst. Ich …«
»Cathy, ich habe wirklich viel zu tun. Sieh es mal so: Er scheint sich einmal im Monat ein Opfer zu schnappen, oder?«
»Was …?«
Monroe ließ sich nicht unterbrechen. »Und jetzt hat er gerade jemanden getötet. Also können wir eine Weile beruhigt sein.«
»Ist das … Machst du Witze, Charlie?«
Er hob die Stimme. »Cathy, ich muss wirklich Schluss machen. Ich habe keine Zeit für so was.«
Eine Geschäftsfrau im Sitz vor ihm drehte sich um und sah ihn wütend an.
Was hatte sie für ein Problem?
Dann hörte er eine Stimme. »Entschuldigen Sie, Sir.«
Der Mann, der neben ihm saß – ein Wirtschaftsprüfer oder Anwalt, vermutete Monroe –, lächelte ihn trübselig an.
»Ja?«, fragte Monroe.
»Es tut mir leid«, sagte der Mann, »aber Sie sprechen sehr laut. Manche von uns würden gern lesen.«
Monroe blickte mehrere andere Pendler an. Ihre gereizten Mienen verrieten ihm, dass sie genauso dachten.
Er war nicht in der Stimmung, sich belehren zu lassen. Alle Welt telefonierte im Zug mit dem Handy. Wenn eins läutete, gingen immer ein Dutzend Hände zum eigenen Gerät.
»Tja«, knurrte Monroe, »ich war zuerst hier. Sie haben mich telefonieren sehen und sich trotzdem gesetzt. Wenn Sie jetzt erlauben …«
Der Mann blinzelte überrascht. »Oh, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich habe mir nur gedacht, Sie könnten vielleicht ein wenig leiser sprechen.«
Monroe seufzte frustriert und wandte sich wieder seinem Gespräch zu. »Cathy, mach dir keine Sorgen, okay? Und jetzt hör zu, ich brauche für morgen das Hemd mit dem Monogramm.«
Der Mann sah ihn pikiert an, dann seufzte er, sammelte Zeitung und Aktentasche ein und zog auf den Sitz hinter Monroe um. Nicht schade um ihn.
»Morgen?«, fragte Cathy.
Monroe brauchte das Hemd eigentlich gar nicht, aber er ärgerte sich über Cathy, weil sie angerufen hatte, und er ärgerte sich über den Mann neben ihm, weil er so unhöflich war. Deshalb sagte er lauter als nötig: »Ich sagte doch gerade, ich muss es morgen haben.«
»Heute ist nur ziemlich viel zu tun. Wenn du gestern Abend etwas gesagt hättest …«
Stille.
»Also gut«, fuhr sie fort, »ich mache es. Aber Charlie, versprich, dass du vorsichtig bist, wenn du heute Abend nach Hause fährst.«
»Ja, in Ordnung. Ich muss Schluss machen.«
»Bye …«
Er trennte die Verbindung.
Großartig, wenn der Tag so anfängt, dachte er. Und tippte eine andere Nummer ein.
»Carmen Foret, bitte«, sagte er zu der jungen Frau, die sich meldete.
Weitere Pendler stiegen zu. Monroe warf seine Aktentasche auf den Sitz neben sich, um mögliche Interessenten für den Platz abzuschrecken.
Einen Augenblick später meldete sich die Stimme der Frau.
»Ja, bitte?«
»Hallo, Baby, ich bin’s.«
Kurzes Schweigen.
»Du wolltest mich gestern Abend anrufen«, sagte die Frau kühl.
Er kannte Carmen seit acht Monaten. Sie war, dem Vernehmen nach, eine talentierte Immobilienmaklerin und wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht eine wunderbare, großzügige Frau. Was er aber von ihr wusste – und was alles war, was er wissen wollte –, war, dass sie einen weichen, geschmeidigen Körper besaß und langes, zimtfarbenes Haar, das sich wie warmer Samt auf dem Kissen ausbreitete.
»Tut mir leid, Häschen, die Besprechung ging sehr viel länger, als ich dachte.«
»Deine Sekretärin dachte nicht, dass es so spät werden würde.«
Himmel, sie hatte in seinem Büro angerufen. Das tat sie fast nie. Wieso gestern Abend?
»Wir gingen noch auf ein paar Drinks, nachdem wir den Vertragstext durchgesehen hatten. Dann sind wir im Four Seasons hängen geblieben. Du weißt, wie das ist.«
»Ich weiß«, sagte sie säuerlich.
»Was machst du heute Mittag?«, fragte er.
»Ich mache ein Thunfischsalatsandwich, Charlie. Was machst du?«
»Wir könnten uns bei dir treffen.«
»Nein, Charlie, nicht heute. Ich bin sauer auf dich.«
»Sauer auf mich? Weil ich einen Anruf versäumt habe?«
»Nein, weil du ungefähr dreihundert Anrufe versäumt hast, seit wir zusammen sind.«
Zusammen sind? Wie kam sie denn auf die Idee? Sie war seine Geliebte. Sie schliefen miteinander. Sie waren nicht zusammen, sie gingen nicht miteinander aus, sie machten sich nicht den Hof.
»Du weißt, wie viel Geld ich bei diesem Geschäft verdienen kann. Ich durfte es nicht verpfuschen, Schatz.«
Falsch, verdammt.
Carmen wusste, dass er Cathy »Schatz« nannte. Sie mochte es nicht, wenn er diesen Kosenamen bei ihr verwendete.
»Ich bin heute Mittag jedenfalls beschäftigt«, sagte sie frostig. »Kann sein, dass ich in nächster Zeit sehr oft mittags beschäftigt bin. Vielleicht für den Rest meines Lebens.«
»Komm schon, Baby.«
Ihr Lachen sagte: Netter Versuch. Aber sein Ausrutscher mit dem »Schatz« wurde ihm noch nicht verziehen.
»Kann ich rasch rüberkommen und etwas abholen?«
»Etwas abholen?«, fragte Carmen.
»Eine Hose.«
»Du meinst, du hast mich gerade angerufen, weil du Wäsche abholen wolltest?«
»Nein, nein, Baby, ich wollte dich sehen. Wirklich. Ich habe nur gerade Kaffee auf meine Hose verschüttet. Während wir gesprochen haben.«
»Ich muss Schluss machen, Charlie.«
»Baby …«
Klick.
Verdammt.
Montage, dachte Monroe. Ich hasse Montage.
Er rief die Auskunft an und bat um die Nummer eines Juwelierladens nicht weit von Carmens Büro. Er bestellte ein Paar Diamantohrringe für fünfhundert Dollar und arrangierte, dass sie ihr so schnell wie möglich geliefert wurden. Die Nachricht, die er diktierte, lautete: »Für meine Erste-Klasse-Geliebte: eine kleine Beilage zu deinem Thunfischsalat. Charlie.«
Dann blickte er aus dem Fenster. Der Zug war nun beinahe in der City. Statt der großen Villen und der kleinen Möchtegern-Villen flogen nun Reihenhäuser und niedrige Bungalows vorbei, die in hoffnungsvollen Pastelltönen gestrichen waren. Blaues und rotes Plastikspielzeug und Spielzeugteile lagen in den schütteren Gärten. Eine schwergewichtige Frau hielt beim Wäscheaufhängen inne und sah stirnrunzelnd dem vorbeibrausenden Zug nach, als verfolgte sie die Bilder einer Flugschaukatastrophe auf CNN.
Er machte noch einen Anruf.
»Geben Sie mir Hank Shapiro.«
Einen Augenblick später war eine barsche Stimme in der Leitung. »Ja?«
»Hallo, Hank. Hier ist Charlie. Monroe.«
»Charlie. Sagen Sie, wie kommt unser Projekt voran?«
Monroe hatte die Frage nicht zu diesem frühen Zeitpunkt des Gesprächs erwartet. »Großartig«, antwortete er nach kurzem Zögern. »Es läuft großartig.«
»Aber?«
»Aber was?«
»Es klingt, als versuchten Sie mir etwas mitzuteilen«, sagte Shapiro.
»Nein … Es ist nur so, dass alles ein bisschen langsamer geht, als ich dachte. Ich wollte …«
»Langsamer?«, fragte Shapiro.
»Sie speisen einen Teil der Informationen in ein neues Computersystem. Dort sind sie ein bisschen schwerer zu finden als bisher.« Er versuchte zu scherzen. »Erinnern Sie sich noch an diese alten Disketten? Man nannte sie …«
»Ich höre ›ein bisschen langsamer‹. Ich höre ›ein bisschen schwerer‹«, bellte Shapiro. »Das ist alles nicht mein Problem. Ich brauche diese Informationen, und ich brauche sie bald.«
Die gesammelten Ärgernisse des Vormittags wurden Monroe zu viel, und er flüsterte wütend: »Hören Sie, Hank, ich bin seit Jahren bei Johnson, Levine. Niemand außer Foxworth selbst verfügt über solches Insiderwissen. Also setzen Sie mir nicht zu, okay? Ich besorge Ihnen, was ich versprochen habe.«
Shapiro seufzte. Nach einem Augenblick fragte er: »Sind Sie sicher, dass er keine Ahnung hat?«
»Wer, Foxworth? Der tappt völlig im Dunkeln.«
In Monroes Kopf tauchte blitzschnell ein irritierendes Bild von seinem Boss auf. Todd Foxworth war ein massiger, schrulliger Mann. Er hatte aus einer kleinen Graphic-Design-Firma in SoHo eine riesige Werbeagentur aufgebaut. Monroe war dort Leiter der Kundenbetreuung und stellvertretender Geschäftsführer. Er war so weit in der Firma aufgestiegen, wie er es als Betriebswirt konnte, aber Foxworth hatte sich seinen wiederholten Vorschlägen widersetzt, einen besonderen Titel für ihn zu kreieren. Spannungen vergifteten die Atmosphäre zwischen den beiden Männern, und im Lauf des letzten Jahres war Monroe zu der Überzeugung gelangt, dass ihn Foxworth verfolgte – er beschwerte sich ständig wegen seines Spesenkontos, seiner nachlässigen Aktenführung, seiner unerklärten Fehlzeiten. Als er dann schließlich nach seiner jährlichen Beurteilung nur eine siebenprozentige Gehaltserhöhung bekam, hatte Monroe beschlossen, zurückzuschlagen. Er war zu Hunter, Shapiro, Stein & Arthur gegangen und hatte ihnen Insiderinformationen über Kunden zum Kauf angeboten. Erst störte ihn die Vorstellung, aber dann dachte er sich, dass es nur ein anderer Weg war, sich die zwanzig Prozent Gehaltserhöhung zu sichern, die ihm seiner Ansicht nach zustanden.
»Ich kann nicht mehr viel länger warten, Charlie«, sagte Shapiro. »Wenn ich nicht bald etwas sehe, muss ich das Angebot vielleicht zurückziehen.«
Verrückte Ehefrauen, rüde Pendler … und jetzt das noch. Himmel, was für ein Morgen!
»Diese Info wird erstklassig, reines Gold, Hank.«
»Hoffentlich. Denn ich bleche auf jeden Fall wie für Gold.«
»Bis zum Wochenende habe ich gutes Material beisammen. Was halten Sie davon, wenn Sie zu meinem Landhaus hinaufkommen und es sich ansehen? Dort haben wir es nett und ungestört.«
»Sie haben ein Landhaus?«
»Ich posaune es nicht herum. Tatsache ist, dass Cathy nichts davon weiß. Eine Freundin und ich fahren manchmal hinauf.«
»Eine Freundin?«
»Ja. Und sie hat ein, zwei Freundinnen, die sie einladen könnte, falls Sie mitkommen wollen.«
»Zwei?«
Oder drei, dachte Monroe, aber er sagte nichts.
Ein langes Schweigen. Dann kicherte Shapiro. »Ich denke, sie sollte nur eine Freundin mitbringen, Charlie. Ich bin kein junger Mann mehr. Wo ist das Haus?«
Monroe beschrieb ihm den Weg. Dann sagte er: »Wie wäre es heute Abend mit Dinner? Ich lade Sie ins Chez Antibes ein.«
Erneutes Kichern. »Damit könnte ich leben.«
»Gut. Gegen acht.«
Monroe war versucht, Shapiro zu bitten, Jill mitzubringen, eine junge Kundenbetreuerin, die in Shapiros Agentur arbeitete – und zufällig auch die Frau, mit der er den gestrigen Abend im Holiday Inn verbracht hatte, als Carmen ihn zu erreichen versuchte. Aber er fand, er sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Er und Shapiro legten auf.
Monroe schloss die Augen und begann wegzudösen. Er hoffte, noch ein paar Minuten Schlaf abzubekommen, aber der Zug ruckte seitwärts und rüttelte ihn wach. Er sah aus dem Fenster. Man blickte auf keine Einfamilienhäuser mehr. Nur rußige Wohnblocks aus Ziegeln. Monroe verschränkte die Arme und legte den restlichen Weg bis zur Grand Central Station in aufgewühltem Schweigen zurück.
Der Tag besserte sich umgehend.
Carmen gefielen die Ohrringe sehr, und sie war nahe dran, ihm zu vergeben (zu einer vollständigen Wiedergutmachung würden allerdings ein teures Dinner und eine Nacht im Sherry Netherland gehören, wie er wusste).
Im Büro war Foxworth überraschend fröhlich gelaunt. Monroe hatte sich Sorgen gemacht, der Alte könnte ihn wegen seines in letzter Zeit stark aufgeblähten Spesenkontos zur Rede stellen. Aber Foxworth genehmigte es nicht nur, er lobte Monroe außerdem für die gute Arbeit, die er bei der Werbekampagne für Brady Pharmaceutical geleistet hatte. Er bot ihm sogar für das kommende Wochenende einen Golfnachmittag in Foxworths exklusivem Country Club auf Long Island an. Monroe verabscheute Golf, und besonders verabscheute er North Shore Country Clubs. Aber ihm gefiel die Vorstellung, Hank Shapiro auf Foxworths Kosten zum Golfen einzuladen. Zwar verwarf er diesen Einfall als zu riskant, aber der Gedanke daran amüsierte ihn über weite Strecken des Nachmittags.
Um neunzehn Uhr, kurz bevor er aufbrechen musste, um Shapiro zu treffen, fiel ihm plötzlich Cathy ein. Er rief zu Hause an. Niemand ging ans Telefon. Dann wählte er die Nummer der Schule, in der sie zuletzt freiwillig gearbeitet hatte, und erfuhr, dass sie heute nicht dort gewesen war. Er rief wieder zu Hause an. Sie ging immer noch nicht ran.
Für einen kurzen Moment war er beunruhigt. Nicht, dass er sich Sorgen wegen des South Shore Killers gemacht hätte; ihm war nur instinktiv unwohl, wenn seine Frau nicht zu Hause war – er fürchtete, sie könnte die Sache mit Carmen oder wem auch immer herausgefunden haben. Außerdem wollte er nicht, dass sie von seinem Deal mit Shapiro erfuhr. Je besser sie über seine Einkünfte Bescheid wusste, desto mehr würde sie haben wollen. Er rief noch einmal an und sprach auf ihren Anrufbeantworter.
Doch inzwischen war es Zeit, zum Abendessen aufzubrechen, und da Foxworth bereits gegangen war, bestellte er sich eine Limousine und setzte sie auf die Rechnung für allgemeinen Geschäftsbedarf. Er ließ sich durch Downtown chauffieren und genoss ein gutes Abendessen mit Hank Shapiro. Um dreiundzwanzig Uhr setzte er Shapiro an der Penn Station ab und fuhr mit der Limousine zur Grand Central. Er erwischte den Zug eine halbe Stunde vor Mitternacht, schaffte es bis zu seinem Wagen, ohne von einem Verrückten mit einem Messer abgestochen zu werden, und fuhr nach Hause, zu Ruhe und Frieden. Cathy hatte zwei Martinis getrunken und schlief fest. Monroe schaute noch ein wenig fern, schlief auf der Couch ein und wachte am nächsten Morgen spät auf; er erwischte den Zug um 8.11 Uhr, dreißig Sekunden vor der Abfahrt.
Um halb zehn marschierte Monroe ins Büro und dachte: Den Montag hätten wir hinter uns, heute ist ein neuer Tag. Bringen wir wieder Schwung ins Leben. Er beschloss, den Vormittag dazu zu nutzen, in das neue Computersystem zu gelangen und Listen angehender Klienten für Shapiro auszudrucken. Dann würde er mit Carmen ein romantisches Mittagessen einnehmen. Außerdem würde er Jill anrufen und sie zu ein paar Drinks am Abend überreden.
Monroe betrat gerade sein Büro, als ihn Foxworth, der noch fröhlicher als gestern zu sein schien, zu sich winkte und fragte, ob sie sich kurz unterhalten könnten. Monroe kam ein ironischer Gedanke: Dass Foxworth es sich anders überlegt hatte und ihm doch noch eine anständige Gehaltserhöhung gewähren wollte. Würde er die vertraulichen Informationen trotzdem verkaufen? Es war ein Dilemma. Doch dann entschied er, zum Teufel, ja, er würde es tun. Und zwar als Entschädigung für die beleidigenden fünf Prozent Erhöhung vom Vorjahr.
Monroe nahm in Foxworths vollgestopftem Büro Platz.
Man machte sich in der Agentur darüber lustig, dass Foxworth keine zusammenhängenden Unterhaltungen zustande brachte. Er polterte los, er schweifte ab, er erfand sogar Worte. Die Kunden fanden es entzückend. Monroe hatte nicht die Geduld für die weitschweifige Persönlichkeit des Mannes. Aber heute war er großzügiger Stimmung und lächelte höflich, als der zerknitterte Alte drauflosplapperte.
»Ein paar Dinge, Charlie. Leider hat sich da etwas ergeben, und diese Einladung zum Golf am Wochenende … Ich weiß, Sie hätten wahrscheinlich gern ein paar Bälle geschlagen, haben sich schon darauf gefreut, aber ich fürchte, ich kann das Angebot nicht aufrechterhalten. Tut mir sehr leid.«
»Schon in Ordnung. Ich …«
»Ein guter Club, dieser Hunter’s. Haben Sie mal dort gespielt? Nein? Sie haben keinen Pool, keine Tennisplätze. Man geht hin, um Golf zu spielen. Punkt, Ende der Geschichte. Wenn man dort nicht Golf spielt, verschwendet man nur seine Zeit. Es gibt natürlich dieses Dogleg am siebzehnten … scheußlich, scheußlich. Bin noch nie auch nur einem Par nahe gekommen. Wie lange spielen Sie schon?«
»Seit dem College. Ich weiß es wirklich zu schätzen …«
»Jetzt zu der anderen Sache, Charlie. Patty Kline und Sam Egglestone von der Rechtsabteilung, Sie kennen die beiden ja, waren gestern Abend im Chez Antibes. Zum Abendessen. Sie haben noch länger gearbeitet und gingen dann essen.«
Monroe erstarrte.
»Nun war ich selbst zwar nie dort, aber wie ich höre, ist das Lokal lustig eingerichtet. Sie haben diese Raumteiler, so ähnlich wie die Papierschirme in japanischen Restaurants, nur eben keine japanischen, weil es ja ein französisches Restaurant ist. Langer Rede kurzer Sinn, die beiden konnten jedes Wort verstehen, das Sie und Hank Shapiro gewechselt haben. So. Da haben Sie es. Der Sicherheitsdienst räumt in diesem Augenblick Ihren Schreibtisch aus, ein paar Wachen sind auf dem Weg, um Sie aus dem Gebäude zu eskortieren, und Sie sollten sich lieber einen guten Anwalt nehmen, denn Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen ist eine verdammt ernste Angelegenheit – sagen Patty und Sam; ich kenn mich mit so was nicht aus, ich bin nur ein kleiner Wortschmied. So. Ich werde Ihnen wohl nicht viel Glück wünschen, Charlie. Sondern einfach sagen: Machen Sie, dass Sie aus meiner Agentur verschwinden. Ach ja, und ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, dass Sie in dieser Branche kein Bein mehr auf die Erde kriegen.«
Fünf Minuten später stand er auf der Straße, seine Aktentasche in der einen Hand, das Handy in der anderen, und sah zu, wie Kartons mit seiner persönlichen Habe in einen Lieferwagen mit Bestimmungsort Connecticut verladen wurden.