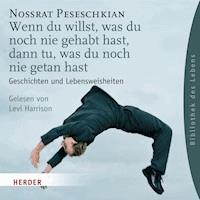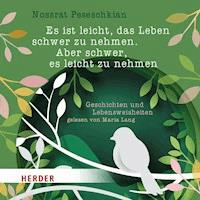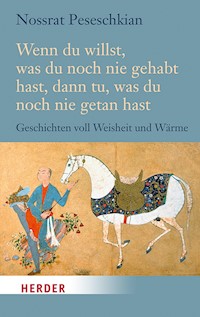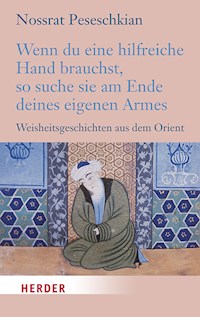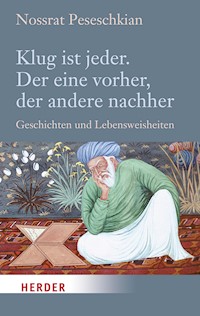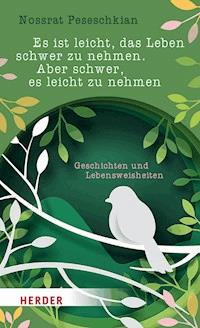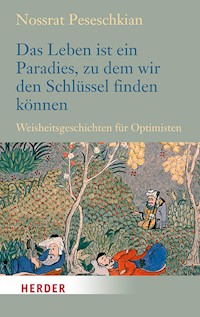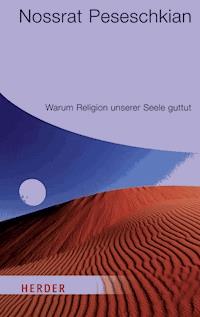
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Viele Weisheitsgeschichten zeigen, welch fatale Folgen es hat, wenn Glaube, Religion und Institution verwechselt werden. Peseschkian macht deutlich, warum Religion unserer Seele gut tut. Ein Buch von tiefer Weisheit, das aus dem Wissen der großen religiösen Kulturen schöpft und mit großer menschlicher Wärme eingeht auf die letzten Fragen des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nossrat Peseschkian
Glaube an Gott und binde dein Kamel fest
Warum Religion unserer Seele guttut
HERDER spektrum Band6372
© Verlag Kreuz in der Verlag Herder GmbH 2008
ISBN (Buch) 978-3-7831-3152-9
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Agentur R•M•E Eschlbeck
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Charkles O’Rear/Corbis
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
ISBN (E-Book) 978-3-451-33876-2
ISBN (Buch) 978-3-451-06372-5
Inhalt
Glaube an Gott und binde dein Kamel fest
Danksagung
Einführung
1 Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben? (Lichtenberg) Verschiedene Wissenschaftler über Religion: R. Battegay, R. M. Bonelli, U. Schaefer, H. A. Kick, W. Paris und F. Biland
2 Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet. Religion und moderne Globalisierung
3 Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille sehen! Ratlosigkeit und Hoffnung in unserer Zeit – mögliche Auswege
4 Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit der Zeit. Religion und Zeitgeist
5 Eigene Erfahrungen sind teuer. Fremde Erfahrungen sind kostbar. Wer sind wir? Identität und Sinnfragen
6 Weniges auf dieser Welt verbindet so stark wie eine gemeinsame Abneigung gegen einen Dritten. Glaube, Religion und Kirche – wichtige Unterscheidungen
7 Wer alleine arbeitet, addiert, wer mit anderen zusammenarbeitet, multipliziert. Die großen Weltreligionen: kurze Einführung
8 Was man in der Wiege gelernt hat, das hält auch im Alter vor. Wissenschaft und Religion – alte Rivalitäten, neue Positionen
9 Der Wert von Menschen und Diamanten lässt sich erst schätzen, wenn man sie aus der Fassung bringt. Viele Fragen – viele Antworten zu Religion und Freiheit
10 Luftschlösser lassen sich leicht aufbauen, aber schwer wieder abreißen. Psychopathologie und Religion – vier Reaktionstypen
11 Urteile kann man revidieren, Vorurteile nicht. Goethe Urteil und religiöses Vorurteil
12 Es ist nicht schlimm wenn man hinfällt, sondern wenn man liegen bleibt. Einseitigkeit: Ursache für die großen Krisen unserer Zeit
13 Die Gabe, sich widersprechen zu lassen, ist wohl überhaupt eine Gabe, die unter den Gelehrten nur die Toten haben. (Lessing) Die vier Jahreszeiten der Religionen
14 Es kommt vielmehr darauf an, das Alte in einem neuen Licht zu sehen. (Balint) Religiöse Freiheit und der positive Umgang mit religiösen Radikalismen
15 Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Einheit in der Vielfalt – unsere Hoffnung auf die Zukunft
16 Kränkung macht krank und Krankheit kränkt. Fallbeispiele zu religiösen Vorurteilen
17 Einige Gedanken zum Abschluss
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Schaubilder
Glaube an Gott und binde dein Kamel fest
Die Gläubigen kamen in Scharen, um die Worte des Propheten zu hören. Ein Mann hörte besonders aufmerksam und andächtig zu, betete mit gläubiger Inbrunst und verabschiedete sich schließlich vom Propheten, als es Abend wurde. Kaum war er draußen, kam er wieder zurückgerannt und schrie mit sich überschlagender Stimme: »O Herr! Heute Morgen ritt ich auf meinem Kamel zu dir, um dich, den Propheten Gottes zu hören. Jetzt ist das Kamel nicht mehr da. Weit und breit ist kein Kamel zu sehen. Ich war dir gehorsam, achtete auf jedes Wort deiner Rede und vertraute auf Gottes Allmacht. Jetzt, o Herr, ist mein Kamel fort. Ist das die göttliche Gerechtigkeit? Ist das die Belohnung meines Glaubens? Ist das der Dank für meine Gebete?« Der Prophet hörte sich diese verzweifelten Worte an und antwortete mit einem gütigen Lächeln: »Glaube an Gott und binde dein Kamel fest.«
Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben? Georg Christoph Lichtenberg
Zwei Dinge erfüllen mich mit Bewunderung und Ehrfurcht: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. In diesen Dingen erahne ich den Schöpfer. Und die Ordnung in der Natur spricht mir von einem Ordner. Immanuel Kant1
Danksagung
Ohne die Mitarbeit und Aufgeschlossenheit der Patienten und Seminarteilnehmer in verschiedenen Ländern, die bereitwillig ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Falldarstellungen gaben, wäre dieses Buch so nicht zustande gekommen. Die Fallbeispiele entstammen meiner eigenen psychotherapeutischen und psychiatrischen Arbeit in Einzel-, Familien- und Gruppenpsychotherapie sowie Supervisionen. Natürlich habe ich die Namen und Daten verändert, um die Anonymität zu wahren. Im Sinn der Originalität wurden die mündlichen und schriftlichen Berichte zumeist wörtlich wiedergegeben. Die Falldarstellungen dienen insbesondere einem besseren Verständnis der Theorie und Praxis der Positiven Psychotherapie.
Leser, die sich für eine systematische Darstellung der Positiven Psychotherapie interessieren, möchte ich auf meine Veröffentlichungen im Literaturverzeichnis hinweisen. Im Folgenden habe ich mich zur Verdeutlichung auf Konzepte aus meinen früheren Arbeiten bezogen. So ergänzte ein Buch das andere.
Wertvolle Anregungen gaben mir für diese Veröffentlichung insbesondere Prof. Dr. med. Raymond Battegay, Prof. Dr. med. Shridhar Sharma, Prof. Dr. med. Hermes A. Kick, Dr. med. François Biland, Privatdozent Dr. med. Raphael Bonelli, Dr.Walter Paris, Dr.Horst Burand, Dr.Udo Schaefer, Dr.Peter Sillem, Dipl. Psych. Hans Deidenbach, Dipl. Psych. Christian Henrichs, Dr.Michael Katzensteiner, Dr.Reinhard Larcher, Dr. med. Dieter Spengler, Prof. Dr. med. Thomas Loew, Dr. med. Dieter Schön, Dr. med. Mehdi Enayati, Dr.Ilaj Eshraghi, Dr.Bahman Soluki und die Dozenten der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie und der Internationalen Akademie für Positive Psychotherapie. Sie alle reagierten überaus freundlich auf meine Einladung, sich für dieses Buch zum Thema zu äußern.
Meiner Mitarbeiterin Constanze Rottleuthner danke ich für ihre sorgfältige Arbeit und vielfältige Unterstützung bei der Textverarbeitung und endgültigen Gestaltung des Manuskripts. Ebenso danke ich meiner Mitarbeiterin Heidi B. Haefele für ihre Geduld und Sorgfalt beim Redigieren und bei der Neugestaltung bestimmter Texte.
Mein besonderer Dank gilt dem Kreuz Verlag, insbesondere Frau Dr.Mathilde Fischer, die mich zur Veröffentlichung dieses Buches ermutigte und mich bei meiner Arbeit unterstützte und motivierte.
Meine Frau Manije, Familientherapeutin, und meine Söhne Dr. med. habil. Hamid und Dr. med. Nawid Peseschkian haben mich und meine Arbeit an diesem Buch in vielfältiger Weise unterstützt.
Wiesbaden,
im Mai 2008
Prof. Dr. med. Nossrat Peseschkian
Einführung
Nicht das macht frei, dass wir nichts über uns anerkennen wollen, sondern eben,dass wir etwas verehren, das über uns ist. Denn indem wir es verehren, heben wir uns zu ihm hinauf und legen durch unsere Anerkennung an den Tag, dass wir selber das Höhere in uns tragen und wert sind, seinesgleichen zu sein.
Goethe
Nichts hindert uns, die Weltordnung der Naturwissenschaft und den Gott der Religion zu identifizieren.
Max Planck
Dialog zwischen zwei Freunden
»Du siehst gut aus!«
»Es geht mir sehr gut und ich bin richtig glücklich, besonders heute.« »Hast du im Lotto gewonnen? Erzähl doch mal!« »Ich bin glücklich, dass ich nicht in dem Zug saß, der im Tunnel einen Unfall hatte.« »Du warst doch gar nicht auf einer Reise!« »Trotzdem bin ich glücklich, dass ich nicht unter die Räder kam. Auch, dass ich nicht aus dem 6. Stockwerk gesprungen bin; dass ich nicht mit einem Flugzeug unterwegs war, das abstürzte; dass ich nicht im Erdbebengebiet im Urlaub war; dass ich nicht als Spion verhaftet wurde; dass ich nicht im Kino war, als es in Brand gesteckt wurde. Das alles sind Gründe meines Glücks. Und es geht noch weiter: Ich bin glücklich, dass ich noch nicht durch einen Herzinfarkt gestorben bin; dass niemand mich umgebrachthat, weil ich keine Feinde habe. Ich habe bis jetzt noch kein Problem mit der Polizei gehabt. Meine Mutter hat mich nicht geschlagen, und meine Frau ist nicht fremdgegangen. Darüber hinaus bin ich nicht vom Blitz getroffen worden, und die Erde dreht sich noch …«
Um an die Quelle zu gelangen, muss man gegen den Strom schwimmen.
Für die Gestaltung meiner Arbeit spielte unter anderem meine Beziehung zur Religion eine entscheidende Rolle.
Ich betrachte mich als einen religiösen Menschen. Mein Glaube hat mich immer geleitet und meine Entwicklundag als Psychiater und Psychotherapeut maßgeblich bestimmt.
Eine wichtige Motivation für mich, den Ansatz der Positiven Psychotherapie zu entwickeln, war zweifellos, dass ich mich selbst in einer transkulturellen Situation befinde. Als Perser lebe ich seit 1954 in Europa. Mir wurde bald klar, dass viele Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Einstellungen in den beiden Kulturkreisen unterschiedlich bewertet werden. Hier kam auch die Religion ins Spiel, genauer gesagt, die religiösen Vorurteile, die ich in meiner Kindheit in Teheran sehr genau beobachten konnte. Als Bahá’í standen wir immer wieder im Spannungsfeld zwischen unseren islamischen, christlichen und jüdischen Mitschülern und Lehrern. Diese Erfahrungen gaben letztlich den Anstoß, die Beziehungen der Religionen untereinander und die Beziehung der Menschen zueinander genauer zu untersuchen.
Sehr anschaulich verkörperte dies der Wanddteppich der Bahá’í. Im Iran stellten und stellen große Künstler besonders dekorative Wandteppiche aus erlesenem Material als Geschenke oder für das eigene Heim in Handarbeit her. Die persischen Bahá’í-Teppichkünstler hatten im 19. und 20. Jahrhundert die zwölf Prinzipien der Bahá’í-Religion sehr kunstvoll in ihren Teppichmustern als Schriftzüge eingearbeitet. Fast in jedem Bahá’í-Haushalt im Iran hing solch ein Wandteppich. Dadurch konnten auch die Kinder ohne großen Aufwand die wesentlichen Prinzipien dieser Religion verinnerlichen.
In der Idee leben heißt, das Unmögliche behandeln, als wenn es möglich wäre. Goethe
Als vor zehn Jahren in Deutschland Vertreter der beiden christlichen Kirchen, der jüdischen, islamischen, buddhistischen, orthodoxen Gemeinschaften sowie des Rates der Bahá’í zu einem breiten Dialog in der Bevölkerung aufriefen, weckte dies in mir die Erinnerung an eine Situation, die mehr als 50 Jahre zurückliegt und mich tiefe Dankbarkeit empfinden lässt. Ich wuchs in einem Mehrfamilienhaus auf, das ein Sammelbecken nicht nur für islamische, jüdische und christliche Bewohner, sondern auch für Zarathustra-Anhänger und Bahá’í war, ein Haus also, in dem sowohl die Alten als auch Kinder und Jugendliche aller Religionen lebten. Die Bewohner betonten immer ihre Mitverantwortung für das gesellschaftliche Zusammenleben in diesem Haus. Wir Kinder genossen die Fest- und Feiertage aller Religionen, was meist mit sehr gutem Essen verbunden war. Wir losten aus, wer am nächsten Samstag bei der jüdischen Familie das Feuer anzünden durfte.
Auf die Abende, an denen musiziert wurde und alle Hausbewohner und deren Gäste mit interessanten Gesprächen über verschiedene Weltanschauungen Stunden füllten, in denen Fragen über Religion, Wirtschaft und Geschichte, Literatur und Leben eine angenehme Unterhaltung bildeten, blicke ich mit Begeisterung zurück. Hier wurde das Fundament für die transkulturelle Psychotherapie gelegt.
Die Bahá’í-Familien waren und sind verpflichtet, ihre Kinder in acht bis neun unterschiedlichen Religionen zu unterrichten und zu erziehen. Diese Erfahrungen waren für mich sehr kostbar. Schon in der Kindheit sah ich also die Einheit in der Vielfalt stets vor meinen Augen, und ich konnte sie später in meine therapeutische Arbeit mit einbeziehen.
Bei vielen Menschen im europäischen Abendland dagegen herrscht ein »Unbehagen in der Kultur« vor: Sie sind von Einseitigkeit, Menschenfeindlichkeit, kalter Wissenschaft abgeschreckt, von der bürgerfernen Politik und Wirtschaft enttäuscht und sehen in den traditionellen Religionen und weltanschaulichen Systemen keine geistige Heimat. Ihnen bleibt nur, sich auf sich selbst zurückzuziehen und aus sich heraus neue Orientierungen zu finden.
So können wir uns zu Beginn dieses Buches einige wichtige Fragen stellen:
Warum sind viele Menschen heute von der Religion enttäuscht? Hat Religion überhaupt noch eine Chance? Die heutigen negativen Entwicklungen des religiösen Lebens wie Massenaustritte aus der Kirche und intellektueller Widerstand gegen religiöse Wahrheiten und Werte sind als ein Teil eines Entwertungs- und Auflösungsprozesses aufzufassen (das Gesetz der Entwicklung), dessen tiefere Ursachen nicht in einem »religiösen Defizit« liegen, wie viele Fachleute annehmen, sondern in einer »Unterscheidungsschwäche«. Wichtig ist zu begreifen, dass wir zwischen Glaube, Religion und Kirche als Institution unterscheiden müssen.
In welcher Beziehung steht nun der Glaube zur Religion? Religion ist ein kulturelles Phänomen und mehr oder weniger eng mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Der Glaube dagegen gehört zum Wesen des Menschen. Er ist wie eine Kerze, welche die Fähigkeit hat zu brennen.
Wenn ich schon den Glauben habe, wozu brauche ich dann auch noch eine Religion oder die Kirche? Eine Kerze hat zwar die Fähigkeit zu brennen, so wie wir alle die Fähigkeit haben zu glauben. Aber sie kann nie von allein brennen; sie braucht eine Flamme, die ihren Docht in Brand setzt. Diese Flamme entspricht der Religion. Damit die Kerze genügend Halt bekommt und dazu keinen Schaden anrichtet, stellt man sie in einen Kerzenhalter. Die Kirche kann man mit einem Kerzenhalter vergleichen, aber nur eine wahre Kirche hat genügend Stabilität, um die Kerze aufrecht zu halten, und sie darf nicht so übermächtig sein, dass die Flamme des Glaubens durch die Auswüchse der Institution erstickt wird.
Wie kommt es aber zu diesen grundsätzlichen Verwechslungen?
Wenn auch die höchsten Würdenträger einer Religion ihre Religion für einmalig und unüberbietbar halten, so sind sich die meisten Religionswissenschaftler darin einig, dass alle Religionen dem Gesetz der Entwicklung unterliegen. Die Ursprungskraft, die einer neuen Religion vom Stifter oder Propheten mitgegeben wird, bleibt nicht über die Jahrhunderte erhalten.
Gott spricht immer wieder in neuen Offenbarungen zu den Menschen, wenn die »alte Religion« sie nicht mehr überzeugt und verwandelt. Man könnte diesen Vorgang auch mit dem Jahreslauf in der Natur vergleichen: Jede Religion erlebt einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Der Religionswissenschaftler Gustav Mensching2 schildert diese Abfolge, die ich inhaltlich ein wenig erweitert habe, so:
Entwicklungsstufen der Religionen
Im Folgenden wollen wir also versuchen, uns mit diesen Tatsachen, die eigentlich jeden Menschen betreffen, näher zu befassen, Gründe zu erfragen, Annahmen zu prüfen und angemessene Lösungen zu finden.
Zum Einstieg noch folgende Geschichte und ein Fallbeispiel, das die Thematik des Buches gut beschreibt:
Geschichte: Das Hemd des glücklichen Menschen
Ein Kalif lag sterbenskrank in seinen seidenen Kissen. Die Hakinus, die Ärzte seines Landes, standen um ihn herum und waren sich einig, dass nur eines dem Kalifen Heilung und Rettung bringen könne: das Hemd eines glücklichen Menschen, das dem Kalifen unter den Kopf gelegt werden müsse. Boten schwärmten aus und suchten in jeder Stadt, in jedem Dorf und in jeder Hütte nach einem glücklichen Menschen. Doch alle, die sie nach ihrem Glück fragten, hatten nur Sorgen und Kummer. Endlich trafen die Boten, als sie ihre Hoffnung schon aufgeben wollten, einen Hirten, der lachend und singend seine Herde bewachte. Ob er glücklich sei? »Ich kann mir niemanden vorstellen, der glücklicher ist als ich«, antwortete der Hirte lachend. »Dann gib uns dein Hemd«, riefen die Boten. Der Hirte aber sagte: »Ich habe keins.« Diese dürftige Botschaft, dass der einzige glückliche Mensch, den die Boten trafen, kein Hemd hatte, gab dem Kalifen Anlass nachzudenken. Drei Tage und drei Nächte ließ er niemanden zu sich kommen. Am vierten Tage schließlich ließ er die seidenen Kissen und seine Edelsteine unter dem Volk verteilen, und wie die Legende berichtet, war der Kalif von diesem Zeitpunkt an wieder gesund und glücklich.
Reichtum gewinnt häufig ein eigentümliches Eigenleben, sei es als Prestige, das er vermittelt, als Rollenverhalten, das er fordert, als Exklusivität, die er verleiht, oder als sozusagen calvinistische Ethik, nach der Reichtum gepflegt und in seiner Entwicklung gefördert werden muss wie ein Kind. Dabei bildet sich ein Bruch zwischen der Persönlichkeit des Menschen, seiner Emotionalität, Offenheit und Ansprechbarkeit, und dem Charakterpanzer, den ihm seine gesellschaftliche und ökonomische Stellung auferlegt.
In unserer Gesellschaft ist Erziehung meist gleichbedeutend mit Erziehung zur Leistung. Dies kann sich dann besonders auf die Partnerschaft und die Beziehung auswirken.
Fallbeispiel: Der Weg eines Architekten und sein einseitiger Umgang mit der Religion – »Ich bin Atheist!«
Ein erfolgreicher Architekt hatte Schlafstörungen und erlitt einen Hörsturz. Nachdem seine Beschwerden unter dem Aspekt der Positiven Psychotherapie gedeutet und ihr tieferer Sinn aufgedeckt wurde (seine Schlafstörung bedeutete, dass er ein wachsamer Mensch ist, sein Hörsturz, dass er viel um die Ohren hatte), konnte er über die Funktion und den Sinn seiner Beschwerden sprechen. Er hatte eine sieben Jahre jüngere Frau geheiratet. Ihr wollte er alles bieten. Um ein schönes Heim zu haben, das ihm vorschwebte, arbeitete er wie eine Maschine – Freizeit gab es für ihn kaum. Überstunden waren die Regel, und wenn er müde nach Hause kam, berichtete er von den Erfolgen und Fortschritten, die er erzielte. Dafür, so meinte er, dürfte er Liebe, Zuwendung und Geborgenheit erwarten.
Seine Frau nahm dieses Angebot zunächst an. Sie lebte als Hausfrau und Mutter in ihrem goldenen Käfig, den sie nicht verlassen durfte. Ihr Wunsch, in ihrem alten Beruf als Sekretärin tätig zu sein oder zumindest ihrem Mann im Büro zu helfen, wurde von diesem als Beleidigung zurückgewiesen: »Als ob ich nicht für dich sorgen könnte!« Diese scheinbare Idylle platzte wie eine Seifenblase, als seine Frau einen Künstler kennenlernte, der – wie ihr Mann sagte – »noch nie etwas Rechtes auf die Beine gestellt hatte und nichts anderes konnte, als herumzupoussieren«. Dass der andere seiner Frau etwas gab, was er für sich selbst noch nicht entdeckt hatte, bemerkte der Ehemann erst später: nämlich Fantasie und Zeit. Er hatte gelernt, dass man sich Wärme, Liebe, Zuwendung und Sicherheit durch seine Leistung und seinen Fleiß verdienen muss. Dieses Konzept trieb ihn, sich in Geschäftigkeit zu |21|verausgaben, und er übersah völlig, dass eine Partnerschaft auf anderen Kriterien beruht. Die gut gemeinte und in der Familientradition verhaftete Erziehung durch die Eltern erwies sich als Beziehungsfalle mit Zeitzünder, eine Falle, die er sich selbst durch seine Partnerwahl und die Gestaltung seiner Ehe gestellt hatte.
Ich fragte ihn nach seiner religiösen Einstellung. »Ist das wichtig?«, fragte er mich. »Spielt das eine Rolle? Ich bin Atheist. Wissen Sie, was das ist?« Ich antwortete: »Ja, ein Atheist ist ein Mensch, der die Existenz eines anderen Gottes als sich selbst nicht zulässt.« Er lächelte und meinte dann: »Das gefällt mir. Aber es ist niemand von den Verstorbenen bis jetzt zurückgekommen.«
Ich antwortete, für mich bedeute das, dass sich alle an jenem Ort wohlfühlen. Wieder lächelte er und begann, mir über seine Kindheitserfahrungen mit der Religion zu erzählen: »Als ich 14 Jahre alt war, habe ich in der Schule zwei Toiletten gesehen: eine für Katholiken, eine für Protestanten. Seit dieser Zeit wollte ich mit der Kirche nichts mehr zu tun haben und bin, als ich volljährig wurde, ausgetreten. Obwohl ich als Kind Messdiener war, schimpfte mein Vater auf die Kirche und ließ Zweifel in mir aufkommen. Als ich 16 Jahre alt war, starb mein Vater plötzlich und ich musste für meine beiden kleineren Brüder 30 Stunden in der Woche zusätzlich neben der Schule arbeiten gehen, um sie versorgen zu können. So erlebte ich die Arbeit als Sinn des Lebens, und Leistung war dasselbe wie Freude für mich. Den Verlust und die Trauer um meinen Vater bemerkte ich vor lauter Arbeit und Pflichten kaum – ich hatte einfach keine Zeit dazu. Auch über spätere Verluste, die ich erlebte, habe ich weder gesprochen noch nachgedacht; selbst mit meiner Ehefrau sprach ich nicht darüber (noch nicht einmal über den Tod der Schwiegermutter). Auch mit religiösen Themen habe ich mich kaum auseinandergesetzt, und mein soziales Umfeld beschränkte sich auf meine Arbeit und die Familie.«
Nachdem ich mit dem Patienten über die vier Qualitäten des Lebens (das in diesem Buch ab Seite 68 vorgestellte Balance-Modell) gesprochen hatte, konnte er sich darin wiederfinden und entdeckte, dass der Bereich Leistung überbetont war und dadurch die anderen Lebensbereiche in seinem Leben zu kurz gekommen waren. Leistung und finanzielle Sicherheit waren eine Art Ersatzreligion für ihn. Diese Erkenntnis und die gemeinsame Arbeit in der Therapie ermöglichte es ihm, sein Eheproblem als Chance zu erkennen und ein erfüllteres Leben zu beginnen, mit dem Erfolg, dass er mit seiner Frau die Probleme konstruktiv bearbeitete und heute wieder mit ihr zusammenlebt.
Fazit: Es ist wichtig, für einseitige Entwicklungen sensibel zu werden, gleichgültig, ob man sich auf dem Feld der Psychotherapie, der Religion oder der Erziehung bewegt.
1Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben? (Lichtenberg)
Verschiedene Wissenschaftler über Religion: R. Battegay, R. M. Bonelli, U. Schaefer, H. A. Kick, W. Paris und F. Biland
Die Gotteserfahrung im Menschen
Raymond Battegay3, Basel (Schweiz)
Die Geschichte des Judentums umfasst über 3000 Jahre. Diese Religion rückte die bilderlose Gottesverehrung und die Zehn Gebote mit ihren fundamentalen theologischen, ethischen und sozialen Weisungen ins Zentrum des Denkens und Lebens des jüdischen Volkes. Wesentliche Erkenntnisse davon strahlten auf die weitaus größeren christlichen und muslimischen Religionsgemeinschaften aus, wie auch auf andere monotheistische Religionen. Einerseits lebt der Mensch im ständigen Bemühen, sich selbst zu finden, andererseits strebt er danach, bis an die Grenzen des Erlebbaren vorzustoßen. Er möchte letztlich, sich als Ebenbild Gottes verstehend, seine Einmaligkeit erfahren, aber auch die Gewissheit erlangen, dass eine höhere, ihm Geborgenheit und Sinn vermittelnde Macht besteht, die ihn in seinem Werden und über seinen Tod hinaus begleitet und auch die folgenden Generationen beschützt.
C.G. Jung4 sprach von einem in jedem Individuum angelegten archaischen Gottesbedürfnis, das er Gottesarchetypus nannte. In dieser Sicht möchte der Mensch Erleichterung für seine existenziellen Ängste finden und Anteil an der göttlichen Ewigkeit erlangen.
Wie der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers5 bemerkte, vermag der Mensch seine Sterblichkeit emotional nicht zu begreifen. Er lebt unbewusst und unbedacht, trotz seiner intellektuellen Einsicht in die Begrenztheit seines Lebens, in einer Ewigkeitsillusion. Er plant und schafft Werke, als hätte er für alle Zeiten am Dasein Anteil. Versucht er, sich das Leben zu nehmen, so ist ihm, wie wir aus Abschiedsbriefen von Selbstmördern oder von Geretteten wissen, das Unwiederbringliche bei seiner Handlung nicht vollständig bewusst. Wie wir z.B. auch von Jean Améry wissen6, der in mehreren Essays über den Selbstmord nachdachte und sich schließlich auch das Leben nahm, glauben Selbstmörder bewusst oder zumindest unbewusst, dass sie trotz ihrer fatalen Handlung und nach ihrem Tod in Kontakt mit der Welt bleiben, die sie umgab. Der Akt der Selbsttötung enthält deshalb unbewusst auch die – meist aus mangelnder Selbstidentität heraus entstandene – kompensatorische Größenidee. Sie besagt, dass diese Menschen meinen, die natürlichen Schranken überschreiten zu können, die dem Menschen gesetzt sind. Sie glauben, auf irgendeine Weise mit ihrem Akt der Selbsttötung ein Jenseits in den sozialen Bezügen herbeiführen zu können, in dem ihnen keine Grenzen mehr gesetzt sind und wo sie die Gesetze der Natur überwinden und damit, gottähnlich, unbeschwert am ewigen Leben teilnehmen können7.
Nach der Schöpfungsgeschichte im Alten Testament ist jeder Mensch in seinem inneren Wesen, nicht in der äußeren Erscheinung, ein »Ebenbild Gottes«, wenn man so will, also auch ein Stück Unsterblichkeit. Das Christentum verlegte das Ebenbild Gottes auf Jesus Christus, und mit seiner Gottessohnschaft zog diese Unsterblichkeit auch in den menschlichen Bereich ein. Im Innersten des Menschen ist also die Gottesbeziehung, dieser Bezug zum Ewigen, enthalten. In der griechisch-römischen Antike und in anderen alten Kulturen verkörperten die Götter die Unsterblichkeit, nach der sich der Mensch so sehnt.
Platon8 lässt in seinem Dialog Phaidon den Sokrates wie folgt sagen: »Die Gottheit jedenfalls«, bemerkte Sokrates, »und die Idee des Lebens und wenn sich außerdem Unsterbliches noch finden sollte, wird niemals untergehen – darüber sind sich alle einig. Ja, alle«, sagte er, »bei Zeus, die Menschen und noch mehr, wie mich bedünkt, die Götter. Da nun bekanntlich das Unsterbliche auch unzerstörbar ist, muss dann nicht auch die Seele, sofern sie unsterblich ist, auch unzerstörbar sein?
Der Schluss ist zwingend, das heißt, sobald der Tod den Menschen antritt, stirbt also das, was sterblich ist, an ihm. Doch das Unsterbliche geht heil und unzerstört von dannen; ganz leise hat es sich dem Tod entzogen.«
In diesen Überlegungen ist der Wunsch des Menschen nach ewigem Leben beim Innewerden seines schwachen und vergänglichen Selbst zu erkennen. Die monotheistischen Religionen stellen die Unsterblichkeit des einen, unerfassbaren Gottes ins Zentrum ihrer Lehre. In der Unsterblichkeit seines Gottes versucht der Mensch seine Zeitlichkeit zu überwinden. Die Bereitschaft zur Gotteserfahrung der monotheistischen Religionen dürfte wohl kaum einen gewichtigen anderen Ursprung haben als jenes Gewahrwerden der menschlichen Ohnmacht angesichts der nicht erfassbaren Dimensionen des Kosmos, der den Menschen umgibt.
Wir können die Treue zu Gott und den Glauben an Gott nicht mit rational-naturwissenschaftlichen Mitteln erfassen. Und doch gibt das Göttliche dem Menschen in der unendlichen Größe des Universums – oder der heute angenommenen Universen – die Gewissheit, dass ihm ein mächtiger Begleiter zur Seite steht, der ihn beschützt, aber auch zur Bescheidenheit zwingen müsste.
Sind nicht auch die so genannten Atheisten im Grunde Gottsuchende, die allerdings vergeblich nach einer wissenschaftlich überprüfbaren und beweisbaren Gottesinstanz forschen, statt sie in ihrem Inneren zu suchen? Die unzerstörbare Gottesidee im Kern des Menschen könnte die Menschheit einen. Die ihm eigenen kompensatorischen Größenideen, die seine relative Unscheinbarkeit überbrücken sollten, lassen ihn indes oft seine Möglichkeiten überschätzen und ihn verleiten, die Ideen seiner (religiösen) Gruppe, in die er hineingeboren ist oder die durch seinen Beschluss die seine geworden ist, als die einzige Wahrheit zu interpretieren.
Der in der Bibel angekündigte messianische Friede kann indes dereinst nur dann eintreten, wenn die Menschen nach den vielen Konflikt- und Kriegserfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart endlich erkennen, dass sie auch in und mit einem Kollektiv nicht allmächtig sind. Eine Erlösung zum allgemeinen Frieden in der Menschheit wird nur dann möglich sein, wenn die in allen Erdenbürgern schlummernde Gottessehnsucht in aller Bescheidenheit in den individuellen und kollektiven Bezügen verwirklicht wird.
Psychiatrie und Religiosität
Raphael M. Bonelli, Graz (Österreich)
In der Psychiatrie ist das Thema Religiosität im Kommen. Im Vergleich zu seiner gesellschaftlichen Bedeutung wurde der Faktor Religiosität in der medizinischen (und besonders in der psychiatrischen) Forschung lange Zeit vernachlässigt, ja tabuisiert9. Vor allem in den USA weckt Religion wieder wissenschaftliches Interesse. Zahlreiche US-amerikanische Autoren10 propagieren die Integration der spirituellen Dimension in den medizinischen Heilungsprozess und sind sogar überzeugt, dass praktizierte Religiosität erwiesenermaßen gesundheitsfördernd ist. In Europa dagegen wird oft allein die Fragestellung schon als unwissenschaftlich abgelehnt. Wer sich bemüht, die spirituelle Dimension in den Medizinalltag zu integrieren, muss sich manchmal den Vorwurf gefallen lassen, die vorgelegten Studien seien methodisch schwach und die Datenlage insgesamt widersprüchlich11. Kritische Stimmen meinen außerdem, die zunehmende Aufmerksamkeit der Ärzte für die Spiritualität ihrer Patienten könne zu Missbräuchen führen, weil gerade kranke Menschen besonders anfällig für Manipulation seien12.
Das Thema Religiosität in Zusammenhang mit der Psychiatrie erzeugt eine starke Ambivalenz (vergleichbar mit Themen wie »Euthanasie« oder »Intelligentes Design«), die sich am Ende auch in einer Spaltung unter den Wissenschaftlern äußert. Diese Ambivalenz könnte man mit der Angst vor einem neuen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft deuten, die mancherorts vielleicht Erinnerungen an den Fall Galileo Galilei wecken. In der Tat findet sich für fast jede Meinung in diesem Feld irgendein »wissenschaftlicher« Beleg.
Die wohl umfangreichste und methodisch sauberste Studie wurde im Jahr 2003 von dem renommierten Psychiater Kenneth S. Kendler und Mitarbeitern im American Journalof Psychiatry veröffentlicht13. Dabei wurden 2616 Männer und Frauen anhand eines ausführlichen Fragebogens untersucht. Signifikant waren Geschlecht (Frauen religiöser als Männer), Alter (Ältere religiöser) und Bildungsstand (höhere Bildung religiöser) mit der Religiosität assoziiert. Interessanterweise waren Frauen in sechs von sieben Faktoren religiöser, nur beim Faktor »Gottesgericht« zeigten sich die Männer eifriger.
Religiosität ist mit der menschlichen Psyche und dem täglichen Leben natürlicherweise eng verwoben, was – auch durch ihren absolut privaten Charakter – die psychotherapeutischen Interventionen besonders heikel macht. Es bedarf eines in religiösen Fragen sensiblen Psychiaters, weil praktisch alle psychischen Probleme bei religiösen Patienten auch eine religiöse Dimension haben. Da es nunmehr deutliche naturwissenschaftliche Hinweise gibt, dass Religiosität einen positiven Einfluss auf den Verlauf einer psychiatrischen Krankheit hat, scheint die Wertschätzung dieser Dimension noch dringender geraten.
Diese besagte Sensibilität kann ein Facharzt in der Praxis, der selbst dem Glauben entfremdet ist, nur selten aufbringen. Der Therapeut muss allerdings nicht unbedingt derselben Glaubensgemeinschaft angehören, obwohl dies häufig einen gewissen Vertrauensvorschuss gewährleistet. Auf der anderen Seite kann auch der Seelsorger ohne psychologisches Feingefühl schweres Leid verursachen: Auch mit noch so viel Gebet und verbissenem asketischen Kampf verschwindet keine Depression; von einer Schizophrenie ganz zu schweigen. Psychiatrische Symptome können zwar manchmal durch Schuld ausgelöst sein, oft jedoch treten sie ohne Zusammenhang mit der moralischen Lebensführung auf. Gerade dies ist besonders religiösen Patienten häufig schwer näherzubringen. Psychiatrie/Psychotherapie und Seelsorge haben verschiedene Aufgabenbereiche. Dem Seelsorger geht es gemäß seinem Auftrag in erster Linie um das »Seelenheil« des Patienten, also um eine gelungene Beziehung zu Gott (mit entsprechenden Implikationen in der Glaubenspraxis und im moralischen Bereich). Ein Seelsorger, der sich nur oder vorrangig um die Befindlichkeit seiner Ratsuchenden sorgt, vernachlässigt einerseits den wichtigsten Teil seiner eigentlichen Aufgabe und überschreitet andererseits seine Kompetenz. Es ist für psychiatrische Patienten geradezu gefährlich, wenn der Seelsorger sich als Psychiaterersatz versucht. Diese beiden Kompetenzen zu trennen ist sehr wichtig, ohne dass eine der beiden Realitäten ausgeblendet wird. Aus diesem Grund sind Seelsorger mit psychotherapeutischem Schwerpunkt eine ungesunde (weil für den Patienten wie auch für den Seelsorger verwirrende) Vermischung von Kompetenzen.
Die Erlangung des Seelenheils für den Patienten ist andererseits nicht die Aufgabe des Psychiaters, auch nicht des religiösen Psychiaters. Dessen Aufgabe besteht in der psychischen Gesundung des Patienten, prinzipiell fernab einer Transzendenz. Der Arzt darf dem religiösen Patienten nicht zum Seelsorgerersatz werden (er kann keine Sünden vergeben, spricht nicht im Namen der Glaubensgemeinschaft und muss nicht »predigen« …), auch wenn das der Patient manchmal durchaus wünschen kann. Offen diskutiert wird in der Literatur die Frage der Intervention in psychiatrischmoralischen Grenzbereichen: So ergab eine Studie, dass etwa die Hälfte der religiösen (evangelikalen) Psychiater in den USA ihren religiösen Patienten von einer Abtreibung, von homosexuellen Akten oder von vorehelichen Sexualkontakten abraten würde; etwa ein Drittel würde sogar nicht religiösen Patienten davon abraten14. In diesen Punkten wird in Europa mit Sicherheit mehr Zurückhaltung geübt; ich selbst halte solche Stellungnahmen im therapeutischen Kontext für bedenklich. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Seelsorger bewahrt den Psychiater vielleicht manchmal vor der Versuchung, selbst seelsorgerliche Funktionen zu übernehmen15.
Wozu Religion?
Udo Schaefer, Heidelberg
Die Frage, ob die Religion eine positive Kraft ist, ob sie gut, wünschenswert oder gar notwendig sei, wurde seit jeher kontrovers beantwortet, denn Religion ist immer ambivalent. Sie ist gleichsam eine Arznei, deren Bestimmung es ist, zu heilen, die aber, falsch angewandt, auch das Gegenteil bewirken, das Leiden verschlimmern kann. Das Ziel aller Religion ist das Heil, die Wandlung des Menschen zu einem vollkommenen Wesen und die Wandlung zu einer gerechten Gesellschaft. Weil aber der Mensch, der das Heilige auf Erden verwaltet und gestaltet, ein gebrochenes Wesen ist, sind die Religionen nicht dagegen gefeit, zu entarten. Wenn Religion Fanatismus und Bigotterie zutage fördert, wird sie zur Ursache von Unheil – von Hass, Streit, Gewalt, Terror und Krieg, wie die ganze Religionsgeschichte bezeugt. Unsägliches Leid wurde im Namen der Religion den Menschen angetan: »Tantum religio potuit suadere malorum«, sagt der römische Dichter Lukrez16.
In einer Zeit, da ein zur finsteren politischen Ideologie pervertierter Glaube Menschen veranlasst, mit Gebeten und Invokationen Gottes auf den Lippen, ad maiorem Dei gloriam schlimmste Verbrechen zu begehen, ist es schwierig geworden, für die Notwendigkeit der Religion einzutreten. Leider ist eben alles, selbst die hehrsten Ideen, die höchsten Ziele, die edelsten Zwecke, für Missbrauch anfällig.
Man darf sich von den Deformationen der Religionen nicht den Blick verstellen lassen, dass sie Großes geleistet haben: Sie haben Antworten auf existenzielle Fragen gegeben (Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist der Sinn und das Ziel meines Seins?). Sie haben den Weg für ein glückliches und erfülltes Leben gewiesen und moralische Orientierung gegeben. Sie alle waren die Entstehungsursache für ein substanziell neues Denken, für einen genuin neuen Menschentypus, für die Umgestaltung von Gesellschaften und für den Aufstieg glanzvoller Hochkulturen.
Ich hatte die Religion nur aus der Perspektive ihrer Pathologie gesehen und war darum Agnostiker, bis ich nach Kriegsende dem Bahá’í-Glauben – der jüngsten Weltreligion – begegnete, die mir die Augen dafür öffnete, wie wenig der Mensch ohne ein über ihn hinausweisendes Ziel einen Sinn im Leben und eine Motivation zur Selbstvervollkommnung finden kann und wie sehr er auf seinem Weg zur Selbstfindung auf die Dimension der Transzendenz angewiesen ist.
Wie ein Vogel zum Fliegen zwei Flügel braucht, so braucht der Mensch für seine Erkenntnis beides: Wissenschaft und Religion. Wissenschaft wird aber zu einer »Ersatzreligion«, wenn sie die religiösen Deutungssysteme ersetzen will und im Menschen eine »biologische Missgeburt«, einen »Irrläufer der Evolution« (Arthur Koestler) sieht oder ihn gar ein »Untier« (Ulrich Horstmann) nennt; wenn die moderne Hirnforschung dem Menschen den freien Willen und damit die moralische Verantwortung für sein Handeln abspricht. Ohne den zunehmend über Bord geworfenen Schatz von Wissen und Weisheit, der in den Lehren der Weltreligionen verborgen ist, bleibt der Mensch orientierungslos und wird den Herausforderungen einer globalisierten Welt nicht gewachsen sein.
Wie Hans Küng in seinem epochalen Werk Projekt Weltethos dargelegt hat, braucht die immer näher zusammenrückende Menschheitsfamilie ein gemeinsames Ethos, wenn sie überleben soll. Doch woher soll dieses Ethos kommen? Wie soll der Nihilismus und wie der weltweit um sich greifende, die Bindungskräfte der Gesellschaft aufzehrende Hedonismus überwunden werden?
Dass die europäische Moral in der Krise steckt, haben schon Philosophen im 19. Jahrhundert erkannt. Die Versuche, anstelle der traditionellen religiösen Wertsysteme eine rein rationale, universal akzeptierte Ethik zu schaffen, sind, wie der schottische Philosoph Alasdair MacIntyre nachweist, alle kläglich gescheitert. Das »Sein für andere«, das Ludwig Feuerbach als Grundlage der Menschenliebe empfahl, hat sich als eine kraftlose Theorie erwiesen, die für eine praktische Ethik nicht geeignet ist. Ohne gemeinsamen »Vater« gibt es eben auch keine »Brüderlichkeit« unter den Menschen.
Im fortschreitenden Prozess der Säkularisierung versiegen die religiösen Bindungssysteme. Papst Johannes Paul II. hat beklagt, dass in unserer »entchristlichten Kultur« allzu viele Menschen denken und leben, »als ob es Gott nicht gäbe« (Veritatis splendor 88). Aber, wie Dostojewski Iwan Karamasoff sagen lässt: »Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt!« Allein die Religion schafft ein System transzendenter Werte und Ideale, das die Zentralwerte der Gesellschaft in große, letzte Zusammenhänge einordnet. Sie allein kann den zentralen Werten der Menschen innere Verbindlichkeit verleihen und die Menschen überzeugen, sich den aus ihr abgeleiteten Normen zu unterwerfen.
Hans Küng hat versucht, aus den ethischen Prinzipien, die den Weltreligionen gemeinsam sind, verpflichtende Sätze für eine universale Minimalethik zu gewinnen. Bahá’u’lláh (1817–1892), der Stifter des Bahá’ítums, hat zu einer Zeit, als sich die Völker der Erde noch nicht zur Globalgesellschaft formiert hatten, die Grundlagen für eine Menschheitsethik gelegt, die im Willen Gottes für ein neues Äon verortet ist. Das Menschheitsethos, das in Schillers »Ode an die Freude« erklingt, begegnet uns hier in heiligen Texten: »Der ist wirklich ein Mensch, der sich heute dem Dienst am ganzen Menschengeschlecht hingibt … Es rühme sich nicht, wer sein Vaterland liebt, sondern wer die ganze Menschheit liebt. Die Erde ist nur ein Land, und alle Menschen sind seine Bürger.«
Die Krise unserer abendländischen Zivilisation, die bedeutende Denker wie Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler, Karl Jaspers, Arnold Toynbee angekündigt haben, ist zu einer Überlebenskrise der Menschheit geworden. Ohne geistige Erneuerung, ohne Religiosität kann sie, wie ich glaube, nicht überwunden werden.
Was kennzeichnet aus der Sicht der Psychotherapie eine gute Religion?
Hermes A. Kick, Heidelberg
In der Geschichte gab es eine lange Reihe von Versuchen, mit dem Bösen möglichst endgültig aufzuräumen. Diese Versuche sind allesamt gescheitert: historisch, soziologisch, strukturell und existenziell. Die politische Radikalisierung und mit ihr die Extremform des aktuellen Terrorismus will nicht das Böse, sondern mit dem Bösen aufräumen. Gerade an diesem Vorgehen ist zu erkennen, dass der Terrorismus eben nicht religiös, sondern ideologisch motiviert ist. Er erkennt die Dialektik seiner eigenen Bosheit nicht, ein Kennzeichen jeder Ideologie.