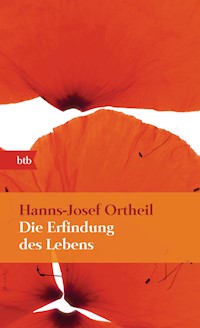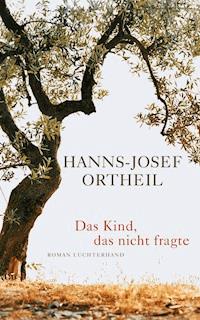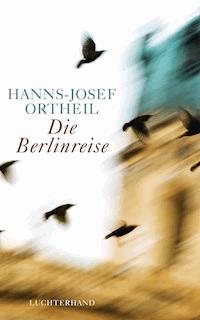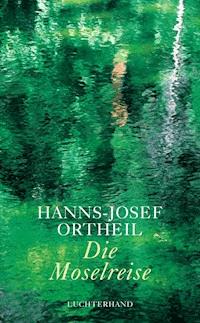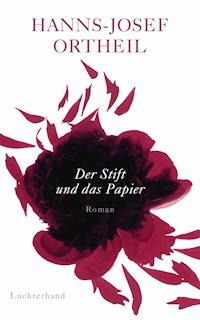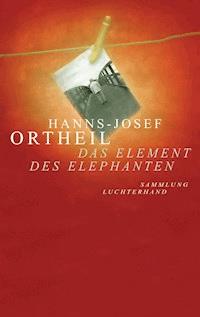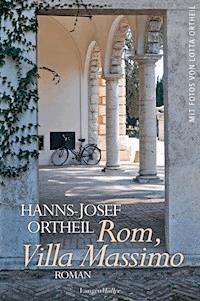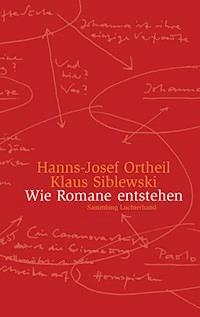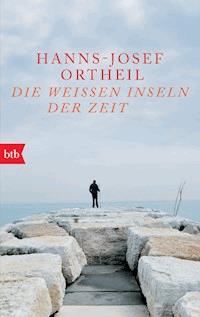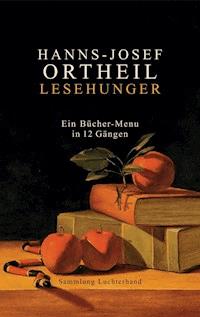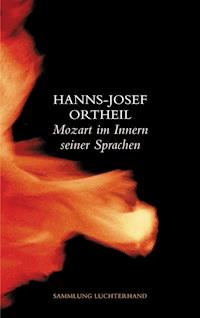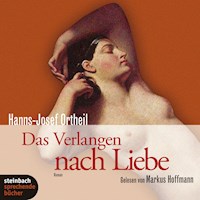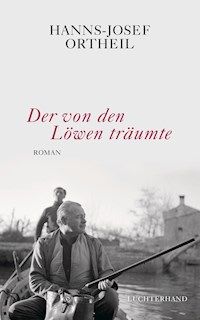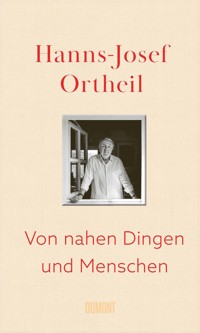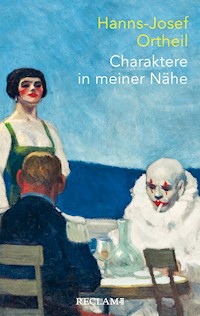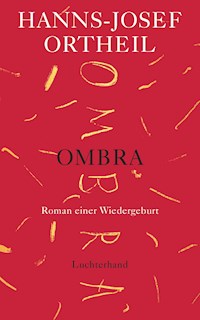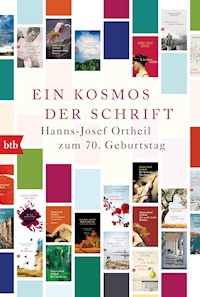9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Geschenkausgabe im kleinen Format, bedrucktes Ganzleinen mit Lesebändchen.
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil hat in seinen autobiografischen, zeitgeschichtlichen und historischen Romanen immer wieder Glaubensmomente dargestellt, in denen die handelnden Akteure sich mit Bruchstücken der christlichen Überlieferung beschäftigen. Mal handelt es sich um Hörerlebnisse in Gottesdiensten, mal um Lektüren biblischer Passagen, aber auch die tieferen Fragen danach, worin der Glaube eigentlich besteht und wie er im alltäglichen Leben erscheint, spielen eine bedeutende Rolle. In dieser Anthologie stellt er einige solcher intensiven Momente aus seinen Romanen vor, erläutert ihre kulturellen Hintergründe und erzählt davon, wie sie entstanden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Ähnliche
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil hat in seinen autobiografischen, zeitgeschichtlichen und historischen Romanen immer wieder Glaubensmomente dargestellt, in denen die handelnden Akteure sich mit Bruchstücken der christlichen Überlieferung beschäftigen. Mal geht es um Hörerlebnisse in Gottesdiensten, mal um Lektüren biblischer Passagen, aber auch die tieferen Fragen danach, worin der Glaube eigentlich besteht und wie er im alltäglichen Leben erscheint, spielen eine bedeutende Rolle. In dieser Anthologie stellt er einige solcher intensiven Momente aus seinen Romanen vor, erläutert ihre kulturellen Hintergründe und erzählt davon, wie sie entstanden sind.
HANNS-JOSEF ORTHEIL wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart, und sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis und zuletzt dem Stefan-Andres-Preis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
HANNS-JOSEF ORTHEIL
Glaubensmomente
Glaubensmomente
Anfang der fünfziger Jahre war der christliche Glaube für meine Eltern, die vor meiner Geburt vier Söhne im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit verloren hatten, das stärkste Fundament ihres Lebens. Damals bin ich in Köln aufgewachsen und habe mit ihnen zusammen erleben dürfen, woraus ein solches Fundament besteht und was es bedeutet.
Meine Eltern kamen aus einem kleinen Ort im Westerwald, wo beide in relativ streng katholischen Großfamilien aufgewachsen waren. Mein Vater hatte zehn Geschwister, meine Mutter vier. Über »den Glauben« wurde in beiden Herkunftsfamilien nicht viel gesprochen oder gar diskutiert. Der Glaube war einfach da, er war in einer langen Reihe von Generationen an meine Großeltern vererbt worden wie ein großes Haus, in dem man sich wohl fühlte und sich gerne und ohne jeden Widerspruch aufhielt.
Auch meine Eltern haben über den christlichen Glauben niemals debattiert oder sich länger darüber unterhalten, auch für sie war der Glaube »einfach da« wie eine Lebensform, die das Leben der Familie bis in den Alltag hinein prägte. Genau hier war der Glaube am spürbarsten: im selbstverständlichen Einhalten bestimmter Rituale, in Formen des Umgangs mit anderen Menschen und in der großen Liebe, die meine Eltern, seit sie sich in ihrem Heimatort während eines Dorffestes kennengelernt hatten, miteinander verband.
Zu den Ritualen gehörte zunächst das tägliche Beten, das meist nur wenige Minuten dauerte. Am frühen Morgen betete ich mit meiner Mutter, und am Abend, vor dem Ins-Bett-Gehen, erneut. Meist wurde ein »Vater unser«, ein »Ave Maria« und noch ein weiteres Gebet (zu einem Heiligen, jeweils wechselnd, vor allem an Gedenktagen) gesprochen. So war der Tag durch die Gebete gerahmt. Das erste und das letzte Wort galten nicht den Themen der Welt, sondern jenen Gestalten oder Personen, die diese Welt entworfen und ihr Prägung und Ausrichtung gegeben hatten.
Anders als in vielen anderen katholischen Familien wurde zu den Mahlzeiten aber nur selten (und meist nur am Sonntag) ein Gebet gesprochen. Mein Vater meinte (und sagte häufig), man solle es mit dem Beten »nicht übertreiben«. In solchen Wendungen kam eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Glauben zum Ausdruck, mit der er sich von der strengen Glaubensausübung seiner eigenen Eltern entfernte. Streng katholisch (im alten Sinn) war meine Familie daher nicht. Man betete nicht viele Male am Tag, man las außerhalb der Gottesdienste nicht in der Bibel, und man gehörte weder einem Pfarrgemeinderat noch sonst einer kirchlichen Institution an.
Wohl aber ging man einmal in der Woche in eine Kirche und nahm an einem (meist besonders festlichen) Gottesdienst teil. Dadurch wurde das Jahr in den Rhythmen und unterschiedlichen Phasen des Kirchenjahres erlebt. Nicht die profanen Festtage, sondern die großen kirchlichen Feiertage wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten waren die Höhepunkte des Jahres, auf die man sich freute und an denen man mehrere Tage lang »feierte«. Speisen und Getränke wurden auf die Themen des Kirchenjahres abgestimmt. Freitags aß man kein Fleisch, in der Fastenzeit reduzierte man das Essen, und in der Adventszeit ging man häufiger in die Kirche (und aß kaum Süßigkeiten, damit sie an Weihnachten umso besser schmeckten).
Ich habe die Glaubensmomente meiner Kindheit in bester Erinnerung. Natürlich haben sie sich während meines weiteren Lebens verwandelt. Ganz verschwunden sind sie aber nie, bis heute nicht. In diesem Buch habe ich einige gesammelt, die in meine Erzählungen und Romane eingegangen sind. Ich kommentiere sie kurz, um auch ihre Herkunft und ihre Hintergründe zu verdeutlichen. Vielleicht regt das die Leserinnen und Leser an, nach ebensolchen Momenten in ihrem eigenen Leben zu fragen.
Hanns-Josef Ortheil
Stuttgart, Köln, Wissen an der Sieg, im Frühjahr 2016
Die Dorfkirche der Kindheit
In meinem Debütroman »Fermer« (1979) gibt es keine Nennungen realer Orts- oder Städtenamen. Deshalb ist für den Leser nicht erkennbar, wo sich der junge Fermer (die Hauptfigur des Romans) auf seiner Reise durch Deutschland gerade aufhält. Im vierten Teil des Romans, der »Die Erinnerung« überschrieben ist, befindet er sich in den Regionen seiner Kindheit auf dem Land.
Ich selbst dachte damals (als Autor des Buches) an den kleinen Ort Wissen an der Sieg, aus dem meine Eltern kamen und in dem ich selbst große Teile meiner Kindheit und Jugend verbracht habe. Natürlich spielte die alte katholische Dorfkirche (die Kirche »Kreuzerhöhung«) darin eine besondere Rolle. Regelmäßig nahmen wir dort zu dritt am Gottesdienst teil, so dass ich das Innere der Kirche bis in jede noch so kleine Einzelheit kannte.
Für ein Kind enthielt gerade diese Kirche aber etwas durchaus Besonderes. Der Kölner Dommaler Peter Hecker (1884–1971) hatte die Kirche in den Jahren 1928–1931 ausgemalt. Das gesamte Langhaus war mit seinen Fresken geschmückt, aber auch die Kuppel sowie der Chor und die Apsis waren voller Bilder, die von den Kirchenbänken aus gut zu erkennen waren. Blickte man zum Priester am Altar, blieb der Blick häufig an der Darstellung des Gottvaters hängen, der oberhalb, in der Apsis, auf einem großen Thron saß und beide Arme ausbreitete.
Genau dieses Bild erscheint auch in »Fermer«. Es handelt sich also nicht um eine freie Phantasie des Autors, vielmehr habe ich auf meine Kindheitserinnerungen zurückgegriffen, in denen das Bild eine bedeutende Rolle spielte.
Wie oft war er in der Kindheit in der alten Dorfkirche gewesen! Mit geschlossenen Augen hätte er sie finden können, hätte er in ihr jede Einzelheit wiederentdeckt! Die Frauen in grauen oder schwarzen Mänteln hatten sich sofort hingekniet, wenn sie in eine der schmalen Kirchenbänke gerutscht waren; sie mussten lange knien und eine ganze Zeit warten, bis sie auf ihrem Sitz Platz nehmen und zum ersten Mal verstohlen um sich schauen konnten, zu sehen, wer gekommen war und in welche Kleider es ihn verschlagen hatte. Die Männer aber waren schneller in den kühlen Kirchenraum gekommen; sie hatten verlegen in den Bänken geknickst und dabei nur flüchtig zum Altar aufgeschaut, um sich dann sofort zu setzen. Ihre Hüte hatten sie an kleinen, drehbaren Haken zwischen den Beinen aufgehangen, von wo diese bei allzu unvorsichtigen Bewegungen mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden gefallen waren.
Die Gebetbücher voll von Heiligenbildern, auf deren Rückseiten die Namen der Toten standen, dazwischen die bekannten Lieder, zu jeder Jahreszeit dieselben; oft hatte er vor Langeweile die Bilder an der Kirchendecke betrachten müssen. Sie waren zu Beginn des Jahrhunderts gemalt worden, und die Großeltern hatten sich noch an den Maler erinnert, der auf einem hohen Gerüst, auf dem Rücken liegend, die Zeichnungen begonnen hatte. Adam und Eva, die Arme schamhaft vor den Leib geschlagen, neben einem verkrüppelten Baum, die Erde voller Risse, aus denen Feuer loderten; in der ausgemalten Apsis thronte der altväterliche Gott mit wehendem weißem Bart, die Rechte in der Höhe, auf einer Insel im unendlich erscheinenden Meer. Wie der Priester am Altar trug er ein Messgewand mit dem Lamm auf der Brust, in der Linken die Erdkugel. Hinter einem Zipfel des bunten Gewandes lugte der Verführer hervor, ganz in Grau, wie eine nicht zu Ende geführte Skizze. Vor dem Thron waren im grün-blauen Wasser die Wellen nur schwach angedeutet; Engel schwammen dort in alle Richtungen davon, die Körper hoch emporgerichtet, segnend, Fackeln in den Händen. Zu beiden Seiten des Thrones aber standen Scharen der in weiße Gewänder gehüllten Propheten, Apostel und Bischöfe, eine unübersichtliche Zahl, die sich bis ins Mittelschiff verlor, von Regenbogen gestützt, die bis zur Taube reichten, die man vor dem goldenen Strahlengrund über dem Triumphbogen sehen konnte. Viele mussten beim Singen, die Köpfe hebend, zur Taube hinaufschauen, und da sie es seit ihrer Kindheit getan hatten, war die Frage, was man sich unter dem »heiligen Geist« vorzustellen habe, längst schon beantwortet.
In den Bänken musste man sich still verhalten und durfte nicht zur Seite blicken. Als Kind hatte er auf den Kniebänken gestanden, um über die hohen Köpfe der Erwachsenen zum von Kerzen umleuchteten Altar zu schauen. Von dort zogen am Sonntag Weihrauchwolken durchs Kirchenschiff.
Auf der Empore mühte sich der Chor, und erschrocken drehte man sich bei den ersten Tönen des Gesangs um, blickte zur Orgel, wurde ermahnt und hielt sich wieder still. In der Kindheit war die Kirche der Ort gewesen, in dem sich die Gerechtigkeit versteckt hatte. Nicht vor das Gericht im Amt gehörten die Verbrecher; sie gehörten in die Kirchenbänke, und indem sie dort knieten, konnte man ihre Schuld erkennen. Seine Schuld zu bekennen, das war immer die erste Pflicht gewesen, und als Kind hatte er sich seiner Sünden und Verfehlungen zu erinnern versucht, jedoch nichts gefunden, war die Sündenkataloge in den Gebetbüchern durchgegangen, hatte erschrocken innegehalten, wenn er sich entdeckt glaubte. Manchmal war die Angst ihm den Rücken hinaufgekrochen, dann war er noch Stunden nach dem Kirchgang stummer als sonst gewesen, hatte die Gedanken an die Kirche aufgehoben wie ein Gut und erst am Abend, geborgen unter der Bettdecke, sich sicher gefühlt und, wie man sagte, »erlöst« …
Es tat ihm gut, sich so zu erinnern, und er nahm sich vor, jene Erinnerungen aus sich hervorzulocken und sie in sich zu befestigen. Was ihm erst die große, ausgemalte Decke der alten Kirche bedeutet hatte, zu der er wie zu einem fliegenden Teppich des heiligen Lebens emporgeschaut hatte – war ihm das nicht dann der Himmel geworden, die Ränder des Blaus, die Wolken, das Licht der Sterne? Der Himmel war zur Landschaft geworden, die sich manchmal zur Erde gesenkt hatte, als könne diese in ihr verschwinden. Wie mochte man wohl früher in den Himmel geschaut haben?
Das Kirchlein der Kindheit
Meine Kinderjahre verbrachte ich, wie schon gesagt, zu einem großen Teil auf dem Land (im Westerwald). Sonst aber lebten wir im Norden Kölns an einem geräumigen, recht großen Platz. Ganz in seiner Nähe befand sich eine Kirche (oder, wie es in der Familie hieß: »Das Kirchlein«). Es standen nur wenige Bänke in dem einschiffigen Raum, aber vorn, direkt nach dem Eingang, gab es eine kleine, dunkle Nische, in der ein Marienbild hing.
Unzählige Male bin ich zusammen mit meiner Mutter in das Kirchlein und in die kleine Nische gehuscht. Nach unseren Einkäufen, vor oder nach einem Spaziergang … – für zehn oder fünfzehn Minuten begleitete ich meine Mutter, und wir knieten dann meist vollkommen unbeweglich und wie erstarrt vor dem Andachtsbild.
Ich wusste genau, dass meine Mutter eine geradezu innige Verbundenheit mit der Mutter Jesu empfand. All ihre Sorgen und Ängste hat sie, vermute ich, mit ihr besprochen, wie mit einer sehr guten Freundin, die sich geduldig jedes kleine Detail anhört. Ich vermute weiter, dass meine Mutter jedes Mal etwas anderes mit ihr besprach und dabei auf keine fertigen, abrufbaren Gebete zurückgriff. Eher mag alles wie eine kurze Unterhaltung gewesen sein, als begegnete man sich wie nebenbei auf der Straße und tauschte fast lautlos ein paar Geheimnisse aus.
Ich selbst wusste nicht, wie ich mich mit der Gottesmutter unterhalten sollte. Und so ließ ich es meist bleiben und betete still den Text einiger Gebete, die ich gut kannte. Als kleines Kind erlebte ich dabei zum ersten Mal in meinem Leben so etwas wie Meditation. Ich war hoch konzentriert, ich hatte wahrhaftig nichts anderes mehr im Kopf. Für kurze Zeit befand ich mich in einem geschlossenen, intensiven Raum der Stille, dessen besondere Kräfte beinahe immer zu spüren waren.
Erneut dachte ich daran, in einen Gottesdienst zu gehen, beinahe an jedem Sonntag kommt dieser Gedanke immer wieder und ganz unwillkürlich. Der Sonntag ist ein Tag, dessen Verlauf und dessen Rituale mir aus den Kindertagen geblieben sind, es ist, als wäre ich damals für immer mit bestimmten Sehnsüchten und Erwartungen geimpft worden, ohne die ich mir einen Sonntag einfach nicht vorstellen kann.
In den Kindertagen war dieser Tag nämlich der Tag des ganz anderen Lebens, des Lebens mit festlichem Charakter, das mit dem sonstigen Werktagleben nur sehr wenig gemein hatte. Einige Bestandteile dieses anderen Lebens hatte ich schon während jener Kirchgänge mit meiner Mutter kennengelernt, die alle paar Tage stattfanden, meist aber nicht länger als einige Minuten dauerten. sie führten uns in eine nahe gelegene Kapelle mit einem spitz zulaufenden Dach, in der es gleich rechts vom Eingang eine Gebetsnische mit einem Marienbild und vielen brennenden Kerzen gab.
Wenn wir uns zum Gebet vor dieses Bild knieten, ereignete sich jedes Mal etwas Merkwürdiges. Schaute ich nämlich konzentriert auf das Bild, wurde die Kirchenstille ringsum um einige Grade stiller, nur noch die feinsten Geräusche waren zu hören, das leise Knistern der brennenden Kerzen oder ein Holzknarren, irgendjemand hatte den Finger auf den Mund gelegt und allem Lebendigen befohlen, stiller und immer stiller zu werden.
Je stiller alles wurde, umso deutlicher aber strahlte das Marienbild auf, so dass ich schließlich sehr ruhig wurde und nur noch in das Gesicht der schönen Maria starrte, als würde ich von ihm in eine Hypnose der Stille versetzt. In dieser Hypnose begann ich zu beten, aber nicht so, dass ich mir bestimmte Worte ausgedacht hätte, sondern eher, indem ich zunächst zuhörte, wie das Beten in mir von selbst begann.
Das Beten begann, wenn mir die bekannten, großen Gebete einfielen, eins nach dem andern kam mir ganz von allein in den Sinn, und ich dachte und sprach sie im Kopf dann von Anfang bis Ende. Die Intensität, mit der ich betete, kam aber auch daher, dass ich neben meiner hingebungsvoll betenden Mutter kniete. Wenn ich etwas verstohlen zur Seite blickte, sah ich genau, wie sehr sie das Beten berührte, es war, als nähme sie sich aufs Äußerste zusammen, so angespannt und konzentriert kniete sie auf der harten Bank und schaute unentwegt die schöne Maria an.
Dieses Anschauen wirkte so, als bettelte sie um ein Gespräch, eine Entgegnung oder zumindest um einen kleinen Wink, alles an ihr hatte etwas Dringliches, so dass ich annehmen musste, es gehe um das Wichtigste überhaupt, um Leben und Tod. Die Anspannung und die hohe Bedeutung, die dem Beten anscheinend zukam, ließen mich daher annehmen, es gebe zwei Leben, das Werktagsleben mit all seinen kleinen Hindernissen, Sorgen und Peinlichkeiten, und das Sonntagsleben mit den Gebeten, dem Besuch des Gottesdienstes und einem festlichen Mittagessen, das an Schönheit und Feierlichkeit genau zu den sonntäglichen Gebeten und Gottesdiensten passte.
Das Gebet und die Gottesdienste waren also ein Hintreten vor Gott, man machte sich klein, sagte seine Verse und Texte auf, bat um seinen Segen und erzählte ihm, was in der letzten Zeit alles geschehen war. Vor allem solche Erzählungen machten das Besondere des Betens aus, man schaute noch einmal zurück, man ließ sich etwas durch den Kopf gehen, oder man überlegte, ob man in dieser oder jener Situation richtig gehandelt hatte.
So war Gott die höchste und strahlendste Instanz, vor der das kleine Leben zusammenschnurrte und sich in ein weites, offenes, großes Leben verwandelte. Der gewaltigste Ausdruck dieses großen Lebens aber stand am Rhein, denn ganz in der Nähe des Rheinufers befand sich der Dom und damit eine Kirche, die alle anderen Kirchen überragte und auch sonst nicht mit ihnen zu vergleichen war.
Ein Glaubensbild meiner Großeltern
Die andächtige Verehrung eines Marienbildes durch meine Mutter und das stille Gespräch mit diesem Bild waren mit Sicherheit angestoßen und angeregt durch ein altes Marienbild, das im Haus meiner Großeltern hing. Dabei handelte es sich um das Bild »Muttergottes in der Rosenlaube« des 1451 in Köln gestorbenen Malers Stefan Lochner, der auch den berühmten Altar der Kölner Stadtpatrone im Kölner Dom gemalt hat.
Jahrzehntelang befand sich eine Kopie dieses Madonnenbildes im Esszimmer meiner Großeltern. Betrat man dieses Zimmer, fiel es einem sofort in die Augen, so dass man für einen Moment innehielt und sich wieder erinnert fühlte: Richtig, da war sie wieder, die schöne Madonna, unter deren »Schutz und Schirm« sich die große Familie geborgen fühlte.
Das Schönste an diesem Bild aber war, dass jedes Familienmitglied ein eigenes Verhältnis zu ihm hatte. Jeder sprach nämlich von ihm in anderer Weise, und jeder betrachtete es so, dass er in ihm etwas von seiner eigenen Art oder seinem eigenen Leben erkannte. So war die »Muttergottes in der Rosenlaube«, die sich heute im Kölner Wallraf-Richartz-Museum befindet, ein Spiegel all der Verschiedenheiten und Unterschiede, die es in unserer Familie gab.
Stefan Lochners »Muttergottes in der Rosenlaube« hing jahrzehntelang im Haus meiner Großeltern, das sich im Siegerland, etwa 100 km östlich von Köln, befindet. Es hing im Esszimmer, über dem schweren Sessel, in dem mein Großvater meist vor und nach den Mahlzeiten saß, um noch etwas zu lesen. An den Feiertagen, wenn die vielen Verwandten sich zur gemeinsamen Mahlzeit in diesem Zimmer versammelten, ging der Blick beim Tischgebet hinüber zu diesem Bild, es war ein Andachtsbild, ein Bild, das scheinbar direkt aus einem Kirchenraum ins Haus meiner Großeltern gebracht worden war, um auch dort ein kleines Stück Kirche unterzubringen und einzurichten. Wenn es einem nicht gut ging, war dieses Bild für einen da, dann betete man zu der Muttergottes als einer Mittlerin, die sich beim höchsten Gott für einen einsetzen würde.
In meinen Kindertagen habe ich den höchsten Gott mit dem Heiligen Geist oberhalb der Marienfigur überhaupt nicht bemerkt, ja ich glaube, dass ich damals überhaupt nur wenige Partien des Bildes wahrgenommen habe. Fast immer fixierte der Blick zunächst das Antlitz Mariens, dieses rätselhaft-fremde Oval mit der breiten Stirn, die ebenmäßige, faltenlose und straffe Haut, unglaublich zart und hell, den winzig-roten, geschwungenen Jungmädchen-Mund, die schweren Augenlider, die den gesenkten Blick noch stärker betonten – dieses blasse, vornehme und ferne Gesicht mit dem goldgelben, in großer Schönheit nach hinten fließenden Haar war alles, was ich erkannte und worauf ich achtete.
Manchmal aber fuhr ich mit meinen Großeltern und den Eltern nach Köln, dann gingen wir vom Bahnhof aus direkt in den Dom, um uns dort Lochners Altarbild der Kölner Stadtpatrone anzuschauen. Vom Dom aus aber spazierten wir oft noch weiter ins nahe gelegene Museum, wo die »Muttergottes in der Rosenlaube« das einzige Bild war, auf das wir überhaupt einen Blick warfen. Wir schauten nach, ob unser Bild sich noch an seiner alten Stelle befand, wir verglichen das Original mit der Kopie, und meist sagte irgendjemand von uns, dass man einfach nicht verstehen könne, warum um Himmels willen das Original einem denn viel kleiner erscheine als die Kopie.
Viel wichtiger aber war, dass ich bei diesen Museumsbesuchen endlich Gelegenheit hatte, unserem »Muttergottes«-Bild auf Augenhöhe und ganz aus der Nähe zu begegnen. Einmal fielen mir dabei die kleinen Engel auf, die sich im Rücken der Madonna über eine Brüstung beugten: Einer der Engel hielt eine rote Rose in der Rechten und streckte sich, um mit der Rechten eine weitere Rose zu pflücken! Ein anderer reichte dem Jesusknaben einen Apfel und hielt in der anderen Hand einen kleinen Korb, hoch mit Äpfeln gefüllt! Zu Füßen der Madonna aber saßen vier etwas größere, musizierende Engel: Zwei Lauten! Eine Harfe! Eine kleine Orgel! Warum aber waren es gerade vier, warum vier?
Seltsam, dass die Muttergottes auf ihr Musizieren nicht reagierte. Sie lächelte nicht, ja, sie kümmerte sich im Grunde nicht einmal ernsthaft um das Jesuskind, das sie gerade noch seitlich auf ihren Knien hielt. Womit also war sie beschäftigt? Mit sich selbst? Mit ihrer Schönheit? Oder war sie eher eine scheue Frau, die zurückhaltend und vorsichtig zur Seite schaute, um sich nicht ganz zu erkennen zu geben?
Meine Großmutter faltete auch im Museum jedes Mal die Hände, sobald sie einen Blick auf das Bild geworfen hatte. Sie faltete die Hände vor der Brust und schaute dann zu Boden, sie betete, aber sie brauchte das Bild nicht anzuschauen, um das zu tun, im Grunde störte das Bild sie sogar beim Beten. Vielleicht erging es der Muttergottes ähnlich, vielleicht betete auch sie, und vielleicht hätte es sie vom Beten abgebracht, wenn sie das Jesuskind oder sogar einen Beter oder Betrachter angeschaut hätte.
Von meinem Großvater wiederum wusste ich, dass er sich nicht so sehr für die Muttergottes und das Kind, sondern vor allem für die Rosenlaube interessierte. Manchmal schmunzelte er, trat näher an das Bild heran und wartete darauf, dass man ihn fragte, ob er sich gerade die Rosenlaube genauer anschaue. Dann nickte er und sagte etwas über die Rosen, meist aber erzählte er auch davon, was er mit dem Rosenspalier in seinem Garten noch so alles vorhabe, je nach Jahreszeit fielen diese Erzählungen anders aus, mal war vom Schnitt, mal vom Hochbinden der Pflanze die Rede, je nachdem.
Mein Vater aber sagte, wenn er Lochners Bild zu Gesicht bekam, meist nur einen einzigen Satz. »Das ist Stefan Lochners Muttergottes in der Rosenlaube«, sagte er, und dann starrte er auf das Bild, als sehe er es zum ersten Mal und müsse uns allen wahrhaftig erklären, um welches Bild es sich handelte.
So standen wir im Halbkreis um Lochners Bild herum, jeder auf andere Weise mit ihm beschäftigt und von ihm geprägt. Für meine Mutter aber war es wohl ein ganz besonderes Bild, denn es war das Bild all ihrer Hoffnungen und all ihrer Ängste. Jedes Mal, wenn sie einen ihrer Söhne während des Krieges und nach dem Krieg verloren hatte, hatte sie vor diesem Bild zu der Muttergottes darum gebetet, dass das Töten und Sterben nun endlich ein Ende haben möge. Vier Mal hatte die Muttergottes sie nicht erhört, vier Söhne hatte meine Mutter verloren, bis die Muttergottes anscheinend zum ersten Mal zugehört und angesichts des Leids meiner Mutter sogar aufgeschaut hatte.
Als ich älter war, hat meine Mutter mir deshalb erzählt, dass die Geburt ihres fünften Kindes (und damit meinte sie natürlich meine Geburt) der Muttergottes in der Rosenlaube zu verdanken sei, denn die Muttergottes habe sich endlich ihrer erbarmt und beim höchsten Gott Fürsprache eingelegt. Seit ich diese Erzählung meiner Mutter gehört hatte, war mir Lochners Muttergottes noch unheimlicher als zuvor, und ich schaute sie während der Sonntagsmahlzeiten im Esszimmer meiner Großeltern nur noch ganz kurz und von der Seite her an.
Statt in das Gesicht der Muttergottes, zu Gott Vater oder zu den Engeln starrte ich auf die große, goldene Brosche, die das dunkelblaue Kleid der Muttergottes als einziges Schmuckstück so auffällig schmückte. Manchmal aber schaute ich auch auf die vier Engel und dann sehr rasch weiter auf den zugewachsenen, grünen Boden: Erdbeeren, ja Erdbeeren! Solche Erdbeeren würde es nach dem Essen geben, frische Erdbeeren, aus Großvaters Garten!
Der Dom der Kindheit
Noch heute bin ich dankbar dafür, dass ich in einer Stadt mit einem der größten Dome Deutschlands aufgewachsen bin. Fast jeden Sonntag machte ich mich mit meinen Eltern auf den Weg zum festlichen Hochamt, das manchmal sogar von einem Kardinal zelebriert wurde. Hatte ich im Kirchlein meiner Kindheit erfahren, was Meditation ist und wie man sie praktiziert, so lernte ich im Kölner Dom das genaue Sehen und Hören.
Denn während der Gottesdienste war genügend Zeit, sich umzuschauen: die Figuren vor den Pfeilern, die Pfeiler selbst, die Kirchenfenster, die Dekoration des Altars. Dazu aber wurde meist eine sehr festliche, geistliche Musik gespielt. Eine große Orgel begrüßte und verabschiedete einen mit ihrem Jubel, ein Chor sang, und manchmal durfte auch die stillsitzende, ruhige Gemeinde etwas singen.
Im Dom habe ich meine beiden Eltern als Sänger erlebt: meine Mutter mit einem hellen Sopran, meinen Vater mit einem oft dramatisch lauten Bass. Vaters Singen hat mich immer am meisten erstaunt, denn er sang im sonstigen Alltag nie, während meine Mutter oft kleine Chansons mit französischen Texten so vor sich hin summte, als wäre sie für ein paar Minuten irgendwo in einem französischen Traum unterwegs.
Überspitzt könnte ich heute sagen: Im Dom lernte ich die Anfangsgründe einer uralten Ästhetik, nämlich der des »Schönen, Guten und Wahren« – und das genau in dieser Reihenfolge und Kombination. Das Schöne bestand aus Bildern, Plastiken, Farben und viel Musik. Das Gute bestand aus den Empfehlungen des Neuen Testaments für ein richtiges Leben. Und das Wahre bestand aus den Glaubensinhalten selbst und aus all ihren schwer zu ergründenden Geheimnissen.
Alle paar Sonntage in den Dom zu gehen – das war in jenen Kinderjahren eines der Erlebnisse, die mich gewiss am stärksten geprägt haben. Es begann damit, dass wir zu dritt am Rhein entlanggingen, die Eltern zu zweit und ich oft auf dem Roller, ihnen voraus. Schon von weitem waren die mächtigen Domglocken zu hören, ihr schwerer Klang füllte das ganze Rheintal und zog einen wie magisch in die Nähe des hohen, schwarzen Gebirges aus Stein, das auf einer kleinen Anhöhe stand, zu der man über viele Stufen hinauf gelangte.
Ich weiß noch genau, wie sehr ich damals bei jedem Betreten des Kirchenraums erschrak, denn sofort nach Passieren des großen Portals ging der Blick ja hinauf in die schwindelerregenden Höhen, an den Pfeilerbündeln und bunten Kirchenfenstern entlang. Ich blieb stehen und wusste nicht weiter, so wie mir erging es aber den meisten Besuchern, sie blieben stehen und schauten eine Zeit lang in die Höhe, als müssten sie zunächst einmal Maß nehmen und sich auf diese den Körper überwältigenden Größenverhältnisse einstellen.
Hinzu kam eine plötzliche, heftige Kühle, es war, als hauchte einen diese eisige Kühle von den Pfeilern und grauen Steinen her an und als bliesen all diese Steine einem ihren jahrhundertealten, leicht modrigen Atem entgegen. Etwas Säuerliches, Bitteres war in diesem Atem, etwas, das einen zurückschrecken und hilflos werden ließ, man wusste nicht genau, ob man in diesem Bau denn auch willkommen war, so viel Fremdheit und Strenge begegneten einem.
Da war es gut, dass der Vater dabei war, denn mein Vater nahm mich meist an der Hand und ging dann mit mir voraus, wir bahnten uns einen Weg durch das rechte Seitenschiff, wo die Menschenscharen bereits dicht gedrängt standen. Nahe der Vierung warteten wir auf meine Mutter, die sich am liebsten gleich nach dem Betreten des Doms in eine der hinteren, noch leeren Bankreihen gesetzt hätte, das jedoch kam für Vater nicht in Frage, er wollte jedes Mal weit nach vorn, in die Nähe des Hauptaltars, die Weihrauchwolken, die während des Gottesdienstes von dort durch das Kirchenschiff zogen, sollten uns erreichen und einhüllen wie schwere Gewänder.