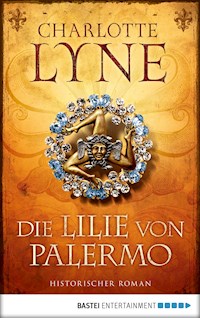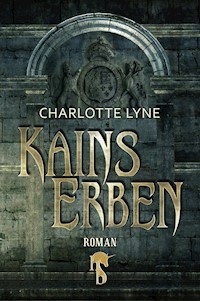6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Glencoe, 1678–1692: Im engen Tal des schottischen Hochlands hält der Clan-Chef der MacDonalds, der MacIan, die Traditionen hoch. Für seinen Sohn Sandy Og erspielt er beim Würfeln Sarah aus dem verfeindeten Campbell-Clan. Von den Frauen des Clans wird sie nie wirklich akzeptiert, aber sie hält zu Sandy Og, dem Schweigsamen, dem niemand etwas zutraut. Der Kampf um die englische und schottische Krone entzweit schließlich auch die Hochländer-Clans. Die einen schwören dem geflohenen König James II. Treue bis in den Tod, andere paktieren mit den Gefolgsleuten der neuen Regenten Mary und William. Sandy Og und Sarah kämpfen an allen Fronten. Um Anerkennung, gegen das Schweigen, um ihre Liebe, ums Überleben, letztendlich auch um den Fortbestand alter Traditionen, die sie aber auch brechen müssen, damit der Clan überleben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Ähnliche
Charlotte Lyne
Glencoe
Historischer Roman
Für Alan
Cruel is the snow that sweeps GlencoeAnd covers the grave of DonaldAnd cruel was the foe that raped GlencoeAnd murdered the house o’ Macdonald.
JIM MACLEAN: „BALLADE OF GLENCOE“
PrologDer Mann aus Glencoe
Glenlyon in Lochaber, Oktober 1678
Glenlyon, so erzählten sich die Alten an den Feuern, war das schönste der Täler in Lochaber. Für Sarah aber, die in sechs Jahren hier nicht hatte heimisch werden können, blieb es das fremde Tal. Sie würde nie eine aus Glenlyon sein.
Sie sah den Männern zu. Hinter der Wurfbahn drängten sich die Bewohner des Tales und Gäste, die zum Leichenbegängnis der Großmutter gekommen waren, so dicht, dass Sarah keinen Zipfel hätte sehen können. Aber Sarah sah alles. Schon immer. Sie war nicht groß und hatte kein Fleisch auf den Knochen, weshalb ihre Tante über sie zeterte: „Die Sarah ist ein komischer Vogel. Mit den besten Bissen kannst du die füttern, die bleibt dürr wie ein Ginsterzweig.“ Doch was für ein Ärgernis Sarahs Leichtgewicht auch für andere darstellen mochte, ihr selbst war es nicht ohne Nutzen: Keine, nur sie, hätte gewagt, in die Rotbuche zu klettern und an altersmorschen Ästen zu hangeln, bis sie alles überblickte.
Es war längst Herbst. Aus den bewaldeten Kuppen der Hügel ragte das Schwarzgrün der Tannen aus Tupfen von Lehmgelb, Erdbraun und Rot. Die Buchenzweige leerten sich so geschwind wie die Schüsseln mit Grütze, die die Tante den Basen hinstellte. Man hätte Sarah leicht finden können, aber niemand achtete auf sie. Ihre Großmutter, die alte Jean Campbell, hatte drei Gatten überlebt und sechzehn Kinder geboren, und alle hatten ihrerseits Kinder, die Jean zu sich holte, wenn diese verwaisten. So kam es, dass es im Tal von Jungvolk wimmelte und eine struppige Sechzehnjährige keinem Menschen wichtig war.
Das war nicht so übel. Wer keinem wichtig war, durfte ungestraft in Bäume klettern. Nur einmal in den sechs Jahren, die sie seit dem Tod ihrer Mutter hier lebte, war Sarah geschlagen worden, und da sie die Striemen jener Schläge noch immer als dickliche Würmer auf den Schenkeln spürte, verzichtete sie gern auf Wiederholung. Dennoch wäre es zuweilen schön gewesen, wichtig zu sein. In der Nacht, sooft der Tod um die Häuser schlich, bekam Sarah Angst, weil sie wusste: Wenn er mich holt und ich morgen fehle, fällt es niemandem auf.
Auch jetzt hätte sie gern im Gedränge einen Menschen entdeckt, der ihr Fehlen bemerkte, aber den gab es von nun an weniger denn je. Die Großmutter, die sie zumindest beim Namen gerufen und ihr erklärt hatte, wie es war, wenn eine heiraten musste, die Großmutter, die vor ihr über die Familie gelästert und des Nachts an ihrer Seite geschnarcht hatte, sie lebte nicht mehr.
Die alte Jean war weit über Glenlyon hinaus eine Berühmtheit gewesen. Ihr Leichenfest währte bereits drei Tage und die Menschen von nah und fern prassten, tanzten und wetteiferten zu ihrer Ehre. Am heutigen dritten Tag, dem Höhepunkt, maßen die Männer des Tales ihre Kräfte mit den Gästen im Weitwurf. Aller Augen waren auf die Linie aus Steinen gerichtet, die den Beginn der Wurfbahn markierte. Daneben lag ein Stapel gespitzter Fichtenstämme, ein jeder dick wie eines Mannes Schenkel. Ein Kerl brauchte die Stirn und Stärke eines Bullen, um einen solchen Stamm zu schleudern. Mithin hatte sich nur eine Handvoll Bewerber eingefunden, obgleich ein Goldpreis winkte, das Ersparte der Verstorbenen.
Sarah entdeckte eine Ansammlung lediger Mädchen, die vorne einen Platz ergattert hatten. „Rob Glenlyon“, kreischte die dralle Fiona, „der Stärkste von allen und der Schönste!“
Tänzelnd setzte der Mann mit dem korngelben Haar einen Schritt, bis seine Stiefelspitze an einen Stein der Linie tippte. Sarah zwang sich, ruhig zu bleiben. Das neue Kleid aus in Hast gesponnener Wolle kratzte, doch sie durfte nicht zappeln, wenn sie nicht abrutschen und sich sämtliche Knochen brechen wollte. Ihr Onkel Rob, der sich sonst gern nach Art der Engländer, der Sassenachs, in Kniehosen und Samtröcke kleidete, trug heute das Gewand seines Volkes: die zwei Teile des Feiliadh, das über die Schulter geworfene Plaid, das seine Brust breiter machte, und den Kilt, der die Waden blank ließ. Er löste das Plaid, legte es sorgsam zusammen und entblößte ein zartweißes Hemd, durch das die Haut rosig schimmerte. Verzücktes Raunen vereinte sich aus fünfzig Frauenkehlen.
Als er den Kopf in den Nacken legte, rann ihm das Haar in Wellen auf den Rücken. „Ein Campbell war der Erste im Bett meiner Mutter!“, rief er. „Also soll ein Campbell den ersten Wurf an ihrer Bahre haben!“
Applaus brandete auf. Er kostete ihn weidlich aus, ehe er sich zur Seite neigte und die Arme um einen Fichtenstamm schlang. Fiona gab Laute von sich, als hätte sie Rob gern verspeist. Wahrscheinlich wünschte sie, er möge statt des Stammes sie umarmen. Hinter ihm standen die Männer, die nach ihm an die Reihe kommen würden, und begrapschten gegenseitig die Muskeln ihrer Oberarme. Einer aber stand abseits. Er trug ein ledernes Wams auf bloßen Schultern.
Sarahs Onkel hievte den Stamm vom Stapel, packte ihn und hob ihn über den Kopf. Johlen und Grölen begleitete jede Bewegung, doch als der Stamm über seinem Kopf in der Luft schwankte, wurde die Menge schlagartig still. Als Rob sich hintenüberbeugte, sah Sarah, wie ihm die Beine zitterten, wie sein Gesicht purpurn anlief; mit ihren scharfen Augen sah sie sogar, wie ihm die Ader auf der Stirn schwoll. Der Stamm stand schräg, stak himmelwärts und neigte sich mit jedem Herzschlag schräger. Gleich reißt er den Onkel um, dachte Sarah. Da aber plusterte Rob sich auf und schleuderte das schwere Geschoss mit einem Schrei nach vorn.
Es schlingerte ein wenig im Flug, verlor vor dem Ende der Wurfbahn an Höhe, fuhr nieder und bohrte seine Spitze in die vom Regen aufgeweichte Erde. Prasselnder Beifall setzte ein, während der Onkel sich mit Grazie verbeugte. Man brauchte wahrlich adlerscharfe Augen, um zu bemerken, dass der stolze Herr des Schlosses Meggernie in den Hüften steif und kein junger Mann mehr war.
Auch als einer von Sarahs Vettern vortrat, der ebenso stämmige wie rotblonde Arthur Campbell, ebbte der Applaus für Rob noch nicht ab. Erst nach geraumer Zeit gebot er mit einem Lächeln Einhalt und räumte für den Neffen das Feld. Wind kam auf, riss zwei Hände voll Blätter aus der Krone und spielte damit Kreiseln. Arthur bückte sich nach dem Wurfgeschoss. Er wirft weiter als der Onkel, dachte Sarah, er ist jung und säuft nicht so viel.
Inzwischen hatte Arthur den Stamm über seinen Kopf gehoben und schleuderte ihn in die Wurfbahn. Selbst einer, der nicht so scharf sehen konnte wie Sarah, hätte bemerkt, dass er nicht mit ganzer Kraft warf. Sein Pfeil kam gut fünf Schritte vor dem des Onkels herunter, noch dazu im falschen Winkel, sodass er sich nicht in den Boden bohrte, sondern polternd aufschlug. Arthur Campbell hatte getan, was sich gehörte. Schließlich musste der Onkel das Erbe der Großmutter erhalten; auch wenn sie seinen Namen nie anders als mit hängenden Mundwinkeln ausgesprochen hatte, war er ihr Erstgeborener. Freundlicher Beifall begleitete Arthurs Abgang, während ein neuer Bewerber in die Bahn trat.
Sarah begann sich zu langweilen und vor Langeweile begann sie zu frieren. Ohne Zweifel würden es die noch wartenden drei Werfer Arthur gleichtun, und sie konnte nur hoffen, dass sie sich beeilten. Den Fremden im Lederwams hatte Sarah vergessen. Er trat als Fünfter und Letzter vor. Merkwürdig sah der aus, die Arme nackt, das dunkle Tartanplaid achtlos vom Leib gestreift, aber am Bonnet ein Zweig Heide. Gelächter platzte in die kühle Luft, in der ein Rest Herbstsonne kläglich flimmerte.
„Wer bist denn du?“, rief die kecke Fiona, da erwartet wurde, dass jeder Kämpe sich mit seinem Namen vorstellte.
„Sandy Og MacDonald aus Glencoe“, murmelte der Fremde, hielt den Blick jedoch gesenkt. Das war unhöflich und zog Rufe des Missfallens nach sich. Sarah aber dachte: Er hat Angst. So wie ich Angst hätte, wenn alle auf mich glotzten.
Noch immer ertönten Schimpfworte, Grollen und Murren. Die aus Glencoe, hatte Sarah sagen hören, waren Mörder und Diebe und ihr Tal war das Tal im Schatten, hinter dem Moor, das Nebel verhüllten. Der Mann hob den letzten Fichtenstamm auf. Er tat es mit einer Spur Zärtlichkeit, wie einer ein Lamm aufhob, das sich ins Moor verstiegen hatte. Auf einmal fror Sarah nicht mehr. Der Mann aus Glencoe war ein ziemlicher Klotz und wirkte schläfrig, als er den Stamm in die Höhe stemmte und sich das Bonnet vom Kopf wischte. Sobald er sich aber nach hinten lehnte, sah Sarah ein viel schlankeres Geschöpf vor sich. Wie eine Weide oder ein Schilfhalm bog er sich, wurde zur Sehne, schnellte vor und schleuderte sein Gewicht in die Flugbahn, ehe er den Pfeil freigab.
Der schien beim Sausen zu pfeifen. Doch Sarahs Blick folgte ihm nicht, sondern hatte sich an dem Mann verhakt, der seinem Geschoss nachblickte, als glaube er nicht recht, dass er es tatsächlich geworfen hatte. Sein Gesicht war rosig vom Wind und sein wirres Haar glänzte wie dunkles Buchenlaub. Als Sarah sich endlich dem Pfeil zuwandte, bohrte der sich weit hinter dem Ende der Wurfbahn in die Erde.
Kurz herrschte Stille, dann brüllte der Onkel los: „Betrüger. Falschspieler. Habt ihr gesehen, wie er über die Linie getreten ist, wie er die Regel gebrochen hat, als wäre er nicht bei ehrbaren Leuten? Diebe und Lügner sind die aus Glencoe, die kommen schon mit Falschheit im Herzen zur Welt!“
Entfesselt stimmte die Menge ein. Röhren, Fluchen, Drohen. Das Gesicht des Beschimpften schien unbewegt, doch auf einmal drehte er den Kopf und sah hinauf in den Baum. Auf Sarah.
„Der meint, ich ließe ihn mit dem Gold meiner Mutter ziehen!“, schrie der Onkel. „Aber da irrt er. Eine Tracht Prügel ist alles, was er in Glenlyon einsacken kann – kein Gold und schon gar keine Braut. Los, Männer, her zu mir, zeigt dem Dreckskerl, wer ihr seid!“
In dem Gewirr der Leiber sah Sarah Waffen zucken, Knüppel, Gerten, Klingen. Der Fremde senkte eine Hand auf seinen Dirk, den Dolch in seinem Gurt. „Behalt dein Gold, Rob Glenlyon, doch auf die Braut habe ich ein Anrecht. Ohne die geh ich von hier nicht weg.“
Vier Männer traten zu ihm. Sie trugen Heide an den Bonnets und einer von ihnen war noch größer und stämmiger als er. „Wir sind gekommen, um die Braut meines Bruders abzuholen“, sagte der Große. „Gebt sie heraus, und ihr seid uns los.“
„Du hast mich gehört!“, schrie der Onkel. „Einen verbläuten Buckel kann er sich holen, aber keine Jungfer aus Glenlyon.“
Der Große zog den Dirk und sprang auf Rob und seinen Haufen zu, aber Sandy Og riss ihn zurück. „Lass gut sein, John. Das hier ist meine Sache.“
Die Männer von Glenlyon rückten vor und hoben ihre Waffen. Dass der Mann, auf den sie einprügeln wollten, den Kopf duckte und die Schultern krümmte, sah nur Sarah. Rob holte mit der Gerte aus und traf den Fremden am Hals. Wie eine Welle türmte und schloss sich die Menge, reckten sich Arme, pfiffen Stöcke, um auf ihn niederzuprasseln.
Vielleicht hätten sie ihn totgeschlagen, das stille Gesicht, die schönen Schultern, alles zu einem Brei aus Blut und Knochen, hätte Sarah ihm nicht das Leben gerettet. Sie hatte ihn angestiert und einen Augenblick lang nicht achtgegeben, und auf einmal glitt sie vom Ast, verlor den Halt und stürzte in die Tiefe. Ich brech mir den Hals, dachte sie im Fall, aber wenigstens lassen sie den aus Glencoe laufen.
Dann prallte sie auf.
Es hatte höllisch wehgetan. Als zerschelle das Häuflein Sarah wie gebrannter Ton. Aber sie war nicht zerschellt. Kaum kam sie zu sich, wurde ihr klar, dass sie sich keinen Knochen gebrochen, sondern nur Schulter und Hüfte geprellt hatte. Auch erhielt sie keine strenge Strafe – dazu war sie in dem Wirrwarr nicht wichtig genug. Als die Menge schon wieder auseinanderströmte, blieb nur Robs Frau Helen bei ihr, zerrte sie auf die Füße und ohrfeigte sie. „Komm mit jetzt. Keine Feier mehr für dich.“ Damit war sie abgefertigt.
Sarah trottete hinter der Tante her. Sie drehte sich nicht um und stellte keine Frage, sondern ging stumm den Weg bis zum Torhaus des Schlösschens, das wie überzuckert auf seinem Vorsprung thronte. Meggernie, der Sitz des Onkels. Rob, der Tropf, hatte die Großmutter stets gewettert. Seinen Bälgern setzt er Lehm und Wasser vor und aus dem gottverfluchten Meggernie macht er einen Palast. Sollte Sarah etwa fortan in diesem Palast schlafen, in dem man mit jedem Atemzug ein Stück kostbaren Inventars beschädigte? Die Großmutter hatte sich dem stets widersetzt und war stur in ihrem windschiefen Haus geblieben.
Es dämmerte schon, als sie das Tor passierten und sich die Schuhe auszogen, wie der Onkel es zur Schonung der Böden verlangte. „Beeil dich“, sagte die Tante und zerrte Sarah mit sich durch die Halle, „komm in die kleine Stube und setz dich zu Tisch.“
Für ihren Frevel erwartete Sarah, kein Nachtmahl zu erhalten, aber die Tante ging doch hinüber ins Küchenhaus und ließ ihr einen Napf mit Suppe auffüllen. Den stellte sie vor Sarah. „Iss.“
Sarah nahm den Löffel, konnte aber nicht essen, denn von dem Sturz tat ihr alles weh und etwas brannte in ihrem Kopf.
„Wird nicht leicht werden, dich durchzufüttern“, sagte die Tante. „Reicht ja kaum für die eigene Brut.“
Dann lass mich doch verhungern, dachte Sarah trotzig. Vor deiner Suppe packt mich ohnehin das Grausen. Auf Meggernie wirkte zwar selbst der Napf für alltägliche Speisen teuer und zerbrechlich, aber das Essen war schaurig und erinnerte Sarah an aus Trögen gekratzte Reste. „Was ist mit denen aus Glencoe geworden?“, fragte sie.
Die Tante seufzte. „Die haben deinen Unfug ausgenutzt, sind auf ihre Gäule und über alle Berge. John, der Tagedieb, hat sich den Goldtopf geschnappt, dabei hätte der uns notgetan und war bis oben hin voll. Die Alte war eine Spielerin vor dem Herrn, aber anders als ihr Sohn hat sie kaum verloren.“
„Hieß der, der geworfen hat, denn John? Nein, er hieß doch Sandy Og und er hat gesagt, der Onkel solle das Gold behalten, er wolle nur die Braut.“
„John ist der Erstgeborene“, erwiderte die Tante und stützte den Kopf in die Hände, „der Erbe des alten MacIain. Du weißt ja, was über die geredet wird: Die stehlen unser Vieh, schneiden unsern Knechten die Ohren ab und singen dabei noch ihr verfluchtes Lied. Jetzt ist das Gold verloren, das deinem Onkel zugestanden hätte, und weißt du, wer daran schuld ist? Keine andere als deine Großmutter, die dem Pack aus Glencoe eine von uns als Braut versprochen hat!“
„Die Großmutter hat das versprochen?“
„In der Tat. John war schon verlobt, aber für Sandy Og hat sie’s dem MacIain zugesagt.“
„Dann müssen wir ihm die Braut doch geben.“
„Das entscheidet dein Onkel“, wies die Tante sie zurecht. „Wenn man mich fragt, kann Sandy Og mit der Braut zum Teufel gehen, dann hätten wir sie wenigstens vom Hals.“
Sarah legte den Löffel beiseite. „Wer ist denn die Braut?“
Die Tante stand auf, ging zum Wandarm und wärmte sich die Hände an der Flamme. „Du“, sagte sie.
Sarah blieb nicht lange auf Meggernie, sondern wurde bald von Robs Knecht ins leere Haus der Großmutter gebracht. Ihr war es recht so. Sie fühlte sich wund und verstört, stopfte das offene Fenster der winzigen Kammer mit Wollzeug aus, damit der Wind nicht gar so gnadenlos ins Innere pfiff, und legte sich gleich schlafen.
Sarah fror trotzdem, denn das Fenster hatte keinen Laden und kein Feuer hatte die Hütte an diesem Tag geheizt. Sie zog sich ein Fell bis an die Ohren und wickelte sich, so fest sie konnte, in ihr Plaid. Sie war nicht überrascht, als es am verstopften Fenster erst zu rascheln, dann zu kratzen begann, denn die Großmutter hatte ihr die alten Geschichten von Cumhaill erzählt, dem Vater des Riesen Finn, der die Druidentochter Muirne liebte und auszog, sie zu rauben, als ihre Hand ihm verwehrt wurde. Ist es denn möglich? Wählt einer mich zu seiner Muirne? Gibt es einen, dem ich wichtig bin?
Sie zwang sich zur Ruhe, kroch aus dem Bett und steckte ihre Kerze an. Schlang das Tuch der Großmutter ums Hemd und richtete sich mit flinken Händen den Zopf. Kein Mensch hatte sie je hübsch genannt, aber sie hatte schönes Haar, dicht und kräftig, wenn auch von aschenem Blond. Ihre Schnallenschuhe, ein weiteres Erbe der Großmutter, sahen an ihren Füßen sehr ordentlich aus.
Ein Hochländer, der kam, um seine Braut auf sein Pferd zu heben, sang ihr für gewöhnlich sein Werbelied, und wie keine anderen wurden die Männer aus Glencoe als Sänger geboren. Der Mann vor Sarahs Fenster aber sang nicht. Stattdessen schlug er Mauerwerk weg, da das Fenster für ihn zu klein war, um hindurchzuschlüpfen.
Um ein Haar hätte Sarah gelacht. Bist du dumm?, wollte sie ihn fragen, warum bittest du mich nicht, dir die Tür aufzutun? Sie lachte trotzdem nicht, denn zu lachen fiel ihr nicht leicht, und sie sprach auch nicht, denn sprechen fiel ihr nicht leichter.
Als das Loch groß genug schien, zwängte der Mann Kopf und Schultern hindurch. Doch die Öffnung war immer noch nicht groß genug, und so blieb er stecken, ein Arm drinnen, ein Arm draußen. Jetzt hätte Sarah erst recht lachen sollen, aber in ihr war kein Lachen. Der Mann klemmte fest wie im Schandbalken, rang und wand sich und litt wahrscheinlich Schmerzen. An seinem Hals klebte noch immer eine dünne Spur Blut, wo der Onkel ihn geschlagen hatte. Er wollte sprechen, öffnete zweimal den Mund, doch von den schnappenden Lippen kam kein Wort.
Dem fällt das Sprechen noch schwerer als mir, erkannte Sarah. Sie ging zu ihm hin, legte ihm zwei Finger auf die Wange und strich daran hinab. Zart wie Kinderhaut. Nie zuvor ertastet. Hastig zog sie die Hand zurück und barg sie in der anderen.
Er sah zu ihr auf. „Ich bin Sandy Og MacDonald aus Glencoe“, sagte er. „Sohn des MacIain, Bruder von John.“
Sie nickte.
„Ich will dich zur Frau.“
Wieder nickte sie, sah, dass er in der Faust etwas umklammert hielt, das sich auf seiner Handfläche offenbarte, als er die zitternden Finger auffaltete. Ein Haferkuchen, zur Kugel zerdrückt. „Magst du Süßes?“
Sarah streckte ihm die Hand hin und er legte die Süßigkeit hinein. Sie schob sie sich auf die Zunge, kaute nicht, sondern ließ sie schmelzen.
„Magst du’s?“, fragte er.
„Ich glaube ja“, sagte sie und blies die Kerze aus.
Im Dunkeln fiel es ihr leichter zu lächeln und seltsamerweise konnte man im Dunkeln hören, ob einer lächelte. Sarah packte die Schultern des Mannes und schob ihn mit aller Kraft zurück; er stöhnte kurz auf und dann war er frei. Ihm hinterdrein stieg Sarah aus dem Fenster.
In den Häusern, die verstreut in der Talsohle standen, brannte kein Licht. Der Onkel hätte während der Nacht Wächter aufstellen sollen, darauf aber offensichtlich verzichtet.
Der Schecke des Mannes wartete an einem Pflock. Als er zauderte, knuffte sie ihn. Da fasste er Mut, hob sie hinauf und schwang sich hinter ihr auf das Pferd. Auf leisen Zuruf setzte sich das Tier in Bewegung.
In der Stille der Sterne ritten Sarah und Sandy Og über das Moor. Sie tauchten ein in die Nebel, ließen Glenlyon hinter sich. Hierher komme ich nicht mehr, dachte Sarah, drehte sich um, wollte nach der Rotbuche und dem Haus der Großmutter sehen, erblickte aber nur des Mannes Schulter, gab sich zufrieden und lehnte sich an. Vernahm sein Herz und den Hufschlag und das Schnaufen seines Atems. „Sandy Og“, flüsterte sie, weil sie wissen wollte, wie sein Name sich anfühlte.
Aus dem Dunkel drang seine Antwort. „Sarah.“
Greenwich, Februar 1689
Mary, die Prinzessin von Oranien, hatte die Überfahrt in ihrer Kabine verbracht, obwohl das Wetter für die Jahreszeit mild war. Aber milde Wetterlagen hin oder her – im Februar unternahm man keine Schiffsreisen, und noch weniger schickte man Damen auf solche.
Nicht zuletzt daher brodelte in Mary von Oranien etwas, von dem sie als Kind gelernt hatte, dass es Zorn war, dass es Damen nicht stand und dass man es zu schlucken hatte, indem man etwas Süßes hinterherstopfte und das Zornige, Undamenhafte vergaß. Mary liebte Feigen im Zuckermantel und Marzipan. Sie strich sich über den Bauch. Diesmal versagte das bewährte Mittel; der Zorn verschwand nicht. Hatte man sie gefragt, ob sie ihr behagliches, bestens ausgestattetes Heim verlassen und in schneidender Kälte über das Meer segeln wollte? Hatte man Mary von Oranien, geborene Mary Stuart, je etwas gefragt?
Als Mädchen von fünfzehn war sie gezwungen worden, ihr Land zu verlassen. Jetzt, wo sie bald doppelt so alt war, zwang man sie, zurückzukehren. Wie konnte man von ihr erwarten, dass sie von diesem Land etwas verstand? Wichtige Männer hatten ihr erklärt, sie sei die Erbin der Krone, dann wiederum, sie sei es nicht, und nun von Neuem, sie müsse es sein. Gelehrt hatte man sie, ihrem Vater in Treue zu gehorchen und ihrem Mann in noch größerer Treue zu folgen. Sie hatte ihr Land nicht verlassen, seine Krone nicht erben und den Mann nicht heiraten wollen, aber sie hatte immer getan, was von ihr verlangt worden war. Es war nicht recht, ihr zuzumuten, dass sie in solchen Wirren Entscheidungen traf.
Wirren gehörten ebenfalls zu den Dingen, die man schluckte, bis im Kopf nichts mehr war, sondern alles sich im Bauch gesammelt hatte. Marys Bauch glich einem gefüllten, ihr Kopf hingegen einem geleerten Fass, und sie hatte niemanden gebeten, den Kopf statt des Bauches benutzen zu dürfen.
Es klopfte an ihrer Tür und gleich darauf trat ein Mann ein, Gilbert Burnet. Dass der Kleriker aus Schottland stammte, merkte man ihm nicht an. Er war nicht im Mindesten unmanierlich, sondern Marys engster Berater. Er hatte ihr vor einem halben Jahr erklärt, Parlament und Regierung von England wünschten eine Invasion, weshalb Mary und ihr Gatte William dem Land zu Hilfe eilen sollten. „England duldet keinen katholischen Monarchen, es will sich seiner entledigen und ist bereit, dem Prinzenpaar von Oranien die Krone anzubieten.“
Der katholische Monarch, dessen England sich entledigen wollte, um an seiner statt William und Mary einzusetzen, war James II., Marys Vater. Sie nahm sich noch eine Zuckerfeige und schob sie sich in den Mund.
„Es wäre von Vorteil, wenn Ihr Euch an der Reling blicken ließet“, sagte Burnet. Er hatte William über das Meer geleitet und begleitete jetzt, zwei Monate später, auch dessen Frau. „In Greenwich empfängt Euch Euer Gatte. Auch steht an den Flussufern Volk, um Euch willkommen zu heißen.“
Mary griff nach einem Marzipanwürfel, der mit kandierten Nusssplittern besetzt war. „Und welches Verhalten wird von mir erwartet?“, fragte sie.
„Zeigt Euch am besten beglückt, Euer Vaterland wiederzusehen.“ Da „Vaterland“ kein klug gewähltes Wort war, fügte er eilig hinzu: „Und Euren Gatten, versteht sich. Den künftigen König.“
Er wandte sich zur Stiege. Als Mary ihr Kleid raffte, um ihm folgen zu können, haftete der Stoff an ihren klebrigen Fingern. Burnet streckte ihr helfend die Rechte entgegen und sie legte ihre verschmierte Hand hinein. Kühle schlug ihr entgegen, die Flussufer lagen im Nebel, und es stank.
„Es besteht kein Grund zur Sorge“, murmelte Burnet. „England will Euch, es öffnet Euch sein Herz. Mit Schottland mag es schwieriger werden, weil im Norden noch Wilde hausen, für die man sich schämt, ein Schotte zu sein. Aber das hat Zeit. Davon lasst Euch nicht den Tag vergällen.“
Was redete der Mann? Wenn ihr schon England fremd war, was sollte sie Schottland scheren? Mary war nie in Schottland gewesen. Ihre Familie, die Stuarts, stammte zwar von dort – das hatte ihr Vater erzählt, als sie sein kleines Mädchen gewesen war und er sie im Schoß mit Naschwerk gefüttert hatte. Aber gemocht hatte der Vater die Schotten nicht.
„Hinter der Biegung bekommt Ihr Greenwich zu sehen“, versprach Burnet. „Denkt daran: Man sollte erkennen, wie Ihr Euch freut.“
Daran hielt sie sich. Lächelnd winkte sie, während ihr Schiff den Hafen anlief, sie jubelte, sobald sie ihren krummrückigen, hustenden Gatten erblickte, strahlte auf der Fahrt mit der Prunkbarke und ebenso, als sie den Palast von Whitehall erreichten. Dort begrüßte sie einen jeden überschwänglich, als erkenne sie ihn wieder, lief durch sämtliche Kammern des düsteren Gemäuers und zog mit entzückten Ausrufen Besitztümer aus Truhen und Schränken.
Tage später kam ihr zu Ohren, dass die Londoner sie für ein Monstrum hielten, weil sie die Räume, aus denen ihr Vater bei Nacht und Nebel gehetzt worden war, so unbekümmert in Besitz genommen hatte. Wer derlei verbreitete, konnte nur ein verbohrter Schotte sein, schließlich hatte Mary nur getan, was man von ihr verlangte. Das hatte sie immer getan. Wer konnte von ihr erwarten, dass sie verstand, was sie tat?
1Das Tal im Schatten
Achnacarry in Lochiel, April 1689
Es war Frühling. Über Nacht waren die Knospen des Ginsters aufgeplatzt und von den Wiesen drang ein Duft in das Haus aus Tannenstämmen, der trunken machte wie dreimal gebranntes Lebenswasser. Es war der Tag vor Beltane und der alte MacIain hockte im Windfang von Achnacarry, dem Heim seines Freundes Ewen Cameron, hielt sich dicht bei der geöffneten Tür und sehnte sich nach seinem Haus. Die Weiber in seinem Tal würden den Fluss entlang vor den Häusern sitzen, Feuer schüren und Bannocks backen, runde Beltane-Kuchen, deren Würze die Lenden stärkte. Von hier bis nach Glencoe würde er selbst bei so klarem Wetter einen halben Tag lang reiten. Wenn er nicht bald aufbrach, käme er nicht mehr rechtzeitig zur großen Nacht, in der ein Mann Söhne zeugen konnte, die stark wie Stiere würden.
Nicht dass der MacIain noch einen Sohn zu zeugen wünschte. Zwei hatte er, dazu den Schwiegersohn und mit Glück bald ein halbes Dutzend Enkelsöhne, das war an Stolz und Sorge genug. Seine Morag war über das Alter hinaus, in dem die Weiber Kinder empfingen, aber er sah sie noch immer gern an, wenn sie das weiße Arisaid, das Plaid der Hochlandherrin, trug, als könnten sie beide noch einmal ein Kind aus ihrem Blut spinnen. Nur sagte er ihr nichts davon, denn es bekam einer Ehe besser, wenn die Frau nicht alles wusste.
Endlich kam sein Freund zurück: Ewen Cameron von Lochiel, der beste Freund, den er besaß. Nur einmal hatte der MacIain einen besseren gehabt, aber das war ein Lebensalter her.
Unter den Chiefs in Lochaber war Lochiel der mächtigste, und wie die meisten Clans fügte sich auch der des MacIains in Glencoe seiner Weisung. Der Freund hatte den Krug mit französischem Wein aufgefüllt. Er trug Rock und Weste aus grüner Seide, silberne Knöpfe daran und den Bart höchst manierlich gekämmt, was den MacIain zum Lachen brachte. Dieses heute so geschniegelte Herrchen hatte in jungen Jahren einem Offizier Cromwells, der ihn entwaffnen wollte, die Kehle durchgebissen und war danach auf dessen Gaul entkommen. Dazu passte der feine Aufzug des Freundes so wenig wie die sorgenvolle Miene.
„Müssen wahrlich die üblen Zeiten sein, von denen du ständig unkst“, warf der MacIain ihm hin, „wenn ein Mann vor Beltane nicht an seinem eigenen Feuer, sondern in der Fremde hockt und kein Weib, sondern nur einen Weinkrug zum Festhalten hat.“
„Die Zeiten sind übel“, verwies ihn Lochiel, trat ins Haus und schenkte ihm den Becher voll. „Und du weißt das, oder nicht?“
Der MacIain dachte kurz nach: „Es ist gewiss übel, dass eine Tochter und ein Schwiegersohn hoffen, dem eigenen Vater die Krone zu rauben, und dass ein Volk seinen König wie einen Strolch aus dem Land jagt. Einen Stuart-König. Das ist fast so, als hätten sie uns Schotten selbst von der Insel heruntergejagt, oder?“
„Auf deine ureigene Weise hast du wohl wieder einmal recht“, bekannte Ewen und ließ sich auf einem Schemel nieder. „Nur weißt du eben nicht, was du mit der Weisheit meinst, die du da von dir gibst. Die Herren, von denen wir reden, wünschen sich in der Tat die Schotten von der Insel. Nicht alle Schotten, aber uns hier im Hochland.“
„Sauf deinen Wein, Alter, schmier keine Teufel an Wände. Welcher Tölpel wäre dumm genug, sich ein menschenleeres Land zu wünschen? Heute ist Beltane und es wird auch noch in hundert Jahren Beltane sein. Dass wir Männer des Hochlands zu König Jamie stehen, versteht sich von selbst; ebenso, dass wir nicht Maulaffen feilhalten, wenn der Sassenach in London irgendeinem Willie aus den Niederlanden Jamie Stuarts Krone aufsetzt.“
„Selbst wenn wir dafür werden kämpfen müssen?“
„Seit wann zierst du dich, wenn es ans Kämpfen geht?“
„Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich wie der geflammte Erzengel auf dich einrede? Ich habe dir bereits gesagt, dass der nämliche Willie seinen schottischen Befehlshaber Hugh MacKay entsandt hat, den fähigsten Heerführer, den er derzeit aufzubieten hat. Einen Hochländer obendrein.“
„Einer, der vom Hochland keinen Pfifferling versteht!“, höhnte der MacIain.
„Betrüg dich nicht selbst“, gab Lochiel zurück. „MacKay ist mit allen Wassern gewaschen. Wenn ein Mann wie er samt einem Haufen Rotröcke nach Leith verschifft wird, wenn Truppenbewegungen vom Grenzland bis hinauf zur Schwarzen Garnison gesichtet werden, geschieht das kaum zum Frühjahrsvergnügen. Und das ist noch nicht alles. Meine Leute in Stirling melden, dass dort die Magazine leer sind wie Londoner Kirchenbänke. Musketen, Piken, Munition – was immer sich bewegen lässt, wird nach Glasgow geschafft, um es an Truppen im Südwesten zu verteilen. Vor der Küste kreuzen die Janet und die Pelican. Weißt du, was für Schiffe die Janet und die Pelican sind, Alasdair? Zwei bis an die Masten bewaffnete Fregatten.“
„Verfluchter Teufelskuss! Also werden wir wie Finns Hunde kämpfen müssen. Aber auch davon geht die Welt nicht unter. Haben wir nicht gekämpft, als der Sassenach Charlie Stuart den Kopf abhauen wollte? Haben wir nicht geheult wie alte Weiber, die Welt ginge unter, und hat der Sassenach König Charlie nicht dennoch den Kopf abgehauen, und steht die Welt nicht trotzdem noch an ihrem Platz? Wir haben doch immer das Blatt herumgerissen, wenn auch bisweilen mit Müh und Not und erst nach Jahren. Kämpfen wir, dafür sind wir Hochländer. Aber hernach brechen wir Bannocks zu Beltane, lassen die Sassenachs Sassenachs sein und küssen unsere Weiber.“
„Es ist den Sassenachs ernst, Alasdair“, insistierte Cameron, „und es geht beileibe nicht allein um Engländer! Gewiss ein Drittel der Anhänger des Willie sind Schotten. Es war Archibald Argyll, der ihm Schottlands Krone angeboten hat. Ein Hochländer! Und er will ihn in Edinburgh krönen lassen.“
„Archibald Argyll ist ein Campbell“, entgegnete der MacIain mit einer Ruhe, die er auf einmal nicht mehr in sich spürte. „Der zählt nicht. Schon sein Vater hat einen Stuart verraten. Und auf das Gesäusel von seinem Oheim, dem Wendehals Breadalbane, gebe ich keinen Penny. Mein Nachbar Rob Glenlyon würde dem Sassenach seine Großmutter verkaufen, wenn er noch eine besäße und sich nicht den letzten Faden Wolle vom Arsch gesoffen hätte.“
Ewen Cameron lachte müde. „Dass solche Leute gefährlich sind, behältst du im Gedächtnis, ja?“
Der MacIain spuckte aus der Tür, dass sein Barde und sein Pfeifer, die auf der Schwelle warteten, die Köpfe drehten. „Das ganze Leben ist gefährlich, Ewen: eine Herde den Black Mount hinauftreiben, ein goldäugiges Mädchen lieben, auf der Heide ein Söhnchen zeugen. Du und ich, wir sind grau. Wir haben Schlachten geschlagen, Prügel ausgeteilt und nicht selten welche bezogen. Vielleicht sind wir in einem Alter, in dem wir lieber vor unseren Türen hockten, die Enkel auf den Knien und das Beißholz zwischen den stumpfen Zähnen. Aber so weit ist es noch nicht. Es geht noch einmal in den Kampf?“
Der MacIain war sich sicher, dass durch einen erneuten Kampf kein Verhängnis drohte. Das abergläubische Weibsvolk – seine Tochter Gormal, seine Schwiegertochter Eiblin, seine Milchtochter Ceana und Morag, seines Herzens Liebste – hätten gesagt: Wir haben den Großen Mann von Ballachullish nicht bei Nacht übers Moor streifen sehen, und wenn der Große Mann nicht bei Nacht übers Moor streift, steht Glencoe nichts Böses bevor. Der MacIain zwirbelte seine Schnurrbartspitze, mit der er sich das Ohr putzen konnte, wenn er wollte, und hieb Ewen freundschaftlich auf die Schulter. „Haben wir nicht Bonnie Dundee an der Spitze, und könnte dieser Teufelskerl nicht höllische Heerscharen in Grund und Boden stampfen? Wir haben doch noch Saft in uns, Ewen. Sieh dir Ranald an. Gegen den sind wir zwei grüne Bübchen.“
Bei der Nennung seines Namens wandte der Barde erneut den Kopf. Er war so alt wie das Jahrhundert und schon Barde in Glencoe gewesen, als MacIain der Zwölfte als Säugling in den eisigen Fluss getaucht worden war, um zu prüfen, aus welchem Holz er geschnitzt war. Ranald hatte ihm von den Heldentaten seiner Väter gesungen, als MacIain auf dem Cairn, dem steinernen Hügel, zum Chief des Tales ernannt worden war, und seither war er an seiner Seite gewesen. Gern hätte der MacIain den Alten in Glencoe gelassen, aber das hätte diesen, den sie ob seines Kriegsruhms Ranald vom Schild nannten, gekränkt. Wo ein Chief hinging, folgte ihm sein Barde, um für ihn zu singen, wie die Riesen der Fianna gesungen hatten, als sie die Wikinger aus Lochaber jagten.
Der MacIain verzog den Mund. Wenn am nächsten Tag die kampftauglichen Männer aufbrachen, um unter Bonnie Dundee gegen die Truppen des Thronräubers zu ziehen, würde Ranald es sich nicht nehmen lassen, sie zu begleiten. Ich werde dich begraben, versprach er dem Alten in Gedanken. Einerlei, wo du vom Gaul kippst, ich begrabe dich auf unserer Toteninsel Eilean Munde, wie die Sitte es gebietet, und deine Tochter singt dir das Totenlied. Dann trank er den Wein aus, der ihm nicht halb so gut schmeckte wie der köstliche Wein in seinem Haus in Carnoch. „Hier hast du mein Versprechen, Ewen: Sobald ich heimkomme, unterrichte ich meine Männer. Morgen in der Frühe marschieren wir.“
„Nach Dalcomera sind es dreißig Meilen unwegsames Land“, wandte Ewen ein.
„Und wen soll das schrecken? Nach Mittag sind wir da. Heute Nacht aber lass mich mit meinen Leuten feiern. Ein Feuer zu Beltane anzuzünden ist wie für einen Stuart-König Waffen anzulegen, und nun sag, ich hätte nicht recht?“
„Hast du das nicht grundsätzlich?“ Ewen Cameron erhob sich. Sein Lächeln war gezwungen, aber immerhin ein Lächeln. „Los, auf den Grauen und nach Hause mit dir! Grüß mir deine Morag, dieses Inbild einer Dame. Und deine Jungen, den wackeren Johnnie und den Kleinen, die hab ich seit einem Zipfel Ewigkeit nicht gesehen. Ist denn alles wohl?“
„Trefflich“, antwortete der MacIain, „ganz trefflich.“ Er hatte Ranald und Big Henderson, dem Pfeifer, bereits gewinkt und wartete auf Ewens Knecht, der ihre Pferde brachte.
„Stiehl unterwegs keine Rinder aus Glenlyon!“, rief der Freund ihm zu, als er sich in den Sattel schwang. „Auf seine Clans in Lochaber muss Bonnie Dundee zählen können – die müssen zusammenstehen und dürfen sich nicht gegenseitig die Luft abschnüren.“
Der MacIain ging hierauf nicht ein – der Freund kannte seine Entgegnung ohnehin. „Wir sehen uns in Dalcomera!“, rief er stattdessen und drückte die Schenkel fest an den Pferdeleib.
*
In Glencoe hatten einst, vor sieben Jahrhunderten, die Fianna gehaust, langhaarige Riesen mit Heldenkräften. Finn, ihr Anführer, hatte ein Horn und zwei Hunde. Als die Wikinger kamen, um sich das Tal zu holen, blies er das Horn und ließ die Hunde los, und die Fianna jagten die Wikinger zum Teufel. Die Schlacht aber kostete teures Blut und als sie geschlagen war, zogen die Helden sich in die Berge zurück, wo sie noch heute schlafen oder über Baumwipfeln singen. Atmen sie schwer, so kommt Wind auf, und sollte dem Tal je Gefahr drohen, so bläst Finn in sein Horn wie einst, und die Fianna stehen auf, um es zu schützen.
In der Beltane-Nacht erwachten diese alten Geschichten zum Leben. Den Fluss entlang loderte vor jedem Haus ein Feuer ins Graurot der Dämmerung. Für Sarah würde es auf alle Zeit so aussehen, als hätte ein Reicher seine Kerzen angesteckt.
Sandy Og, hatte sie gefragt, als sie nach Glencoe gekommen war. Es war ihr schwergefallen, ihm Fragen zu stellen, aber diese war ihr wichtig gewesen. Sandy Og, warum sagen die Leute, Glencoe ist das Tal im Schatten?
Sagen sie das?
Ja, bei uns drüben. Und in Breadalbane.
Bei euch drüben? „Bei euch“ ist jetzt hier, Sarah. Du bist eine aus Glencoe.
Eine aus Glencoe zu sein war so aufregend gewesen, dass ihr das Herz bis hinauf in den Hals hüpfte und sie auf die Antwort verzichtet hatte. Sie sah es ja selbst: Glencoe war eine schartige Narbe in den schwärzesten Bergen Lochabers und die Sonne fand ihren Weg hinein nur schwer. Wollte sie sich nicht in das Nadelöhr bei Loch Leven zwängen, vorbei an der Toteninsel, so musste sie durch das Moor von Rannoch waten, wo Scharen versunken waren, oder über die Nordwand steigen, Aonach Eagach, deren Pass des Teufels Stiegenhaus genannt wurde, weil er tödliche Fallen barg. Hatte die Sonne sich mühsam ins Tal gewunden, so floh sie des Abends früh wieder hinaus, während sie in Glenlyon auf den Hängen liegen blieb und sich behäbig rekelte, ehe sie sich davonstahl.
Für gewöhnlich sagte auch Sandy Og nichts mehr, wenn Sarah schwieg. Dieses Mal aber hob er, ohne dass sie ihn nötigte, noch einmal an: Hör nicht hin, wenn sie schlecht von Glencoe reden, Sarah. Glencoe ist eben eng. Er zeigte mit Daumen und Zeigefinger etwas an, das schmaler war als ein Hochzeitsring. Die Sonne hat’s nicht einfach hier. Aber Glencoe ist ein gutes Tal.
Er hatte recht. Glencoe mochte im Schatten liegen, aber seine Weiden waren fett und saftig, die Wasser fischreich und die Männer gefürchtet. Von den Felsen stürzten hundert Bäche in den Fluss. Wenn Glencoe das Tal im Schatten ist, sagte Sandy Og, dann schüren wir eben Feuer, die die ganze Nacht brennen. Wie wenn einer in seinem Haus die Kerzen ansteckt, oder nicht?
Sarah hatte die Feuer der Wächter betrachtet und zu Sandy Og gesagt: Das muss ein Reicher sein, der so viele Kerzen hat.
Wahrhaftig, es musste ein Reicher sein, auch jetzt noch, nach zehn Jahren. Wir hatten es doch gut, dachte Sarah. Auch wenn wir zwei Schweiger vor dem Herrn sind, wenn er die Lippen nicht aufbekommt und ich die Zähne nicht auseinander, haben wir auf unsere eigene Weise doch geredet. Erst als uns Unaussprechliches geschah, hörten wir zu reden auf. Das, was keinen Namen haben darf, hat uns stumm gemacht.
Schneller als erwartet verschlang die Dämmerung das Tal. Im sich verdichtenden Zwielicht loderte die Kette kleiner Lichter. Die Feuer, die heute brannten, waren keine Wächterfeuer, sondern die Flammen der Beltane-Nacht. In ihnen erhitzten die Frauen von Glencoe Steine, um auf ihnen Bannocks zu rösten, Haferkuchen in runden Scheiben, die man später brach und in Rahm tunkte, um sie zu Ehren wilder Tiere zu verspeisen. Dazu würden sich alle in den Kreis setzen, jede Hausherrin stellte Korb und Rahmtopf bereit, und reihum tauchte jeder ein Gebäckstück ein. Noch triefend führte er es zum Mund, und ehe er hineinbiss, rief er: „Diesen Bannock zu Beltane verspeise ich für dich, Fuchs, der du klüger bist als alle Geschöpfe. Lass es dir wohlergehen und fall mir nicht in mein Hühnerhaus, auf dass mein Tisch gedeckt sei wie der deine.“ Oder: „Für dich, Wolf, sei dieser Bannock verzehrt. Grauer Bruder, wenn unsere Pfade in den Wäldern sich kreuzen, lass uns ohne böses Blut, wie Edelleute, du deines und ich meines Weges ziehen.“
So ging es, bis der Korb mit dem Backwerk fast leer war; nur ein einziger, mit einem Kreuz gekennzeichneter Bannock blieb für jeden Haushalt übrig. Der musste fest wie Stein geknetet sein, da ihn der Hausherr am Ende des Festes einen Hang hinunterrollte, um die Zukunft seiner Familie zu deuten: Wie der Bannock rollte und auftraf, so verlief im Folgejahr das Leben. Sarah schüttelte sich. Sie hatte vor Jahren beim Bannockrollen entsetzlich versagt und seither nicht mitgetan, aber heute wollte sie es wieder wagen, heute sollte alles richtig sein. Nach all der Zeit entdeckte sie in sich noch immer den kindischen Wunsch, zu denen aus Glencoe zu gehören, zu sein wie sie.
Wie die übrigen Frauen teilte sie vom Teig in der irdenen Schüssel einen Klumpen ab, formte ihn zum Kuchen und schob ihn auf den glühenden Stein, wo sie ihn drehte und wendete, bis er goldbraun gebacken war. Sarah war eine schlechte Bäckerin. Zwar hatte sie inzwischen gelernt, den Teig so zu bereiten, dass er nicht klebte, sondern sich reißend von den Händen löste, aber ihr Gebäck verströmte nicht den köstlichen Duft, der über den anderen Feuern waberte. Noch schlimmer aber war, dass an den anderen Feuern Frauen in Trauben zusammensaßen. Sie naschten sich gegenseitig Teig von den Fingern, lachten und schwatzten, stillten Säuglinge und stritten sich mit den lärmenden Kindern. Einzig Sarah saß allein bei ihrem Feuer.
Ihre Schwiegermutter Morag, die Lady des MacIain, lagerte mit ihren Mägden vor dem Haus Carnoch am Ausgang des Tales bei Loch Leven – das wusste Sarah, ohne es sehen zu können, denn Glencoe war ein Arm, der sich im Ellenbogen krümmte. Ihr Schwager John hatte sein Haus keinen Steinwurf weit von ihrem, und davor saßen seine Frau Eiblin, seine Schwester Gormal und seine Milchschwester Ceana, umringt von Kindern. Fünf Söhne und zwei Töchter hatten die Schwägerinnen dem Clan geschenkt und damit bewiesen, welch große Kraft ihren Männern in den Lenden klopfte.
Sarah hörte sich schnaufen. Neid steht dir schlecht, tadelte sie sich und war doch unfähig, den Blick von den Kindern zu lösen. Das siebte, das jüngste, war erst am Morgen zur Welt gekommen, und Eiblin saß schon aufrecht bei den Gefährtinnen, walkte Teig, als hätte sie nicht stundenlang in den Wehen gelegen, und hielt das Frischgeborene im Schoß. Als Sarah sich durch Wehen hatte kämpfen müssen, hatte sie tagelang auf Leben und Tod gelegen.
Es war ein Glück, an diesem besonderen Tag zur Welt zu kommen, vor allem für einen Knaben, denn es bescherte ihm Schönheit und Kraft. Sarahs Schwager John war so ein Beltane-Geborener, stark wie ein Stier und schön wie ein junges Vollblut, und nun hatte er einen an Beltane geborenen Sohn. Der allerdings musste als Enkel des MacIain noch die Probe bestehen. Schon nahte vom Knick des Ellenbogens der Zug, der kam, um das Kindchen abzuholen. Die Hebamme Mairi stolzierte mit klingenden Schellen vorneweg, hinter ihr ritt die Lady des MacIain auf einem so kleinen Pony, dass ihre Füße am Boden schleiften, und von allen Feuern sprangen Frauen auf und folgten. Hinterdrein stolperte der uralte Calum, von dem es hieß, er habe sich um den Verstand gesoffen. Er durfte bei den Frauen bleiben, weil er den Männern lästig war. Kinder umtanzten die Schar. Sie sangen.
Crodh Chailein mo chridhe,Crodh Chailein mo ghaoil,Gu h-eutrom ’san eadradhA’ beadradh ri ’n laoigh.
Colins Rinder,Meinem Herzen so lieb.Colins RinderGeben Milch auf den Hügeln, in der Heide.
Glencoes Lied. Zum Tanz gesungen und zum Kampf, zum Lieben und zum Tod. Die Kinder jauchzten, stürmten los, um dem Zug entgegenzulaufen, und schleiften das Schwesterlein mit den speckigen Beinchen hinterdrein.
Kaum waren die Kleinen davongetollt, erhob sich Ceana. Sie saß stets mit gekreuzten Beinen, und wenn sie aufstand, gebrauchte sie nicht die Arme, sondern drückte sich wie ein Fohlen mit der Kraft ihrer schlanken Schenkel vom Boden. Aber Ceana war kein Fohlen. Sie war Ceana, aufrechter gewachsen als ein Tannenstamm, ihr Haar glich einem nachtschwarzen Gewand. Im Tal sagten sie: Wenn Ceana geht, trägt der Boden keine Narben davon. Sie war nicht mager wie Sarah oder klein wie Eiblin, sondern groß und wohlgestaltet, doch ihren Bewegungen haftete eine Leichtigkeit an, die nichts Irdisches hatte.
Obgleich sie schon weit über zwanzig und damit in einem Alter war, in dem die meisten Frauen selbst schon Kinder hatten, durfte Ceana als lediges Mädchen noch mit den Kindern laufen. Es klang wie ein schlechter Scherz: Ceana, die Schönste des Tales, die Ziehtochter des Chiefs, war eine alte Jungfer. Die ist zu schön, raunten sich die Frauen zu, da traut sich keiner dran, und die Männer, die sich von ihr eine Abfuhr einfingen, zeterten: Soll sie doch warten, bis sie schwarz wird, die Gletscherspalte, für einen braven Kerl ist die sich ja zu gut. Ceana galt als hochmütig und unnahbar.
Was für ein schöner Abend, so trocken, windstill und mild. Mairi, die Hebamme, warf bei jedem Tanzschritt ein Bein, dass es unterm Rock hervorschwang, sie winkte auch Sarah, doch nur flüchtig, schließlich wusste sie, dass die spindeldürre Campbell auf ihrem einsamen Posten sitzen bleiben würde. Sarah hatte sich vorgenommen, heute mitzulaufen. Als aber die anderen Frauen, ohne innezuhalten, weiterhüpften, ließ sie die gespannten Muskeln erschlaffen und blieb, wo sie war.
Von allen Seiten erhielt der Strom Zulauf. Viele hatten sich für den Festtag Flöten und Klanghölzer geschnitten, die sie jetzt mit einem Heidenlärm spielten. Eiblins Achtjähriger, der schon ein Kreuz bekam wie sein Vater, boxte einen andern aus dem Weg, und sogleich entstand eine wilde Rauferei. Schläge hallten, Schreie gellten und wandelten sich zu Gelächter. Sarah duckte sich, als sie den nadelspitzen Stolz spürte, mit dem die Weiber ringsum ihre Söhne begafften.
Ein einzelner Knabe hoppelte dem Zug um das Kliff der Fianna hinterdrein, ein Winzling für seine sieben Jahre und zu langsam, um Schritt zu halten. Er brauchte zum Laufen eine unter die Achsel geklemmte Krücke, denn sein linkes Bein war unbrauchbar: steif und verkümmert, ohne Schienbein, ohne Fuß. Es war Duncan, Sarahs Sohn.
Der Zug rauschte an ihr vorbei. Er saugte die Frauen vor Eiblins Haus auf, nahm die Mutter mit dem Neugeborenen, dem der Trubel galt, in die Mitte und folgte dem Seitenarm des Flusses bis zu einem Feuer, das höher als die anderen brannte. Dort scharte die Menschenschlange sich zum Kreis.
„Dichter, dichter“, bellte Mairi, „drängt euch zusammen, damit jeder sehen kann!“ Heute, an Beltane, in der Nacht der fruchtbaren Kräfte, war die Hebamme, die den fünfmal hundert Männern und Frauen des Tales ihre Kinder ins Leben holte, Herrin des Festes. Wenn gleich die Männer dazustießen, würde sie den segnenden Ritus vollziehen.
Noch aber waren die Männer bei den sumpfschwarzen Rindern. Die prachtvollen Tiere machten Glencoes Reichtum aus und wurden während der grimmigen Jahreszeit auf den Weiden bei Loch Achtriachtan gehalten, wo sie am struppigen Wintergras rupften und vor Hunger brüllten, bis ihnen im Frühjahr die Knochen aus dem zottigen Fell ragten. Da es kein Heu in Lochaber gab, waren manche der Tiere im Frühjahr so schwach, dass die Männer sie aus ihren Verschlägen tragen mussten. Aber die Schwarzen würden sich im Nu erholen, und ehe es Sommer würde, wären sie fett wie Königstöchter. Jetzt, zu Beltane, schmückten die Männer die Hörner der Rinder und päppelten sie mit Grütze aus Getreide auf, um sie für den Marsch zu stärken. Am nächsten Morgen wollten sie sie auf die Hänge des Black Mount treiben, wo die Leute von Glencoe ihre Sommer verbrachten.
Es war ein gutes Zeichen, wenn die Männer kamen und das Beltane-Kalb brachten. Es bedeutete: Das Leben wird in diesem Jahr sein, wie es in allen Jahren war. Hört nicht hin, wenn euch einer ins Ohr zischt, uns drohe das Schlimmste, der Stuart-König sei vertrieben und der Throndieb ein Schlächter, der Schottenblut saufe. Unsere Herden umfassen noch ein Drittel von Tausend, und was wir im Winter verloren haben, wird im Sommer ersetzt. Unsere Weiber sind schön, unsere Häuser bewacht und unsere Söhne hart genug, sie ins Wasser des Flusses zu tauchen.
Sarah wollte all das glauben, wie die anderen es glaubten, und nicht daran denken, dass der MacIain in fliegender Hast zu Ewen Cameron geritten war. Schon nahten die Männer. Sarah wandte den Kopf vom Kreis der Frauen ab und blickte zum Kliff der Fianna, dem Felsen, in dem die ranghöchsten der sagenhaften Riesen schliefen.
Wer eine Horde Männer aus Glencoe auf sich zumarschieren sieht, waffenfähige Männer in der Pracht ihres Tartan, der kann sich nicht fürchten. Nicht einmal Sarah vermochte es, sich dem Zauber zu entziehen. Ein Sturm waren diese Kerle, ein Frühlingssturm, vor dem alles Getier in die Höhlen floh. Sarah war nicht groß, doch sie hatte noch immer scharfe Augen und war gewitzt genug, auf einen Stein zu steigen, um den Fluss zu überblicken.
Colins RinderHübsch wie junge MädchenUnd ihr Fell schwarz gesprenkeltWie der Flügel des Moorhuhns.
Der helle Gesang der Frauen und Kinder mischte sich mit dem vollen der Männer, und so vermengten sich auch ihre Leiber; die Kinder quollen zwischen die Reihen ihrer Väter und umtanzten das geschmückte Kalb. So war es in jedem Jahr, und doch sah Sarah an diesem Abend Schatten auf den Farben: Der MacIain war noch nicht zurück, und er fehlte, als tanze ein Körper ohne Kopf. Warum bin ich eine solche Schwarzseherin? Warum schaue ich dem Schauspiel nicht ohne Sorge zu?
Männer in weißen Hemden und straff gegürteten Plaids hoben ihre Kinder vom Boden und warfen sie in die Höhe, umarmten ihre Frauen, drückten sie an warme Leiber, bargen sie wie Schätze und ließen sich durch Küsse, zärtliche Klapse und neckische Knüffe dafür belohnen, dass sie die Herden über den Winter gebracht hatten.
Sarah stand auf dem Stein und sah mit ihren scharfen Augen alles, auch den einen, der nichts bekam: keinen Kuss, keinen Strich durchs Haar. Wer den Haufen der Glencoe-Männer betrachtete – den stattlichen John und das goldblonde Brüderpaar von Larroch –, der mochte Sandy Og nicht bemerken. Wer aber genauer hinsah, übersah ihn nicht: Sandy Og, das Haar wie ein Blutbuchenwald, die Augen so dunkelblau wie keine Nacht. Sandy Og, immer halb verborgen hinter einem anderen, seinem schönen Bruder oder den blonden Larrochs, und doch von allen der Schönste. Sandy Og, allein und abseits wie der uralte Calum, klammheimlich schön. Mein Sandy Og.
Er würde von ihr enttäuscht sein. Wie immer. Sie hatte alles anders machen wollen, aber sie hatte nichts anders gemacht, und er würde auch nichts anders machen, sondern wortlos die Enttäuschung schlucken. Sein Kind, Duncan Kurzbein, war das einzige, das nicht zu seinem Vater rannte. Stattdessen drängte es sich zwischen die Vettern, die John umringten, erkämpfte einen Platz und wurde weggestoßen. Die Krücke glitt seitwärts, Duncan verlor das Gleichgewicht und stürzte aufs Gesicht. Geschieht dir recht, zwang sich Sarah zu denken und griff sich dennoch ans Herz.
„Jetzt seht alle her!“, rief die Hebamme. Sie riss Eiblin den in Leinen gewickelten Säugling aus den Armen und stemmte ihn auf beiden Händen in die Höhe. „Am großen Morgen von Beltane hat uns die Kraft der Erde ein Knäblein geschenkt.“
Die MacDonalds von Glencoe waren getaufte Katholiken, in Carnoch und auf der Eilean Munde standen Kapellen, und wer Zeit fand, hörte sonntags die Messe. All das Getue von der Kraft der Erde war überlebter Humbug, doch weil er so alt und vertraut war, tat er wohl wie der Glaube, in den Gipfeln schliefen Helden der Fianna, um beim Ruf von Finns Horn zu erwachen und das Tal vor Gefahr zu schützen. „Seht ihn euch an, den wonnigen Brocken!“, rief Mairi und zerrte dem Kind die Tücher herunter, bis es splitternackt an ihrer Brust lag. Lustvoll klatschte sie ihm auf die Hinterbacken, dass es zu brüllen anhob, doch sie selbst überstimmte den Säugling: „Was für ein Riese! Was für ein würdiger Spross für den Stamm des MacIain! Und wieder eine Frucht von den Lenden seines Sohnes John.“
Und wieder eine Frucht von den Lenden seines Sohnes John. Sarah sah nicht nur die Hebamme, die mit dem Säugling auf den Armen niederkniete und sich über den Saum des Flussausläufers beugte, nicht nur die Frauen und Kinder, sondern auch die Männer, die sich aalten und plusterten, um Liebkosungen einzuheimsen. Nur der meine steht still, als heimse er Ohrfeigen ein, erkannte Sarah. Sie beobachtete, wie Ceana ihren Tanz unterbrach und zu Sandy Og hinüberging. Sie blieb vor ihm stehen, schenkte ihm ihr Lächeln und sprach zu ihm mit ihrer streichelnden Stimme.
Sarah wollte nicht vor Tränen blind sein, keinen Druck im Kopf spüren, der ihr die Augen aus den Höhlen sprengte. Sie sollte sich freuen, dass eine andere ihren Mann tröstete, während sie Bannocks buk wie jede brave Frau aus Glencoe. Danach würde sie zu Sandy Og laufen, aber bis dahin war es doch gut, wenn seine Milchschwester ihn tröstete. Oder durfte eine Schwester ihrem Bruder keinen Trost spenden?
Und warum braucht dein Mann Trost?, röhrte es mit dem Blut in ihren Ohren. Unwillig wandte Sarah sich ab und sah zu Mairi, die ihre Arme mit Eiblins Söhnchen zu den Wellen senkte. Der Säugling brüllte. Zu Beltane war die Probe nicht so grausam wie im Winter, aber das Wasser des Coe blieb auch im Mai eiskalt.
Während des Bruchteils eines Herzschlags, in dem das brüllende Menschenbündel über dem Wasser schwebte, erinnerte sich Sarah. Auf einmal war nicht mehr Mai, sondern ein ferner Dezember, und nicht Eiblins Sohn wurde in die Flut getaucht, sondern Duncan, Sarahs Sohn.
Die Verantwortlichen – Ranald vom Schild, der MacIain und die Tacksmen – hatten das armselige Häuflein der Probe nicht unterziehen wollen. Es war ohnehin nicht gesund, würde nie Chief werden, auch nicht, wenn alle Erben vor ihm starben. „Nimm dein Kindchen und zieh’s auf, solange der Herrgott es dir lässt“, hatte der MacIain ihr geraten. „Uns Männern mag das Wurm nichts taugen, aber ich weiß, wie ihr Mütter seid. Tragt ja die Kinder unterm Herzen und nährt sie von eurem Blut.“
Ja, Sarah hatte Duncan unter ihrem Herzen genährt und mit ihm all die Hoffnungen und Träume, die mit ihm wuchsen: Gott, gib, dass es ein Knabe ist. Gott, gib, dass er stark und schön gewachsen ist, gib, dass Sandy Og mit ihm glücklich ist! Sandy Og war sehr glücklich gewesen, als Sarah sein Kind trug. Sie hatte ihn nie so gesehen: spitzbübisch, mit blitzenden Augen, in jedem Wort ein verstohlenes Lachen. „Jetzt weiß ich, warum Cumhaill in Frieden sterben konnte, nachdem er mit seiner Muirne Finn zeugte“, hatte er an Sarahs Ohr geflüstert. All das hatte Sandy Og gesagt, obwohl er so selten sprach und die Lieder der Fianna nie sang.
Doch dann war die Geburt hereingebrochen, ehe das Kind und mit ihm die Träume und Hoffnungen reif waren. Das Lebenschenken war ein blutiges Schlachtfeld, auf dem Sarah und das Kind hätten sterben sollen; es währte drei Tage, aber am Ende überlebten sie beide. Sandy Og warf keinen Blick auf das, was Sarah ihm geboren hatte, sondern stand auf und ging, als man ihm sagte, seine Frau habe das Schlimmste überstanden.
„Lass ihn“, hatte Mairi gesagt. „Er hat Tag und Nacht an deinem Bett gewacht.“
„Ist hart für einen Mann“, hatte Gormal hinzugefügt. „Für Sandy Og erst recht. Weißt du, wie viel Hohn er sich von seinen Kumpanen gefallen lassen muss?“
Das wusste Sarah nicht, nur dass sie ihn enttäuscht hatte. Sie hatte ihn gehen lassen. Und vor dem MacIain bestand sie darauf, dass auch an ihrem Sohn die Probe vollzogen wurde. Jeder wusste: Wenn eine Mutter so etwas forderte, bedeutete es: Ich will das Kind lieber tot, als dass es dem Clan nicht genügt. Und das, obwohl Sarah wie eine Verdurstende auf dieses Kind gewartet hatte.
Der MacIain hatte ihrem Drängen nachgegeben, und daher hatte Sarah wie jetzt Eiblin neben Mairi am Ufer gekniet – wenn auch im Schnee statt im Gras. Mairi hatte die Arme aufs Wasser gesenkt. Das Wimmern des Säuglings verstummte, die Wellen teilten sich, und die Arme der Frau tauchten unter, bis der winzige Leib verschwand. Das Wasser war so eisig, dass die Alte sich auf die Lippen biss, und unhörbar zählten die ringsum Versammelten: Eins für Kraft und Zähigkeit. Zwei für unbeugsamen Mut. Drei für die schützenden Hände alter Götter. Mit Schwappen und Spritzen wurde ihr Kind aus dem Wasser gezogen, und in dem einen Atemzug sah Sarah seine Augen. Weit aufgerissen, der Kranz der Wimpern an die Lider geklebt. Du wirst leben. Unbewegt wartete sie ab, bis ihr Mairi den Knaben, der eisblau angelaufen war, wieder in die Arme legte.
Heute aber war es Eiblin, die ihr Kind an sich drückte, aufsprang und einen Siegesschrei in die Frühlingsluft stieß. Im Nu war John bei ihr, ihr Mann, der Erbe des Chiefs, um Frau und Sohn in die Arme zu schließen. Die rundliche Eiblin schmiegte sich an ihn und presste ihm die Hand aufs Hinterteil, als wären sie allein. „Fraoch Eilean!“, brüllte John, Heideinsel, das war das Motto der MacDonalds, die ihr Geschlecht auf den jungen John von der Heide zurückführten, den heldischen Stammesgründer der Legende. „Lang lebe der Clan MacIain! Lasst uns das Kalb schlachten. Ich stifte für meinen Sohn drei Fässer Wein.“
Das war mehr als großzügig, und zur Antwort ertönte ein dankbares Heulen. Wimmelnd löste der Pulk sich auf, die einen liefen, um das Kalb auf den Rost zu stemmen, und die andern beeilten sich, den Wein in Krüge zu schenken. Noch lachte und grölte alles durcheinander, doch es dauerte nicht lange, bis Musik die Stimmen verschluckte. Pfeifen und Fiedeln klangen auf, und der Tanz begann. Bunte Wolle wippte, Sohlen stampften wie Schmiedehämmer, Haar flog, Schenkel protzten, auf geschwellten Brüsten hüpften Ketten. Lippen teilten sich. Kehliges Lachen versilberte das Dunkel. Sarah, die von ihrem Stein stieg, um nicht mehr alles sehen zu müssen, war noch in den Jahren, in denen Frauen Kinder empfingen, aber Sandy Og kam nicht zu ihr.
Kurz darauf kündeten Hendersons Pfeifen von weiterer Freude: Der MacIain kehrte auf seinem riesigen Grauschimmel zurück. Er ließ sein weißes Haar vom Nachtwind zerzausen und trug seinen gelben Mantel, von dem er prahlte, er habe ihn einem Campbell gestohlen. Hinter ihm ritten Barde und Pfeifer, und seine Hunde umsprangen ihn, wie Bran und Sceolan einst den Helden Finn umsprungen hatten. Als er sein tanzendes Volk erblickte, sprang der Chief gieriger als jeder Jüngling vom Pferd. „Es ist Beltane!“, brüllte er, „und wer, wer, wer hat die fettesten Rinder und die schönsten Weiber von Lochaber?“
Der MacIain war das Leben selbst. Ehe du den totkriegst, sagten seine Feinde, reißt du die Heide mit Stumpf und Stiel aus dem Grund. Er zog seine Frau in die Arme und drückte sie an sich wie einer, der sich noch ein Dutzend Söhne wünscht. Morag, die Lady Glencoe, trug das weiße Arisaid noch immer mit Würde. Einst war sie die lieblichste Blume des Tales gewesen. Die war jetzt Ceana, ihre Milchtochter, die sich der MacIain als Tänzerin holte, sobald die Runde mit seiner Frau vorüber war. Bei alledem war ihm nicht die geringste Sorge anzumerken. War die Zusammenkunft mit Lochiel also glücklich verlaufen oder verbarg der MacIain nur, was ihn bedrückte?
Er tanzte zweimal mit Ceana um den Weidenbaum, dann tanzte er mit seiner Tochter Gormal, anschließend mit seiner Schwiegertochter Eiblin, der er für den Enkel, den sie ihm geschenkt hatte, einen schnalzenden Kuss auf die Wange setzte. Als John sie ihm wieder abnahm, sah der MacIain sich um.
Auch wenn Sarah sich hinter einem Baum verbarg, entdeckte der Chief sie. „Magst nicht tanzen, a graidh?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Und Wein?“
Zögerlich blickte sie auf. Sein Wein war als so vorzüglich bekannt, dass man das Haus ihres Schwiegervaters auch „Haus der Weinbecher“ nannte. Er würzte seinen Wein selbst und machte ein großes Geheimnis darum. Als sie ihn einmal gefragt hatte, was er hineingab, hatte der MacIain seinen wild behaarten Kopf an ihr Ohr gelegt und „Erde“ geflüstert. Jetzt hob er die Brauen. Sarah nickte. Er strich ihr das Haar von der Schläfe, dann ging er und kehrte mit Krug und Becher zurück.
„Müsst Ihr fort, Vater MacIain? Ruft Lochiel Euch für König Jamie in die Schlacht?“
„Ah bah! Bist du ein Kerl, dass du mir solche Fragen stellst? Sehen Kerle etwa neuerdings so reizend aus?“
Nein, dachte Sarah. So sieht eine Campbell aus. Und hängt nicht von solchen Fragen ab, ob ich in Glencoe bleiben darf? „Lasst es mich wissen“, bat sie ihn.
„Verfluchter Teufelskuss!“, stieß der MacIain aus. „Ich lass dich was anderes wissen, denn das geht dich an: Dein Mann, mein Sohn Sandy Og, ist ein Glückspilz vor dem Herrn und steht trotzdem in der Beltane-Nacht herum wie ein verstaubter Weihepriester. Wenn du willst, geh ich zu ihm und mach ihm Beine.“
„Nein.“
„Was ‚nein‘?“
Sie lachte. „Dass du Sandy Og Beine machst, will ich nicht.“
„Dann tu’s selbst“, sagte der MacIain und wies mit dem Kopf zu Sarahs Mann, der am Rand des Tanzgevierts stand, während ein schönes Mädchen mit hüftlangem schwarzen Haar an ihm zerrte.
Verrätst du mich, Sandy Og? Deine Leute würden sagen, es geschieht mir recht, aber wie kannst du mich verraten, du, der du gelobt hast, dass ich dir fehle, wenn nachts der Tod kommt und mich holt? „Hörst du mich, Sarah?“, drängte der MacIain. „Verlier keine Zeit, es ist spät, und ehe ihr die Bannocks bringt, will ich das Mannsvolk sprechen.“
„Warum, Vater MacIain?“