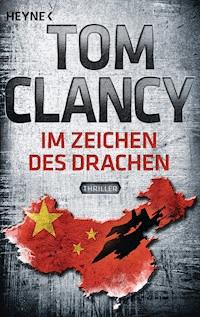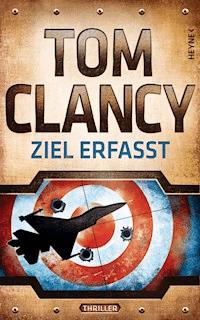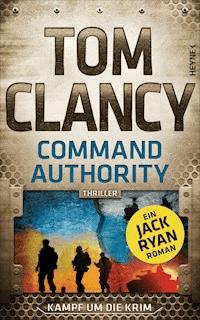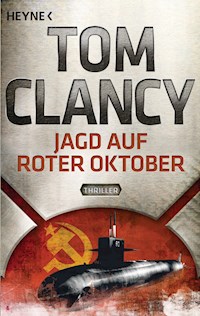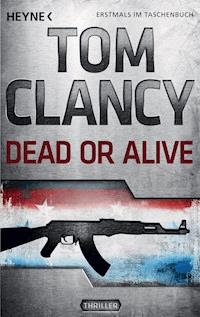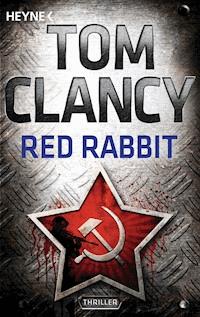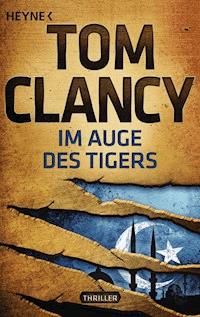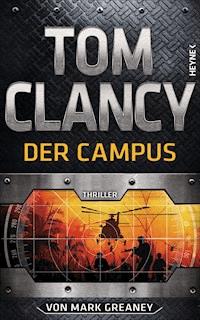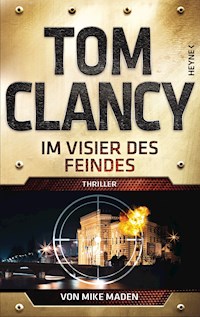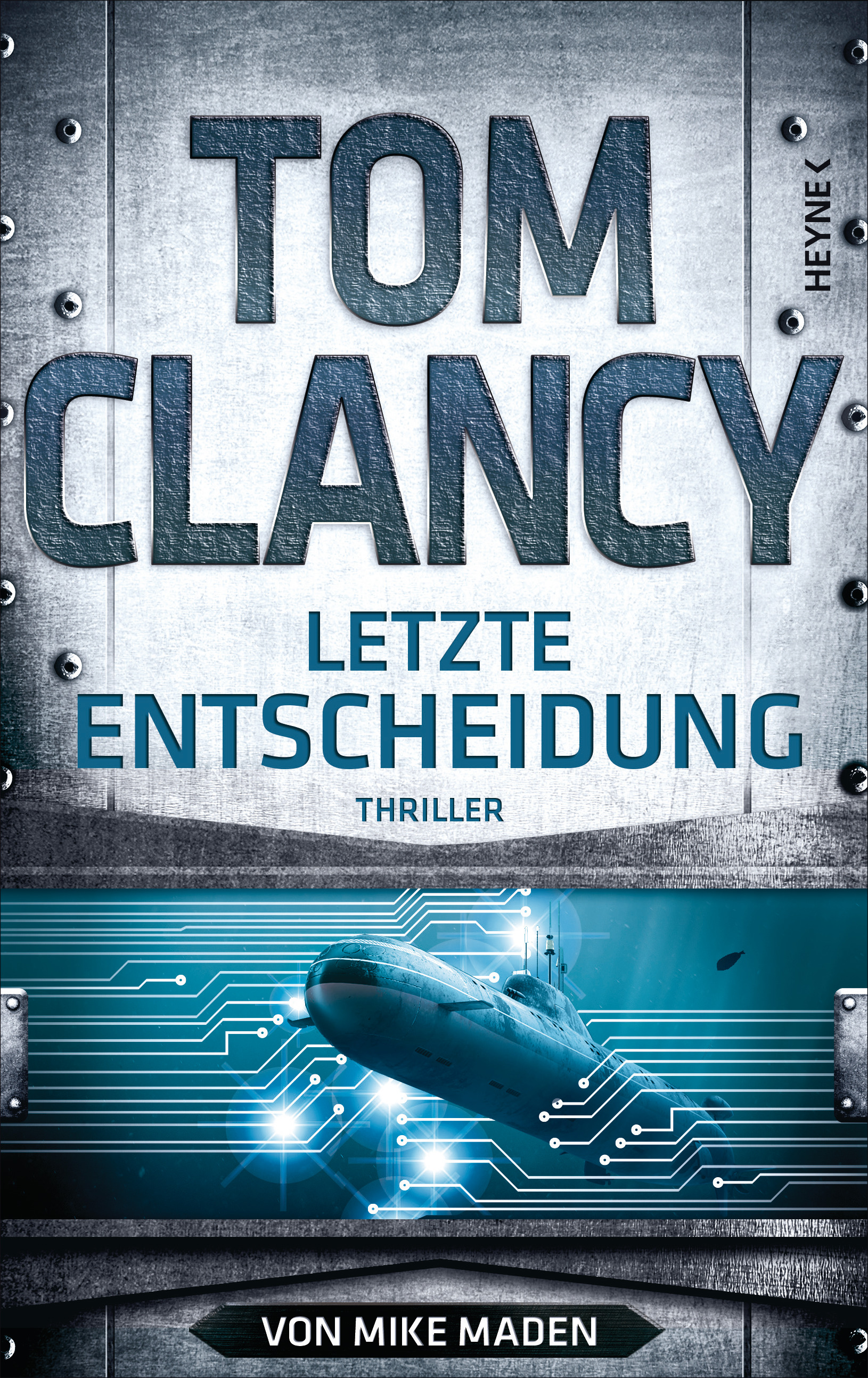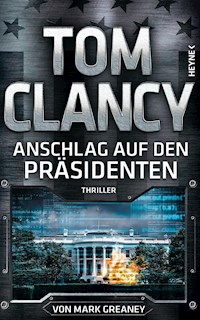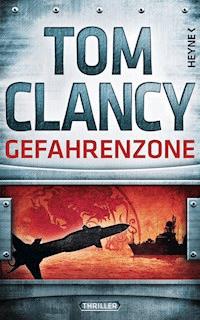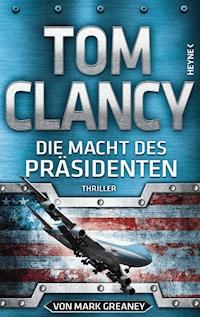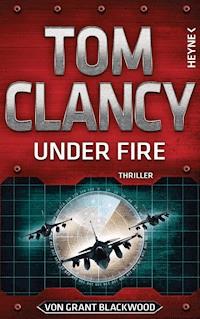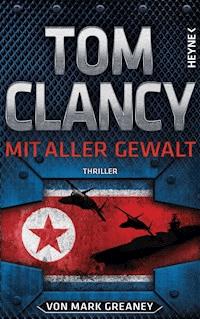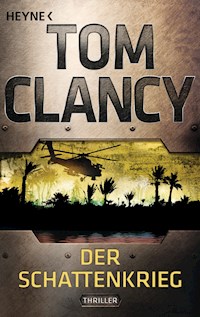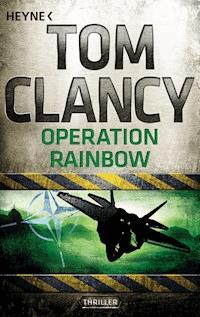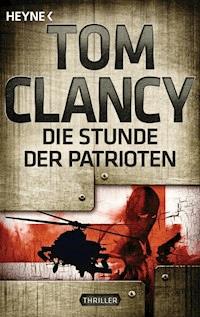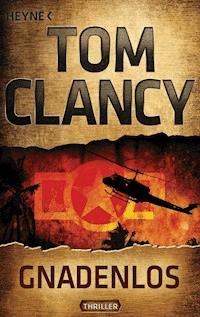
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
John Kelly, ehemaliger US-Marine und Spezialist für riskante Missionen, erhält den Auftrag, amerikanische Geiseln aus Nordvietnam herauszuholen - eine beinahe aussichtslose Mission, zumal Kelly sich gerade durch einen privaten Rachefeldzug in Lebensgefahr gebracht hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und der geringste Fehler könnte sein letzter sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1328
Ähnliche
TOM CLANCY
GNADENLOS
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulli Benedikt
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
DAS BUCH
John Kelly war früher Spezialist der US-Marine für riskante Kommandos. Nach dem Unfalltod seiner schwangeren Frau kommt er mit dem Leben nicht mehr zurecht. Menschliche Wärme findet er erst wieder bei Pam, einer jungen Frau mit einer düsteren Geschichte. Als ihre Vergangenheit sie auf grausame Weise einholt, fasst Kelly einen verzweifelten Entschluss: Er will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Zu dieser Zeit plant das Pentagon eine spektakuläre Aktion, um amerikanische Kriegsgefangene aus einem vietnamesischen Lager zu befreien. Dort kennt sich keiner so gut aus wie Kelly und er kann sich dem geheimen Auftrag nicht entziehen. In beiden Fällen trifft er auf übermächtige Gegner, auf Verrat und Intrigen. Er muss mit der tödlichen Gewissheit leben, dass jeder falsche Schritt unweigerlich das Ende bedeutet.
DER AUTOR
Tom Clancy, geboren 1947, hatte mit seinem ersten Thriller Jagd auf Roter Oktober auf Anhieb internationalen Erfolg. Clancy gilt als Begründer des modernen Techno-Thrillers und zählt neben John Grisham zu den erfolgreichsten amerikanischen Spannungsautoren. Aufgrund seiner gut recherchierten, überaus realistischen Szenarien wurde der Autor nach den Anschlägen vom 11. September von der amerikanischen Regierung als spezieller Berater hinzugezogen. Bei Heyne erscheinen Tom Clancys große Thriller aus dem Universum um den Spezialagenten Jack Ryan.
Am Ende des Buches findet sich ein ausführliches Werkverzeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag lieferbaren Tom-Clancy-Thriller.
Die Originalausgabe WITHOUT REMORSE erschien bei G. P. Putnam’s Sons, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 1993 by Jack Ryan Ltd. Partnership Copyright © 1995 der deutschsprachigen Ausgabe by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg Copyright © 2012 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München. Covergestaltung: Nele Schütz Design Covermotiv: Shutterstock
ISBN 978-3-641-22664-0V007
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
In der Original-Hardcoverausgabe von Gnadenlos war ein Gedicht enthalten, auf das ich durch Zufall stieß und dessen Verfasser und Titel ich zunächst nicht ausfindig machen konnte. Dieses Gedicht erinnerte mich sehr an meinen kleinen Freund Kyle Haydock, der im Alter von acht Jahren und sechsundzwanzig Tagen verstarb; für mich wird er jedoch niemals wirklich gegangen sein.
Erst später erfuhr ich, daß der Titel dieses Gedichts Himmelfahrt lautet und daß Colleen Hitchcock, eine außergewöhnlich talentierte Dichterin aus Minnesota, die Autorin dieser wundervollen Zeilen ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ihr Werk allen Literaturstudenten ans Herz legen, und ich wünsche mir, daß ihre Worte – so wie sie bei mir Aufmerksamkeit und Begeisterung hervorriefen – in ähnlicher Weise auch auf andere wirken mögen.
Arma virumque cano Publius Vergilius Maro
Hüte dich vor dem Zorn eines sanftmütigen Mannes
John Dryden
Prolog:
Treffpunkte
November
Camille war entweder der stärkste Hurrikan oder der mächtigste Tornado der Weltgeschichte gewesen. Auf jeden Fall hatte er bei dieser Bohrinsel ganze Arbeit geleistet, dachte Kelly, während er sich die Sauerstoffflaschen für seinen letzten Tauchgang im Golf von Mexiko auf den Rücken schnallte. Die Aufbauten waren nur noch ein Trümmerhaufen, die vier wuchtigen Stelzen allesamt ramponiert – verbogen wie das kaputte Spielzeug eines Riesenbabys. Alles, was sich noch entfernen ließ, war bereits abmontiert und mit dem Kran auf die Barkasse verladen worden, die den Tauchern auch als Stützpunkt diente. Übrig blieb nur das Skelett der Plattform, das den Fischen bald einen hervorragenden Unterschlupf bieten würde, dachte Kelly, als er das Beiboot bestieg, das ihn hinüberbringen sollte. Zum Team gehörten noch zwei weitere Taucher, aber Kelly hatte das Kommando. Während sie ihre üblichen Vorbereitungen trafen, umkreiste sie ein Küstenwachboot in hektischen Bahnen, damit die Fischer vor Ort nicht zu nahe herankamen. Ganz schön dumm von ihnen, herzukommen – während der nächsten paar Stunden würde es hier sowieso nichts zu angeln geben –, aber solche Ereignisse zogen eben Neugierige an. Und schließlich wird ihnen hier ja auch was geboten, dachte Kelly mit einem Grinsen, als er sich rücklings ins Wasser fallen ließ.
Unter Wasser war es unheimlich, das war immer so, aber irgendwie auch behaglich. Sonnenstrahlen drangen durch die gekräuselte Oberfläche, bildeten sich ständig verändernde Lichtvorhänge, die um die Stelzen der Plattform schwebten. Das ermöglichte eine gute Sicht. Die C4-Ladungen, acht Zentimeter dicke Blöcke mit einem Durchmesser von gut 15 Zentimetern, waren bereits an ihrem Platz, mit Draht fest an den Stahl gebunden, und die Zündung so angebracht, daß sie nach innen detonierten. Kelly überprüfte jeden Block gründlich, beginnend mit der ersten Reihe, die drei Meter über dem Boden angebracht war. Er arbeitete dennoch rasch, weil er nicht länger als nötig hier unten bleiben wollte, genausowenig wie die anderen. Die Männer hinter ihm spulten die Zündleitung ab, die sie fest um die Blöcke wickelten. Beide waren erfahrene UDT-Männer aus der Gegend, beinahe ebenso gut ausgebildet wie Kelly. Er überwachte ihre Arbeit, und sie überwachten seine, denn Männer von diesem Schlag zeichneten sich durch Vorsicht und Gründlichkeit aus. Die untere Ebene erledigten sie in zwanzig Minuten und stiegen dann langsam zur oberen Reihe auf, die sich gerade drei Meter unter der Wasseroberfläche befand. Hier wiederholten sie gründlich und sorgfältig die gleiche Prozedur. Wer mit Sprengstoff umging, ließ sich Zeit und ging kein Risiko ein.
Colonel Robin Zacharias konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Aufgabe. Gleich hinter dem nächsten Bergrücken befand sich eine SA-2-Stellung. Von dort waren bereits drei Raketen abgefeuert worden. Sie suchten nach den Kampfbombern, zu deren Schutz er hier war. Auf dem Rücksitz seiner F-105G Thunderchief, der Thud, saß Jack Tait, sein »Bär«, ein Lieutenant Colonel und Abwehrexperte. Die beiden Männer hatten die Taktik mit entwickelt, nach der sie gerade vorgingen. Er steuerte den Wild-Weasel-Jäger, zeigte sich, bot sich als Ziel an, tauchte dann weg und hielt auf die Raketenstellung zu. Es war ein tückisches, tödliches Spiel, nicht das von Jäger und Gejagtem, sondern von Jäger und Jäger – der eine klein, beweglich und empfindlich, der andere wuchtig, in fester Position und verschanzt. Diese Stellung hatte die Männer seines Geschwaders schon halb zur Verzweiflung getrieben. Der Kommandant war einfach zu gut mit seinem Radar, wußte genau, wann er ihn einschalten und wann er wieder ausschalten mußte. Wer dieses kleine Scheusal auch war, er hatte in der vorigen Woche zwei Weasels aus Robins Kommando abgeschossen. Deshalb hatte der Colonel den Auftrag selbst übernommen, als der Befehl kam, dieses Gebiet erneut zu beschießen. Darin war er Experte: Luftabwehr aufspüren, durchbrechen und zerstören – ein gewaltiges, schnelles, dreidimensionales Spiel. Dem Gewinner winkte das Überleben.
Zacharias donnerte im Tiefflug dahin; er ging nie höher als 200 Meter. Seine Finger betätigten halb automatisch den Steuerknüppel, während seine Augen die karstigen Berggipfel überflogen und seine Ohren den Worten vom Rücksitz lauschten.
»Er ist bei unserer Neun«, sagte ihm Jack. »Sucht noch, aber er hat uns nicht. Kreiselt hübsch herein.«
Wir werden ihm keine Shrike verpassen, dachte Zacharias. Das haben sie das letzte Mal probiert, und er hat sie irgendwie ausgetrickst. Dieser Irrtum hatte ihn einen Major, einen Captain und ein Flugzeug gekostet … der eine, Al Wallace … wie er aus Salt Lake City … sie waren seit Jahren miteinander befreundet gewesen … verdammt noch mal! Er schüttelte den Gedanken ab, tadelte sich nicht einmal für seine gotteslästerliche Ausdrucksweise.
»Werde ihm mal was anderes zu schmecken geben«, sagte Zacharias, während er den Knüppel nach hinten zog. Die Thud zog höher in den Radarbereich der Stellung und blieb dann in Wartestellung. Der Kommandant da unten war wahrscheinlich von den Russen ausgebildet. Sie wußten nicht genau, wie viele Flugzeuge der Mann abgeschossen hatte – nur daß es mehr als genug gewesen waren –, aber er mußte deswegen ganz schön stolz auf sich sein, und Stolz war in diesem Geschäft tödlich.
»Er hat abgefeuert … zweimal, zwei Raketen, Robin«, warnte Tait von hinten.
»Bloß zwei?« fragte der Pilot.
»Vielleicht muß er sie selbst bezahlen«, meinte Tait kühl. »Ich hab sie auf neun. Zeit für etwas Pilotenzauber, Rob.«
»So etwa?« Zacharias kippte nach links, um die Stellung im Gesichtsfeld zu halten, hielt auf sie zu und tauchte dann in Spiralen wieder ab. Er hatte es gut geplant, denn er konnte sich hinter einen Bergrücken verziehen. Er fing sich erst gefährlich tief wieder ab, aber die SA-2-Lenkraketen rasten wie zwei wildgewordene Hummeln 1500 Meter über seinen Kopf hinweg ins Leere.
»Ich denke, es ist Zeit«, sagte Tait.
»Da hast du wohl recht.« Zacharias zog hart nach links, machte seine Splitterbomben abschußbereit. Die F-105 strich über den Bergrücken, sank wieder tiefer, und gleichzeitig taxierte Zacharias mit den Augen den nächsten Rücken, zwei Kilometer und 50 Sekunden entfernt.
»Sein Radar hat uns noch im Visier«, berichtete Tait. »Er weiß, daß wir kommen.«
»Aber er hat nur noch eine übrig.« Außer, seine Geschützmannschaft ist heute extrem gut drauf. Sei’s drum, man kann nicht alles bedenken.
»Etwas leichte Flak auf zehn Uhr.« Sie war zu weit weg, um sich Sorgen darüber zu machen, wenn es ihm auch sagte, welchen Kurs er nicht nehmen durfte. »Da ist das Plateau.«
Vielleicht konnten sie ihn sehen, vielleicht auch nicht. Möglicherweise war er bloß ein beweglicher Lichtpunkt auf einem übervollen Bildschirm, den ein Radarbeobachter zu enträtseln versuchte. Die Thud bewegte sich im Tiefflug schneller als alles, was je gebaut worden war, und der Tarnanstrich auf den Außenflächen erfüllte seinen Zweck. Wahrscheinlich blickten sie nach oben. Da war jetzt eine Mauer aus Störsignalen, Teil des Plans, den er für den anderen Weasel-Vogel ausgeheckt hatte. Die normale amerikanische Taktik sah einen Anflug auf mittlerer Höhe mit anschließendem Sturzflug vor. Aber das hatten sie schon zweimal vergeblich versucht, und so hatte sich Zacharias für eine geänderte Vorgehensweise entschieden. Er würde die Stelle im Tiefflug mit Rockeyes belegen, dann würde die andere Weasel den Rest erledigen. Seine Aufgabe bestand darin, das Kommandofahrzeug und den Kommandeur zu töten. Er wich mit der Thud nach links und rechts, nach oben und unten aus, um den Schützen am Boden keine Ziellinie zu bieten. Es konnten ja noch Gewehre in Stellung sein.
»Da haben wir den Stern!« sagte Robin. Das russische SA-6-Handbuch schrieb sechs Startrampen um einen Kontrollpunkt in der Mitte vor. Mit all den Verbindungsgängen sah die typische Lenkraketenabschußbasis genau wie ein Davidstern aus, was dem Colonel ziemlich gotteslästerlich vorkam. Doch dieser Gedanke berührte ihn nicht weiter, als er das Kommandofahrzeug auf seinem Zielradar ins Visier nahm.
»Rockeye bereit«, sagte er laut, um sich selber die Durchführung zu bestätigen. Die letzten zehn Sekunden hielt er das Flugzeug felsenfest auf Kurs. »Sieht gut aus … Abschuß … jetzt!«
Vier der eindeutig nicht aerodynamischen Kanister fielen aus den Luken des Jägers, platzten noch in der Luft auf und verstreuten Tausende von kleinen Splittergeschossen über das Zielgebiet. Bevor sie auftrafen, war Zacharias schon weit von dem Gelände entfernt. Er sah niemanden in die Schützengräben rennen, blieb aber tief, bremste die Thud in eine enge Linkskurve und sah hoch, um sich zu vergewissern, daß er die Stellung ein für allemal erledigt hatte. Aus den Augenwinkeln konnte er eine gewaltige Rauchwolke im Mittelpunkt des Sterns erkennen.
Das ist für Al: Diesen Gedanken gestattete er sich. Keine Rolle mit dem Bomber zum Zeichen des Sieges. Es war nur ein Gedanke, als er wieder in die Waagerechte ging und sich die günstigste Stelle zum Ausbüxen suchte. Die Kampftruppen konnten jetzt kommen, diese Luftabwehrstellung war außer Gefecht gesetzt. Okay. Er wählte einen Einschnitt im Bergrücken aus und raste knapp unter Mach-1 darauf zu, direkt und gerade, nun, da die Gefahr hinter ihm lag. Weihnachten zu Hause.
Die roten Leuchtspurgeschosse, die vom engen Paß aufstiegen, verblüfften ihn. Die sollten nicht hier sein. Keine Abweichung, sie kamen genau auf ihn zu. Er riß die Maschine hoch, wie der Schütze es vorausgesehen hatte, und der Rumpf des Flugzeugs rauschte direkt durch die Feuergarbe. Ein heftiges Schütteln, und im Verlauf einer Sekunde verwandelte sich Gut in Böse.
»Robin!« schrie eine Stimme über den Bordfunk, doch den größten Lärm machten die aufheulenden Alarmsignale, und Zacharias wußte im Bruchteil einer Sekunde, daß es aus war mit seinem Flieger. Bevor er überhaupt reagieren konnte, wurde alles nur noch schlimmer. Das Triebwerk ging in Flammen auf, und dann geriet die Thud ins Schlingern, was nur bedeuten konnte, daß das Leitwerk ausgefallen war. Zacharias reagierte automatisch, rief seinem Kameraden zu, den Schleudersitz zu betätigen, doch als er schon am Hebel zog, ließ ein weiterer unterdrückter Schrei ihn herumfahren, obwohl er wußte, daß diese Geste sinnlos war. Das letzte, was er von Jack Tait sah, war Blut, das wie eine Dunstwolke unter seinem Sitz schwebte. Doch da wurde sein eigener Rücken von einem unsäglichen Schmerz zerrissen.
»Okay«, sagte Kelly und feuerte eine Leuchtkugel ab. Von einem anderen Boot aus wurden kleine Sprengladungen ins Wasser geworfen, um die Fische zu vertreiben. Fünf Minuten beobachtete er die Gegend, dann blickte er fragend den Sicherheitsbeamten an.
»Alles klar.«
»Dann lassen wir’s jetzt krachen.« Kelly wiederholte die Formel dreimal, bevor er den Griff am Sprengzünder umdrehte. Das Ergebnis war befriedigend. Inmitten von schäumenden Wasserstrudeln brachen die Stelzen der Plattform unten und oben aus ihrer Verankerung. Dann neigte sich die gesamte Konstruktion verblüffend langsam zur Seite. Mit einem gewaltigen Klatschen prallte sie auf die Wasseroberfläche, und einen Augenblick lang hatte man den irrwitzigen Eindruck, als ob Stahl schwimmen könnte. Doch dann senkte sich das Gerippe aus schmalen Metallstreben in die Tiefe, um auf dem Meeresgrund liegenzubleiben. Wieder eine Aufgabe gelöst.
Kelly zog die Stecker aus dem Generator und schob die Kabel zur Seite.
»Zwei Wochen früher als geplant. Sie waren wohl wirklich scharf auf die Prämie«, meinte der Geschäftsführer. Es gefiel dem ehemaligen Kampfpiloten der Navy, wenn jemand sein Geschäft verstand. Schließlich war kein Öl ausgelaufen. »Dutch hatte recht mit Ihnen.«
»Der Admiral ist eine Seele von Mensch. Er hat viel für Tish und mich getan.«
»Ja, wir sind zwei Jahre lang zusammen geflogen. Ein verdammt harter Kämpfer. Gut zu wissen, daß er mir nichts vorgelogen hat.« Der Geschäftsführer umgab sich gern mit Leuten, die Ähnliches erlebt hatten wie er selbst. Den Horror, von dem man im Gefecht gepackt wurde, hatte er irgendwie verdrängt. »Was soll das eigentlich bedeuten? Das habe ich schon immer mal fragen wollen.« Er zeigte auf die Tätowierung auf Kellys Arm, eine rote Robbe, die auf den Hinterflossen hockte und unverschämt grinste.
»Das haben alle aus meiner Einheit«, erklärte Kelly so lässig wie möglich.
»Und welche Einheit war das?«
»Darf ich nicht sagen.« Kelly lächelte beschwichtigend, damit seine Abfuhr nicht so schroff wirkte.
»Sie hatte bestimmt ihre Finger im Spiel, als man Sonny rausgeholt hat – aber gut.« Als ehemaliger Offizier der Navy hielt er sich an die Spielregeln. »Der Scheck wird noch heute ihrem Konto gutgeschrieben, Mr. Kelly. Ich sage über Funk Bescheid, daß Ihre Frau Sie abholen kann.«
Mit einem strahlenden Lächeln verkündete Tish Kelly den Frauen im Mutter-Kind-Laden, daß sie auch dazugehörte. Gerade erst im dritten Monat, konnte sie eigentlich noch alles anziehen, was ihr gefiel – oder zumindest fast alles. Sie brauchte bisher keine Umstandskleider, doch da ihr etwas Zeit geblieben war, wollte sie sich schon mal ansehen, was auf sie zukommen würde. Sie bedankte sich bei der Verkäuferin und beschloß, am Abend noch mal mit John vorbeizukommen. Es machte ihm immer soviel Spaß, Sachen für sie auszusuchen. Aber jetzt mußte sie ihn erst mal abholen. Der Plymouth-Kombi, mit dem sie von Maryland hierhergekommen war, stand direkt vor dem Laden, und sie kannte sich in den Straßen dieser Küstenstadt inzwischen einigermaßen aus. Die Fahrt zur Küste des Golf von Mexiko, wo sich der Sommer nie länger als für ein paar Tage verabschiedete, hatte ihr eine willkommene Abwechslung zu den eintönigen Herbstschauern in ihrer Heimatgegend geboten. Sie lenkte den Wagen auf die Straße und nahm den Weg nach Süden, in Richtung auf den riesigen Versorgungspark der Ölgesellschaft. Selbst die Verkehrsampeln waren ihr wohlgesonnen. Sie sprangen so rechtzeitig auf Grün, daß sie kein einziges Mal auf die Bremse zu treten brauchte.
Der Fahrer des Schwertransporters runzelte die Stirn, als die Ampel auf Gelb schaltete. Er war spät dran und fuhr ein bißchen zu schnell. Immerhin hatte er den größten Teil der neunhundert Kilometer von Oklahoma jetzt hinter sich gebracht. Seufzend trat er auf Kupplung und Bremse. Aus dem Seufzer wurde ein erstaunter Ausruf, als sich beide Pedale ohne Widerstand bis zum Anschlag heruntertreten ließen. Noch war die Kreuzung vor ihm leer, und so lenkte er geradeaus weiter, versuchte durch Herunterschalten die Geschwindigkeit zu drosseln und zog verzweifelt an der Schnur seines Diesel-Horns. Oh, mein Gott, bitte laß –
Sie sah nicht, was auf sie zukam. Sie blickte nicht zur Seite. Der Kombi glitt auf die Kreuzung, und alles, was der Fahrer im Gedächtnis behielt, war das Profil einer jungen Frau, das unter dem Kühler seiner schweren Zugmaschine verschwand. Dann das schreckliche Schlingern und das zitternde Aufbäumen, als der Kombi unter den Vorderrädern des Lasters zermalmt wurde.
Daß sie nichts fühlte, war am allerschlimmsten. Helen war ihre Freundin. Helen lag im Sterben, und Pam wußte, daß sie eigentlich etwas fühlen mußte. Aber sie empfand nichts. Helen war geknebelt, doch an den erstickten Geräuschen, die sie von sich gab, war zu erkennen, daß Billy und Rick das mit ihr machten, was sie gewöhnlich in solchen Fällen taten. Irgendwie bahnte sich der Atem seinen Weg, und obwohl sie den Mund nicht bewegen konnte, waren es die Laute einer Frau, die diese Welt bald verlassen würde. Doch bevor sie ihre Reise antreten konnte, mußte sie noch den Fahrpreis zahlen – dafür sorgten Rick und Billy und Burt und Henry in diesem Augenblick. Pam versuchte sich einzureden, daß sie woanders war, doch dieser rasselnde Atem zwang sie immer wieder hinzusehen, machte ihr bewußt, was jetzt ihre Realität war. Helen war schlecht. Helen war ausgerissen, und das konnten sie nicht zulassen. Das hatten sie ihnen allen mehr als einmal erklärt, und jetzt wurde es ihnen, wie Henry meinte, auf eine Art vor Augen geführt, die sie bestimmt nie vergessen würden. Noch immer konnte Pam die Stelle spüren, an der man ihr die Rippen gebrochen hatte, um ihr eine Lektion zu erteilen. Sie wußte, daß sie nichts tun konnte, als sich Helens Augen auf ihr Gesicht hefteten. Sie bemühte sich, Mitgefühl in ihrem Blick auszudrücken, mehr wagte sie nicht. Kurz darauf verstummte Helen. Zumindest für den Augenblick war es vorbei. Jetzt konnte Pam nur noch die Augen schließen und sich fragen, wann sie selber an der Reihe sein würde.
Die Mannschaft fand es äußerst lustig. Sie hatten den amerikanischen Piloten neben den Sandsäcken vor ihrer Unterkunft angebunden, so daß er die Geschütze sehen konnte, die ihn abgeschossen hatten. Was ihr Gefangener getan hatte, war weniger lustig, und sie zeigten ihm mit Fäusten und Stiefeln, was sie davon hielten. Den anderen Körper hatten sie auch gefunden und direkt neben ihn gesetzt, um sich daran zu weiden, mit wieviel Kummer und Verzweiflung der Feind seinen Kameraden musterte. Inzwischen war der Abwehroffizier aus Hanoi eingetroffen, der sich über den Mann beugte, um den Namen auf seiner Brust zu lesen, bevor er ihn auf einer mitgebrachten Liste heraussuchte. An seiner Reaktion merkten die Geschützsoldaten, daß ihr Gefangener etwas Besonderes sein mußte, denn der Abwehroffizier hängte sich hinterher gleich ans Telefon. Als der Gefangene vor Schmerzen ohnmächtig wurde, begoß der Mann aus Hanoi das Gesicht des Lebenden mit dem Blut des Toten. Dann schoß er ein paar Fotos. Die Geschützmannschaft wußte nicht, was sie davon halten sollte. Es sah beinahe so aus, als wollte er damit erreichen, daß der Lebende genauso tot aussah wie die Leiche neben ihm. Irgendwie seltsam.
Es war nicht die erste Leiche, die er identifizieren mußte. Eigentlich hatte Kelly angenommen, daß dieser Aspekt seines Lebens hinter ihm lag. Andere Leute waren da, um ihm beizustehen, doch daß er nicht zusammenbrach, hieß noch lange nicht, daß er es durchstehen würde. In solch einem Augenblick gab es keinen Trost. Als er die Notaufnahme verließ, folgten ihm die Ärzte und Schwestern mit den Blicken. Man hatte einen Priester herbeigerufen, damit er seines Amtes walten und ein paar Worte an Kelly richten konnte, die aber ganz offenbar ungehört blieben. Ein Polizeibeamter
1
Enfant perdu
Mai
Kelly konnte nicht sagen, warum er angehalten hatte. Ohne bewußt darüber nachzudenken, lenkte er seinen Scout auf den Seitenstreifen. Sie hatte nicht den Daumen in den Wind gehalten. Sie hatte nur am Straßenrand gestanden und beobachtet, wie die Autos splitaufwirbelnd und Abgase verbreitend vorbeirauschten. Aber sie stand wie eine Anhalterin da, das eine Knie durchgedrückt, das andere leicht angewinkelt. Ihre Kleidung war abgenützt, und ein Rucksack baumelte ihr locker über der Schulter. Ihr hellbraunes, schulterlanges Haar bewegte sich im Luftzug der vorbeifahrenden Autos. Ihr Gesicht war ausdruckslos, aber das sah Kelly erst, als er den rechten Fuß aufs Bremspedal drückte und auf den losen Schotter des Seitenstreifens zusteuerte. Er fragte sich, ob er sich wieder in den Verkehr einreihen sollte, aber nun hatte er den ersten Schritt schon getan, wenn er auch nicht genau wußte, wohin. Das Mädchen folgte dem Wagen mit den Augen, und als er in den Rückspiegel blickte, zuckte sie gleichgültig die Achseln und kam auf ihn zu. Das Seitenfenster war bereits heruntergekurbelt, und dann stand sie neben ihm.
»Wohin fahren Sie?« fragte sie.
Das überraschte Kelly. Die erste Frage – Soll ich Sie mitnehmen? – hätte eigentlich von ihm kommen sollen. Als er sie ansah, zögerte er ganz kurz. Vielleicht einundzwanzig, sah aber älter aus. Ihr Gesicht war nicht dreckig, aber auch nicht sauber, vielleicht kam das vom Wind und Staub der Überlandstraße. Sie trug ein Männerhemd aus Baumwolle, das monatelang nicht gebügelt worden war, und hatte das Haar im Nacken zusammengebunden. Aber am meisten überraschten ihn ihre Augen. Ein bezauberndes Graugrün. Sie starrten an Kelly vorbei … wohin? Er kannte diesen Blick schon, doch nur von übermüdeten Männern. Er hatte selbst schon so ins Leere geblickt, erinnerte sich Kelly, und dabei nie gewußt, was seine Augen wahrnahmen. Es kam ihm nicht in den Sinn, daß er im Moment gar nicht viel anders guckte.
»Zu meinem Boot zurück«, antwortete er schließlich, da er nicht wußte, was er sonst sagen sollte. Und blitzschnell veränderte sich ihr Ausdruck.
»Sie haben ein Boot?« fragte sie. Ihre Augen fingen wie bei einem Kind zu strahlen an, ein Lächeln blitzte auf und breitete sich über ihr ganzes Gesicht aus, als hätte er gerade eine wichtige Frage beantwortet. Kelly sah, daß sie eine niedliche Lücke zwischen den Schneidezähnen hatte.
»Eine Zwölfmeterjacht – Diesel.« Er deutete auf die Ladefläche des Scout, die mit Kartons voller Lebensmittel vollgestellt war. »Wollen Sie mitkommen?« fragte er, ohne nachzudenken.
»Na klar!« Ohne zu zögern, riß sie die Tür auf und schmiß ihren Rucksack auf den Boden am Beifahrersitz.
Das Eingliedern in den Verkehr war gefährlich. Der Scout mit seinem kurzen Radabstand und den wenigen PS war nicht für Schnellstraßen gebaut, und Kelly mußte sich konzentrieren. Die Geschwindigkeit des Wagens reichte nur für die rechte Fahrspur aus, und da an jeder Kreuzung immerzu jemand ein- oder abbog, mußte er auf der Hut sein. Der Scout war nicht wendig genug, daß er allen Idioten ausweichen konnte, die zum Meer fuhren oder wohin zum Teufel sie auch immer an einem verlängerten Wochenende unterwegs waren.
Wollen Sie mitkommen? hatte er gefragt, und sie hatte darauf erwidert: Na klar. Was zum Teufel hatte er sich nur dabei gedacht? Kelly zog die Stirn in Falten, nicht nur, weil der Verkehr ihn nervte, sondern vor allem, weil er die Antwort nicht wußte. Aber in den letzten sechs Monaten hatte es eine Menge Fragen gegeben, auf die er keine Antwort wußte. Er brachte seine Gedanken zum Schweigen und konzentrierte sich auf den Verkehr, aber sie bohrten im Hinterkopf hartnäckig weiter. Die eigenen Gedanken gehorchen einem eben selten.
Memorial-Day-Wochenende, dachte er. Die Autos um ihn herum waren vollbesetzt mit Leuten, die von der Arbeit heimfuhren oder den Weg bereits hinter sich und ihre Familien abgeholt hatten. Kindergesichter starrten aus den Rückfenstern. Ein oder zwei Kinder winkten ihm zu, aber Kelly tat so, als habe er es nicht bemerkt. Es war schwer, keine Seele zu haben, besonders, wenn man sich erinnern konnte, daß man einmal eine gehabt hatte.
Kelly fuhr sich mit der Hand ans Kinn: rauh wie Sandpapier. Die Hand selbst war schmutzig. Kein Wunder, daß sie sich im Lebensmittelmarkt so komisch benommen hatten. Läßt dich gehen, Kelly.
Und? Wen zum Teufel juckt das?
Er wandte sich seiner Mitfahrerin zu und merkte, daß er ihren Namen nicht kannte. Er nahm sie mit auf sein Boot und wußte nicht einmal, wie sie hieß. Seltsam. Sie starrte mit heiterem Gesicht nach vorn. Im Profil war es ein hübsches Gesicht. Sie war dünn – vielleicht war gertenschlank das richtige Wort –, ihr Haar so zwischen blond und braun. Ihre Jeans war an einigen Stellen abgewetzt und zerrissen und stammte aus einem jener Läden, wo sie einen Aufpreis für vorgebleichte Ware verlangten – oder was auch immer sie damit anstellten. Kelly wußte es nicht, es war ihm auch egal. Eine Sache mehr, um die er sich nicht zu scheren brauchte.
Herrgott, wie konntest du nur so herunterkommen? wollte sein Verstand von ihm wissen. Er wußte die Antwort, aber auch das war keine vollständige Erklärung. Verschiedene Bereiche des Organismus, der John Terence Kelly hieß, wußten jeweils einen Teil der ganzen Geschichte, aber irgendwie wollte sich nie alles zusammenreimen. Von dem, was einst ein harter, gewiefter, entschiedener Mann gewesen war, blieben nur vereinzelte Fragmente, die wirr durch die Gegend stolperten – und spielte da nicht auch Verzweiflung mit? Was für ein ungemein tröstender Gedanke.
Er erinnerte sich an sein früheres Leben. Er entsann sich all dessen, was er überlebt hatte; daß er überlebt hatte, erstaunte ihn noch immer. Und wohl die schlimmste Qual überhaupt war die, daß er nicht verstand, was schiefgegangen war. Sicher, er wußte, was geschehen war, aber das war alles äußerlich gewesen, und irgendwie war ihm das Verständnis der Dinge um ihn herum abhanden gekommen, und nun lebte er verwirrt und ziellos dahin. Er bewegte sich wie ein Automat. Das wußte er, aber nicht, wohin das Schicksal ihn führte.
Wer sie auch war, sie versuchte gar kein Gespräch, und das kam Kelly gerade recht, obwohl er spürte, daß da etwas war, was er wissen sollte. Die Erkenntnis kam überraschend, rein instinktiv, und er hatte schon immer seinen Instinkten vertraut, diesem kalten Schauer, der ihm wie zur Warnung über Arme und Rücken lief. Er sah sich nach dem Verkehr um und konnte nichts Gefährlicheres entdecken als Autos mit zuviel PS unter der Haube und zuwenig Verstand hinterm Lenkrad. Seine Augen suchten alles sorgfältig ab und fanden nichts. Aber das warnende Gefühl verschwand nicht, und Kelly ertappte sich dabei, wie er aus unerfindlichen Gründen immer wieder in den Rückspiegel sah, während seine Hand zwischen den Beinen hindurchlangte und nach dem geriffelten Griff seines automatischen Revolvers fühlte, der versteckt unter dem Sitz hing. Erst da wurde ihm bewußt, daß er die Waffe streichelte.
Wozu verdammt noch mal hast du das getan? Kelly zog die Hand zurück und schüttelte frustriert den Kopf. Aber er sah immer wieder in den Rückspiegel – bloß das normale Augenmerk auf den Verkehr, log er sich in den nächsten zwanzig Minuten vor.
Das Jachtgelände war sehr belebt. Natürlich wegen des langen Wochenendes. Auf dem kleinen und schlecht befestigten Parkplatz schossen die Autos viel zu schnell umher. Jeder Fahrer versuchte, dem Freitagsstoßverkehr zu entkommen, zu dem er selbst natürlich beitrug. Zumindest hier kam der Scout zur Geltung. Die große Bodenfreiheit und erhöhte Sicht waren für Kelly von Vorteil, als er den Wagen zum Heck der Springer manövierte und wendete, um rückwärts an die Anlegestelle zu fahren, die er erst vor sechs Stunden verlassen hatte. Kelly war erleichtert, den Wagen stehenlassen zu können. Sein Highway-Abenteuer war vorüber, und ihm winkte die Sicherheit des Wassers, auf dem es keine Fahrspuren gab.
Die Springer war eine dieselgetriebene Motorjacht, zwölf Meter lang, eine Einzelanfertigung, aber in den Umrissen und der Innenaufteilung einer Pacemaker Coho ähnlich. Sie war nicht besonders schön, aber sie hatte zwei ansehnliche Kabinen, und die Kajüte mittschiffs ließ sich leicht in eine dritte verwandeln. Sie verfügte über große Dieselmotoren, die aber nicht zu sehr hochgezüchtet waren, weil Kelly lieber eine bequem ausgelegte große Maschine als eine überdrehte kleine hatte. Er besaß einen hochwertigen Marineradar, alle möglichen gesetzlich erlaubten Kommunikationsinstrumente und Navigationshilfen, die normalerweise nur Hochseefischer benutzten. Der Fiberglasrumpf war makellos, an der verchromten Reling kein einziger Rostfleck, obwohl er auf die Hochglanzpolitur verzichtet hatte, auf die die meisten Jachtbesitzer schwörten. Es lohnte den Aufwand nicht. Die Springer war ein Arbeitsboot oder sollte es doch sein.
Kelly und sein Gast stiegen aus dem Wagen. Er öffnete die Laderaumtür und fing an, die Kartons an Bord zu bringen. Die junge Dame, sah er, war so vernünftig, ihm nicht in die Quere zu kommen.
»Yo, Kelly!« rief eine Stimme von der Brücke.
»Ja, Ed, was war denn?«
»Kaputte Anzeige. Die Bürsten an den Generatoren waren ein bißchen abgewetzt, da hab ich sie ersetzt, aber ich meine, es lag an der Anzeige. Die hab ich auch ausgewechselt.« Ed Murdock, der Chefmechaniker des Hafens, entdeckte das Mädchen erst, als er das Fallreep herunterkam. Murdock verfehlte die letzte Stufe und schlug vor Überraschung fast der Länge nach hin. Der Mechaniker bedachte das Mädchen mit einem rasch abschätzenden, anerkennenden Blick.
»Sonst noch was?« fragte Kelly betont.
»Hab die Tanks aufgefüllt. Die Motoren sind warm«, sagte Murdock, während er sich seinem Kunden zuwandte. »Ist alles auf Ihrer Rechnung.«
»Okay, danke, Ed.«
»Oh, Chip hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, jemand hat ein Angebot gemacht, falls Sie das Boot je …«
Kelly schnitt ihm das Wort ab. »Keine Chance, Ed.«
»Sie ist ein Juwel, Kelly«, meinte Murdock, als er sein Werkzeug aufsammelte und lächelnd davonschritt, höchst zufrieden mit sich, weil ihm diese doppeldeutige Bemerkung gelungen war.
Kelly brauchte einige Sekunden, bis er kapierte. Er ließ nur ein verspätetes, halb amüsiertes Knurren hören, als er die letzten Lebensmittel in die Kajüte lud.
»Was soll ich tun?« fragte das Mädchen. Sie hatte bisher nur herumgestanden, und Kelly hatte den Eindruck, daß sie ein wenig zitterte und das zu verbergen suchte.
»Nehmen Sie einfach oben Platz«, sagte Kelly, auf die Brücke deutend. »Ich werde ein paar Minuten brauchen, um alles fertigzumachen.«
»Okay.« Sie warf ihm ein strahlendes Lächeln zu, das garantiert jedes Eis zum Schmelzen gebracht hätte – als wüßte sie genau, was er brauchte.
Kelly ging nach achtern zu seiner Kabine, letztlich froh, daß er sein Boot in Ordnung gehalten hatte. Alles war sauber, und er ertappte sich dabei, wie er in den Spiegel schaute und fragte: »Na schön, und was wirst du jetzt tun?«
Es kam keine unmittelbare Antwort, aber der Anstand sagte ihm, er sollte sich erst mal waschen. Zwei Minuten später betrat er die Kajüte. Er sah noch einmal nach, ob die Lebensmittelkartons sicher verstaut waren, und ging dann nach oben.
»Ich, äh, hab vergessen, Sie etwas zu fragen …« begann er.
»Pam«, sagte sie, die Hand ausstreckend. »Und Sie?«
»Kelly«, erwiderte er, wiederum verdutzt.
»Wohin soll’s gehen, Mr. Kelly?«
»Nur Kelly«, verbesserte er sie, wahrte aber momentan noch die Distanz. Pam nickte nur und lächelte wieder.
»Okay, Kelly, wohin?«
»Ich besitze eine kleine Insel etwa dreißig …«
»Du besitzt eine Insel?« Sie machte große Augen.
»Richtig.« Eigentlich hatte er sie nur gepachtet, aber das war schon so lange her, daß es Kelly gar nicht mehr der Rede wert fand.
»Dann mal los!« sagte sie begeistert mit einem Blick zurück auf die Küste.
Er warf die Kielraumentlüftung an. Die Springer hatte Dieselmotoren, und er brauchte sich wegen einer Abgasentwicklung eigentlich keine Sorgen zu machen, doch wenn er sich in letzter Zeit auch hatte gehenlassen, so war Kelly immer noch ein Seemann, und sein Leben auf dem Wasser gehorchte einer strikten Routine, was die Beachtung aller Sicherheitsvorschriften umfaßte, die mit dem Blut der Männer geschrieben worden waren, die nicht die nötige Sorgfalt hatten walten lassen. Nach den vorgeschriebenen zwei Minuten drückte er den Anlasser des Backborders, dann den für den Steuerborder. Die beiden großen Dieselmotoren sprangen sofort an und erwachten zu tuckerndem Leben, während Kelly die Anzeigen überprüfte. Alles sah gut aus.
Er verließ die Brücke, um die Vertäuungen zu lösen, dann kam er zurück, um in langsamer Fahrt vom Steg abzulegen, während er Gezeitenstand und Wind prüfte – derzeit war beides niedrig – und nach anderen Booten Ausschau hielt. Kelly schob den Gashebel des Backborders eine Markierung vor, während er am Steuerrad drehte, und ließ die Springer sich damit noch schneller in der engen Fahrrinne drehen, bis sie direkt hafenauswärts gerichtet war. Er schob den Gashebel des Steuerborders weiter vor und brachte seine Jacht auf manierliche fünf Knoten, während er an den aufgereihten Motor- und Segeljachten vorbeisteuerte. Pam schaute sich auch nach den Booten um, hauptsächlich achtern, und ihr Blick heftete sich mehrere Sekunden lang auf den Parkplatz, bis sie sich wieder nach vorn umdrehte. Dabei entspannte sich ihr Körper allmählich.
»Kennst du dich denn ein bißchen mit Booten aus?« fragte Kelly.
»Kaum«, gestand sie, und zum erstenmal bemerkte er ihren etwas schleppenden Akzent.
»Wo bist du her?«
»Texas. Und du?«
»Eigentlich aus Indianapolis, aber das ist schon eine Weile her.«
»Was ist das?« Sie berührte mit der ausgestreckten Hand die Tätowierung an seinem Unterarm.
»Das ist von einem der Orte, an denen ich gewesen bin«, sagte er. »Kein sehr netter Ort übrigens.«
»Oh, drüben.« Sie verstand.
»Genau da.« Kelly nickte sachlich. Sie waren nun aus dem Hafenbecken heraus, und er schob die Gashebel noch weiter vor.
»Was hast du dort gemacht?«
»Nichts, was ich einer Dame erzählen sollte«, erwiderte Kelly, während er sich umblickte.
»Wie kommst du darauf, daß ich eine Dame bin?«
Das traf ihn wieder unvorbereitet, aber allmählich gewöhnte er sich daran. Außerdem hatte er inzwischen festgestellt, daß er ein Gespräch mit einem Mädchen ziemlich nötig hatte, egal über welches Thema. Zum erstenmal erwiderte er ihr Lächeln.
»Na ja, es wäre nicht sehr nett von mir, etwas anderes anzunehmen.«
»Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis du mal lächelst.« Du hast ein sehr nettes Lächeln, sagte ihm ihr Tonfall.
Sechs Monate. Was sagst du nun? hätte er beinahe geantwortet. Statt dessen lachte er, hauptsächlich über sich selbst. Auch etwas, das er schon lange nötig gehabt hatte.
»Es tut mir leid. Ich schätze, ich bin kein guter Gesellschafter.« Er wandte ihr wieder seinen Blick zu und sah Verständnis in ihren Augen. Nur ein stiller Blick, sehr menschlich und weiblich, aber Kelly fühlte sich ertappt. Er spürte die Wirkung, achtete aber nicht auf den Teil seines Bewußtseins, der ihm sagte, daß er auch das seit Monaten sehr nötig gehabt hatte. Das mußte ihm nicht extra gesagt werden, besonders nicht von ihm selbst. Einsamkeit war schon schlimm genug, ohne auch noch darüber nachzudenken, wie elend man sich dabei fühlte. Wieder streckte sie die Hand aus, offensichtlich, um die Tätowierung zu befühlen, aber das war nicht alles. Erstaunlich, wie warm ihre Berührung war, selbst unter einer heißen Nachmittagssonne. Vielleicht ließ sich daran ablesen, wie kalt es in seinem Leben geworden war.
Aber er hatte sein Boot zu steuern. Tausend Meter vor ihm lag ein Frachter. Kelly war nun in voller Fahrt, und die Trimmruder hatten sich automatisch so eingestellt, daß das Boot in den bestmöglichen Einstellwinkel gebracht war, sobald es seine achtzehn Knoten erreichte. Die Fahrt war glatt, bis sie in die Bugwelle des Handelsschiffes gerieten. Da fing die Springer heftig zu schaukeln an. Ihr Bug ging mehr als einen Meter auf und ab, während Kelly das Boot nach links manövrierte, um den schlimmsten Wellen auszuweichen. Als sie ihn überholten, ragte der Frachter wie eine Klippe vor ihnen auf.
»Kann ich mich hier irgendwo umziehen?«
»Meine Kabine ist achtern. Du kannst vorn einziehen, wenn du willst.«
»Oh, tatsächlich?« Sie kicherte. »Warum sollte ich das?«
»Hmm?« Sie hatte es wieder geschafft.
Pam ging mit ihrem Rucksack nach unten, wobei sie sich immer vorsichtig an der Reling festhielt. Sie hatte nicht viel angehabt. Nach ein paar Minuten kehrte sie sogar mit noch weniger zurück: Hot pants und ein Trägertop, keine Schuhe, und außerdem war sie sichtlich entspannter. Sie hatte die Beine einer Tänzerin, bemerkte Kelly, schlank und ungeheuer weiblich. Auch sehr bleich, was ihn überraschte. Das Top hing locker an ihr herunter und war an den Säumen ausgefranst. Vielleicht hatte sie in letzter Zeit abgenommen oder hatte bewußt eine Übergröße gekauft. Was auch immer der Grund war, es zeigte einiges von ihrem Oberkörper. Kelly ertappte sich dabei, wie er die Augen verdrehte, und tadelte sich selber dafür, daß er dem Mädchen nachgeschielt hatte. Aber Pam machte es ihm auch schwer, nicht hinzusehen. Und nun zog sie sich auch noch an seinem Oberarm hoch und setzte sich direkt neben ihn. Wenn er ihr den Kopf zudrehte, konnte er in das Top hineinsehen, so weit er nur wollte.
»Gefallen sie dir?« fragte sie.
Hirn und Mund versagten Kelly den Dienst. Er ließ ein paar verlegene Laute hören, und bevor er sich für eine Antwort entscheiden konnte, lachte sie los. Aber nicht über ihn. Sie winkte der Crew des Frachters zu, die zurückwinkte. Es war ein italienisches Schiff, über der Reling hingen etwa ein halbes Dutzend Männer, und einer davon warf ihr gerade eine Kußhand zu. Sie grüßte entsprechend zurück.
Es machte Kelly eifersüchtig.
Er drehte das Steuer wieder nach Backbord, ließ sein Boot über die Bugwelle des Frachters gleiten, und als es die Brücke des Schiffs passierte, ließ er sein Horn ertönen. Es war Vorschrift so, wenn auch wenige kleine Boote sich daran hielten. Gerade da hatte ein Wachoffizier sein Fernrohr auf Kelly gerichtet – eigentlich eher auf Pam. Er wandte sich um und rief etwas zum Ruderhaus. Einen Augenblick später tönte die gewaltige »Pfeife« des Frachters mit ihrem dumpfen Baß los und ließ das Mädchen fast von ihrem Platz hüpfen.
Kelly lachte, sie auch, dann wand sie die Arme fest um seinen Bizeps. Er spürte, wie ein Finger rund um die Tätowierung fuhr.
»Es fühlt sich gar nicht wie …«
Kelly nickte. »Ich weiß. Die meisten erwarten, daß es sich wie Farbe oder so anfühlt.«
»Warum hast du …«
»… es mir machen lassen? Jeder in der Einheit hat es gemacht. Sogar die Offiziere. Gehörte zum guten Ton, schätze ich. Ganz schön dumm eigentlich.«
»Ich find’s süß.«
»Nun, ich find dich ganz schön süß.«
»Du sagst lauter nette Sachen.« Sie drehte sich ein wenig und rieb dabei eine Brust an seinem Oberarm.
Kelly behielt eine konstante Fahrtgeschwindigkeit von achtzehn Knoten bei, während er aus dem Hafen von Baltimore auslief. Der italienische Frachter war das einzige Handelsschiff in Sichtweite, und die See war glatt, kräuselte sich nur minimal. Er hielt sich während des ganzen Weges hinaus in die Cheasapeake Bay an die Hauptfahrrinne.
»Hast du Durst?« fragte sie, als sie nach Süden drehten.
»Mhm. In der Kochnische ist ein Kühlschrank – die ist in der …«
»Ich hab sie gesehen. Was möchtest du?«
»Bring einfach irgendwas.«
»Schön«, erwiderte sie strahlend. Als sie aufstand, kroch ihm das Gefühl von weicher Haut den ganzen Arm hoch und verließ ihn wieder an der Schulter.
»Was ist das?« fragte sie, als sie wieder da war. Kelly drehte sich um und schrak zusammen. Er war mit dem Mädchen am Arm so zufrieden gewesen, daß er nicht auf das Wetter geachtet hatte. »Das« war ein Gewitter, eine sich auftürmende Masse von dunklen Quellwolken, die mehr als zehn Kilometer in den Himmel ragten.
»Sieht aus, als würden wir ein paar Tropfen abbekommen«, sagte er, als er das Bier entgegennahm.
»Als ich noch klein war, war das die Umschreibung für einen Tornado.«
»Hier aber nicht«, erwiderte Kelly, während er sich auf dem Boot umschaute, ob irgendwo etwas lose herumlag. Unter Deck, das wußte er, war alles an seinem Platz, weil es das immer war, ob es einen nun anödete oder nicht. Dann schaltete er den Küstenfunk an. Sogleich erwischte er einen Wetterbericht, einen, der mit der üblichen Warnung endete.
»Ist das ein kleines Boot?« fragte Pam.
»Technisch gesehen ja, aber du kannst unbesorgt sein. Ich weiß, was ich tue. Ich bin Bosun’s Mate gewesen.«
»Was ist das?«
»Ein Dienstgrad. In der Navy. Außerdem ist das hier ein ganz schön großes Bötchen. Die Überfahrt kann ein bißchen unruhig werden, das ist alles. Wenn du Angst hast, da sind Schwimmwesten unter deinem Sitz.«
»Hast du Angst?« fragte Pam. Kelly lächelte und schüttelte den Kopf. »Na gut.« Sie nahm ihre frühere Position wieder ein, mit dem Oberkörper an seinem Arm, dem Kopf an seiner Schulter. Ihre Augen hatten einen verträumten Ausdruck, als würde sie sich auf das Kommende freuen, ob Gewitter oder nicht.
Kelly hatte keine Bedenken – zumindest nicht wegen des Gewitters –, aber er nahm auch nichts auf die leichte Schulter. Als er an Bodkin Point vorbeikam, fuhr er östlich über die Schiffahrtsrinne weiter. Er drehte erst nach Süden ab, als er Gewässer erreicht hatte, die zu seicht für jedes andere Schiff waren, das groß genug gewesen wäre, ihn zu überrollen. Alle paar Minuten drehte er sich nach dem Gewitter um, das mit etwa zwanzig Knoten direkt hinter ihnen aufzog. Es hatte bereits die Sonne verdeckt. Wenn ein Gewitter schnell herankam, hieß das meistens, daß es auch heftig sein würde, und bei seinem südlichen Kurs konnte er ihm nicht länger ausweichen. Kelly trank sein Bier aus und beschloß, sich kein zweites mehr zu genehmigen. Die Sicht würde schnell abnehmen. Er zog eine plastiküberzogene Karte heraus und befestigte sie auf dem Wisch rechts vom Armaturenbrett, markierte seine Position mit einem Fettstift und versicherte sich noch mal, daß sein Kurs ihn auf keinen Fall in Untiefen bringen würde – die Springer hatte mehr als einen Meter Tiefgang, und für Kelly bedeutete alles unter zwei Meter zwanzig seichtes Gewässer. Zufrieden setzte er seinen Kompaßkurs und entspannte sich wieder. Seine Ausbildung diente ihm als Puffer sowohl gegen Gefahr als auch gegen Selbstzufriedenheit.
»Wird nicht mehr lange dauern«, bemerkte Pam mit nur einer Spur von Unbehagen in der Stimme, während sie sich an ihm festhielt.
»Du kannst nach unten gehen, wenn du willst«, sagte Kelly. »Es wird naß und windig werden. Und schaukeln.«
»Aber nicht gefährlich.«
»Nein, außer ich tue etwas wirklich Dummes. Ich werd’s nicht darauf ankommen lassen«, versprach er.
»Kann ich hierbleiben und es mir ansehen?« fragte sie, eindeutig nicht gewillt, von seiner Seite zu weichen, wenn Kelly auch nicht wußte, warum.
»Es wird naß werden«, warnte er sie nochmals.
»Das macht nichts.« Sie lächelte strahlend, klammerte sich noch enger an seinen Arm.
Kelly drosselte etwas die Fahrt, so daß das Boot flacher lag. Es gab keinen Grund zur Eile. Bei gedrosselter Fahrt bestand keine Notwendigkeit mehr, mit zwei Händen zu steuern. Er legte den Arm um das Mädchen, dabei sank ihr Kopf automatisch wieder auf seine Schulter, und trotz des nahenden Gewitters war auf einmal alles mit der Welt im Lot. Zumindest soweit es Kellys Gefühle betraf. Seine Vernunft sagte etwas anderes, und die beiden Ansichten wollten sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Seine Vernunft erinnerte ihn daran, daß das Mädchen an seiner Seite … ja, was war sie denn? Er wußte es nicht. Seine Gefühle sagten ihm, daß es absolut keinen Unterschied machte. Sie war, was er brauchte. Aber Kelly war kein Mann, der sich von seinen Gefühlen beherrschen ließ, und der innere Widerstreit ließ ihn finster auf den Horizont starren;
»Stimmt was nicht?« fragte Pam.
Kelly wollte etwas sagen, besann sich dann aber eines Besseren und rief sich ins Gedächtnis zurück, daß er auf seiner Jacht mit einem hübschen Mädchen allein war. Diese Runde ließ er zur Abwechslung mal an die Gefühle gehen.
»Ich bin etwas verwirrt, aber, nein, alles in Ordnung soweit.«
»Ich seh es dir doch an, daß …«
Kelly schüttelte den Kopf. »Mach dir keine Sorgen. Was es auch ist, es kann warten. Entspann dich und genieß die Fahrt.«
Einen Augenblick später kam der erste Windstoß, der das Boot ein paar Grad nach Backbord krängen ließ. Kelly adjustierte das Ruder, um es wieder aufzurichten. Der Regen kam schnell. Auf die ersten wenigen Spritzer folgten rasch dichte Streifen, die wie Vorhänge über die Oberfläche der Chesapeake Bay schleiften. Binnen einer Minute ging die Sicht auf ein paar hundert Meter zurück, und der Himmel war so dunkel, als wäre es schon spät abends. Kelly vergewisserte sich, daß seine Positionslichter an waren. Die Wellen schlugen nun wirklich hoch, von einem etwa dreißig Knoten starken Wind getrieben. Wetter und See kamen genau quer. Er entschied, daß er durchaus weiterfahren könnte, aber er war gerade an einem guten Ankerplatz, und das würde er die nächsten fünf Stunden nicht mehr sein. Kelly warf noch einen Blick auf die Karte, schaltete dann den Radar ein, um seine Position zu bestätigen. Wassertiefe drei Meter, sandiger Grund, der auf der Karte mit HRD bezeichnet war, griffiger Boden also. Er steuerte die Springer in den Wind und drosselte weiter die Fahrt, bis die Schiffsschrauben gerade genug Schub entwickelten, um gegen die treibende Kraft des Windes anzukommen.
»Nimm mal das Steuer«, wies er Pam an.
»Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll.«
»Das geht schon. Halt es nur fest und steuere so, wie ich es dir sage. Ich muß nach vorn gehen, um die Anker zu setzen. Okay?«
»Paß auf dich auf!« schrie sie durch den peitschenden Wind, Die Wellen waren inzwischen knapp zwei Meter hoch, und der Bug des Bootes hüpfte auf und ab. Kelly klopfte ihr aufmunternd auf die Schulter und ging nach vorn.
Er mußte natürlich aufpassen, doch seine Schuhe hatten rutschfeste Sohlen, und Kelly kannte sich aus. Er behielt die Hände den ganzen Weg an den Aufbauten vorbei an der Reling, und binnen einer Minute war er auf dem Vordeck, wo zwei Anker festgemacht waren, ein Danforth und ein CQR-Pflugscharanker, beide ein klein wenig zu groß. Er warf erst den Danforth ins Wasser, dann signalisierte er Pam, sie solle das Steuer nach Backbord drehen. Als das Boot sich vielleicht 20 Meter nach Süden bewegt hatte, ließ er den CQR auch noch ab. Beide Trossen waren bereits auf die entsprechende Länge eingestellt, und nachdem er überprüft hatte, daß alles in Ordnung war, hangelte sich Kelly wieder zur Brücke zurück.
Pam sah nervös aus bis zu dem Moment, wo er sich wieder auf die Vinylbank setzte – alles war nun naß vom Wasser, und ihre Kleider waren völlig durchweicht. Kelly drosselte die Maschinen auf Leerlauf und überließ es dem Wind, die Springer fast dreißig Meter zurückzutreiben. Bis dahin hatten sich die beiden Anker in den Boden gegraben. Kelly war mit ihrer Plazierung nicht ganz zufrieden. Er hätte sie weiter auseinander setzen sollen. Aber eigentlich war sowieso nur ein Anker notwendig. Der zweite diente als reine Sicherheitsmaßnahme. Zufrieden schaltete er die Dieselmotoren ab.
»Ich könnte es auch auf der ganzen Strecke mit dem Sturm aufnehmen, aber ich lass’ es lieber«, erklärte er.
»Also parken wir hier für die Nacht?«
»Genau. Du kannst runter in deine Kabine gehen und …«
»Du willst, daß ich weggehe?«
»Nein – ich meine nur, wenn es dir hier nicht gefällt …« Ihre Hand streckte sich seinem Gesicht entgegen. Durch den Wind und den Regen hindurch konnte er ihre Worte kaum verstehen.
»Mir gefällt’s hier aber.« Irgendwie schien das überhaupt kein Widerspruch zu sein.
Einen Augenblick später fragte sich Kelly, warum es so lange gedauert hatte. Alle Anzeichen waren dagewesen. Es gab eine weitere kurze Diskussion zwischen Gefühl und Vernunft, und wieder verlor die Vernunft. Hier gab es nichts, wovor er hätte Angst haben müssen, nur einen Menschen, der genauso einsam war wie er. Es war so leicht, zu vergessen. Einsamkeit sagte einem nicht, was man verloren hatte, nur, daß etwas fehlte. Erst in einem Augenblick wie diesem konnte man die Leere bestimmen. Ihre Haut war weich, tropfnaß vom Regen, aber warm. Es war so anders, als sich Leidenschaft zu mieten, was er im vergangenen Monat zweimal ausprobiert hatte. Hinterher hatte er sich jedesmal vor sich selbst geekelt.
Das hier aber war anders. Das hier war echt. Die Vernunft rief ein letztes Mal, daß es nicht sein konnte, daß er sie vom Straßenrand aufgeklaubt hatte und sie erst eine kurze Zeit lang kannte. Das Gefühl sagte ihm, daß es nichts ausmachte. Als wisse sie um seinen inneren Widerstreit, streifte Pam das Top über den Kopf. Das Gefühl gewann.
»Ich finde sie einfach toll«, sagte Kelly. Er berührte zart ihre Brüste. Sie fühlten sich auch einfach toll an. Pam hängte das Top ans Steuerrad und drückte ihr Gesicht an seines, während ihre Hände ihn nach vorn zogen. Auf sehr weibliche Art ergriff sie die Initiative. Irgendwie hatte ihre Leidenschaft nichts Animalisches. Etwas machte sie anders. Kelly wußte nicht genau, was, suchte aber auch nicht nach dem Grund, nicht jetzt.
Beide standen auf. Pam glitt beinahe aus, aber Kelly fing sie auf und ließ sich auf die Knie nieder, um ihr beim Ausziehen ihrer Hot pants zu helfen. Dann war sie an der Reihe, sein Hemd aufzuknöpfen, nachdem sie seine Hände auf ihre Brüste gedrückt hatte. Das Hemd blieb noch eine lange Weile an seinem Körper, weil keiner von beiden wollte, daß seine Hände sich entfernten, doch dann war es geschafft, immer nur ein Arm, und als nächstes war die Jeans dran. Kelly schlüpfte aus den Schuhen, als die letzten Kleidungsstücke fielen. Dann umarmten sie sich im Stehen, schwankten hin und her, während das Boot unter ihnen schaukelte und schlingerte und Regen und Wind auf sie prasselten. Pam nahm ihn bei der Hand, führte ihn nur ein Stück vom Führerstand weg und drückte ihn sanft aufs Deck. Ohne Umschweife setzte sie sich auf ihn. Kelly versuchte sich aufzurichten, aber sie ließ es nicht zu und beugte sich statt dessen vor, während sich ihre Hüften mit sanftem Nachdruck bewegten. Kelly war darauf so wenig vorbereitet wie auf alles andere an diesem Nachmittag, und sein Schrei schien den Donner noch zu übertönen.
Als er die Augen aufschlug, befand sich ihr Gesicht nur Zentimeter von seinem entfernt, und ihr Lächeln glich dem eines steinernen Engels in einer Kirche.
»Es tut mir leid, Pam, ich …«
Sie unterbrach seine Entschuldigung mit einem Kichern. »Bist du immer so gut?«
Viele Minuten später hielt Kelly die dünne Gestalt umschlungen, und so blieben sie, bis der Sturm vorüber war. Kelly hatte Angst, loszulassen, Angst vor der Möglichkeit, daß all das so irreal war; wie es sein müßte. Dann frischte der Wind auf, und sie gingen nach unten. Kelly holte Handtücher, und sie trockneten sich gegenseitig ab. Er versuchte sie anzulächeln, aber der Schmerz war wieder da, und das nur um so stärker nach der genüßlichen letzten Stunde; nun war Pam an der Reihe, überrascht zu sein. Sie setzte sich neben ihn und zog sein Gesicht an ihre Brust. Da mußte er weinen, bis ihr Oberkörper wieder ganz naß war. Sie war klug genug, keine Fragen zu stellen. Statt dessen hielt sie ihn fest, bis es vorüber war und er wieder normal atmete.
»Es tut mir leid«, sagte er nach einer Weile. Kelly versuchte sich zu bewegen, aber sie ließ es nicht zu.
»Du mußt nichts erklären. Aber ich möchte gerne helfen«, sagte sie und wußte doch genau, daß sie das schon getan hatte. Eigentlich hatte sie es schon ab dem ersten Augenblick im Auto gesehen: ein starker Mann, schwer angeschlagen. So anders als alle, die sie gekannt hatte. Als er endlich sprach, spürte sie seine Worte an ihrer Brust.
»Es ist fast sieben Monate her. Ich hatte unten am Mississippi einen Job. Sie war schwanger, hatten wir gerade erst erfahren. Sie ist zum Laden gefahren, und – es war ein Lastwagen, ein großer Sattelschlepper. Die Bremsleitung ist gerissen.« Mehr konnte er nicht herausbringen, und mehr war auch nicht nötig.
»Wie hieß sie?«
»Tish – Patricia.«
»Wie lange wart ihr …«
»Eineinhalb Jahre. Dann war sie einfach … nicht mehr da. Ich habe nie damit gerechnet. Ich meine, ich war viel weg, habe einige gefährliche Sachen gemacht, aber das ist alles vorbei, und das war eben ich, nicht sie. Ich habe nie gedacht …« Seine Stimme versagte wieder. Pam blickte im gedämpften Licht der Kajüte auf ihn herunter und sah die Narben, die ihr bisher entgangen waren. Sie fragte sich, was sie wohl für eine Geschichte hatten. Aber das war nicht wichtig.
Sie legte die Wange auf seinen Kopf. Er hätte etwa genau jetzt Vater sein sollen. Hätte eine Menge sein sollen.
»Du hast es nie rausgelassen, oder?«
»Nein.«
»Und warum jetzt?«
»Ich weiß nicht«, flüsterte er.
»Danke schön.« Kelly blickte überrascht auf. »Das ist das Netteste, was ein Mann mir je angetan hat.«
»Ich verstehe nicht.«
»Doch, das tust du«, erwiderte Pam. »Und Tish versteht auch. Du läßt mich ihren Platz einnehmen. Oder vielleicht sogar sie? Sie hat dich geliebt, John. Sie muß dich unheimlich geliebt haben. Danke, daß du mich hast helfen lassen.«
Er fing erneut zu weinen an, und Pam bettete seinen Kopf wieder in ihren Schoß, wiegte ihn wie ein kleines Kind. So ging es zehn Minuten, aber keiner von ihnen sah auf die Uhr. Als er sich erholt hatte, küßte er sie voller Dankbarkeit, die sich rasch wieder in Leidenschaft verwandelte. Pam legte sich auf den Rücken, ließ ihm die Oberhand, wie er es jetzt brauchte, da er im Geiste wieder ein Mann war. Sie wurde
2
Begegnungen
Kelly erwachte zur gewohnten Zeit eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Möwen kreischten, und am östlichen Horizont erschien der erste trübe Schimmer. Zunächst war er verwirrt, daß über seiner Brust ein schlanker Arm lag, doch binnen kürzester Zeit kamen die Gefühle und Erinnerungen wieder. Er entschlüpfte ihr und breitete eine Decke über sie, um sie vor der morgendlichen Kühle zu schützen. Er mußte sich um das Schiff kümmern.
Kelly setzte die Kaffeemaschine in Gang, zog eine Badehose an und ging nach oben. Er hatte nicht vergessen, das Ankerlicht zu setzen, bemerkte er erleichtert. Der Himmel hatte aufgeklart, und die Luft war kühl nach den Gewitterstürmen der vorigen Nacht. Er ging nach vorn und sah überrascht, daß einer seiner Anker sich etwas verschoben hatte. Kelly machte sich Vorwürfe deswegen, obwohl ja nichts Schlimmes passiert war. Das Wasser war ruhig, ölig glatt, und es wehte eine sanfte Brise. Ein rosigorangefarbener erster Lichtschimmer zierte die von Bäumen gesäumte Küstenlinie im Osten. Alles in allem schien das ein so schöner Morgen zu werden, wie er sich nur denken konnte. Dann fiel ihm ein, daß das, was sich geändert hatte, überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun hatte.
»Verdammt«, flüsterte er der noch nicht angebrochenen Morgendämmerung zu. Kelly war steif, und er machte einige Streckübungen, um die Verspannungen zu lösen. Erst langsam dämmerte ihm, wie toll er sich ohne den üblichen Kater fühlte. Noch länger brauchte er, um sich zu erinnern, wann es das letzte Mal so gewesen war. Neun Stunden Schlaf? fragte er sich. So viel? Kein Wunder, daß er sich so gut fühlte. Als nächstes mußte er im Rahmen seiner morgendlichen Prozedur einen Deckabsetzer holen, um das Wasser zu beseitigen, das sich auf dem Fiberglasdeck angesammelt hatte.
Ein leises, gedämpftes Wummern von Dieselmotoren ließ ihn den Kopf wenden. Kelly blickte nach Westen, um es zu orten, aber in dieser Richtung lag ein wenig Nebel, der von der Brise dorthin geweht worden war, und er konnte nichts ausmachen. Er ging zum Kontrollpult auf der Brücke und holte sein Fernrohr, um durch das 7X50er gerade noch einen starken Scheinwerfer aufblitzen zu sehen. Kelly wurde vom Licht geblendet, das genauso plötzlich wieder abgeschaltet wurde, und ein Megaphon quäkte übers Wasser.
»Entschuldigung, Kelly. Wußte nicht, daß Sie es waren.« Zwei Minuten später legte das vertraute Zwölf-Meter-Patrouillenboot der Küstenwache längsseits der Springer an. Kelly stürzte nach Backbord, um die Gummifender anzubringen.
»Versuchen Sie mich umzubringen oder was?« sagte Kelly leichthin.
»Entschuldigung.« Der Quartermaster Erster Klasse Manuel »Portagee« Oreza stieg mit geübter Behendigkeit von einem Schanzdeck auf das andere. Er deutete auf die Gummifender. »Wollen Sie mich beleidigen?«
»Aber auch kein gutes seemännisches Benehmen«, fuhr Kelly fort, als er auf seinen Besucher zuging.
»Ich hab schon mit dem jungen Burschen darüber gesprochen«, versicherte ihm Oreza. Er streckte die Hand aus. »Morgen, Kelly.«
Die ausgestreckte Hand hielt einen Styroporbecher mit Kaffee. Kelly nahm ihn entgegen und lachte.
»Entschuldigung angenommen, Sir.« Oreza war berühmt für seinen Kaffee.
»Lange Nacht. Wir sind alle müde, und es ist eine junge Crew«, erklärte der Mann von der Küstenwache mit matter Stimme. Oreza war selbst fast 28 und bei weitem der älteste Mann in seinem Team.
»Schwierigkeiten?« fragte Kelly.
Oreza nickte, während er sich auf dem Wasser umblickte. »Irgendwie schon. So ’n verdammter Trottel in ’ner Jolle ist nach dem kleinen Gewitter letzten Abend vermißt gemeldet worden, und wir haben weiß Gott überall nach ihm gesucht.«
»Wind mit vierzig Knoten. Hat ganz schön gepustet, Portagee«, erklärte Kelly. »Ist auch ganz schön schnell rangekommen.«
»Jaja, wir haben auch schon sechs Boote gerettet, bloß das eine fehlt noch. Haben Sie letzte Nacht irgendwas Ungewöhnliches gesehen?«
»Nein. Bin von Baltimore rausgekommen um … na, etwa 16 Uhr, denke ich. Zweieinhalb Stunden Herfahrt. Hab gleich, als das Gewitter da war, Anker geworfen. Sicht war ganz schön schlecht, hab so gut wie nichts gesehen, bevor wir nach unten sind.«
»Wir«, bemerkte Oreza und streckte sich. Er ging zum Steuerrad, hob das regendurchweichte Top auf und schob es Kelly zu. Sein Gesichtsausdruck blieb neutral, aber hinter seinen Augen leuchtete Interesse auf. Er hoffte, daß sein Freund jemand gefunden hatte. Das Leben hatte es mit diesem Mann nicht besonders gut gemeint.
Kelly gab ihm den Becher mit einem gleichfalls neutralen Gesichtsausdruck zurück.
»Hinter uns ist ein Frachter rausgekommen«, fuhr er fort. »Unter italienischer Flagge, etwa halbvolles Containerschiff, muß etwa fünfzehn Knoten gemacht haben. Hat noch jemand den Hafen verlassen?«
»Mhm.« Oreza nickte und sagte dann in professionellem, leicht verärgertem Tonfall: »Das macht mir Sorgen. Diese Scheißfrachter, die mit Volldampf rausrauschen und nicht aufpassen.«
»Na ja, zum Teufel, wenn du außerhalb des Steuerhauses stehst, kannst du eben naß werden. Außerdem könnte vielleicht irgendwas an der Ausrüstung gegen eine Gewerkschaftsbestimmung verstoßen, nicht? Vielleicht ist Ihr Kerl untergegangen«, bemerkte Kelly düster. Das wäre nicht das erste Mal, selbst in einem so zahmen Gewässer wie der Chesapeake.