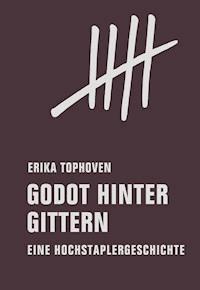
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Karl Franz Lembke war ein Mann mit vielen Gesichtern. Für die einen, die ihn kennenlernten, war er der Dr. Allwissend, erfahren in Politik, Medizin, Pferdezucht und was immer gerade gefragt war, für andere, zu anderen Zeiten, ein mitleiderregender Zuchthäusler, doch stets ein Mann mit außergewöhnlichen Qualitäten. KFL wusste seine Talente geschickt zu nutzen - in Deutschland ebenso wie in Frankreich. Als junger, mehrmals straffällig gewordener Mann verlässt er sein Heimatland, gelangt im Zuge der Emigrantenströme nach Paris, wo er sich mit Charme und Verführungskunst in höhere Regierungskreise einschmeichelt, Generäle und Verwaltungsbeamte düpiert, bei Ausbruch des Krieges nach Südfrankreich flüchtet und mit allerhand Hochstapeleien seine Haut vor dem Zugriff der deutschen Besatzer rettet. Nach dem Krieg vagabundiert er durch Westdeutschland, betört Frauen durch märchenhafte Geschichten und erdichtet sich immer neue Identitäten. Er landet im Knast, bringt eine Aufführung von "Warten auf Godot" in eigener Übersetzung zustande, wechselt herzerweichende Briefe mit dem Autor Samuel Beckett und beschäftigt die deutsche und die französische Justiz nach seiner Freilassung noch jahrzehntelang. Erika Tophoven, deren Mann Elmar unmittelbar in das Geschehen involviert war, rekonstruiert in einem spannenden Text den kurvenreichen Weg dieser Beckett'schen Bühnenfigur. Es ist ihr gelungen, anhand von unveröffentlichten zeitgeschichtlichen Dokumenten einen Blick auf die Lebensverhältnisse des vorigen Jahrhunderts diesseits und jenseits des Rheins zu werfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Tophoven
Godot hinter Gittern
Eine Hochstaplergeschichte Mit unveröffentlichten Dokumenten
Teil I
Paris, 1956
Es war ein sonniger Herbsttag. Ich erinnere mich, dass wir vor dem Toreingang der Nr. 179 Champs-Élysées standen, wo der Französische Rundfunk (ORTF) 1956 seinen Sitz hatte. Auch die deutsche Abteilung, von der aus allabendlich zwischen 19 und 20 Uhr die Sendung»Ici Paris … Im Brennpunkt des politischen Geschehens«ausgestrahlt wurde. Elmar Tophoven, von Freunden und Bekannten kurz Top genannt, las dort die Nachrichten oder kulturellen Berichte aus der französischen Hauptstadt, und ich wurde schon bald, nachdem wir uns kennengelernt hatten, zu kleinen Reportagen und Synchronisationen hinzugezogen. Eine Gruppe von deutschsprachigen Journalisten bereitete in einem bescheidenen Büro desORTF-Gebäudes die allabendliche Sendung vor, und es dauerte nicht lange, bis mein Kurzname Kiki die Runde machte und ich mit»Voilà Kiki de Montparnasse«begrüßt wurde – in Anspielung auf die Muse vieler Montparnasse-Künstler der Zwanzigerjahre.
Es war ein Glücksfall, dass ich, kaum in Paris eingetroffen, durchTop hier und da kleine Jobs bekam, Touristenbusse durch Paris begleiten durfte oder Pilgergruppen, die auf der Durchreise nach Lourdes oder Lisieux in Paris Station machten. Eine andere willkommene Einnahmequelle bot sich mir bei Synchronisationen von Werbe- und Dokumentarfilmen, wenn eine weibliche Stimme gebraucht wurde.
Von einer ungeahnten Bedeutung für mein späteres Leben sollte die Übersetzung eines englischen Hörspieltextes werden. Der irische Autor Samuel Beckett, der seit 1937 in Paris lebte, hatte gerade für dieBBCLondon das Hörspiel»All That Fall«geschrieben, was seinen Übersetzer Elmar Tophoven, der bis dahin Beckett-Texte nur aus dem Französischen übersetzt hatte, vor gewisse Schwierigkeiten stellte. Er stand seit der Übersetzung des Theaterstücks»En attendantGodot«und der ersten französischen Prosawerke in engem Kontakt mit dem Autor. Würde es bei englischen Texten so weitergehen?
Mit meinem gerade in München erworbenen Übersetzerdiplom fühlte ich mich stark genug, Top das Hörspiel»mal eben«zuübersetzen. So trafen wir uns denn an jenem Oktoberabend an den Champs-Élysées, um nach der Sendung einen ersten Blick in das Hörspielmanuskript zu werfen, als er mir beiläufig von einem Vorfall erzählte, der sich wenige Wochen zuvor eben dort abgespielt hatte.
»Da stand er.«
»Wer?«
»Lembke.«
»Lembke?«
»Ja, Karl Franz Lembke, der Mann, der ›Godot‹ im Knast übersetzt hat.«
»Ein Kollege von dir gewissermaßen.«
»Könnte man sagen. Ich hier in meiner Mansarde im Hotel Bonaparte in Paris und Lembke in seiner Zelle in Lüttringhausen.«
»Lüttring… – was?«
»Lüttringhausen. In der Strafanstalt Lüttringhausen unweit von Wuppertal.«
»Seit wann werden denn Übersetzer mit Zuchthaus bestraft?«
»Bestraft wurde er wohl wegen anderer Delikte. Aber was ihn auf die Idee brachte, Becketts ›Godot‹ zu übersetzen, ist ein Rätsel. Der ganze Mann überhaupt.«
Ich war neugierig geworden, und an einem der nächsten Abende zeigte mir Top zwei Briefe, die in der Tat mehr als verblüffend waren. Da schrieb ein deutscher Zuchthäusler aus einer Strafanstalt im Rheinland in flüssigem Französisch einen zwei Seiten langen Brief an Samuel Beckett in Paris:
Cher Maître,
Certainement vous allez être surpris de recevoir au sujet de votre »En attendant Godot« une lettre venant d’une Maison, dont les fenêtres soient gardées par des barreaux.
»… ein Brief aus einem Haus mit vergitterten Fenstern«, so viel verstand ich. Er saß also hinter schwedischen Gardinen und meinte damit die Strafvollzugsanstalt Lüttringhausen. Unterschrift? Anstatt des Namens:»un Prisonnier«. Wahrhaftig eine spannende Geschichte.
Oui! D’une Maison quelque part en Rhénanie où des forçats passent leur drôle d’existence, où les Durs, les Vrais de vrai, les voleurs de grand chemin, les aventuriers, les fausseurs, les Pédales, les assassins, les maniaques, les harbeaux et les escrocs, passent cette putain de vie … et qui attendent … attendent …
»Da passe ich. Das ist ein Vokabular, das man nicht auf der Schulbank lernt.«
Und Top übersetzte:»Also, derPrisonnierschreibtaus einem Haus irgendwo im Rheinland, in dem die Zuchthäusler ihr verrücktes Leben zubringen: wo die Hartgesottenen, die echten Kerle, die Straßenräuber, die Abenteurer, die Fälscher, die Zuhälter, die Mörder, die Besessenen, dieharbeaux– das Argot-Wort kenne ich auch nicht – und die Hochstapler ihr beschissenes Dasein fristen … und warten … warten.«
»… auf›Godot‹.«
»Richtig! So geht der Brief auch weiter:›Attendent quoi? – Godot? – Peut-être.‹«
Brief Karl Franz Lembke an Samuel Beckett
Rd Lüttringhausen, 1. Oktober 54
Cher Maître,
gewiss werden Sie überrascht sein, in Bezug auf Ihr »En attendant Godot« einen Brief aus einem Haus zu bekommen, dessen Fenster vergittert sind – ja, aus einem Haus irgendwo im Rheinland, wo die Zuchthäusler ihr verrücktes Leben zubringen, wo die Hartgesottenen, die echten Kerle, die Straßenräuber, die Abenteurer, die Fälscher, die Zuhälter, die Mörder, die Besessenen, dieharbeauxund die Hochstapler ihr beschissenes Dasein fristen … und warten … warten.
Warten worauf? – Godot – Vielleicht! –
Die meisten jedenfalls warten auf den Tag ihrer Freilassung, auf die Freiheit, auf Briefe, auf Sprecherlaubnis, auf die nächste Mahlzeit, auf ihre Eltern, auf den Feierabend, auf Nachrichten, darauf, dass die Vögel singen, auf den Ruf eines Kindes auf der Straße, auf das betäubende Lachen einer Frau auf der anderen Seite der Mauer, und ein paar von uns warten auch auf die Sonntage mitder großen Stille, der Ruhe, dem Glockengeläut, der Messe und dem Gebet.
Und da kam eines Tages im Juli ’53 mit einem Brief aus Frankreich die Nachricht, dass in Paname ein sensationelles Stück gespielt würde, das ganz Paris auf die Beine brächte und vor allem die Schreiberlinge nicht zur Ruhe kommen ließe.
»Pascal gespielt von den Fratellinis im Médrano«, sagte der Freund aus Frankreich. Auf meine Bitte und nach harten Kämpfen mit der »Verwaltung« bekam ich das Bändchen der ersten Ausgabe in die Hand – und ich habe es gelesen und wieder gelesen und immer noch einmal: gelesen … bis ich nicht mehr der Gefangene des Strafvollzugs war, sondern der Gefangene Ihres Werks, ja mehr noch: von Godot!
Und dann? – Dann habe ich angefangen, es zu übersetzen, ich habe es ganz übersetzt … und dann bin ich auf die Idee gekommen, es hier spielen zu lassen, hier im Zuchthaus, dieses Stück vom Warten auf Godot, damit meine Mitgefangenen Ihr Werk ebenfalls kennenlernen … Und Gott sei Dank!, unser unermüdlicher und hochverehrter Pastor hat die Genehmigung für uns bekommen, das Stück hier aufzuführen.
Ich habe mir meine Schauspieler gesucht. Unter den etwa 400 Gefangenen habe ich die Typen gefunden, die die Rollen in Godot spielen können. Kein einziger von ihnen hat je zuvor auf der Bühne gestanden.
Am 29.11.1953 hob sich der Vorhang zur Premiere! …
Nun denn – obwohl wir von Zeit zu Zeit Theatervorstellungen hier haben, Stücke von der Art derBibliothèque Rosefür artige Chorknaben, und obwohl uns jedes Jahr eine Weihnachtskrippe aufgebaut wird und Theatergruppen von außerhalb Stücke für uns spielen wie »Der Mann mit dem Strick« von Armand Payot aus Genf – Ihr Godot war ein Triumph, ein Rausch! – Ihr Godot war »unser« Godot, unser eigener, er gehörte uns! – Denn jeder sah sich verkörpert, wiedergeboren, verkörpert in einer der Gestalten des Stücks! – Wir alle sind diese Clochards, denen die Füße wehtun. Wir, die nicht jeden Tag gebraucht werden – andere machen es ebenso gut, wenn nicht besser … –,
Aber die sich fragen müssen: »Was machen wir hier?«, und die nicht ohne Verwunderung feststellen: Ja, auch wir warten auf Godot – und wir wissen nicht, dass Godot schon da ist! – Ja, er ist da! – Godot ist mein Nächster. Der Mitgefangene in meiner Zelle – Tun wir etwas, um ihm zu helfen! – Helfen wir ihm, dass er andere Schuhe bekommen kann, die ihm nicht so wehtun! …
Seitdem haben wir das Stück mehr als fünfzehn Mal gespielt! Freunde vom Sozialwerk haben es gesehen. Die große Presse draußen hat darüber geschrieben.
Die Illustrierten, die Wochenzeitungen, die großen Kritiker, die Dramaturgen und die Theaterregisseure draußen sind gekommen, um uns spielen zu sehen, nein, nicht spielen, sondern ihr Stück durchleben …
Man sagt, dass es »die allerbeste Aufführung Ihres Werks ist, die es je in Deutschland gegeben hat« …
Na, könnte es Sie nicht dazu verlocken, uns zu besuchen? – Obwohl unsere Vorstellungen ganz entschieden »geschlossene« Veranstaltungen sind, wäre es für uns eine große Ehre, Sie hier zu empfangen, ganz privat, hier im Zentralgefängnis. Als illustrer Gast unseres Pastors.
Angeblich werden sie in nächster Zeit nach Deutschland kommen. Ins Rheinland sogar. Dann seien Sie doch so nett und kommen Sie zu uns, ja?
Ich wage zu hoffen, dass wir Sie hier sehen!
En attendant, daignez d’accepter l’hommage de mon profond respect et, cher Maître, je vous en pris, aussi les remerciements
d’un Prisonnier
»Eine unglaubliche Geschichte. Und der Typ, der diesen Brief geschrieben hat, stand dann eines Tages hier auf den Champs-Élysées vor dir?«
»Zunächst musste er noch zwei Jahre absitzen.«
Nach und nach erfuhr ich, was sich in jenen beiden Jahren abgespielt hatte: DerPrisonnierhatte das Glück, zwei tatkräftige Fürsprecher im Zuchthaus Lüttringhausen zu haben: Pastor Manker, den Seelsorger der Anstalt, und Frau Flora Klee-Palyi, eine Wuppertaler Künstlerin mit engen Beziehungen nach Paris. FrauKlee-Palyi, die sich sehr um die Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft bemühte, hatte offenbar die intellektuellen Fähigkeiten und das charismatische Auftreten des Strafgefangenen erkannt. Eventuell war sie es, die Lembke auf das Theaterstück aufmerksam machte und ihn dazu anregte, es zu übersetzen, obgleich derPrisonnierin seinem Brief an Beckett behauptet, es sei ein Freund aus Paris gewesen, der ihm den»Godot«-Text zugespielt habe. Pastor Manker jedenfalls ermöglichte dieAufführungdes Stücks in der Gefängniskirche. In bewegenden Worten schilderte er in einem Brief, der dem Brief desPrisonnierbeilag, wie bedeutend das Stückfür ihn selbst war.
Es ist anzunehmen, dass Frau Klee-Palyi beide Briefe mit nach Paris nahm, wo sie immer wieder mit französischen Künstlern zusammentraf. Jedenfalls gelangten die Briefe Anfang Oktober 1954 über den Verleger Jérôme Lindon, Les Éditions de Minuit, an Beckett, der sich in jenen Tagen in seinem Häuschen an der Marneaufhielt. Den Briefen waren mehrere Ausschnitte aus deutschen Zeitungen beigefügt, die vermutlich Frau Klee-Palyi gesammelt hatte, und die zeigten, dass die»Godot«-Inszenierung im Gefängnis in Deutschland eine Sensation war.
Beckett bestätigte umgehend den Empfang:
Mein lieber Jérôme, Dank für Ihren Brief mit den beigefügten beiden Briefen. Sie sind wahrhaftig ergreifend, und ich werde unverzüglich darauf antworten. Ich weiß nicht, wer glaubte, dass ich ins Rheinland fahre, denn davon war nie die Rede. Ich hoffe aber, dass ich eines Tages hinkomme und sie sehen werde …
Er entwarf sogleich eine Antwort an denPrisonnier,die im Archiv desTrinity College Dublin erhalten ist und von der Rührung zeugt, die ihn beim Lesen der Briefe geradezu überwältigt hatte: Ihm fehlten die Worte, jetzt mehr denn je, da er sich wie verwandelt fühle nach dem, was alle dort für ihn getan hätten. In seinem ganzen Schriftstellerleben sei ihm noch nie etwas Derartiges passiert. Dort, wo er sich seit jeher im Kreis gedreht habe, gestürzt sei und sich wieder aufgerichtet habe, sei es nicht mehr ganz so dunkel und nicht mehr ganz so still.
Aus seinem Brief geht auch hervor, dass die Nachricht von der»Godot«-Aufführungin Lüttringhausen für ihn nicht ganz überraschend kam. Bereits im Juli 1954 war in Frankreich imFigaro Littéraireeine Notiz erschienen, in der von derAufführungberichtet wurde. In ihr hieß es lapidar:»Von Weihnachten bis Ostern wurde die deutsche Fassung des Theaterstücks von Samuel Beckett›En attendant Godot‹von Gefangenen vor ihren Mitgefangenen im Gefängnis von Lüttringhausen aufgeführt.«
DerPrisonnierKarl Franz Lembke schrieb seinen Brief an Beckett erst am 1. Oktober 1954. Seit derUraufführungam 5. Januar 1953 in Paris waren also fast zwei Jahre vergangen. Damals war Elmar Tophoven einer der wenigen Zuschauer gewesen, die nicht im Laufe derAufführungden Saal des kleinen Théâtre de Babylone verlassen hatten. Im Gegenteil: Er beschloss spontan, das Stück zu übersetzen. Sechs Wochen später saß er dem Autor gegenüber, und beide legten gemeinsam letzte Hand an den Text.
Der Ruf des Stücks war schnell nach Berlin gedrungen, nur die Korrektur des Titels gelangte infolge eines Poststreiks nicht mehr rechtzeitig zur Premiere dorthin. Am 8. September wurde im Berliner Schlosspark Theater»Wirwarten auf Godot«aufgeführt.Der Titel, ohne das vereinnahmendeWir,setzte sich danach schnell durch und wurde bald zu einer geläufigen Redewendung.
Ankündigung des Schlosspark Theaters 1953
Ohne Wissen der Außenwelt probte man unterdessen in Lüttringhausen die Lembke-Übersetzung»Manwartet auf Godot«. Am 29. November verfolgten Pastor Manker und seine Schutzbefohlenen mit angespannter Miene das Spiel in der Anstaltskirche.
Lembke mimte den Vladimir/Didi, während unweit von dort der spätere»Derrick«-Darsteller Horst Tappert als Didi in Wuppertal auf der Bühne stand. Dort hatte Grischa Barfuß das Stück inszeniert und schickte nach der erfolgreichen Premiere gleich ein Telegramm nach Paris.
Telegramm von Grischa Barfuß an Elmar Tophoven
In seiner Zeitschrift Theater und Zeit wurde ein paar Monate später auch über die Lüttringhauser Aufführung berichtet. In einem Artikel von Dr. Hermann Krings »›Man wartet auf Godot‹ – im Zuchthaus« geht es auch um den hier gewählten Titel:
Jenem Strafgefangenen in Lüttringhausen, dem die Behörde erlaubt hatte, einen Teil seiner Haftzeit mit der Übersetzung und Bearbeitung von Samuel Becketts »En attendant Godot« zuzubringen, hat es gefallen, jenes »en attendant« mit »man wartet« wiederzugeben. Im Zuchthaus zu sagen, »wir warten auf Godot« wäre peinlich, denn was löst dort das Wort »warten« aus? In einem solchen Haus, dessen kasernenhafte Kälte die erhitzten Schicksale fugendicht abschließt, dessen Lysol gereinigte, ärmlich-äußerliche Ordentlichkeit ständig die tiefe Verworrenheit der Menschen gegenüber hat und zu ihr so wenig passen will wie das kümmerliche, aber peinlich aufgeräumte Gartenbeet im grauen Hof zum Mord aus Wut oder Lust, in einem solchen Haus, in dem nur noch Gitter, Schlösser und Karabiner die furchtbaren Eruptionen der Menschenseele körperlich gefesselt halten, muss man wohl so behutsam sein wie etwa an einem Krankenbett …
Aus dem Artikel in Theater und Zeit. Oben ganz rechts: Karl Franz Lembke
Aus dem Artikel in Theater und Zeit
Es vergehen noch zwei Jahre, bis der Gefangene Karl Franz Lembke in die Freiheit entlassen wird. Frau Klee-Palyi, der gute Geist von Lüttringhausen, scheint weiterhin eifrig bemüht gewesen zu sein, ihrem Schützling das Leben hinter Gittern erträglich zu machen. Von Top erfuhr ich, dass sie bei ihren Reisen nach Paris für ihn sammelte: Geld, Anziehsachen, Zigaretten. Lembke war wählerisch, es kam vor, dass die Konfektionsgröße nicht stimmteoder die Zigarettenmarke nicht die richtige war. Top referierte oft den Satz:»Sie schicken mir Gitanes, aber ich rauche doch nur Gauloises«– oder umgekehrt. Auch den Namen Klee-Palyi habe ich oft von ihm gehört, ohne zu wissen, was für eine interessante Persönlichkeit sich dahinter verbarg.
Die gebürtige Ungarin hatte an Kunsthochschulen in Genf und München studiert und lebte seit 1927 in Wuppertal, verheiratet mit Professor Dr. Philipp Klee, einem renommierten Internisten und Pharmakologen. Flora Klee-Palyi war eine von französischen und deutschen Lyrikern hoch geschätzte Künstlerin, die mit ihren Linolschnitten und Lithografien die Werke bekannter Dichter illustrierte und selbst zweisprachige Gedichtbände herausgab. 1956 erhielt sie den Kunstpreis der Stadt Wuppertal, zu welchem Anlass Karl Krolow die Festansprache hielt.
Etwa zu jener Zeit muss Karl Franz Lembke aus dem Knast entlassen worden sein. Ich wüsste gern, wann Frau Klee-Palyi von den Machenschaften ihres Schützlings erfahren hat, aber ich konnte bis jetzt nur erfahren, dass Professor Klee ihn in seinem Lebensbericht erwähnt und als einen redegewandten Mann mit starker Ausstrahlung schildert – aber verdächtig!
Flora Klee-Palyi, die als Jüdin im Herbst 1944 noch verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde, kehrte nach der Befreiung mit schweren gesundheitlichen Schäden nach Wuppertal zurück, setzte aber trotz allem ihre künstlerische Tätigkeit fort. Sie starb 1961 nach schwerem Leiden.
Auch Beckett hatte der Gedanke an denPrisonnier





























