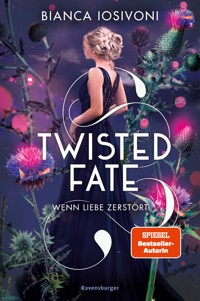12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Canadian-Dreams-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die schicksalhafte Second-Chance-Romance der Bestsellerautorin geht weiter – Teil 2 aus Holdens Sicht
Verzehrende Gefühle. Dunkle Geheimnisse. Die Fehler von damals dürfen sein Leben nicht länger bestimmen …
Süße Erinnerungen. Heiße Tränen. Und das Gefühl, die Liebe seines Lebens verloren zu haben …
Mit seiner Rückkehr nach Golden Bay hat Holden Embers Gefühlswelt erneut zum Einstürzen gebracht. Auch wenn es ihn fast umbringt, sie leiden zu sehen, kann er ihr nicht geben, was sie sich so verzweifelt von ihm wünscht – die Wahrheit über jene Nacht vor fünf Jahren. Die Nacht, die alles zwischen ihnen veränderte. Stattdessen will er ihr der gute Freund sein, den sie gerade so dringend braucht – auch wenn ihn ihre Nähe mit jedem Ausflug und jeder Berührung fast um den Verstand bringt. Doch Holden muss nicht nur gegen seine Gefühle für Ember ankämpfen, sondern auch gegen seine dunkle Vergangenheit: Zwielichtige Gestalten, Lügen und Geheimnisse drohen ihn erneut in den Abgrund zu reißen – und ihm wird klar, dass Ember in seiner Nähe immer in Gefahr sein wird …
Romantik & Spice von der Bestsellerautorin – nach ihrem Nr.1-Hit »SORRY« lockt Bianca Iosivoni ihre Leser*innen mit einer umwerfenden Liebesgeschichte und Endless-Summer-Vibes auf eine traumhafte Insel vor der Küste Kanadas:
1. Golden Bay. How it feels
2. Golden Bay. How it hurts
3. Golden Bay. How it ends
Die Geschichte von Ember und Holden ist perfekt für dich, wenn du diese Tropes liebst:
• Second Chance
• Broken Hero
• Found Family
• Dark Past
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Ähnliche
Bianca Iosivoni ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten New-Adult-Autorinnen Deutschlands. Ihr Roman SORRY. Ich habe es nur für dich getan, ein unwiderstehlicher Mix aus Romantik und Thrill, sprang sofort auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste und hielt sich, angefeuert von seinen begeisterten Fans, wochenlang in den Top 10. Auch mit ihren Romantasy-Bestsellern macht Bianca Iosivoni seit Jahren unzählige Leser*innen süchtig. Die Canadian-Dreams-Reihe ist eine New-Adult-Trilogie voller Gefühle, Spice und Leidenschaft, die die Sehnsucht nach einem Sommerurlaub auf einer kanadischen Insel wie Golden Bay weckt.
Außerdem von Bianca Iosivoni lieferbar:
SORRY. Ich habe es nur für dich getan
Golden Bay. How it feels
www.penguin-verlag.de
Bianca Iosivoni
Golden
Bay
Roman
Band 2
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 by Penguin Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur.
Redaktion: Melike Karamustafa
Illustration: Francis Eden
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildungen: www.shutterstock.com/Konstanttin; www.shutterstock.com/surachet khamsuk; www.shutterstock.com/oksanka007; www.shutterstock.com/merrymuuu
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-30781-3V001
www.penguin-verlag.de
Soundtrack
Taylor Swift, Gary Lightbody – The Last Time (Taylor’s Version)
Munn – can you hear me?
OneRepublic – Waking Up
Walking On Cars – Colonize My Heart
Chord Overstreet – Hold On
Taylor Swift – Anti-Hero
Tyrone Wells – Days I Will Remember
Simple Plan – Welcome to My Life
Imagine Dragons – Cutthroat
Ed Sheeran – Happier
Taylor Swift – Don’t Blame Me (Taylor’s Version)
VOILÀ – Figure You Out
Lilith Czar – Burn With Me
DIAMANTE, Breaking Benjamin – Iris
Black Lab – Matter of Time
JAY-Z, Linkin Park – Jigga What / Faint
Welshly Arms – I Surrender
JAY-Z, Linkin Park – Numb / Encore
Forest Blakk – If You Love Her
Rosa Linn – SNAP (High and Fast)
Zac Efron, Zendaya – Rewrite The Stars
Linkin Park – In the End
SLANDER, Dylan Matthew – Love Is Gone (Acoustic)
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet sich auf S. 401 eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Bianca Iosivoni und der Penguin Verlag
Für alle,
die sich eine zweite Chance wünschen.
Willkommen in Golden Bay.
Fünf Jahre zuvor
07. August
Holden, 00 : 31 Uhr
Ich hab vorhin die letzte Fähre aufs Festland genommen.
Ich komme nicht mehr zurück …
Gemma, 00 : 32 Uhr
Warum? Was ist passiert? Ist Ember bei dir?
Holden, 00 : 34 Uhr
Nein.
Gemma, 00 : 35 Uhr
Wieso nicht? Was ist los?
00 : 39 Uhr
Rede mit mir, Holden!
Holden, 00 : 40 Uhr
Das mit Em und mir ist vorbei
00 : 40 Uhr
Ich hab Mist gebaut, Gemma. Gigantischen Mist
00 : 42 Uhr
Mach dir keine Sorgen.
Ich melde mich später noch mal bei dir und Mom
Gemma, 00 : 46 Uhr
Komm zu mir. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Ich hab zwar kein Geld, aber wir finden eine Lösung, Holden. Wirf nicht dein ganzes Leben weg!
Holden, 00 : 46 Uhr
Zu spät
1. Kapitel
»Du wirst mir das niemals vergeben, oder?«
Die Frage schwebt zwischen uns in der Luft. Und mit jeder Sekunde, die vergeht und in der Ember nicht antwortet, wird sie immer bedeutungsvoller, immer schwerer, wie ein Sommergewitter, das sich jeden Moment entladen wird.
Gerade spüre ich Embers Finger noch in meinen, dann zieht sie sie zurück und weicht meinem Blick aus. Wahrscheinlich merkt sie nicht einmal, wie sie die Hände an ihren Seiten zu Fäusten ballt, löst und erneut zusammenballt.
Sie sieht erschöpft aus, wie sie da in dunkelgrünem T-Shirt und kurzer, farbverschmierter Latzhose vor ihrem alten Elternhaus steht. Als hätten sie die letzten Tage unendlich viel Kraft gekostet. Und mit einem Mal bereue ich es, dass ich nicht früher hergekommen bin, um für sie da zu sein. Aber nach der Konfrontation im Krankenhaus vor zwei Tagen weiß ich nur zu gut, dass sie das nicht zugelassen hätte. Das Beste, das Einzige, was ich für sie tun konnte, war, Shae zu ihr zu schicken, damit sie nicht ganz allein ist.
Der Unfall ihrer Großmutter hat sie erschreckt, sie fertiggemacht und viel aufgewühlt. Ich konnte es ihr schon ansehen, bevor sie mir von ihrer Mom erzählt hat.
Aber jetzt … zu wissen, was damals passiert ist, was Ember durchmachen musste … verdammt. Wenn ich könnte, würde ich ihr all das abnehmen, es ungeschehen machen, die Vergangenheit auslöschen, damit sie ihr nicht mehr so wehtut. Damit ich ihr nicht mehr so wehtue.
Im Gegensatz zu mir weiß Ember noch immer nicht, was in jener Nacht geschehen ist. Ich dagegen kenne nun die ganze Wahrheit. Ihre – und meine. Und hätte ich damals erfahren, was Ember zu Hause miterleben musste, wie sie ihre Mom im Badezimmer vorgefunden und zu retten versucht hat, wäre womöglich alles anders gekommen. Vielleicht würden wir heute unter ganz anderen Umständen hier stehen.
Oder ich wäre gar nicht mehr da.
Embers Augen sind gerötet, als hätte sie stundenlang geweint. Bei dem Anblick zieht sich meine Brust zusammen. Ich habe es schon früher gehasst, sie leiden zu sehen. Doch das Wissen darüber, was sie alles durchgemacht hat und dass ich ihr nicht beistehen konnte, zerreißt mir regelrecht das Herz.
Du wirst mir das niemals vergeben, oder?
Sie muss es nicht aussprechen, ich kenne die Antwort bereits. Und sie ist wie ein Schlag in die Magengrube.
»Nein.« Als Ember mich wieder ansieht, glänzen ihre Augen feucht. »Das kann ich nicht.«
In der Sekunde, in der sie das sagt, wird mir klar, dass ich mich geirrt habe. Diese Worte zu hören, tut viel mehr weh, als sie mir nur vorzustellen. Das Brennen in meinem Magen verstärkt sich, breitet sich aus, droht mich zusammen mit meinen Schuldgefühlen aufzufressen.
Ich hatte keine verdammte Ahnung, was in jener Nacht passiert ist. Ich habe ihre Nachrichten gelesen, ohne zu reagieren. Habe ihre Anrufe weggedrückt und mir eingeredet, dass es besser für uns beide wäre. Wenn ich geahnt hätte, was ich damit anrichte … Scheiße, ich wäre niemals gegangen. Ich hätte sie nie verlassen. Ganz egal, was die Konsequenzen gewesen wären.
Ich nicke, weil ich nichts anderes zustande bringe, aber Ember ist noch nicht fertig.
»Ich bin dir wirklich dankbar dafür, dass du mir mit Grandma geholfen hast.« Ihre Stimme ist leise. Rau. Nur ein Wispern zwischen uns. »Ehrlich gesagt hätte ich nie damit gerechnet oder überhaupt zu hoffen gewagt, dass du dort auftauchen und auch im Krankenhaus bei mir bleiben würdest. Das ist …« Sie schüttelt den Kopf. »Danke.«
»Em …« Ohne nachzudenken, hebe ich die Hand und streiche mit den Knöcheln über ihre Wange.
Weder weicht sie zurück, noch stößt sie mich weg. Sie schließt sogar die Augen, als versuche sie, sich ganz auf die Berührung zu konzentrieren. Sie sich ein allerletztes Mal einzuprägen.
»Wenn ich es in jener Nacht gewusst hätte …«, stoße ich hervor und muss mich förmlich dazu zwingen, die Hand wieder sinken zu lassen, statt Ember an mich zu ziehen. Statt sie festzuhalten, bis ihr Schmerz nachlässt. »Dann wäre ich bei dir geblieben.«
Ich muss es ihr noch mal sagen, für den Fall, dass sie mir noch immer nicht glaubt. Dass sie mir nicht glauben kann oder will. Aber ich weiß, dass ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hätte, um Ember beizustehen, nachdem ihre Mutter sich umgebracht hat. Nichts und niemand hätte mich davon abhalten können.
Und es gibt noch etwas, das ich ihr sagen muss. Etwas, das ich in ihren Augen lese und das mir viel zu bekannt vorkommt.
»Es war nicht deine Schuld, hörst du? Das mit deiner Mom war nicht deine Schuld.«
»Wirklich nicht?« Sie atmet erstickt ein und sieht mich gequält an. »Vielleicht bin ich nicht der Grund dafür, dass sie sich etwas angetan hat, aber ich … ich war da, Holden. Nur ein Zimmer entfernt. Ich hätte sie retten können. Nein, ich hätte sie retten müssen! Ich hätte …«
»Ember …« Am liebsten würde ich wieder die Hände an ihre Wangen legen, doch diesmal weicht sie vor mir zurück.
»Nicht. Wenn du mich jetzt berührst oder in den Arm nimmst, kann ich mich nicht länger zusammenreißen.«
Ich will ihr deutlich machen, dass sie das nicht muss. Dass ich sie halten werde, solange sie es braucht, aber sie kommt mir zuvor.
»Und dafür fehlt mir die Kraft. Ich kann nicht zusammenbrechen. Nicht schon wieder. Und ich … ich weiß nicht, ob ich dir je verzeihen kann, weil ich …« Ihre Stimme ist nur noch ein ersticktes Flüstern. »Weil ich nicht weiß, ob ich mir je dafür vergeben kann.«
»Em …«
Warnend hebt sie die Hand und schüttelt den Kopf.
Fuck.
Schuldgefühle toben wie ein Sturm in mir. Ich war nicht für sie da. Ich bin nicht aufgetaucht, wie wir es verabredet hatten. Wenn ich mich an mein Versprechen gehalten hätte, wäre alles anders gelaufen. Dann hätte Ember all das nie erleben, sich nie damit herumschlagen müssen.
Würde es etwas an der Gegenwart ändern, wenn ich ihr erzählen würde, was in der Nacht vor fünf Jahren passiert ist? Warum ich abgehauen bin?
Nein, es ist besser – für alle – , wenn Ember die Wahrheit nie erfährt. Selbst wenn sich ein Teil von mir eine Bestätigung wünscht, dass ich das Richtige tue. Aber ich ziehe das schon so lange durch, habe dermaßen lange geschwiegen, dass es keinen Weg zurück gibt. Nicht für sie, und erst recht nicht für mich.
Der Impuls, ihr von damals zu erzählen, verfliegt und wird durch die harte Realität ersetzt. Die Wahrheit würde nichts ändern. Wenn überhaupt, würde sie alles nur noch schlimmer machen. Also zwinge ich mich zu einem Nicken, während ich die Lippen fest aufeinanderpresse.
»Es tut mir so verflucht leid, Em. Einfach alles.«
»Ich weiß.« Eine Träne läuft ihr über die Wange. »Mir auch …«
Es kostet mich sämtliche Willenskraft, nicht die Hand auszustrecken und sie wegzuwischen. Ember zu trösten, zu umarmen, ihr beizustehen. Stattdessen bin ich dazu verurteilt … nichts zu tun.
Mein Blick fällt auf die Sonnenblumen, die ich zu ihrem Geburtstag vor der Veranda für sie angepflanzt habe. Mit einem eigenen Bewässerungssystem, bei dem Mom mir geholfen hat, weil Ember früher immer dazu geneigt hat, sämtliche Pflanzen in ihrem näheren Umfeld zu töten. Unabsichtlich versteht sich.
Jetzt wiegen sich die Köpfe der Sonnenblumen traurig im Wind, wie ein Versprechen, das gebrochen wurde. Wie eine Hoffnung, die verblasst ist.
»Ich verstehe.« Irgendwie bringe ich die Worte hervor.
Ich bin hergekommen, um nach Ember zu sehen. Weil ich mir Sorgen gemacht habe und um eine Antwort zu erhalten. Die habe ich nun. Und obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte, schaffe ich es, einen Schritt zurück zu machen. Einen Schritt von ihr weg. Dann noch einen. Und einen weiteren.
Der einzige Grund, aus dem ich jetzt gehen kann, ist, dass es ihr Wunsch ist. Und das Wissen, dass sie nicht allein zurückbleibt.
Kurz nicke ich Shae zu, die in der Haustür aufgetaucht ist. Dann kehrt mein Blick ein letztes Mal zu Ember zurück, die reglos auf der Veranda steht, bevor ich mich umdrehe und gehe.
Und während ich in den Pick-up steige, den Motor anlasse und wegfahre, ohne zurückzuschauen, kreist dieselbe Frage in meinem Kopf: Wie kann ich von Ember erwarten, dass sie mir verzeiht, wenn ich mir für meine Entscheidungen in jener Nacht nicht einmal selbst vergeben kann?
2. Kapitel
Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich bereue. Damals weggegangen zu sein. Den falschen Leuten vertraut und den Mund gehalten zu haben, wenn ich etwas hätte sagen sollen. Alles, was in der Nacht vor fünf Jahren passiert ist – und alles, was danach kam.
Mit jedem Schritt wirble ich in einem gleichmäßigen Rhythmus den Sand auf, während ich am Golden Bay Beach entlangjogge. Es ist später Nachmittag, und die meisten Touristen sind bereits verschwunden. Dunkle Wolken sind am Himmel aufgezogen, was ein fast schon dramatisches Bild abgibt. Das Meer ist aufgewühlt, das Rauschen der Wellen übertönt sogar die Musik, die aus meinen Kopfhörern schallt.
Normalerweise hilft mir das Laufen. Heute nicht. Nichts lenkt mich ab. Weder der Sport noch der Strand oder die warme, salzige Brise, die so vertraut ist, dass sich jeder Atemzug anfühlt, als würde ich daran ersticken. Ich versuche mich zusammenzureißen, meine Gedanken und Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Doch egal, wie sehr ich all dem entfliehen möchte, es funktioniert nicht. Ich kann es nicht. Habe es nie gekonnt. Meine Fehler holen mich immer wieder ein. Lachen mir zynisch ins Gesicht, ganz egal, wie schnell und weit ich renne.
Ich entkomme ihnen nie.
Frustriert schiebe ich mir die Kopfhörer in den Nacken. Auf einmal ist das Tosen der Wellen noch lauter, schafft es jedoch genauso wenig, meine Gedanken zum Schweigen zu bringen, wie die Musik zuvor.
Immer wieder muss ich an das Gespräch mit Ember heute Mittag denken. Und daran, wie sie mich angestarrt hat, als ich bei ihr zu Hause aufgetaucht bin, um ihr mit ihrer Großmutter zu helfen. Sie schien gleichzeitig erleichtert wie fassungslos und überrumpelt zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet, mich dort zu sehen. Im Gegenteil. Sie ist sogar fest davon ausgegangen, dass ich der letzte Mensch bin, der ihr je zur Hilfe eilen würde. Und … scheiße, das tut weh. Fast genauso sehr wie das Wissen, dass sie ausgerechnet Will getextet hat, als sie verzweifelt war. Als sie jemanden an ihrer Seite gebraucht hat.
Nicht mich. Sondern ihn.
In jener Nacht hat sie mich angefleht, ihr beizustehen, und ich habe sie ignoriert. Aber … fuck, wenn ich davon gewusst hätte, wäre ich nie auf diese Fähre gestiegen. Oder hätte wenigstens mit ihr telefoniert, bis ich das nächste Schiff zurück zur Insel hätte nehmen können. Stattdessen habe ich sie im Stich gelassen, als sie mich am meisten gebraucht hat.
Kein Wunder, dass sie mich jahrelang gehasst hat. Kein Wunder, dass sie mir nicht mehr vertraut und mir nie vergeben wird. Kein Wunder, dass …
»Hey, Mann.«
Unvermittelt taucht jemand an meiner Seite auf und joggt im gleichen Tempo neben mir her. Ich muss nicht mal hinsehen, um zu wissen, um wen es sich handelt. Seit meiner Rückkehr nach Golden Bay waren Jayden und ich regelmäßig zusammen laufen, doch heute kann ich seine Gesellschaft nicht gebrauchen. Ich will allein sein, um mich mit meinen Erinnerungen und falschen Entscheidungen zu quälen und weiter in Selbstmitleid zu baden.
Doch Jaydens Anwesenheit macht das unmöglich. Er ist trainierter denn je, mit eng anliegendem weißem Shirt, Laufshorts und Sportschuhen, die relativ neu aussehen.
»Alles klar?«, fragt er, als würde er wittern, was mir durch den Kopf geht. Vielleicht liegt es an seinem Instinkt als Polizist – oder wir kennen uns schon zu lange.
»Nein«, erwidere ich ehrlich.
»Willst du darüber reden?«
»Ich dachte, du wärst zum Joggen hergekommen?«
Jayden lässt sich nicht von meiner brüsken Gegenfrage beirren, sondern hebt herausfordernd die Brauen. »Wenn du nicht beides gleichzeitig kannst, machst du etwas falsch, Bro.«
Ich schüttle den Kopf. Zu Schulzeiten hat Coach DuPont uns jedes Mal angebrüllt und mit fünfzig Liegestützen bestraft, wenn wir während des Trainings gequatscht haben – und jetzt will Jayden ein Plauderstündchen halten?
Selbst wenn ich das Angebot zu schätzen weiß, gibt es Dinge in meinem Leben, Dinge, die ich getan habe, über die ich nicht mit Jayden reden kann, ganz egal, wie lange wir schon befreundet sind. Er würde es nicht verstehen. Das könnte er gar nicht. Aber er kennt Ember und unsere Geschichte. Er war lange, nachdem ich fortgegangen bin, noch auf Golden Bay. Er weiß, wie sehr ich sie verletzt habe …
Fluchend ziehe ich das Tempo an, renne schneller, treibe meinen Körper an seine Grenzen. Während der Highschool war ich dank der Eishockeymannschaft immer gut in Form, doch danach habe ich noch mehr, noch härter trainiert. Ich musste schneller und stärker werden, um in dieser Welt überleben zu können. Und ab einem gewissen Zeitpunkt blieb mir gar keine andere Wahl mehr. Also habe ich trainiert und im Sport eine willkommene Zuflucht vom beschissenen Alltag gefunden.
Bis heute.
»Will hat mir von dem Notfall mit Embers Grandma erzählt.«
Will. Natürlich. Wer auch sonst?
Hat er auch erzählt, wie beschissen es Ember hinterher ging? War er bei ihr? Hat sie zugelassen, dass er sie tröstet, während sie mich immer wieder wegstößt?
Fuck.
Jeder einzelne dieser Gedanken legt sich wie ein Gesteinsbrocken auf meinen Brustkorb, bis mir das Atmen immer schwerer fällt und ich …
»Hey, nicht stehen bleiben!« Jaydens Hand landet auf meiner Schulter.
Mir war nicht mal klar, dass ich angehalten habe, um keuchend die Hände auf die Oberschenkel zu stützen.
»Schon gut.« Ächzend richte ich mich wieder auf und schüttle ihn ab.
»Du siehst aber nicht so aus.« Die Besorgnis in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Im Gegensatz zu meiner ist seine Atmung ruhig, und sein hellbraunes Haar klebt auch nicht verschwitzt an seiner Stirn. »Du bist fast genauso grün im Gesicht wie damals in der zehnten, kurz nach dem Spiel gegen Quebec City. Da hast du auch behauptet, alles wäre okay.«
Schnaubend setze ich mich wieder in Bewegung. »Damals ist mir einer von der gegnerischen Mannschaft volle Kanne in die Seite gefahren.« Und hatte seinen Ellbogen dabei dermaßen ungünstig platziert, dass er ihn mir geradewegs in den Magen gerammt hat. Den Rest des Spiels habe ich noch durchgehalten, danach bin ich über dem nächsten Mülleimer zusammengebrochen. »Keine Sorge, mir hat niemand eins reingewürgt.«
Zumindest nicht körperlich.
Jayden wirft mir einen nachdenklichen Blick zu, während wir deutlich langsamer nebeneinander den Strand entlanglaufen. »Vielleicht solltest du noch mal mit ihr reden.«
Nur mit Mühe kann ich eine Reaktion unterdrücken. »Woher willst du wissen, dass es um sie geht?«
»Weil ich euch genau wie alle anderen beim Sommerfest zusammen gesehen habe. Und kurz danach ist das mit ihrer Großmutter passiert. Ich kann eins und eins zusammenzählen, also verarsch mich nicht.«
»Ich habe mit ihr gesprochen«, presse ich hervor und zwinge mich dazu, mich auf meine Schritte zu konzentrieren. »Und es ist nicht gerade gut gelaufen.«
»Aber ihr wart mal Freunde. Die besten. Lange bevor ein Paar aus euch wurde.«
Freunde. Aktuell sind wir nicht einmal mehr das. Aktuell sind wir gar nichts mehr, nur Fremde mit einer schmerzvollen gemeinsamen Vergangenheit.
»Bist du hergekommen, um mich zu babysitten oder um zu laufen?«, wechsle ich das Thema und versuche gleichzeitig, uns beide anzuspornen, schneller zu werden. Noch mal das Beste zu geben.
Jayden schnaubt, zieht jedoch mit. »Beides. Aber eigentlich bin ich hier, weil ich meinem Kumpel beistehen möchte.«
»Sicher, dass du mich nicht wie früher von irgendwelchen Ideen überzeugen willst, mit denen du uns in die Scheiße reiten kannst?«, versuche ich vom Thema abzulenken.
»Also echt.« Jayden grinst. »Wann habe ich uns jemals in die Scheiße geritten? Meine Ideen sind fantastisch!«
Ich hole schon Luft, halte jedoch inne, weil es Stunden dauern würde, sie alle aufzuzählen. Wie zum Beispiel das Bootsrennen, als wir und ein paar andere Jungs uns Kanus ausgeliehen haben, um nachts einen Wettkampf auf offener See damit zu veranstalten. Jayden hat dafür zwei Monate Hausarrest von seinen Eltern bekommen – und Mom war nicht unbedingt gnädiger mit mir. Oder wie wir ein paar Tage vor Silvester in Lille Port Coach DuPont und einigen anderen Lehrkräften einen Streich mit jeder Menge Feuerwerk gespielt haben. Wir hatten echt Glück, dass nichts Feuer gefangen hat – und dass wir der Polizei entwischen konnten. Davon, dass uns nichts passiert ist, ganz zu schweigen; weder bei diesen waghalsigen Aktionen noch bei den Stunts auf dem Eis, wenn der Coach nicht hingeschaut hat, oder bei den nächtlichen Autorennen über die Insel, kurz nachdem wir unsere Führerscheine hatten.
Wir haben jeden Mist zusammen gemacht. Zumindest fast.
Diesmal scheint Jayden allerdings nicht zum Scherzen aufgelegt zu sein – oder sich so leicht ablenken zu lassen. Er wirkt erschreckend ernst. »Warum bist du zurückgekommen, Mann? Warum jetzt, nach all den Jahren?«
Ich atme tief durch. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieses Thema aufkommt. In den letzten Wochen hat Jayden überraschend viel Selbstbeherrschung bewiesen, jede Neugier im Zaum gehalten und mich nie mit irgendwelchen Fragen gelöchert. Allem Anschein nach ist meine Schonfrist vorbei.
»Gemmas und Peters Hochzeitseinladung war der Auslöser«, erwidere ich ehrlich. »Aber der wahre Grund ist, dass ich mein Leben zurückhaben wollte. Und Ember.«
»Willst du das immer noch?«
»Ja.« Die Antwort kommt sofort. Kein Zögern, kein Zweifeln.
»Dann kämpfe dafür! Du weißt doch: Aufgeben ist keine Option.«
Ich starre ihn an – und breche in Gelächter aus. »Hast du gerade allen Ernstes unseren alten Eishockey-Coach zitiert?«
»So alt ist er gar nicht.« Jayden zuckt vergnügt die Schultern. »Er trainiert immer noch die Schulmannschaft. An den Wochenenden helfe ich ihm.«
»Du?«, wiederhole ich ungläubig. »Ein Trainer?«
»Du wärst überrascht, wie viel Spaß es macht, die kleinen Scheißer herumzuscheuchen.«
Wieder muss ich lachen, und es tut verdammt gut.
»Ich hätte nie gedacht, dass aus dir mal ein Aushilfscoach wird. Oder ein Cop«, füge ich stirnrunzelnd hinzu.
»Ich auch nicht. Aber du weißt ja, wie das Leben spielt. Es war die sichere Wahl.« Bevor ich nachhaken kann, was genau er damit meint, fährt er bereits fort. »Hör mal, es ist okay, wenn du über gewisse Dinge nicht mit mir sprechen willst. Das habe ich immer akzeptiert und tue es auch heute noch. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Aber wenn dir etwas – oder jemand – wirklich wichtig ist, dann gib nicht auf. Das würdest du für immer bereuen.«
Er hat recht. Ich habe Ember und mein ganzes Leben auf Golden Bay schon einmal zurückgelassen – und es seither jeden einzelnen Tag und jede Nacht bereut. Diesen Fehler werde ich nicht wiederholen.
»Wann bist du so weise geworden, hm?« Im Laufen stoße ich Jayden mit der Schulter an.
»War ich schon immer«, behauptet er grinsend.
»Bullshit.«
»Das hab ich überhört. Also, was steht bei dir als Nächstes an?«
Ohne uns abzusprechen, drehen wir an derselben Stelle wie immer um, genau dort, wo sich der feine Sandstrand mit Steinen vermischt und wenige Meter weiter vor einer steilen Klippe mündet, die die Bucht von Golden Bay eingrenzt.
»Wahrscheinlich sollte ich erst mal mein Leben sortieren«, murmle ich.
Ich bin zwar wieder da und habe einen Job und alte Freundschaften, die gerade erst erneut aufleben. Und Ember, die ich in ihrem Schmerz nicht allein lassen will.
Aber das ist nicht alles. Ich habe auch eine Familie. Ein Zuhause. Oder eher ein Kinderzimmer, in dem ich mich so selten wie möglich aufhalte, weil es mich viel zu sehr an früher erinnert. An die schönen Momente, aber auch an die falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und an alte Bekanntschaften, denen ich heute lieber aus dem Weg gehe.
»Mir fällt daheim die Decke auf den Kopf«, gebe ich zum ersten Mal zu. Nicht nur vor jemand anderem, sondern auch vor mir selbst. »Ich muss da raus, bevor …«
Bevor mich die Erinnerungen erneut in den Abgrund reißen.
Der einfachste Weg wäre, Golden Bay endgültig den Rücken zu kehren, um meiner Vergangenheit zu entfliehen, aber …
»Aber ich kann nicht weggehen. Nicht schon wieder.« Ich starre auf einen Punkt in der Ferne, dort, wo Meer, Strand und Himmel miteinander verschmelzen.
Jayden nickt, als wüsste er genau, was ich meine. »Tja, leider hab ich kein freies Zimmer für dich und auch keinen ausgebauten Keller, in den du einziehen könntest. Außerdem würde dir mein Mitbewohner nicht gefallen. Polizeikollege. Steht jeden Morgen um halb fünf auf, macht drei Stunden Krafttraining und trinkt absolut widerliche Smoothies.«
Ich schnaube amüsiert. »Und das ist was Schlechtes?«
Jayden würgt so laut, dass ich nicht sicher bin, ob es nur gespielt ist. »In denen ist Unmengen an Knoblauch drin. Und Spinat. Der ganze Kühlschrank steht voll damit und stinkt bestialisch. Außerdem versucht er mich ständig zu überreden, das gesunde Zeug zu probieren.«
»Vielleicht solltest du ihn rausschmeißen und dir einen neuen Mitbewohner suchen?«
»Kann ich nicht.« Er zieht eine Grimasse. »Das Haus gehört ihm.«
Mir war nicht mal bewusst, dass ich kurz Hoffnung hatte. Hoffnung darauf, dass sich die Probleme in meinem Leben ein einziges Mal auf leichte Weise lösen würden. Hoffnung darauf, mit Jayden als Mitbewohner alte Zeiten wiederaufleben zu lassen, auch wenn wir beide längst nicht mehr in der Eishockeymannschaft der Bayville Highschool sind. Doch dieses Gefühl der Hoffnung ist mir dermaßen fremd, dass ich es erst als das erkenne, was es ist, als es bereits stirbt.
»Ich schätze, du hast trotzdem Glück«, redet Jayden unbeirrt weiter.
»Glück?«, wiederhole ich mit einem ungläubigen Schnaufen. Mittlerweile läuft mir der Schweiß den Rücken hinunter, und ich kann es kaum erwarten, unter die Dusche zu kommen. »Warum das?«
»Ich kenne jemanden, der seit Kurzem einen Mitbewohner sucht.«
Zweifelnd schaue ich ihn von der Seite an. »Noch einer von deinen Polizeikumpels?«
Denn das würde mir gerade noch fehlen.
Jayden wackelt mit den Brauen, genau wie früher, wenn er einen spontanen Einfall hatte, mit dem er uns in Schwierigkeiten bringen konnte. »Wart’s ab.«
3. Kapitel
»Das ist doch wohl ein Witz, oder?«
Ich überfliege die Textnachricht auf Jaydens Handy, ohne wirklich wahrzunehmen, was da steht. Die Zimmergröße, die Möbel, die Miete – nichts davon bleibt hängen. Der Name des Absenders dafür umso mehr.
»Kein Witz.« Jayden klopft mir eine Spur zu fest auf die Schulter. »Ich bin sicher, du und Beck werdet super Mitbewohner.«
Ja, klar. Ausgerechnet ich und der Typ, der Ember eindringlich vor mir gewarnt hat. Was könnte da schon schiefgehen?
Schnaufend wende ich mich ab. »Danke, aber nein, danke.«
Ich finde etwas anderes. Das Letzte, was ich gerade brauche, ist ein Typ, der mich nicht leiden kann und mir ständig im Nacken sitzt. Von der Sorte gab es in den letzten Jahren mehr als genug.
Ich brauche eine eigene Wohnung. Freiraum. Oder wenigstens ein winziges Zimmer irgendwo auf dieser Insel, das ich mir leisten kann.
»Überleg es dir noch mal!«, ruft Jayden mir nach, da ich mich bereits abgewandt habe, und verabschiedet sich mit einem knappen Winken, als ich einen Blick über die Schulter werfe.
Ich erwidere nichts. Wut und Schuldgefühle sind wieder da und begleiten jeden meiner Schritte, während ich über den Parkplatz zu meinem Pick-up zurückstapfe. Wut auf mich selbst, auf meine Machtlosigkeit, auf diese ganze beschissene Situation. Beim Joggen bin ich kein bisschen davon losgeworden. Jayden war eine mehr oder weniger willkommene Ablenkung, mehr nicht.
Mit einem Handtuch wische ich mir den gröbsten Schweiß von der Haut, bevor ich ein paar Schlucke Wasser trinke. Dann setze ich mich hinters Steuer und fahre los.
Von der Bucht, die vor Hunderten von Jahren namensgebend für die ganze Insel war, ist es nicht weit bis nach Hause. Mom wohnt noch immer in derselben Wohnung wie früher, am Stadtrand von Bayville. Ich parke den Pick-up in einer freien Lücke ein Stück die Straße hinunter, hänge mir das Handtuch um den Hals und jogge zum Haus, obwohl meine Beine vor Anstrengung brennen.
Kurz bevor ich das Gebäude mit der hellblauen Fassade erreiche, geht die Haustür unten auf und unsere Nachbarin tritt heraus, gefolgt von ihrem Mann, der sich schwer auf eine Gehhilfe stützt.
»Hallo Mr. und Mrs. Seyfried«, begrüße ich das ältere Ehepaar.
Ihre Gesichter hellen sich auf, und die Falten rund um Augen und Mund vertiefen sich. »Holden! Was für eine schöne Überraschung.« Wie immer will mich Mrs. Seyfried zur Begrüßung in die Arme schließen, aber ich weiche zurück.
»Sorry. Ich war gerade beim Sport.«
Sie lächelt nachsichtig. »Na gut. Aber nächstes Mal kommst du nicht um eine Umarmung herum. Wir freuen uns noch immer riesig, dass du wieder da bist. Nicht wahr, Rupert?«
»Ja, ja«, brummt der alte Mann. »Wurde auch Zeit.«
Mrs. Seyfried macht eine wegwerfende Handbewegung. »Achte nicht auf ihn. Er hat gleich einen Arzttermin, da ist er immer mürrisch.«
»Soll ich Sie hinfahren?«, biete ich an. »Ich muss nur kurz duschen, aber dann kann ich …«
»Du guter Junge.« Liebevoll tätschelt Mrs. Seyfried mir den Arm. »Das ist wirklich nicht nötig. Unser Taxi ist gleich da.«
»Sicher?«
»Sicher«, bestätigt Mrs. Seyfried entschieden. »Es ist nur eine allgemeine Untersuchung. Deine Mutter hat auch schon angeboten, uns zum Arzt zu begleiten.« Sie sieht ihrem Mann nach, der mit dem Rollator Schritt für Schritt den Gehweg hinunterläuft. Allem Anschein nach will er nicht warten, sondern dem Taxi entgegengehen. »Er zeigt es nicht, aber er hat Schmerzen. Und sollte es weitere Untersuchungen geben …«
»Dann bringe ich Sie hin«, unterbreche ich sie. »Keine Widerrede, okay? Ich mache das gerne, genau wie Mom.«
»Na gut.« Mrs. Seyfried lächelt dankbar, aber in ihren Augen glitzern Tränen. »Sie hat dich gut erzogen.«
Ein letztes Tätscheln, dann folgt sie ihrem Mann und winkt dem schwarzen Taxi, das gleich darauf neben ihnen stehen bleibt. Ich beobachte noch kurz, wie sie einsteigen, nur um sicherzugehen, dass sie wirklich keine Hilfe benötigen, dann wende ich mich ab.
Da Moms Auto nirgendwo zu sehen ist, nehme ich an, dass ihre Schicht im Baumarkt noch nicht vorbei ist, und Gemma wohnt schon lange nicht mehr hier. Außerdem ist sie immer noch in den Flitterwochen.
So beschissen es für mich gelaufen ist, bin ich dennoch froh, dass Mom nicht mehr drei Jobs gleichzeitig machen muss, um sich ein Dach über dem Kopf leisten zu können. Gemma und ich haben ihr geholfen, so gut wir konnten, trotzdem war das Geld immer knapp. Auch heute ist meine Familie alles andere als reich, aber der Kühlschrank ist voll, am Haus sind keine größeren Schäden mehr und Mom hat nur noch eine Arbeitsstelle, bei der sie anständig bezahlt wird. Das ist das Mindeste, auch wenn sie viel mehr verdient hätte.
Ihr zu helfen, ist das einzig Gute, das ich in meinem bisherigen Leben geleistet habe.
Als ich die Außentreppe zu unserer Wohnung in der oberen Etage hinaufsteige, überkommt mich ein seltsames Gefühl von Déjà-vu. Wie oft bin ich diese Stufen schon hoch und runter gerannt? Bestimmt Hunderte, ach was, Tausende Male. Dieses Haus ist mir so vertraut wie jede Narbe auf meinem Körper, und das, obwohl ich unglaublich lange weg war.
Mom hat in dieser Zeit nichts in der Wohnung verändert. Die Fotos von unseren Meilensteinen als Kinder hängen nach wie vor an den Wänden im Flur. Vom ersten Schultag. Dem ersten Sieg der Eishockeymannschaft. Gemmas Gewinnerfoto von ihrem ersten Tanzwettbewerb. Ein Foto von mir im Pick-up, kurz nachdem ich den Führerschein in der Tasche hatte. Das Familienfoto von Gemmas Schulabschluss: Mom, Gemma und ich, wie wir in die Kamera strahlen. Doch es gibt weder von meinem Abschluss noch sonst aktuelle Fotos von mir aus den letzten Jahren. Nur noch welche von Gemma und Mom. Und Peter.
Hastig wende ich mich ab, doch die Schuldgefühle bleiben. Sie kleben an mir, als ich den dunklen Flur hinunter zu meinem Zimmer gehe, und werden nur noch stärker, als ich es betrete. Die letzten Wochen muss ich ständig mit Tunnelblick herumgelaufen sein, doch mittlerweile kann ich die Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen. Der bloße Kontrast zwischen meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart ist schon unerträglich, aber ausgerechnet mein eigenes Zimmer gibt mir den Rest. Denn es wirkt wie in der Zeit eingefroren …
Die Pokale und Urkunden an den Wänden und auf den Regalbrettern. Die Eishockeyausrüstung auf dem Boden neben dem Wandschrank. Selbst mein alter Rucksack liegt noch immer neben dem Schreibtisch auf dem Boden, ganz so, als hätte ich ihn erst vor wenigen Minuten dort hingeworfen, dabei ist das eine Ewigkeit her. In all der Zeit hat Mom nichts in diesem Raum angerührt, nur Staub gewischt und durchgelüftet. Alles ist genau so, wie ich es damals zurückgelassen habe – und ich war in den letzten Wochen zu beschäftigt und zu wenig hier, um etwas daran zu ändern.
Dort am Schreibtisch hat Gemma versucht, mir beim Lernen zu helfen. Mom konnte sich keine Nachhilfe für mich leisten, also musste meine große Schwester ran. Leider ohne besonders großen Erfolg. Mein Ehrgeiz beim Eishockey war das Einzige, was mich davor gerettet hat durchzufallen. Wenn ich irgendeine Klausur nicht bestanden hätte, wäre ich aus dem Team geflogen, und das kam nicht infrage.
Dieser Raum bewahrt so verflucht viele Erinnerungen. Überall, wo ich hinsehe, taucht mindestens eine davon sofort in meinem Kopf auf. Fluchend wende ich mich ab, drehe ihnen den Rücken zu, und stürze ins Bad.
Kurz darauf läuft heißes Wasser über meinen Körper, über Narben und die beiden Tattoos, und wäscht auch die letzten Reste Schweiß und Sand von mir ab. Meine Muskeln pochen und protestieren aufgrund der harten Einheit, beginnen sich jedoch langsam ein wenig zu entspannen. Aber ganz gleich, wie lange ich unter der Dusche stehe, das warme Wasser kann weder die Erinnerungen noch die Schuldgefühle wegspülen.
Die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen. Ich bin nicht mehr der Achtzehnjährige, der geglaubt hat, von allem eine Ahnung zu haben. Heute weiß ich, dass ich im Grunde gar nichts weiß.
Fluchend stütze ich mich mit den Händen gegen die Fliesen, während mir das Wasser übers Gesicht läuft und von meinen dunkelbraunen Haaren und meiner Nasenspitze tropft. Solange ich denken kann, wollte ich immer von der Insel runter und woanders neu anfangen. Heute würde ich alles dafür geben, um mein altes Leben zurückzubekommen. Und dazu gehört auch Ember. Ich hätte sie niemals verlassen dürfen.
Es gibt verdammt viel, was ich bereue – aber das? Das bereue ich am meisten.
Als ich nur mit einem Handtuch um die Hüften in mein Zimmer zurückkehre, fällt mein Blick auf das schmale Silberarmband, das auf meinem Schreibtisch liegt. Ich habe es in den letzten Jahren ständig bei mir getragen, trotzdem sieht es noch genauso aus wie an dem Tag, an dem ich es Ember geschenkt habe. Der Anhänger in Form einer Sonnenblume hat mich damals an sie erinnert – und tut es auch heute noch.
Wie von selbst wandern meine Gedanken zurück zu heute Mittag. Zu ihren Worten. Zu dem Schmerz in ihren Augen, der wie ein Echo in meiner Brust widerhallt.
Manchmal, in meinen dunkelsten Momenten habe ich mir gewünscht, alles vergessen zu können. Doch es gibt zu viel, was ich nicht missen möchte. Zu viele schöne Dinge neben all den schrecklichen.
Genau hier auf diesem Bett haben Ember und ich unzählige Male rumgeknutscht – und wären dabei einmal fast von meiner Mom erwischt worden, die einfach reingeplatzt ist. Mann, war das peinlich.
Abrupt wende ich mich ab und ziehe mich an, doch egal, wie sehr ich mich beeile, die Erinnerungen stürzen auf mich ein, als wollten sie mich wie eine Lawine unter sich begraben. Gespräche. Telefonate. Wut. Angst. Frust. Lust. Freude. Erleichterung. Hoffnung. Liebe. Enttäuschung. Hilflosigkeit.
Verdammt.
Ich reibe mir über das unrasierte Kinn. Fahre mir durch das kurze Haar. Bohre die Finger in meinen Nacken.
Plötzlich halte ich es keine Sekunde länger an diesem Ort aus. Ich schnappe mir die Autoschlüssel, reiße die Wohnungstür auf und laufe nach unten. Eine Minute später sitze ich im Pick-up und starte den Motor. Ohne Ziel herumzufahren, hat mir schon immer geholfen, meine Gedanken zu sortieren, auch wenn mir eine fiese kleine Stimme zuflüstert, dass mir auch das, genau wie das Joggen, heute nicht helfen wird.
Ich dachte, alles wird anders, wenn ich zurückkomme, dabei ist alles gleich geblieben – oder schlimmer geworden.
Ich muss aus dieser Wohnung raus, weg von den Erinnerungen, die in meinem alten Zimmer eingeschlossen sind wie in einem verdammten Mausoleum.
Denn ich kann es mir nicht leisten, abgelenkt zu sein. Ich muss funktionieren. Immer wachsam bleiben. Wenn ich etwas in den letzten paar Jahren gelernt habe, dann das. Abgesehen davon bin ich nicht frei. Um ehrlich zu sein, weiß ich schon lange nicht mehr, wie sich wahre Freiheit anfühlt. Vielleicht wusste ich es nie, weil es immer andere gab, die für mich entschieden und mein Leben geformt haben. Und ich hasse es. Ich hasse alles daran.
Ursprünglich bin ich zurückgekehrt, weil ich mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen wollte, doch jetzt, da ich hier bin, entgleitet es mir erneut. Doch diesmal weigere ich mich, das zuzulassen. Diesmal bin ich derjenige, der handelt und entscheidet.
Kurz fällt mein Blick auf mein Handy auf dem Beifahrersitz, auch wenn es stumm bleibt. Trotzdem weiß ich auf einmal genau, was ich tun werde.
4. Kapitel
ACHT JAHRE ZUVOR
Irgendetwas stimmte nicht mit mir. Keine Ahnung, wann es mir aufgefallen war, wahrscheinlich irgendwann zwischen dem Mittagessen und dem Eishockeytraining. Aber als ich zum dritten Mal an diesem Nachmittag auf die Fresse flog, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war und Jayden mich gerammt hatte, rief mich der Coach zu sich.
Ich warf meinem Kumpel einen wütenden Blick zu, doch der grinste nur breit. Wichser. Er hatte bloß darauf gewartet, dass wir in gegnerische Teams aufgeteilt wurden, um mir heimzuzahlen, dass der Coach mich beim letzten Spiel aufs Eis gelassen hatte, während er mit seinem Hintern die Ersatzbank hatte wärmen dürfen.
Selbst schuld, Arschloch.
Ich skatete an den Rand und versuchte mich so cool wie möglich zu geben, auch wenn ich mich innerlich unter den wütenden Blicken von Coach DuPont wand.
»Was ist los, Holden? Hm? Wo bist du mit deinen Gedanken?« Coach DuPont ließ mir keine Sekunde Zeit, um zu antworten, sondern sprach sofort weiter. »Denn wenn du aufs Eis gehst, musst du verdammt noch mal bei der Sache sein, sonst wirst du gefressen. Hast du mich verstanden? Das dort draußen ist ein Haifischbecken – und du bist nur ein kleiner Goldfisch.«
Wow, danke, Coach. Da ist man doch gleich viel motivierter.
Wild gestikulierend deutete er zwischen mir und der Eisbahn hin und her. »Goldfisch. Haie. Haie. Goldfisch.«
Ich biss die Zähne zusammen.
Ist ja gut, ich hab’s kapiert.
Aber mit verfluchten fünfzehn Jahren konnte schließlich niemand eine Eishockeylegende wie Wayne Gretzky sein. Außer vielleicht Zion. Der Mistkerl überragte uns alle und hatte im letzten Jahr mehr Muskelmasse zugelegt als irgendjemand sonst im Team. Dummerweise war er echt in Ordnung, also konnte ich nicht mal sauer auf ihn sein.
»Du hast nicht die gleiche Körperkraft wie deine Gegner«, fuhr der Coach mit seiner Tirade fort. Hatte er zwischendurch überhaupt Luft geholt? Oder hatte ich die Hälfte verpasst, weil ich in Gedanken kurz abgedriftet war? »Aber du bist schnell! Also sei es verdammt noch mal auch! Aufgeben ist keine Option! Wenn du noch einmal – ich wiederhole: noch einmal! – wegen Jayden oder jemand anderem auf die Schnauze fliegst, bist du bis zu den Sommerferien fürs Training gesperrt.«
»Was?!«
»Los jetzt! Zurück aufs Eis!«
»Aber …«
Er blies mir mit der schrillen Trillerpfeife direkt ins Gesicht und schnitt mir damit das Wort ab. »Sofort!«
Ich schluckte sämtliche Flüche und Beleidigungen, die mir auf der Zunge lagen, runter, auch wenn ich dabei fast platzte. Aber sie hätten es nur schlimmer gemacht.
Kopfschüttelnd kehrte ich zu den anderen zurück, die natürlich jedes Wort mitbekommen hatten. Manche warfen mir mitleidige Blicke zu, weil sie selbst schon Ähnliches erlebt hatten. Andere grinsten nur. Wahrscheinlich waren sie erleichtert, dass es mich und nicht sie getroffen hatte. Aber bei Coach DuPonts Launen kam jeder mal dran. Dennoch durfte ich mir nach dem Training in der Umkleide einiges von den Jungs anhören. Auch das gehörte dazu. Wir waren ein Team, also kriegte jeder mal sein Fett weg. Und wie es aussah, war ich heute der glückliche Gewinner.
»Habt ihr DuPonts Gesichtsausdruck gesehen?«, rief Jayden. »Ich dachte echt, dem explodiert gleich der Schädel.«
»Ja, Holden«, mischte sich Arnaud hämisch ein. »Goldfisch. Haie. Gold …«
»Schon gut«, unterbrach ich ihn und ließ mich auf die Bank vor meinem Spind fallen. »Du musst den Scheiß nicht auch noch wiederholen.«
»Macht uns das jetzt alle zu gemeingefährlichen Haien?« Zion spazierte aus der Dusche und drückte sich die Dreadlocks mit einem Handtuch trocken. Dann fiel sein Blick auf mich. »Hey, Goldfisch.«
Ich schmiss einen Ellenbogenschoner nach ihm. Zion fing ihn lachend auf und warf ihn zurück.
Keine Ahnung, was heute mit mir los war. Ich konnte mich nicht konzentrieren, war mit den Gedanken ständig woanders, nämlich die meiste Zeit bei Ember, reagierte auf dem Eis zu langsam und fühlte mich insgesamt total … seltsam. Vielleicht wurde ich ja krank oder so.
Wenige Minuten später verabschiedete ich mich von den anderen, schnappte mir meinen Rucksack und verließ die Umkleide. Als ich nach draußen in den warmen Sommerabend trat, bemerkte ich sie.
Ember. Sie wartete bei den Fahrradständern auf mich.
Das Hämmern in meinem Brustkorb nahm zu, plötzlich waren meine Hände schweißnass und ich konnte den Blick nicht von ihr losreißen.
Im letzten Jahr war sie in die Höhe geschossen, aber noch immer kleiner als ich. Zierlicher. Doch auf einmal waren da Rundungen und … Brüste, wo vorher keine gewesen waren. Zuerst hatte mich das total irritiert, dann hatte ich mich daran gewöhnt. Zumindest hatte ich das geglaubt. Denn in den letzten Wochen war noch etwas passiert, und das hatte nichts mit Embers Verwandlung vom kleinen Mädchen zur jungen Frau zu tun. Oder zumindest nicht nur.
Als sie mich entdeckte, breitete sich ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus, und sie winkte mir zu.
Mir blieb schier das Herz stehen. Sie war so schön, dass es wehtat – und sie wusste es nicht mal. Scheiße, ich hatte es ja bis vor Kurzem selbst nicht mal realisiert, aber jetzt konnte ich nichts anderes mehr sehen. Nichts anderes als dieses hübsche Gesicht, das glänzende rotblonde Haar, das fröhliche Funkeln in ihren grünbraunen Augen und dieses Hammerlächeln. Ein Lächeln, das nur für mich reserviert war und jeden vernünftigen Gedanken in meinem Kopf einfach ausknipste.
Wenigstens funktionierte der Rest meines Körpers noch, und es gelang mir, die Hand zu heben und auf sie zuzulaufen.
»Hey, Em.«
»Hi.« Sie hielt eine Packung Gummibärchen in die Höhe.
Ich grinste. Irgendwann war es unser Ding geworden, dass einer von uns immer eine Tüte dabeihatte. Und wie es aussah, war heute Ember dran. Nach dem Anschiss von Coach DuPont konnte ich das echt gut gebrauchen.
Wir blieben bei den Fahrradständern stehen, während das restliche Team nach und nach die Halle verließ. Die meisten wurden abgeholt oder fuhren bei älteren Geschwistern mit, aber ich rührte mich nicht vom Fleck.
Ember ließ ein paar Gummibärchen auf ihre offene Handfläche fallen und sortierte die Grünen für mich aus. Keine Ahnung, warum, aber das waren die Einzigen, die ich mochte. Zum Glück ergänzten wir uns in der Hinsicht gut, denn Em aß fast alle anderen. Nur die weißen konnte keiner von uns ausstehen.
»Wie war das Training?«, fragte sie kauend.
Ich schnitt eine Grimasse. »Beschissen.«
»Tut mir leid.« Tröstend legte sie eine Hand auf meinen Arm – und ich musste mich beherrschen, um nicht zusammenzuzucken, als ihre warmen Finger meine nackte Haut berührten.
Wie konnte sie nicht den blassesten Schimmer davon haben, welche Wirkung sie auf mich hatte? Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Eines Tages würde ihr klar werden, dass sie die Kerle mit einem einzigen Blick, einem einzigen Lächeln in die Knie zwingen konnte. Dass sie mich in die Knie zwingen konnte. Dass ich alles für sie tun würde.
Leider sah sie in mir nur einen Kumpel. Den besten Freund, den sie schon ewig kannte, genau wie Shae.
Moment mal.
Ich erstarrte. Leider?! Warum leider? Wo kam das denn auf einmal her?
Ember nahm ihre Hand weg – und da wurde es mir klar. Warum ich in letzter Zeit abgelenkt gewesen war. Weshalb ich dermaßen neben mir stand, dass mich der Coach vor versammelter Mannschaft zusammenstauchte und damit drohte, mich aus dem Training zu nehmen. Und warum mein Körper so auf dieses Mädchen reagierte, obwohl wir uns schon seit Ewigkeiten kannten.
Ich hatte mich … verliebt.
Ausgerechnet in sie. In Ember. In meine beste Freundin.
Oh Mann, ich war so was von erledigt.
5. Kapitel
Ich stelle den Pick-up auf dem Parkplatz am beleuchteten Hafen ab und schalte den Motor aus. Schon ironisch, dass ich immer wieder an dem Ort lande, wo damals alles geendet hat.
Mittlerweile hat es angefangen, unangenehm hinter meiner Stirn zu pochen. Meine Gedanken rasen noch immer. Wenn Ember nicht wäre … Wenn Mom und Gemma nicht hier wären, hätte mich nichts und niemand jemals dazu gebracht, nach Golden Bay zurückzukehren. Aber jetzt bin ich wieder da und muss irgendwie damit klarkommen. Nicht, dass mein Leben on the road oder die Zeit in Toronto besser gewesen wären …
Als ich aussteige, werde ich sofort von einer heftigen Böe erfasst. Manchmal vergesse ich, wie windig es insbesondere an der Küste auch im Sommer sein kann. Die letzten fünf Jahre haben aus dem Jungen von der Insel etwas anderes gemacht. Ich bin kein Einheimischer mehr, aber auch kein Fremder, kein Besucher oder neugieriger Tourist. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer oder was ich eigentlich bin. Heute noch weniger als früher.
Ich stecke Handy und Schlüssel ein und mache mich auf den Weg. Vorbei an den vor Anker liegenden Booten, Fischkuttern und der Fähre, die die einzige Verbindung zum Festland Kanadas darstellt. Ihre Lichter spiegeln sich auf der dunklen Meeresoberfläche wie Glühwürmchen in einer warmen Sommernacht. Automatisch bleibt mein Blick an dem großen Schiff hängen. Aber es ist nicht der Abschied von Gemma und Peter, als ich ihnen am Tag nach der Hochzeit ihr vergessenes Gepäck für die Flitterwochen gebracht habe, der mir als Erstes in den Sinn kommt. Auch nicht meine Rückkehr nach Golden Bay.
Es ist jener Abend. Jene Nacht. Und die Umstände, die dazu geführt haben, dass ich allein auf die Fähre gegangen bin, statt …
»Holden?« Die raue Stimme reißt mich aus meinen Gedanken, bevor sie erneut in einen Strudel geraten können.
Suchend drehe ich mich um, bis ich dem Blick des alten Mannes begegne. Er trägt ein kariertes Flanellhemd, das aussieht, als wäre es älter als ich.
»Hey, Murray.« Grüßend hebe ich die Hand.
Er ist einer der Fischer, die schon ihr ganzes Leben lang jeden Morgen auf ihrem Kutter rausfahren, um zu angeln. Es gibt nicht mehr viele von ihnen, und ich habe einen Heidenrespekt vor ihrer Arbeit.
»Lange nicht gesehen.« Murray tippt sich an den bunten Beanie, hält jedoch keine Sekunde in der Arbeit inne. Systematisch löst er die Taue.
Einmal, ich muss etwa zehn gewesen sein, hat mich der alte Murray auf seinem Kutter mitgenommen. Obwohl es ein ganz normaler Arbeitstag für ihn war, hat er sich die Zeit genommen, mir jeden seiner Handgriffe zu erklären und all meine Fragen zu beantworten. Damals habe ich erst so richtig begriffen, wie rau das Leben am Meer eigentlich ist. Einen Fischer hat Murray zwar nicht aus mir gemacht, aber ich werde ihm immer dankbar für diese Erfahrung sein.
»Fährst du raus?«
»Nachtfischen«, erwidert er knapp. »Pass auf dich auf, mein Junge.« Für einen kurzen Moment wird sein Gesichtsausdruck ernst, fast schon eindringlich, dann startet er den Motor.
Stirnrunzelnd sehe ich ihm nach, bis er zwischen den anderen Booten in der Dunkelheit verschwunden ist. Seine Worte klangen wie eine Warnung, aber wahrscheinlich sehe ich einfach nur Gespenster. Mit einem Kopfschütteln wende ich mich ab und gehe weiter.
Die Hände in den Hosentaschen vergraben, wandere ich durch die Straßen, weg vom Hafenviertel und Richtung Innenstadt, bis ich den Pub an der Ecke einer kurzen Seitenstraße erreiche. Turner’s Tavern gab es schon, bevor ich geboren wurde. Wenn ich mich nicht irre, ist es eines der ältesten Gebäude in Bayville. Mom hat eine Weile dort gejobbt, als Gemma noch ein Baby war und der Laden einem netten älteren Ehepaar gehörte.
Kurz lasse ich den Blick über das zweistöckige Sandsteingebäude gleiten. Im Erdgeschoss ist jedes Fenster hell erleuchtet, die Etage darüber dunkel. Efeu schlängelt sich an der Fassade hinauf, an dem gusseisernen Schild vorbei bis unters Dach.
Entschlossen ziehe ich die Tür auf und betrete den Pub.
Meine Augen brauchen einen Moment, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen, dann entdecke ich Beck hinter dem Tresen. Er fährt sich mit den Fingern durch das schwarze Haar und fängt dann an, ein paar Gläser zu polieren, während er sich gleichzeitig mit einem der Stammgäste an der Bar unterhält.
Ich lasse mich auf einen freien Hocker sinken und nicke Beck zur Begrüßung kurz zu. Er scheint allein zu arbeiten, denn von Will und Annie ist nichts zu sehen. Allerdings herrscht an einem Montagabend für gewöhnlich auch kein Hochbetrieb.
Beck poliert das Glas in aller Seelenruhe weiter, beendet das Gespräch und kommt dann zu mir. »Was darf’s sein?«
Einen Moment lang betrachte ich die Flaschen, die hinter ihm auf einem Regal an der Wand aufgereiht stehen. Es gab Zeiten, in denen ich mich hemmungslos habe volllaufen lassen, um zu vergessen. Aber da musste ich auch nicht mit dem Auto nach Hause fahren. Damals hatte ich nicht mal ein richtiges Zuhause, von einer Familie oder Freunden ganz zu schweigen.
Ich reiße den Blick vom Alkohol los und reibe mir über die schmerzende Stirn. »Eine Cola. Und ein paar Infos zu dem Zimmer, das du angeblich vermieten willst.«
Er hält nur eine Sekunde inne. Das einzige Anzeichen dafür, dass ihn meine Bemerkung überrascht. Dann fährt er nahtlos mit seinem Job fort, holt ein Glas, füllt es mit Eiswürfeln, Cola und einer Zitronenscheibe.
In der Zwischenzeit schwingt erneut die Tür zur Bar auf, und ein paar Leute kommen herein.
Reflexartig verspannen sich meine Schultern. Ich schaue kurz zur Seite, nur um erleichtert festzustellen, dass es sich um eine harmlos wirkende Touristengruppe handelt. Die Kleidung – von den Caps und Sonnenbrillen über die Rucksäcke bis hin zu den Wanderschuhen – sagt alles aus. Spätestens die Broschüre, die einer von ihnen in der Hand hält, bestätigt meine Vermutung. Touristen. Wahrscheinlich kommen sie gerade von einem der Wanderwege entlang der Klippen und wollen zum Abschluss etwas essen und trinken.
Mein Puls beruhigt sich wieder, und ich atme tief durch. Scheiße. Ich stehe wirklich neben mir.
Unvermittelt taucht meine Bestellung vor mir auf, und mein Blick bleibt an Becks Armen hängen. Er trägt ein schwarzes Shirt und hat sich die Ärmel hochgekrempelt, sodass die vielen Tattoos, die seine gesamten Unterarme bedecken, deutlich sichtbar sind. Manche scheinen neuer zu sein, mit scharfen Linien und strahlenden Farben, andere älter, weicher, mit Tinte, die bereits unter der Haut verlaufen ist. Ich habe selbst zwei Tätowierungen und denke nicht gerne an die Umstände zurück, unter denen ich sie mir habe stechen lassen. Beck scheint seine jedoch mit Stolz zu tragen. Zumindest versucht er sie im Gegensatz zu mir nicht zu verstecken. Aber vermutlich sind seine dazugehörigen Geschichten auch netter als meine.
»Danke.« Ich nippe an meiner Cola. »Was das Zimmer angeht …«
Shit, ich klinge echt verzweifelt. Selbst wenn ich es tatsächlich bin, muss ich es ja nicht unbedingt zeigen.
Beck hat wieder das Poliertuch in der Hand und macht sich an die Arbeit, diesmal jedoch auf meiner Seite des Tresens. »Wer hat dir davon erzählt?«
»Jayden. Er scheint es für eine gute Idee zu halten, dass ich bei dir einziehe.«
»Ich nicht.«
Alarmsirenen schrillen in meinem Kopf los. Der Tipp kam zwar von Jayden, aber im Grunde kenne ich Beck kaum. Beim Ausflug zur Lighthouse Bay vor zwei Wochen schien er mir allerdings in Ordnung zu sein. Ziemlich ruhig und in sich gekehrt, zumindest solange er sich nicht mit Shae anlegt. Aber das ist mir tausendmal lieber als jemand, der ohne Punkt und Komma quasselt oder alles über mich wissen will. Ich kann niemanden gebrauchen, der sich in meine Angelegenheiten einmischt, und Beck scheint nicht der Typ dafür zu sein.
Außer an dem Abend, als er Ember geraten hat, sich lieber vor mir in Acht zu nehmen.
»Warum nicht?«, hake ich nach und trinke einen Schluck. Aus dem Augenwinkel bemerke ich Annie, die mit mehreren Tellern auf den Armen aus der Küche kommt und sie an einen Tisch bringt. »Weil du Ember vor mir gewarnt hast?«
Unsere Blicke treffen sich. Wie es aussieht, ist Beck kein Typ, der ausweicht und kuscht. Davor habe ich Respekt.
»Unter anderem«, erwidert er, ohne die geringste Miene zu verziehen. Der Ausdruck in seinen graublauen Augen bleibt starr. »Ich passe auf die Menschen auf, die ich zu meinen Freunden zähle.«
Was im Umkehrschluss bedeutet, dass er Ember als Freundin betrachtet, mich jedoch nicht. Damit kann ich leben. Wir müssen nicht die besten Kumpels werden. Ich brauche nur einen Ort, an dem ich pennen kann, ohne von meiner verdammten Vergangenheit verschlungen zu werden.
Mehrere Sekunden lang starren wir einander an, und ich weiß instinktiv, dass keiner von uns als Erster nachgeben wird. Nicht freiwillig.
»Danke.«
Seine Brauen schießen in die Höhe. »Danke wofür?«
»Dass du auf sie achtgibst.«
Vor allem in Zeiten, in denen ich es nicht konnte.
Beck stellt das polierte Glas vorsichtig ab, sodass es nicht das geringste Geräusch verursacht. Einen Moment lang betrachtet er es, während es in seinem Kopf zu arbeiten scheint, dann nickt er knapp. »Die Miete ist viel zu hoch, dafür ist die Lage echt in Ordnung und es ist nicht weit von hier. Die Küche funktioniert, das Bad ist klein, aber zweckmäßig, und das Zimmer möbliert.«
Als Beck mir den konkreten Mietpreis nennt, überschlage ich rasch die Kosten im Kopf. Mit einem Zimmer direkt in der Stadt wäre ich mobiler. Wenn mein Boss mich auf einer Baustelle in Bayville braucht, könnte ich hinlaufen. Einkäufe und andere Besorgungen ließen sich ebenfalls zu Fuß erledigen. Ich müsste nur noch für Jobs außerhalb der Stadt ins Auto steigen. Und für Ember. Die Miete ist nicht ohne, dafür würde ich mir einiges an Fahrtkosten sparen. Und ich müsste nicht mehr Nacht für Nacht in meinem Mausoleum von Kinderzimmer verbringen.
»Ich würd’s nehmen.«
Beck sieht nicht überzeugt aus. »Ich denke darüber nach«, erwidert er nur und geht dann ans andere Ende der Bar, um zwei junge Frauen mit Getränken zu versorgen.
Nachdenklich sehe ich ihm nach. Er und ich werden mit Sicherheit keine besten Freunde, aber wir könnten miteinander klarkommen. Einander respektieren. Und manchmal ist das mehr als genug.
6. Kapitel
»Lass den bloß nicht fallen«, warnt mein Kollege Darren. Er ist locker doppelt so alt wie ich, braun gebrannt und immer gut drauf.
»Keine Sorge«, ächze ich, während wir den Betonblock gemeinsam vom Laster wuchten und dorthin tragen, wo der Boss ihn haben will. Eigentlich sollte das der Kran für uns erledigen, aber der Hebegreifer ist defekt und wir hängen dem Zeitplan sowieso schon hinterher. Also muss die gute alte Handarbeit herhalten. »Ich hab echt keine Lust auf einen Krankenhausbesuch.«
»Ich auch nicht«, keucht Darren. »Hab gehört, Lee fällt noch mindestens vier Wochen aus.«
Vorsichtig stellen wir den Betonblock ab – anstatt ihn fallen zu lassen wie Lee. Der arme Kerl hat eine Sekunde nicht aufgepasst, und in der nächsten hatte er einen gebrochenen Fuß. Die Schutzausrüstung hat Schlimmeres verhindert, aber krankgeschrieben werden musste er trotzdem.
Schwer atmend richte ich mich auf, wische mir Schweiß und Staub von der Stirn und schiebe den Helm auf meinem Kopf zurecht. Eigentlich dachte ich, ich wäre gut in Form, aber nichts kann einen auf diese Art von Arbeit vorbereiten. Und wir sind noch lange nicht fertig, denn es warten noch jede Menge Betonblöcke und Ziegelsteine auf uns.
Das Gebäude in der Stadt, an dessen Restaurierung ich in den letzten zwei Wochen mitgeholfen habe, ist praktisch fertig. Wir haben beschädigte Dachziegel und die Dachrinne ersetzt, die Fassade ausgebessert und Fenster und Türen verstärkt, damit sie sturmsicher sind. Mittlerweile bin ich auf der nächsten Baustelle, am Stadtrand von Bayville, wo eine ganze Anlage mit Ferienwohnungen und Pools entstehen soll. Doch bis es so weit ist, wird es noch eine Weile dauern.
Zusammen mit Darren marschiere ich zum Laster zurück, vorbei an Dutzenden Leuten mit Helm und leuchtend gelben Westen, die geschäftig hin und herlaufen. Manche davon nicken uns zu, andere sind zu vertieft in ihre Arbeit, um uns zu beachten. Obwohl ein Job auf dem Bau als kleiner Junge nie mein Berufswunsch war, gefällt es mir. Der Boss ist streng, es ist verflucht anstrengend, aber ehrliche Arbeit und hart verdientes Geld.
Ich ziehe die Handschuhe zurecht und packe den nächsten Betonblock. »Bereit?«
Darren nickt, und wir hieven ihn gemeinsam hoch.
Als wir das nächste Mal zum Laster zurückkehren, spüre ich plötzlich ein Prickeln im Nacken. Meine Schultern verspannen sich. Unwillkürlich verlangsame ich meine Schritte und sehe mich um. Wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein, aber ich habe auf die harte Tour gelernt, auf meine Instinkte zu vertrauen. Und in dieser Sekunde schlagen sie Alarm.
Die Baustelle ist unübersichtlich. Überall rennen Arbeiter herum, andere stehen neben dem Betonmischer, um das Material für das Fundament vorzubereiten, und wieder andere sitzen ein Stück abseits zusammen und machen mit ein paar Sandwiches Mittagspause.
Schließlich bleibt mein Blick an ein paar Typen hinter dem Bauzaun hängen. Zwei Kerle, dunkel angezogen, der eine in meinem Alter oder jünger, der andere scheint um die vierzig zu sein.
Ich beiße die Zähne zusammen. Das sind keine neugierigen Anwohner, die zufällig vorbeigekommen sind und herausfinden wollen, was wir treiben. Die beiden sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Und so unterschiedlich diese Typen auch aussehen, eine Sache haben sie gemeinsam: Sie beobachten nicht, was auf der Baustelle vor sich geht. Sie beobachten mich. Und ich weiß genau, für wen sie arbeiten.
Der Ältere lächelt leicht, als sich unsere Blicke begegnen – und ich erinnere mich. Er war einer der Kerle, die mich vor einer Weile in der Nähe von Turner’s Tavern angesprochen haben. Und das nicht, um mich höflich nach dem Weg zu fragen, sondern um mich daran zu erinnern, wer auf der Insel das Sagen hat. Erst hinterher habe ich erfahren, dass Beck uns zusammen gesehen hat – und schon Ärger mit den Typen hatte. Kurz darauf hat er Ember vor mir gewarnt. Zu Recht. Aber ich bin nicht die gefährlichste Person hier – genauso wenig wie diese Kerle. Sie sind nur die Späher. Die vorderste Front. Derjenige, der sie hergeschickt hat, ist die wahre Bedrohung.
Nur mit Mühe unterdrücke ich ein Schaudern. Es kostet mich sämtliche Willenskraft, ihnen den Rücken zuzukehren und mich auf diese Weise verwundbar zu machen. Gleichzeitig zeige ich ihnen damit, dass sie mir nichts anhaben können. Ich habe keine Angst vor ihnen. Meinetwegen können sie den ganzen Tag dort herumstehen und mir beim Arbeiten zuschauen. Mich machen sie damit nicht mürbe. Ich habe schon ganz anderes durchgestanden – und überlebt.
Doch das mulmige Gefühl bleibt. Auch Stunden später, als die Typen längst verschwunden und alle Betonblöcke endlich verladen sind.
Ich verabschiede mich von den letzten Kollegen, die noch da sind, und will mich auf den Weg zu meinem Pick-up machen, der zwischen den anderen Autos der Männer steht, als mein Handy in der Hosentasche vibriert. Noch im Gehen ziehe ich es hervor und bleibe abrupt stehen, als ich auf das Display starre. Unbekannt. Was zur Hölle …?
So gut wie niemand hat diese Nummer. Mom, Gemma, mein Boss Gonzalez, Jayden, Zion und neuerdings auch Beck sind die Einzigen. Und Ember. Ihr habe ich sie kurz nach unserem Wiedersehen geschickt. Und ich habe jeden Einzelnen meiner wenigen Kontakte abgespeichert. Wer also ist der unbekannte Anrufer?
Meine Gedanken wandern zurück zu den beiden Kerlen, die am Rande der Baustelle aufgetaucht und genauso schnell wieder verschwunden sind. Stecken sie oder eher ihr Auftraggeber dahinter? Aber woher sollten sie meine Nummer haben? Oder ist das alles bloß ein Zufall?
Ich lasse den Anruf ins Leere gehen. Nur ärgerlich, dass ich ihn nicht nachverfolgen kann, um mehr herauszufinden.
Verflucht!
»Thorne!« Eine schwere Hand landet auf meiner Schulter.
Ich hasse es, dass ich vor Schreck zusammenzucke. Instinktiv reiße ich die Arme hoch, wirble herum und nehme eine Abwehrhaltung ein.
»Hoppla.« Gonzalez hebt entschuldigend die Hände. Er muss um die sechzig sein und hat das Bauunternehmen von seinem Vater und der von dessen Vater geerbt. »Wollte dich nicht erschrecken. Aber solltest du nicht langsam nach Hause gehen?«
Als er um sich deutet, fällt mir auf, dass mein Boss und ich die Letzten sind. Der Parkplatz neben der Baustelle ist inzwischen völlig verlassen. Im Westen verfärbt sich der Himmel orangerot, weil die Sonne bald untergeht.
»Sorry.« Ich lasse die Hände, die ich instinktiv zur Verteidigung hochgerissen habe, wieder sinken. »Ich war nur … egal.« Dann kommt mir ein Gedanke. »Sag mal, Gonzalez, hast du irgendwem meine Nummer gegeben? Oder hat vielleicht jemand nach mir gefragt?«
Die Falten auf seiner Stirn vertiefen sich. »Nicht, dass ich wüsste. Und ich gebe keine Daten weiter, ohne euch Jungs zu fragen. Will euch ja nicht an die Konkurrenz verlieren.«
Sein Scherz entlockt mir nur ein abgelenktes Nicken. Denn wenn Gonzalez meine Handynummer nicht weitergegeben hat – wer dann?
Auf der Fahrt nach Hause halten sich die Fragen in meinem Kopf ebenso hartnäckig wie das mulmige Gefühl in meinem Bauch. Doch egal, wie oft ich in Rück- und Seitenspiegel schaue, niemand folgt mir. Und mein Handy bleibt still. Keine weiteren ominösen Anrufe mehr.



![Sturmtochter. Für immer vereint [Band 3 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/661345b7546184504a60a70b5eedeaf1/w200_u90.jpg)
![Twisted Fate. Wenn Magie erwacht [Band 1 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3a5ca8beed0e03eb5b9ec5019f556df5/w200_u90.jpg)








![Twisted Fate. Wenn Liebe zerstört [Band 2 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3120cf0cd51a7cc2c0f77e86ae0b96a7/w200_u90.jpg)