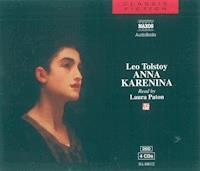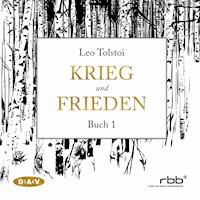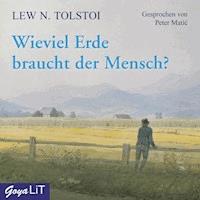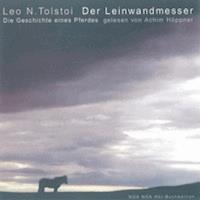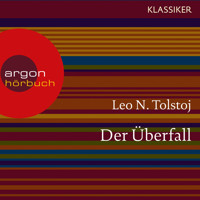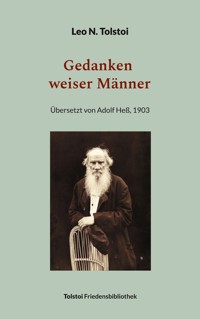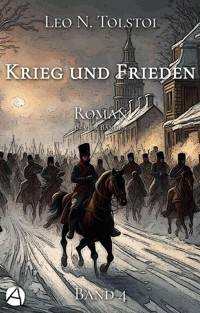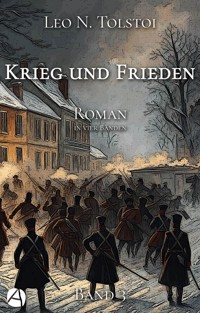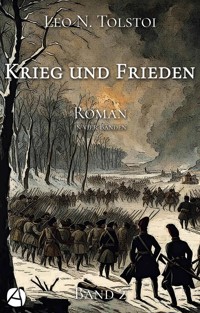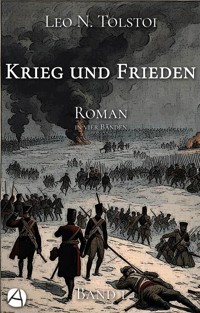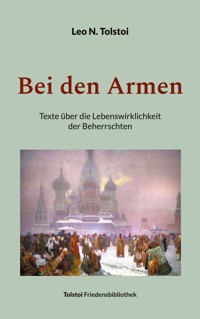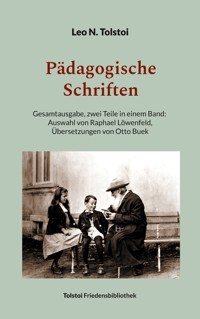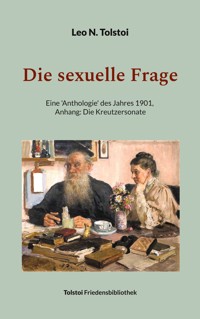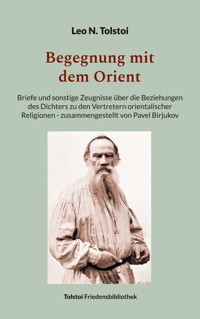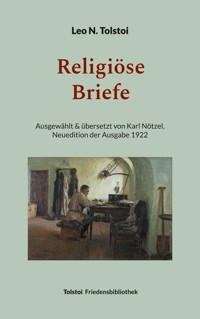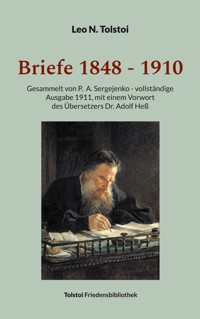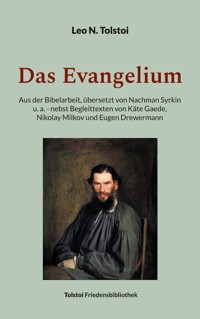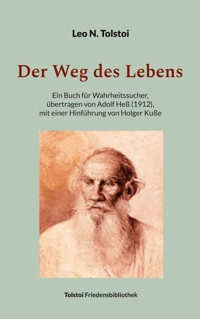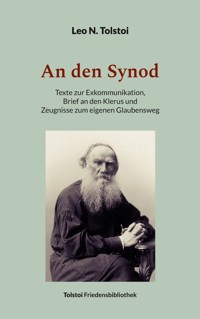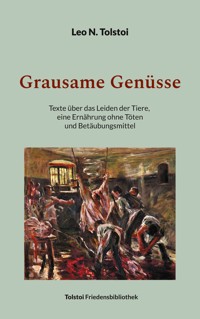
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek B
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der vorliegende Band vereinigt Texte Leo N. Tolstois über den Umgang des Menschen mit Tieren, eine Ernährung ohne Fleischverzehr und den Gebrauch von Rauschmitteln: Der Leinwandmesser (Erzählung 1863/1886); Die erste Stufe (1891, drei verschiedene Übertragungen); Über die Jagd (1890); Warum die Menschen sich betäuben (1890); Die Trunkenheit bei den leitenden Klassen (Übersetzung 1894); u.a. Vollständig enthalten ist in dieser Ausgabe der Tolstoi-Friedensbibliothek auch die seit über einem Jahrhundert im Handel nicht mehr greifbare Anthologie "Grausame Genüsse" (Berlin 1895). Tolstois Traktat über die Fleischesser wurde von Mahatma Gandhi in besonderen Leseempfehlungen berücksichtigt. Schon zu Lebzeiten galt der russische Dichter als "Sonne der vegetarischen Welt". Zu den Aufklärungsschriften über eine Ernährungsweise ohne Töten gehört z.B. die erschütternde Schilderung seines Schlachthaus-Besuchs in Tula am 7. Juni 1891. Für das letzte Lesebuch (1910) hat der "Alte von Jasnaja Poljana" die Botschaft der Achtung des Lebens noch einmal zusammengefasst: "Wir fühlen mit dem Herzen, dass das, wodurch wir leben, das, was wir unser Ich nennen, nicht nur in allen Menschen, sondern auch im Hunde, Pferde, in Mäusen, im Huhn, Sperling und in der Biene ... ein und dasselbe ist. ... Wer ist dann der Nächste? Hierauf gibt es nur eine Antwort: 'Frag nicht, wer dein Nächster ist, sondern behandle alle Lebewesen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.' - Alles Lebende fürchtet Qualen, alles Lebende scheut den Tod; erkenne dich nicht nur im Menschen, sondern in jedem Lebewesen; töte nicht und verursache keine Leiden und Tod. Alles Lebendige will dasselbe wie du: erkenne dich in jedem Lebewesen. - Der Mensch steht nicht deswegen über den Tieren, weil er sie quälen kann, sondern weil er imstande ist, Mitleid mit ihnen zu empfinden ..., weil er fühlt, dass in ihnen ein und dasselbe Wesen lebt, wie in ihm selbst. ... Die Zeit wird ... kommen, und unsere Nachkommen werden sich wundern, dass ihre Vorfahren jeden Tag Millionen Tiere töteten, um sie zu essen, obgleich man sich gesund und schmackhaft, ohne Mord, von Früchten der Erde ernähren kann." Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe B, Band 14 (Signatur TFb_B014) Herausgegeben von Peter Bürger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort des Herausgebers | Tolstoi-Friedensbibliothek
Geschichte eines Pferdes
Leo N. Tolstoi
LEINWANDMESSER
(Холстомер | Cholstomer, 1863/1886)
Übersetzt von Hermann Röhl| 1913
Über Fleischverzehr, tötende Gewalt und Auswege (mit Übersetzungsvarianten)
Leo N. Tolstoi
DIE ERSTE STUFE
(Pervaja stupenʼ, 1891)
Aus dem Russischen übersetzt von Wilhelm Henckel| 1892
Leo N. Tolstoi
GRAUSAME GENÜSSE
Ein Sammelband mit fünf Texten| 1895
Die Fleischesser (Pervaja stupenʼ, 1891)
Der Krieg (Buchauszug, 1890-1893)
Die Jagd (Vorwort zu einem Buch V. G. Čertkovs, 1890)
Das Glück (Buchauszug, 1883/84)
Glaubensbekenntnis (Brief an einen Freund, 1882)
Leo N. Tolstoi
DIE ENTHALTSAMKEIT, EINE FORDERUNG WIDER DEN LUXUS
UNSERERZEIT (Pervaja stupenʼ, 1891)
Renatus-Verlag| 1931, mit Übersetzung von 1893
Über den Gebrauch von Betäubungsmitteln
Leo N. Tolstoj
WARUM DIE MENSCHEN SICH BETÄUBEN
(Dlja čego ljudi odurmanivajutsja? 1890)
Übersetzt von Raphael Löwenfeld| 1891
Einführung (des Übersetzers)
Warum die Menschen sich betäuben
Anhang: Zuschriften von Dumas, Zola, Daudet, Jules Simon, Claretie, Charcot – Conrad Ferdinand Meyer, Möbius, Preyer, Büchner, Carrière
Leo N. Tolstoi
DIE TRUNKENHEIT BEI DEN LEITENDEN KLASSEN
Übersetzt von L. Albert Hauff| 1894
Gewissen und freier Wille
Leo N. Tolstoi
GEWISSENSFRAGEN
Brief an die Baronin Rosen (26.11.1894)
Übersetzt von L. Albert Hauff
Leo N. Tolstoi
ZUR FRAGE VON DER FREIHEIT DES WILLENS
(Buchauszug, 1890-1893)
Übersetzt von L. Albert Hauff
Anhang
Kommentierte Bibliographie zu den beiden Grundtexten Leo N. Tolstois über Fleischverzehr und Betäubung
Übersicht zu den Bänden der Tolstoi-Friedensbibliothek
VORWORT DES HERAUSGEBERS
der Tolstoi-Friedensbibliothek
„Vergesst nicht die Tiere! Auch sie können trauern und tanzen, und sie haben mit ihren Gefühlen unsere Empfindungen von Zärtlichkeit, Obhut, Vertrauen und Liebe in den langen Zeiten der Evolution erst ermöglicht und vorbereitet. Der Himmel wäre kein Himmel ohne die Tiere. Wir gehören zusammen. […] Wie wir mit den Tieren, die uns am nächsten stehen, weil wir sie als Haustiere gezüchtet haben, in unseren Stallungen heutigentags verfahren, um sie als Nutztiere zu halten und als Schlachtvieh auf den Markt zu werfen, verrät eine Rohheit und Barbarei, die beweist, wie viel wir selber in der Ersatz-Religion des Kapitalismus an Menschlichkeit verloren haben.“ EUGEN DREWERMANN1
Im Zentrum des vorliegenden Bandes stehen Texte Leo N. Tolstois über den Umgang des Menschen mit Tieren, eine Ernährung ohne Fleischverzehr und den Gebrauch von Betäubungs- bzw. Rauschmitteln. Der Traktat „Die erste Stufe“ (Pervaja stupenʼ, 1891) ist berücksichtigt in den vordringlichen Lese-Empfehlungen von Mohandas K. Gandhi.2 Er wird von uns sogar in drei unterschiedlichen Übertragungen aus dem Russischen – mit jeweils abweichenden deutschen Titeln – dargeboten, so dass die entsprechende Abteilung auch das Kulturphänomen der Mehrfachübersetzungen und konkurrierenden Tolstoi-Editionen in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg im Ausschnitt dokumentiert. Die aus fünf Texten bestehende – wenig bekannte und nur schwer greifbare – Anthologie „Grausame Genüsse“ (Janke Verlag, Berlin 1895), die thematisch nicht nur Fragen von Fleischgenuss und Tiertötung (Schlachthof, Jagd) behandelt, haben wir ohne Kürzungen aufgenommen.3
Porträt eines Pferdes | Otto Erelman, 1907 (commons.wikimedia.org)
Der bibliographische Überblick im Anhang endet mit einem Abschnitt zur Sekundärliteratur (Auswahl). Wer Tolstois – auch in wirkungsgeschichtlicher Hinsicht bedeutsamen – Beitrag zur Wegbereitung einer vegetarischen Lebensweise eingehender kennenlernen möchte, sei besonders nachdrücklich auf die Monographie des Slawisten Peter Brang (1924-2019) hingewiesen.4
Eine „unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier“?
Karl Nötzel schreibt in einer Darstellung des Jahres 1915: „Die orthodoxe Kirche lehrt ja bekanntlich eine unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier – die übrigen Geschöpfe lässt sie überhaupt links liegen oder hat für sie bloß mechanische Erklärungen. Das sind Automaten, die der Höchste aufzieht – und damit ist der natürlichen Empfänglichkeit des von Hause aus gemütsweichen Russen der Tierwelt gegenüber eine geradezu peinliche Grenze gesetzt. Der Russe [!] quält völlig gedankenlos Tiere, vor allem Pferde und Hunde. Wie oft ward mir dabei in Russland, wenn ich mich bei unerträglichen Tierquälereien einzuschreiten veranlasst sah, und den Betreffenden ersuchte, sich doch selber in die Lage des gepeinigten Tieres zu versetzen, aufrichtig erstaunt und harmlos lächelnden Mundes geantwortet: ‚Das ist ja doch ein Tier!‘ So erinnere ich mich, dass einst meine sehr fromme und gutherzige Köchin einen Hund mit heißem Wasser verbrühte, weil er in die Küche gelaufen war, wo ein Heiligenbild hing! Diese Vorstellung einer absoluten Kluft zwischen dem Menschen und der übrigen Schöpfung, wie sie die griechische Kirche lehrt, hat sich tief eingenistet in den Anschauungen auch des aufgeklärten Russlands. Der Anblick übergroßen Menschenelends mag da mitgespielt haben. (Und ihm gegenüber erscheint es tatsächlich fast frivol, sich um Tiere zu kümmern.) Wie dem aber auch sei, tatsächlich finden wir in keinem russischen Erlösungstraum – auch nicht bei Tolstoi – Platz für unsere demütigen Brüder, die Tiere, und für unsere stummen, sündlosen Schwestern, die Pflanzen. Das aufgeklärte Russland denkt streng anthropozentrisch: der heilige Franz hat nicht für es gelebt. Und das ist um so seltsamer, als das heutige Russentum eigentlich nur als ursprüngliches Künstlertum zu begreifen ist (wenn man sich nicht beschränkt verhalten will ihm gegenüber, das heißt, es einfach als unsympathisch ablehnt). Künstlertum ist aber immer auch ein Bekenntnis zum Glauben an die Allbeseeltheit, oder setzt wenigstens solchen Glauben voraus.“5
Nun war zum Zeitpunkt dieser Niederschrift die Behauptung einer ‚unüberbrückbaren Kluft zwischen Mensch und Tier‘ gewiss kein theologisches Alleinstellungsmerkmal des orthodoxen Kirchentums, so wenig wie wohl Tierquälerei als Besonderheit des russischen Kulturraums gelten kann. Leo Tolstoi hat vielleicht keinen eigenen ‚Erlösungstraum‘ für die Tierwelt verfolgt, doch sein letztes Lesewerk vermittelt – kurz vor seinem Tod – unter der Überschrift „Nicht nur in allen Menschen, sondern in allem Lebenden existiert ein und dasselbe göttliche Wesen“ u. a. folgende Anschauungen:
„Wir fühlen mit dem Herzen, daß das, wodurch wir leben, das, was wir unser Ich nennen, nicht nur in allen Menschen, sondern auch im Hunde, Pferde, in Mäusen, im Huhn, Sperling und in der Biene, sogar in Pflanzen ein und dasselbe ist. – […] Wer ist dann der Nächste? Hierauf gibt es nur eine Antwort: ‚Frag nicht, wer dein Nächster ist, sondern behandle alle Lebewesen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.‘ – Alles Lebende fürchtet Qualen, alles Lebende scheut den Tod; erkenne dich nicht nur im Menschen, sondern in jedem Lebewesen; töte nicht und verursache keine Leiden und [keinen] Tod. Alles Lebendige will dasselbe wie du: erkenne dich in jedem Lebewesen. – Der Mensch steht nicht deswegen über den Tieren, weil er sie quälen kann, sondern weil er imstande ist, Mitleid mit ihnen zu empfinden. Mitleid hat der Mensch mit Tieren, weil er fühlt, daß in ihnen ein und dasselbe Wesen lebt, wie in ihm selbst. […]
Wir wundern uns darüber, daß es Leute gab und gibt, die Menschen töten, um ihr Fleisch zu essen. Die Zeit wird aber kommen, und unsere Nachkommen werden sich wundern, daß ihre Vorfahren jeden Tag Millionen Tiere töteten, um sie zu essen, obgleich man sich gesund und schmackhaft, ohne Mord, von Früchten der Erde ernähren kann.“6
Der vorliegende Band wird eröffnet mit der zu Beginn der 1860er Jahre entstandenen Erzählung „Leinwandmesser“ (Cholstomer | Erstveröffentlichung 1886), in dem ein Pferd seine eigene Geschichte unterbreitet. Dieser Text Tolstois ist wohl kaum als eigenständige Dichtung zur ‚Verteidigung der Rechte von Tieren‘ zu betrachten, doch er bezeugt schon zwei Jahrzehnte vor der Abkehr des Dichters von Fleischverzehr und Jagd eine Grundhaltung, die den Mitteilungen von Karl Nötzel entgegensteht. Der Wallach ‚Leinwandmesser‘ vermag sich nicht als Besitztum der menschlichen Herrengattung zu verstehen: „Damals konnte ich gar nicht begreifen, was das eigentlich heißen sollte, daß sie mich als das Eigentum eines Menschen bezeichneten. Der Ausdruck ‚mein Pferd‘ bezog sich auf mich, ein lebendiges Pferd, und erschien mir ebenso seltsam wie solche Ausdrücke: ‚mein Land‘, ‚meine Luft‘, ‚mein Wasser‘.“
Peter Brang betont in seiner Studie „Unbekanntes Russland“: „Die Ernsthaftigkeit des Mitleids mit den Tieren als eines wesentlichen Motivs für Tolstojs Übergang zum Vegetarismus geht deutlich aus Tagebuchaufzeichnungen wie der vom 9. August 1857 hervor (‚die Armut der Leute und die Leiden der Tiere sind furchtbar‘), aus Erzählungen wie dem Leinwandmesser, vor allem aber auch aus den zahlreichen Berichten über all jene Diskussionen, die in Tolstojs Familienkreis über den Umgang mit Tieren, mit Haustieren sowohl wie mit Tieren in freier Wildbahn geführt wurden. Nicht wenige solcher Gespräche hat D. P. Makovickij7 in seinen Aufzeichnungen aus Jasnaja Poljana 1904 bis 1910 festgehalten. In manchen dieser Wortgefechte blitzt Humor auf. Bei Tolstoj steht im Schlafzimmer eine Mausefalle. Die Mäuse, die in sie geraten, trägt er ins Čapyž (einen alten Eichenwald), etwa 150 Schritte vom Haus. ‚Aber die kehren doch zurück‘, wendet Sof’ja Andreevna ein. – ‚Nein, das sind andere‘, antwortet L[eo]. N. (27. Januar 1905). – Sof’ja Andreevna tut beim Mittagessen kund: ‚Ich mag Hühner sehr‘ [esse gern Hühnerfleisch]. L[eo]. N.: ‚Aber sie mögen das nicht, weil man sie schlachtet‘. (18. Oktober 1909).“8
Keineswegs humorlos klingen auch die Nachrichten über den Herbstbesuch einer fleischliebenden Verwandten – wohl während der Abwesenheit der gräflichen Hausherrin. Tolstois Tochter Tat ʼjana Lvovna hat darüber erzählt: „Zur Abendessenszeit begaben wir uns in das Speisezimmer; aber was entdeckten wir dort? Neben dem Gedeck unserer Tante lag ein riesiges Küchenmesser, und am Bein ihres Stuhles war ein lebendiges Hähnchen angebunden. Das arme Tier schlug um sich und riss den Stuhl mit. ‚Da wir wissen‘, sagte Vater zu unserem Gast, ‚dass du gern lebende Wesen verspeist, haben wir dir dieses Hähnchen zugedacht. Aber da keiner von uns hier einen Mord begehen will, haben wir dir dieses tödliche Instrument bereit gelegt, damit du es selber tust.‘ ‚Das ist wieder einmal einer deiner Scherze‘ rief Tante Tat’jana lachend aus. ‚Tanja, Maša, bindet sofort dieses arme Federvieh los und gebt ihm seine Freiheit zurück.‘ Wir beeilten uns, der Tante zu gehorchen. Nachdem das Hähnchen befreit war, servierten wir das von uns zubereitete Abendessen: Makkaroni, Gemüse und Obst. Unsere Tante aß von allem mit großem Appetit.“9
Manifest für Vegetarismus
Noch um 1880 hatte L. N. Tolstoi in bewusster Abkehr von der zeitweilig sehr getreuen Kirchenbindung während der fleischlosen Fastenzeit ein Schweinekotlett verzehrt. Nach Beginn der Bekanntschaft mit dem aufgrund religiöser Bedenken aus dem Militärdienst ausgeschiedenen Vladimir G. Čertkov (1854-1936) gegen Ende 1883 vollzog sich jedoch die – dann im Verlauf des Jahres 1885 gefestigte – Abkehr Tolstois von Fleischnahrung, was seine Gattin allerdings missbilligte.
Die im Juni 1891 niedergeschriebene Schrift „Die erste Stufe“ bestätigt den Weg nonkonformistischer russischer Christen wie der Duchoborzen und wird später als ein wichtiges ‚Manifest‘ der vegetarischen Bewegung Geltung erlangen. Sie enthält eine der bekanntesten Schilderungen der Arbeit in Schlachthöfen. Für den 7. Juni 1891 vermerkte die damals 26jährige älteste Tochter Tatʼjana: „Papa ist heute mit dem Datschenzug nach Tula ins Schlachthaus gefahren und hat uns darüber erzählt. Furchtbar ist das, und ich glaube, Papas Erzählung genügt, um mit dem Fleischessen aufzuhören.“10
Zum weiteren Schrifttum führt Peter Brang aus: „Auch nach der Veröffentlichung von Die erste Stufe setzte Tolstoj sein Werben für den Vegetarismus fort; er propagierte die vegetarische Ernährung, wo er konnte, begrüßte die Gründung von Vegetarischen Gesellschaften in Russland und in anderen Ländern (ohne freilich einer dieser Gesellschaften beizutreten). 1903 publizierte er im Verlag ‚Posrednik‘ eine Sammlung mit 250 Äußerungen von Philosophen, Dichtern und Gelehrten zum Vegetarismus und zur Enthaltsamkeit: Die tötungsfreie Ernährung oder der Vegetarismus. Gedanken verschiedener Schriftsteller. Dort sind Plutarch, Ovid, Rousseau, Lamartine und viele weitere vertreten. Diese Texte gingen, gründlich überarbeitet, in den Jahren 1906-1907 dann in den Krug čtenija ein, jene Sammlung von erbaulichen Lektüretexten, die Tolstoj damals für den ganzen Jahreslauf zusammentrug. Unter den Daten 21. Februar, 6. Mai, 20. Juni, 20. Juli und 24. September sind hier literarische Zeugnisse versammelt, die das Mitleid mit den Tieren und den Verzicht auf Fleisch propagieren: Texte wiederum von Plutarch, Ovid (in der Versübersetzung von Barykova), Lamartine, Schopenhauer und anderen sowie auch von Tolstoj selbst. Für drei weitere Tage hatte Tolstoj unter dem Titel ‚Vegetarianstvo‘ zusätzlich verschiedene Texte zusammengestellt, die für die erste Ausgabe des Krug čtenija als ‚Ersatztage‘ […] vorgesehen waren. Hier figurieren Seneca, Rousseau und wiederum Plutarch.“11
Leo N. Tolstoi (1828-1910)
Fotograf: Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski | 1908 (commons.wikimedia.org)
Es bleiben Inkonsequenzen: „Tolstoj muss sich […] gegenüber ‚veganischen‘ Forderungen bezüglich seiner Kleidung rechtfertigen. ‚Sie haben völlig recht, dass man, wenn man die bewusste Tötung lebendiger Wesen ablehnt, auch für die Kleidung nicht Teile ihres Körpers wie Haut, Fleisch benutzen sollte. Dass ich Ledergürtel trage und Lederschuhe und sogar Pelzmützen, beweist keineswegs, dass es nötig ist, das zu tun, und dass es gut sei, sondern nur dies, dass ich, wiewohl ich meine, es sei besser kein Leder und Pelz zu tragen, in meinem Leben nicht nur hinsichtlich des Gebrauchs der Körper getöteter Geschöpfe, sondern auch in vielem, vielem anderen, weit Wichtigerem, so weit von Vollkommenheit entfernt bin, dass ich die Anstrengungen, die ich auf die Verbesserung meines Lebens in sittlicher Beziehung richten kann, zweckmäßiger auf die Verbesserung meiner anderen, vielen und wichtigeren Mängel richte, als auf den Gebrauch von Leder- und Pelzgegenständen für meine Kleidung.‘ (7. November 1909)?“12
Warum betäuben sich die Menschen?
Leo N. Tolstoi hat sich ab den 1880er Jahren – mehr oder weniger streng – auch vom Alkohol- und Tabakkonsum losgesagt.13 Er initiierte Ende 1887 sogar die Gründung einer ‚Vereinigung gegen Trunksucht‘ und beförderte den Druck von Aufklärungsmaterial zur ‚Alkoholfrage‘. Zu seinen eigenen Schriften gegen den Rauschmittelgebrauch (→S. 243-290) gehört der Traktat „Warum die Menschen sich betäuben“ (Dlja čego ljudi odurmanivajutsja? | 1890), welcher diskursfreudig zusammen mit z. T. sehr ausführlichen ‚Widerworten‘ aus Frankreich und Deutschland ediert worden ist (→S. 245-284). Tolstoi appelliert – gemäß seinem Ethos und ‚Menschenbild‘ (→S. 291-305) – abseits der eigenen Dichterwerke vorrangig an Verstandesgaben. Über die Eigenschaften der unterschiedlichen Rausch- bzw. Genussmittel, die tiefenpsychischen Hintergründe von Suchtbiographien und erfolgversprechende Auswege aus der Gefahr sollte man sich heute besser über Sachbücher anderer Autoren informieren. Die soziale Dimension des Alkoholismus wird in vielen gesellschaftskritischen Texten Tolstois beleuchtet, in denen wir allerdings Moralpredigten wider die Trunksucht unter den Armen vergeblich suchen. Der Dichter zeigte „Verständnis für den Alkohol als Tröster des Volkes in einem tristem Leben. N. N. Gusev zitiert unter dem 20. Dezember 1908 ein Gespräch über die Trunksucht. Makovickij hatte berichtet, dass allein in Moskau und dem Moskauer Gouverment jährlich 38 Millionen Rubel versoffen würden. Tolstoj: ‚Ich bin zwar immer froh, wenn jemand aufhört zu trinken, aber die Hand erhebt sich nicht zum Vorwurf. […] Für sie [das Volk] ersetzt der Wodka all unsere Konzerte, Theater …‘.“14 – Didaktisch angelegt sind freilich Dichtungen wie das Volksmärchen „Der erste Branntweinbrenner | Wie der Teufel die Brotschnitte verdiente“ (1886).
In der letzten, erst postum veröffentlichten Anthologie Tolstois (Der Weg des Lebens, 1910) lesen wir dann: „Weder Wein noch Opium noch Tabak sind zum Leben notwendig. Alle Welt weiß, daß Wein, Opium und Tabak für Leib und Seele schädlich sind. Dabei wird die Arbeit von Millionen Menschen auf die Produktion dieser Gifte verwandt. Warum tun die Menschen das? Weil sie der Sünde des Leibesdienstes verfallen und, wohl wissend, daß der Leib niemals Befriedigung findet, Dinge wie Wein, Opium und Tabak anwenden, die sie derart berauschen, daß die Nichterfüllung ihrer Wünsche ihnen nicht weiter auffällt. […] Sich berauschen ist noch kein Verbrechen; wohl aber macht man sich durch den Rausch zu allen möglichen Verbrechen disponiert. […] Man kann sich schwer vorstellen, welch glückliche Veränderungen in unserem Leben stattfänden, wenn die Menschen aufhören würden, sich zu berauschen und mit Schnaps, Wein, Tabak, Opium zu vergiften.“15 – Dass, um nur einen Aspekt zur Erweiterung dieses Blickwinkels anzuführen, Opiate einem Menschen vor allem nach lebensgeschichtlichen seelischen Verwundungen – etwa durch sexuelle Gewalterfahrungen in der Kindheit – durchaus als ‚notwendige‘ Mittel zur Betäubung eines unerträglichen Schmerzes erscheinen können, war dem Dichter vermutlich nicht bekannt.
pb
1 Eugen DREWERMANN: Über die Unsterblichkeit der Tiere (1989) | Über die Verwandtschaft allen Lebens. – Zwei Essays. Ostfildern: Patmos 2022, S. 11.
2 Vgl. Leo N. TOLSTOI: Das Gesetz der Gewalt und die Vernunft der Liebe. Texte über die Weisung, dem Bösen nicht mit Bösem zu widerstehen. Ausgewählt und neu ediert von Peter Bürger. (= Tolstoi-Friedensbibliothek: Reihe B, Band 5). Norderstedt: BoD 2023, S. 255.
3 Die ermittelten ‚Ursprungsorte‘ der einzelnen Texte dieser Anthologie werden nicht im Anhang, sondern jeweils in Fußnoten zu den Überschriften angegeben.
4 Peter BRANG: Ein unbekanntes Russland. Kulturgeschichte vegetarischer Lebensweisen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2002, bes. S. 59-113: „L. N. Tolstoj: ‚Die Sonne der vegetarischen Welt‘“ [Kurztitel nachfolgend: BRANG 2002]. – Diese Darstellung fußt u. a. auch auf Tagebucheintragungen, Briefen und Mitteilungen von Zeitzeugen, die wir im vorliegenden Band unberücksichtigt lassen.
5 Karl NÖTZEL: Das heutige Russland. Eine Einführung in das heutige Russland an der Hand von Tolstois Leben und Werken. Erster Teil. München/Leipzig: Georg Müller 1915, S. 55-56. Vgl. zu den – nicht ganz ‚unbeweglichen‘ – Positionen der orthodoxen Kirchenleitung aber: BRANG 2002, S. 81-84.
6 Leo N. TOLSTOI: Der Weg des Lebens. Ein Buch für Wahrheitssucher. Neuedition der Übertragung von Adolf Heß, 1912. Mit einer Hinführung von Holger Kuße. (= Tolstoi-Friedensbibliothek: Reihe A, Band 14). Norderstedt: BoD 2023, S. 7375. [Kurztitel nachfolgend: TFb_A014]
7 [Dušan Petrovič Makovickij (1866-1921) aus der Slowakei – erstmalig 1894 in Jasnaja Poljana und dann 1903-1910 Hausarzt Tolstois.]
8 BRANG 2002, S. 97.
9 Zit. BRANG 2002, S. 98.
10 Zit. BRANG 2002, S. 72. – Vgl. →S. 96-101; 131-137; 232-239.
11 BRANG 2002, S. 77.
12 BRANG 2002, S. 100-101.
13 Vgl. auch BRANG 2002, S. 101-105; TFb_A014, S. 122-124.
14 BRANG 2002, S. 105.
15 TFb_A014, S. 123-124.
Geschichte eines Pferdes
„Damals konnte ich gar nicht begreifen, was das eigentlich heißen sollte, daß sie mich als das Eigentum eines Menschen bezeichneten. Der Ausdruck ‚mein Pferd‘ bezog sich auf mich, ein lebendiges Pferd, und erschien mir ebenso seltsam wie solche Ausdrücke: ‚mein Land‘, ‚meine Luft‘, ‚mein Wasser‘.“
Leo N. Tolstoi
Leinwandmesser
(Холстомер | Cholstomer, 1863/1886)
Übersetzt von Hermann Röhl | 19131
I.
Immer höher und höher schien sich der Himmel zu heben, immer weiter breitete sich die Morgenröte aus, immer weißer wurde der matte Silberschimmer des Taues, immer glanzloser die Mondsichel, immer vernehmlicher das leise Rauschen des Waldes … Die Menschen begannen, sich vom Lager zu erheben, und im herrschaftlichen Gestüt hörte man immer häufiger Schnauben, Herumstampfen im Stroh und sogar zorniges, kreischendes Wiehern der Pferde, die sich zusammendrängten und um etwas stritten.
„Na, na! Immer Geduld! Seid wohl hungrig geworden?“, sagte der alte Pferdehüter, indem er rasch das knarrende Tor öffnete. „Wohin?“, schrie er und scheuchte eine Stute, die sich durch das Tor drängen wollte, mit dem ausgestreckten Arme zurück.
Der Pferdehüter Nestor trug einen Kosakenrock und um den Leib einen ledernen, rot ausgenähten Gurt; die Peitsche hatte er um die Schulter geschlungen; am Gurt hatte er einen Beutel mit Brot hängen. In den Händen hielt er einen Sattel und einen Reitzaum.
Die Pferde waren über den spöttischen Ton des Pferdehüters ganz und gar nicht erschrocken, fühlten sich auch nicht dadurch gekränkt; es sah aus, als ob sie sich gar nichts daraus machten, und sie gingen ruhig von dem Tore weg. Nur eine alte, dunkelbraune, langmähnige Stute legte das eine Ohr an und drehte sich schnell mit dem Hinterteil herum. In diesem Augenblicke kreischte eine junge Stute, die ganz hinten stand, und die das Ganze gar nichts anging, laut auf und schlug mit den Hinterfüßen gegen das erste beste Pferd, das in ihrer Nähe war, aus.
„Na, na!“, schrie der Pferdehüter noch lauter und drohender und begab sich in eine Ecke des Hofes.
Von allen Pferden, die sich auf dem Hofe befanden (es mochten ihrer etwa hundert sein), zeigte die geringste Ungeduld ein scheckiger Wallach, der allein für sich da in der Ecke unter dem Vordach eines Schuppens stand und, die Augen halb zukneifend, an einem eichenen Pfosten des Schuppens leckte.
Es war schwer zu sagen, welchen Genuß der scheckige Wallach daran fand; aber er machte, während er das tat, eine ernste, nachdenkliche Miene.
„Was machst du da für Dummheit!“, rief ihm der herantretende Pferdehüter in demselben Tone zu; dann legte er den Sattel und die fettglänzende Schweißdecke neben ihn auf einen Düngerhaufen.
Der scheckige Wallach hörte auf zu lecken und sah, ohne sich zu regen, den Pferdehüter lange an. Er lachte nicht, er wurde nicht zornig, er machte keine finstere Miene; sondern er schüttelte sich nur mit dem ganzen Leibe und wandte sich mit einem schweren, tiefen Seufzer ab. Der Pferdehüter faßte ihn um den Hals und legte ihm den Reitzaum an.
„Was hast du denn zu seufzen?“, sagte Nestor.
Der Wallach schwenkte den Schweif, als wollte er sagen: „Ach, ich habe das bloß so in Gedanken getan; etwas Besonderes habe ich nicht, Nestor!“ Nestor legte ihm die Schweißdecke und den Sattel auf, wobei der Wallach die Ohren an den Kopf legte, doch wohl um sein Mißvergnügen auszudrücken; aber er wurde dafür nur „Du Aas!“ geschimpft, und der Untergurt wurde festgezogen.
Dabei blies der Wallach sich auf; aber Nestor steckte ihm einen Finger in das Maul und stieß ihn mit dem Knie gegen den Bauch, so daß er ausatmen mußte. Trotzdem legte er, als dann Nestor den Obergurt mit den Zähnen anzog, noch einmal die Ohren zurück und sah sich sogar um. Obgleich er wußte, daß ihm das nichts half, hielt er es doch für notwendig, zum Ausdruck zu bringen, daß ihm das unangenehm sei und daß er es sich nicht nehmen lasse, das zu zeigen. Als er gesattelt war, setzte er den geschwollenen rechten Vorderfuß seitwärts heraus und begann am Gebiß zu kauen, auch wieder mit irgendeinem besonderen Hintergedanken; denn daß das Gebiß keinen Geschmack habe, mußte er schon lange wissen.
Nestor stieg mittels des kurzen Steigbügels auf den Wallach, wickelte die Peitsche los, zog seinen Rock unter dem Knie hervor, setzte sich auf dem Sattel in der besonderen Art der Kutscher, Jäger und Pferdehüter zurecht und zog die Zügel an. Der Wallach hob den Kopf in die Höhe und bekundete damit seine Bereitwilligkeit, zu gehen, wohin es ihm befohlen würde, rührte sich aber nicht vom Fleck. Er wußte, daß, ehe es losging, sein Reiter noch ein großes Geschrei vollführen und dem anderen Pferdehüter Waska und den Pferden noch allerlei Weisungen erteilen werde. Und wirklich begann Nestor zu schreien: „Waska! He, Waska! Hast du auch die Mutterstuten herausgelassen? Wohin gehst du denn, verfluchter Kerl? Hoho! Du schläfst wohl … Mach das Tor auf! Laß die Mutterstuten vorangehen“, usw.
Das Tor knarrte. Verdrossen und schläfrig stand Waska, ein Pferd am Zügel haltend, beim Pfosten und ließ die Pferde hinaus. Die Pferde, behutsam durch das Stroh schreitend und daran schnuppernd, gingen nacheinander hinaus: junge Stuten, jährige Hengste mit kurzgeschnittenen Mähnen, Saugfohlen und schwerfällige Mutterstuten, diese einzeln und vorsichtig ihre Leiber durch das Tor hindurchtragend. Die jungen Stuten drängten sich mitunter zu zweien und dreien zusammen, legten eins der anderen den Kopf auf den Rücken und beschleunigten ihren Gang im Tore, wofür sie jedesmal von den Pferdehütern mit Schimpfworten bedacht wurden. Die Saugfohlen liefen manchmal zu den Beinen fremder Mutterstuten hin und wieherten hell auf als Antwort auf den kurzen Lockruf ihrer Mütter.
Eine junge übermütige Stute bog, sobald sie das Tor passiert hatte, den Kopf nach unten und zur Seite, sprang mit dem Hinterteil in die Höhe und kreischte auf; aber sie wagte doch nicht, der alten grauen Fliegenschimmelstute Schuldüba vorzulaufen, die mit ruhigem, schwerfälligem Schritt, den Bauch nach rechts und nach links schaukelnd, würdevoll wie immer allen Pferden voranging.
Nach einigen Minuten lag der vorher so belebte Hof traurig verödet da. Trübselig ragten die Pfosten unter dem leeren Vordach auf, und es war nur zertretenes, mit Mist untermengtes Stroh zu sehen. Wenn auch diese Verödung dem scheckigen Wallach ein längst gewohntes Bild war, so schien sie ihn doch traurig zu stimmen. Langsam, als ob er Verbeugungen machte, senkte und hob er den Kopf, seufzte, soweit es ihm der fest angezogene Sattelgurt erlaubte, und wanderte hinkend mit seinen krummen Beinen, die gar nicht auseinandergehen wollten, hinter der Herde her, indem er den alten Nestor auf seinem knochigen Rücken trug.
„Ich weiß schon: sobald wir auf die Landstraße hinauskommen, wird er Feuer schlagen und sein hölzernes Pfeifchen mit dem Kupferbeschlag und dem Kettchen anzünden“, dachte der Wallach. „Ich freue mich darüber, weil früh morgens, wenn alles betaut ist, dieser Geruch mir zusagt und mancherlei angenehme Erinnerungen bei mir wachruft. Verdrießlich ist nur, daß der Alte, sobald er die Pfeife zwischen den Zähnen hat, in allerlei wunderliche Phantasien über sich selbst hineingerät, sich wie ein Held vorkommt und sich schief setzt, unbedingt schief; und gerade auf der Seite, wo er sich hinsetzt, tut es mir weh. Aber mag er es meinetwegen tun; es ist mir nichts Neues, um des Vergnügens anderer willen zu leiden; ich finde sogar schon eine Art von Pferdevergnügen darin. Mag er sich ein Held dünken, der arme Kerl! Er spielt ja die Rolle des Tapferen nur sich selber vor, wenn ihn niemand sieht; meinetwegen mag er auch schief sitzen!“ So reflektierte der Wallach und trottete, vorsichtig mit den krummen Beinen auftretend, in der Mitte der Landstraße dahin.
II.
Nachdem Nestor die Herde zum Fluß getrieben hatte, an welchem die Pferde weiden sollten, stieg er von dem Wallach herunter und nahm ihm den Sattel ab. Unterdessen fing die Herde schon an, sich langsam über die noch nicht zertretene Wiese zu verteilen, die mit Tau bedeckt und von dem Dunst überzogen war, der sowohl von ihr wie von dem sie zum Teil umgebenden Fluß aufstieg.
Nestor nahm dem scheckigen Wallach den Zaum ab und kratzte das Tier unter dem Hals; als Antwort darauf schloß der Wallach zum Zeichen der Dankbarkeit und des Vergnügens die Augen. „Das hat er gern, der alte Hund!“, sagte Nestor. Indessen liebte der Wallach dieses Kratzen ganz und gar nicht und tat nur aus Zartgefühl so, als ob es ihm angenehm sei. Er schüttelte ein wenig mit dem Kopf, um sein Einverständnis auszudrücken. Aber plötzlich, ganz unerwartet und ohne jede Ursache, stieß Nestor, vielleicht in der Annahme, eine allzu große Familiarität könne den scheckigen Wallach zu falschen Vorstellungen von seinem Wert bringen, ohne jede Vorbereitung den Kopf des Wallachs von sich, holte mit dem Zügel aus und schlug den Wallach mit der Schnalle des Zügels sehr schmerzhaft gegen das magere Bein. Dann ging er, ohne ein Wort zu sagen, die Anhöhe hinan zu dem Baumstumpf, bei dem er zu sitzen pflegte.
Obgleich diese Behandlung den scheckigen Wallach kränkte, ließ er es sich doch nicht merken und ging, indem er langsam den dünnhaarigen Schweif hin und her schwenkte, ab und zu an etwas schnupperte und, nur um sich zu zerstreuen, hier und da etwas Gras abrupfte, zum Flusse hin. Er blickte mit keinem Auge danach hin, was um ihn her die jungen Stuten, die jährigen Hengste und die Füllen in ihrer Freude über den schönen Morgen anstellten, und da er wußte, daß es, namentlich in seinem Alter, das gesündeste sei, zuerst auf nüchternen Magen einen tüchtigen Schluck zu trinken und dann erst zu fressen, so suchte er sich am Ufer einen geräumigen, sanft abgedachten Platz, trat so weit in den Fluß, daß er sich die Hufe und das Kötenhaar benetzte, steckte sein Maul in das Wasser und begann, es mit seinen zerrissenen Lippen einzusaugen, die sich allmählich füllenden Seiten sachte zu bewegen und mit der kahlen Rübe des dünnen, scheckigen Schweifes zu wedeln.
Eine braune, mutwillige Stute, die den Alten immer hänselte und ihm allerlei Schabernack spielte, kam auch hier beim Wasser zu ihm heran, als ob sie gleichfalls trinken wollte, in Wirklichkeit aber nur, um ihm das Wasser vor seiner Nase zu trüben. Aber der Schecke hatte sich schon satt getrunken und zog, wie wenn er die Absicht der braunen Stute gar nicht bemerkte, seine Beine, die tief in den weichen Boden eingesunken waren, ruhig eines nach dem anderen heraus, schüttelte mit dem Kopfe, ging ein wenig abseits von der Jugend und machte sich daran, zu fressen. Indem er die Beine auf mannigfache Weise auseinanderspreizte und es so vermied, unnötig viel Gras zu zertreten, fraß er, fast ohne jemals den Kopf in die Höhe zu heben, drei volle Stunden lang. Nachdem er sich so vollgefressen hatte, daß ihm der Bauch wie ein Sack von den mageren, derben Rippen herunterhing, stellte er sich gleichmäßig auf alle seine vier kranken Beine, um möglichst wenig Schmerz zu haben, besonders im rechten Vorderfuß, der der schwächste von allen war. Dann schlief er ein.
Es gibt ein würdevolles Greisenalter, es gibt ein häßliches und es gibt ein klägliches Greisenalter. Mitunter kommt es auch vor, daß ein Greisenalter häßlich und würdevoll zugleich ist. Das Greisenalter des scheckigen Wallachs war gerade von dieser Art.
Der Wallach war von hohem Wuchs, nicht kleiner als zwei Arschin drei Werschok. Von Farbe war er schwarzscheckig; oder vielmehr er war einstmals so gewesen; aber jetzt waren die schwarzen Flecke schmutzigbraun geworden. Solcher dunklen Flecke hatte er drei: der eine war am Kopf mit einer schiefen Blesse an der Seite der Nase, und reichte bis zur Mitte des Halses. Die lange Mähne, die ganz voll Kletten saß, war an manchen Stellen weiß, an anderen braun. Der zweite Fleck zog sich an der rechten Seite hin bis zur Mitte des Bauches; der dritte befand sich auf der Kruppe, umfaßte noch den oberen Teil des Schwanzes und reichte bis zur Mitte der Schenkel. Der übrige Teil des Schwanzes war weißlichbunt. Der große, knochige Kopf mit den tiefen Einsenkungen über den Augen und der herabhängenden, bei irgendeinem Anlaß eingerissenen schwarzen Unterlippe hing schwer und tief an dem vor Magerkeit krummen, wie von Holz aussehenden Hals zum Boden hinunter. Hinter der herabhängenden Lippe wurden die seitlich zwischen die Zähne geklemmte, schwärzliche Zunge und die gelben Reste der durch das Kauen fast ganz zerstörten Unterzähne sichtbar. Die Ohren, von denen das eine zerschnitten war, hingen tief nach den Seiten herab und bewegten sich nur von Zeit zu Zeit lässig, um die zudringlichen Fliegen zu verscheuchen. Ein langer Büschel Schopfhaar hing hinter dem einen Ohr herab; die unbedeckte Stirn war eingesunken und rauh; an den breiten Unterkiefern hing die Haut beutelförmig herunter. Am Hals und am Kopf schlangen sich die Adern in Knoten zusammen, die bei jeder Berührung durch eine Fliege zuckten und zitterten. Das Gesicht trug den Ausdruck ernster Geduld, tiefen Nachdenkens und schmerzlichen Leidens. Seine Vorderfüße waren an den Knien bogenförmig gekrümmt; an beiden Hufen waren Geschwülste; und an dem einen Vorderbein, an welchem der farbige Fleck bis zur Mitte herabreichte, befand sich beim Knie eine faustgroße Beule. Die Hinterbeine waren etwas weniger defekt, aber an den Schenkeln, offenbar schon seit langer Zeit, abgescheuert, und Haar wuchs an diesen Stellen nicht mehr nach. Alle Beine erschienen bei der Magerkeit der ganzen Gestalt unverhältnismäßig lang. Die Rippen waren zwar derb und kräftig, lagen aber offen sichtbar da und waren so straff von der Haut überspannt, daß es aussah, als sei diese in den Vertiefungen zwischen ihnen angetrocknet. Widerrist und Rücken waren ganz übersät mit den Spuren alter Hiebe, und hinten war noch eine frische geschwollene Stelle, die sich zwar schon mit einem Schorfe überzog, aber noch eiterte; die schwarze Rübe des Schwanzes mit den deutlich erkennbaren Wirbeln ragte lang und beinah kahl hervor. Auf der braunen Kruppe, nicht weit vom Schwanz, befand sich eine mit weißen Haaren bewachsene handgroße Wunde, die anscheinend von einem Biß herrührte. Eine andere, schon vernarbte Wunde war vorn am Schulterblatt sichtbar. Die Hinterbeine und der Schweif waren infolge der steten Magenverstimmung unsauber. So kurz das Haar des Felles war, so stand es doch am ganzen Körper struppig in die Höhe.
Aber trotz des abschreckenden Aussehens, welches das Greisenalter diesem Pferde verliehen hatte, konnte man, wenn man es betrachtete, unwillkürlich nachdenklich werden, und ein Kenner hätte sofort gesagt, das müsse seinerzeit ein auffallend schönes Pferd gewesen sein. Ein Kenner hätte sogar gesagt, daß es in Rußland nur einen Schlag gebe, der ein so breites Knochengerüst aufweisen könne und so gewaltige Schenkelknochen und solche Hufe und so schlanke Beine und eine solche Aufsetzung des Halses und vor allen Dingen eine solche Schädelbildung und so große, schwarze, leuchtende Augen und so rassige Aderklümpchen an Kopf und Hals und eine so feine Haut und eine so feine Behaarung.
In der Tat, es lag etwas Würdevolles in der Gestalt dieses Pferdes und in dieser furchtbaren Vereinigung einerseits der abstoßenden Merkmale der Gebrechlichkeit, deren Eindruck durch die Buntscheckigkeit des Felles noch erhöht wurde, und andererseits seiner Gebärden und Manieren und des Ausdrucks von Selbstvertrauen und ruhigem Bewußtsein der eigenen Schönheit und Kraft.
Wie eine lebende Ruine stand das Tier einsam mitten auf der tauigen Wiese, und unweit von ihm erscholl das Stampfen, das Schnauben und das jugendfrohe Wiehern und Kreischen der weit zerstreuten Herde.
III.
Schon stieg die Sonne über den Wald empor, und ihre Strahlen blitzten hell auf dem Grase und auf der Oberfläche des sich krümmenden Flusses. Der Tau trocknete und sammelte sich in Tropfen; wie leichter Rauch verschwand der letzte Morgennebel. Krause Wölkchen erschienen am Himmel; aber es ging noch kein Wind. Jenseits des Flusses stand dicht und straff grüner Roggen, der bereits Ähren ansetzte, und es roch nach frischem Grün und Blumen. Aus dem Walde rief der Kuckuck, mitunter dazwischen heiser krächzend, und Nestor zählte, lang auf dem Rücken liegend, wie viele Jahre er noch leben werde. Die Lerchen erhoben sich über dem Roggenfeld und über der Wiese in die Luft. Ein Hase, der sich verspätet hatte, war zwischen die Pferdeherde geraten, rettete sich in großen Sprüngen ins Freie, setzte sich bei einem Busch hin und horchte. Waska schlief, den Kopf mit dem Gesicht ins Gras gedrückt; die jungen Stuten zogen sich ringsumher noch weiter von ihm fort und zerstreuten sich in der Niederung; auch die älteren Stuten schritten weiter, ab und zu schnaubend und eine helle Spur im Tau hinter sich lassend, und wählten sich immer solche Stellen aus, wo sie niemand stören konnte; aber sie weideten nicht mehr, sie fraßen nur zum Vergnügen manchmal ein paar schmackhafte Halme. Die ganze Herde bewegte sich unmerklich nach einer Richtung hin.
Wieder war es die alte Schuldüba, welche, würdevoll den anderen voranschreitend, ihnen klarmachte, daß man weiter weggehen könne. Die junge Rappstute Muschka, die zum erstenmal gefohlt hatte, wieherte beständig, hob den Schweif und schnob ihrem lilafarbenen Füllen zu; die junge Atlasnaja, mit dem glatten, glänzenden Fell, senkte den Kopf so tief herab, daß der schwarze, seidige Haarschopf ihr die Stirn und die Augen bedeckte, spielte mit dem Gras, indem sie Hälmchen ausriß und wieder fallen ließ, und stampfte mit dem taufeuchten Fuß auf, an dem das Kötenhaar einen dichten Büschel bildete. Eines der älteren Saugfohlen mochte sich wohl ein neues Spiel ersonnen haben: Das kurze, krause Schwänzchen wie einen Helmbusch aufrichtend, jagte es schon zum sechsundzwanzigsten Male im Kreis um seine Mutter herum, welche den Charakter ihres Sohnes schon hinreichend zu kennen schien, ruhig das Gras abrupfte und nur ab und zu mit dem großen schwarzen Auge von der Seite nach dem Fohlen hinblickte.
Eines der kleinsten Saugfohlen, ein schwarzes, dickköpfiges Tierchen, mit einem wie verwundert zwischen den Ohren aufstarrenden Haarschopf und einem kurzen Schwänzchen, das sich noch nach der Seite krümmte, nach der es im Mutterleib gekrümmt gewesen war, richtete die Ohren auf und schaute, ohne sich von der Stelle zu rühren, mit stumpfblickenden Augen unverwandt nach einem anderen Fohlen hin, welches immer einen Sprung machte und dann wieder rückwärts ging; es blieb unklar, ob das zuschauende Tierchen von Neid erfüllt war oder sich überlegte, warum sich das andere wohl so benehme. Einige Fohlen sogen, die Mäuler unter die Mütter schiebend; andere liefen, aus unerfindlichem Grund, trotz aller Zurufe der Muttertiere, in kleinem, ungeschicktem Trab geradeswegs von diesen fort, als ob sie etwas suchen wollten, und blieben dann, wieder aus nicht erkennbarer Ursache, stehen und stießen ein lautes, verzweifeltes Gewieher aus; andere lagen, in einer Reihe hingestreckt, auf der Seite da; andere lernten Gras fressen; andere kratzten sich mit einem Hinterfuß hinter dem Ohr. Zwei noch trächtige Stuten gingen abgesondert; langsam die Beine bewegend, fraßen sie immer noch. Es war nicht zu verkennen, daß ihr Zustand von den anderen respektiert wurde und keines von den jüngeren Tieren an sie heranzukommen und sie zu stören wagte. Und wenn ja eine übermütige Stute sich beikommen ließ, sich ihnen zu nähern, so genügte eine Bewegung des Ohres oder des Schweifes, um ihr die ganze Unziemlichkeit ihres Benehmens zum Bewußtsein zu bringen.
Die jährigen Hengste und die jährigen Stuten taten so, als wären sie schon ausgewachsene Tiere von gesetztem Charakter; nur selten erlaubten sie sich, ein paar Sprünge zu machen und sich an lustige Gesellschaft anzuschließen. Ihre Schwanenhälschen mit den geschorenen Mähnen hinabbiegend, fraßen sie mit Anstand ihr Gras und schwenkten, als ob sie auch schon Schweife hätten, mit ihren Pinselchen umher. Ganz wie die Großen legten sich manche nieder, wälzten sich oder kratzten einander. Die lustigste Gesellschaft bestand aus den zwei- und dreijährigen ledigen Stuten. Sie gingen fast alle in einem gesonderten Trupp, eine fröhliche Mädchenschar. Aus diesem Trupp hörte man Stampfen, Kreischen, Wiehern und Schnauben. Sie drängten sich zusammen, legten einander die Köpfe auf die Schultern, beschnupperten sich, sprangen in die Höhe und liefen manchmal mit erhobenem Schweif, halb im Trab, halb im Paßgang, stolz und kokett vor ihren Genossinnen her. Die schönste und zugleich die Rädelsführerin unter dieser ganzen Jugend war eine mutwillige braune Stute. Was sie angab, das machten die anderen nach; wo sie hinging, dahin folgte ihr der ganze Haufen der Schönen. Diese Übermütige war an diesem Morgen zu allerlei Spielen ganz besonders aufgelegt. Es war eine lustige Laune über sie gekommen, wie das ja auch bei Menschen vorkommt. Schon an der Tränke hatte sie den alten Wallach geneckt; dann lief sie am Wasser entlang, tat, als ob sie vor etwas erschrocken wäre, prustete und lief, so schnell ihre Beine sie tragen konnten, ins Feld hinaus, so daß Waska ihr und den anderen, die sich ihr angeschlossen hatten, nachgaloppieren mußte. Nachdem sie dann ein bißchen gefressen hatte, fing sie an, sich umherzuwälzen; darauf foppte sie die alten Stuten dadurch, daß sie vor ihnen herging; dann trieb sie ein Füllen beiseite und lief hinter ihm her, als ob sie es beißen wollte. Die Mutter erschrak und hörte auf zu fressen; das Füllen schrie mit kläglicher Stimme; aber die übermütige Stute rührte es überhaupt nicht an; sie hatte es nur erschrecken und ihren Genossinnen, die mit großem Interesse ihre Schelmenstreiche als Zuschauerinnen verfolgten, ein Schauspiel darbieten wollen. Dann kam sie auf den Einfall, einem kleinen Grauschimmel in der Ferne, jenseits des Flusses bei dem Roggenfeld, den Kopf zu verdrehen; auf diesem Pferdchen ritt dort ein Bauer; der Pflug schleifte hinterher. Sie stellte sich in stolzer Haltung, ein wenig zur Seite gewendet, hin, hob den Kopf in die Höhe, schüttelte sich und ließ ein süßes, zärtliches, langgedehntes Wiehern erschallen. Mutwille und tiefe Empfindung und eine gewisse Traurigkeit kamen in diesem Wiehern zum Ausdruck. Auch Sehnsucht und Liebesverheißung und Liebeskummer lagen darin.
Dort rief im dichten Schilf, von einer Stelle zur anderen laufend, leidenschaftlich ein Wachtelkönig seine Gefährtin zu sich: dort ließen der Kuckuck und die Wachtel ihren Liebesruf erklingen und die Blumen sandten durch den Wind ihren duftenden Blütenstaub einander zu.
„Auch ich bin jung und schön und stark“, sagte das Wiehern der übermütigen Stute. „Aber es ist mir bisher nicht vergönnt gewesen, die Süßigkeit jenes Gefühles zu kosten, ja, es hat mich überhaupt noch kein Liebhaber gesehen, wahrhaftig noch kein einziger.“
Und das vielsagende Gewieher klang voll jugendlicher Sehnsucht über die Niederung und das Feld dahin und gelangte aus der Ferne zu dem grauen Pferdchen. Dieses lichtete die Ohren auf und blieb stehen. Der Bauer versetzte ihm einen Stoß mit seinem in einem Bastschuh steckenden Fuße; aber der Grauschimmel war wie bezaubert von dem silberhellen Klang des fernen Wieherns und wieherte zur Antwort gleichfalls. Der Bauer wurde zornig, riß ihn an den Zügeln und stieß ihn mit dem Fuß so heftig gegen den Bauch, daß er sein Gewieher nicht zu Ende bringen konnte und weiterging. Aber dem Grauschimmel war gar süß und sehnsuchtsvoll zumute geworden, und noch lange drangen von den fernen Roggenfeldern die Töne eines ansetzenden leidenschaftlichen Wieherns und dann die zornigen Schimpfworte des Bauern zu der Pferdeherde herüber.
Wenn schon von dem bloßen Klang dieser Stimme der Grauschimmel sich so hingerissen fühlte, daß er seine Pflicht vergaß, was wäre dann erst mit ihm geschehen, wenn er die mutwillige Schöne in ihrer ganzen Gestalt gesehen hätte, wie sie die Ohren spitzte, die Nüstern aufblähte, die Luft einzog und, von unbestimmter Begierde getrieben und an dem ganzen jungen, schönen Leibe zitternd, nach ihm rief?
Aber die Übermütige dachte nicht lange über den Eindruck nach, den sie hervorgerufen hatte. Als die Stimme des Grauschimmels verstummt war, wieherte sie noch einmal spöttisch, bog den Kopf herunter, grub mit einem Fuß in der Erde und ging dann hin, um den scheckigen Wallach aufzuwecken und zu foppen. Der scheckige Wallach war stets das arme Opfer, das von diesen glücklichen jungen Tieren gehänselt und gepeinigt wurde. Er hatte von diesen jungen Tieren mehr zu leiden als von den Menschen. Er selbst tat weder den einen noch den anderen Übles. Die Menschen bedienten sich seiner und mißhandelten ihn bei diesem Anlaß; aber warum quälten ihn die jungen Pferde?
IV.
Er war alt, sie waren jung; er war mager, sie waren wohlgenährt; er war traurig, sie waren vergnügt. Folglich war er ein ganz fremdes, ganz andersartiges Wesen, und sie konnten mit ihm kein Mitleid haben. Die Pferde haben nur mit sich selbst Mitleid und außerdem nur noch mitunter mit denjenigen, in deren Haut sie sich mit Leichtigkeit hineindenken können. Aber es war doch nicht des scheckigen Wallachs eigene Schuld, daß er alt und dürr und mißgestaltet war. Man möchte meinen, daß es nicht seine eigene Schuld war; aber nach der Anschauung der Pferde war es allerdings seine eigene Schuld, und nach dieser Anschauung waren immer nur diejenigen im Recht, die stark, jung und glücklich waren, diejenigen, die noch das ganze Leben vor sich hatten, diejenigen, bei denen in übermütiger Anstrengung jeder Muskel zitterte und der Schweif sich steif in die Höhe hob. Vielleicht sah das auch der scheckige Wallach selbst ein und gab in ruhigen Augenblicken selbst zu, daß es seine eigene Schuld sei, wenn er sein Leben schon hinter sich hatte, und daß er nun dafür büßen müsse: aber er war doch bei alledem ein Pferd und konnte sich oft eines Gefühls der Kränkung, des Kummers und des Unwillens nicht erwehren, wenn er all dieses junge Volk ansah, das ihn sein Greisenalter so schwer entgelten ließ, obwohl es doch diesem selben Greisenalter gleichfalls am Ende des Lebens verfallen mußte. Ein weiterer Grund für die Mitleidslosigkeit der Pferde war auch ein gewisses aristokratisches Gefühl. Jedes von ihnen führte seinen Stammbaum väterlicherseits oder mütterlicherseits auf die berühmte Smetanka zurück; von dem Schecken aber wußte niemand, wo er herstammte; der Schecke war so ein Hergelaufener, der vor drei Jahren auf dem Jahrmarkt für achtzig Rubel Papier gekauft war.
Die braune Stute ging, als wenn sie nur so umherpromenierte, bis dicht an die Nase des scheckigen Wallachs und versetzte ihm dann einen Stoß. Er wußte schon, wie das gemeint war, und legte, ohne die Augen aufzumachen, die Ohren an den Kopf und fletschte die Zähne. Die Stute drehte ihm ihr Hinterteil zu und machte Miene, nach ihm zu schlagen. Er öffnete die Augen und ging weg nach einer anderen Stelle. Zum Schlafen hatte er keine Lust mehr; so begann er denn zu fressen. Wieder kam die übermütige Stute, von ihren Freundinnen begleitet, zu dem Wallach hin. Eine zweijährige Stute mit einer Blesse, ein sehr dummes Tier, das der Braunen alles nachmachte und in allen Stücken ihre folgsame Schülerin war, kam mit ihr zusammen heran und begann, wie das Nachahmer stets tun, das, was die Braune tat, noch zu überbieten. Die braune Stute pflegte heranzukommen, als ob sie nur mit sich selbst beschäftigt wäre, und bei dem Wallach dicht vor seiner Nase vorbeizugehen, ohne ihn anzusehn, so daß er wirklich nicht wußte, ob er zornig werden sollte oder nicht, und das wirkte dann in der Tat komisch.
So machte das die braune Stute auch jetzt; aber die Blesse, welche hinter ihr ging und besonders ausgelassen war, gab dem Wallach geradezu einen Stoß mit der Brust. Dieser fletschte wieder die Zähne, kreischte auf, stürzte mit einer Geschwindigkeit, die man ihm gar nicht zugetraut hätte hinter ihr her und biß sie in die Lende. Die Blesse schlug mit beiden Hinterfüßen aus und traf den Alten schwer auf die mageren, kahlen Rippen. Der Alte röchelte ordentlich vor Schmerz; er wollte sich noch einmal auf sie stürzen, dann aber bedachte er sich eines anderen, seufzte schwer auf und ging zur Seite.
Das ganze junge Volk der Herde schien die Dreistigkeit, die sich der scheckige Wallach gegen die Blesse herausgenommen hatte, als eine persönliche Beleidigung aufzufassen; sie ließen ihn den ganzen übrigen Tag absolut nicht mehr fressen und gönnten ihm keinen Augenblick der Ruhe, so daß der Pferdehüter mehrmals einschreiten mußte und gar nicht begreifen konnte, was ihnen eigentlich in den Kopf gekommen war.
Der Wallach war so niedergeschlagen, daß er von selbst zu Nestor hinging, als der Alte sich anschickte, die Herde wieder nach Hause zu treiben, und er fühlte sich glücklicher und ruhiger, als Nestor ihn sattelte und aufstieg.
Gott weiß, welche Gedanken den alten Wallach erfüllten, als er auf seinem Rücken den alten Nestor nach Hause trug – ob er voll Bitterkeit an das freche, grausame junge Volk dachte oder mit jenem verächtlichen, schweigsamen Stolz, wie er dem Alter eigen ist, seinen Beleidigern vergab; jedenfalls ließ er seine Empfindungen nicht kund werden, bis sie zu Hause waren.
An diesem Abend hatte Nestor Besuch von Gevattersleuten bekommen, und als er die Herde an den zum Gestüt gehörigen kleinen Wohnhäusern vorbeitrieb, bemerkte er einen Wagen mit einem Pferd, das vor seiner Haustür angebunden war. Nachdem er die Herde hineingetrieben hatte, hatte er es so eilig, daß er den Wallach, ohne ihm den Sattel abzunehmen, in den Hof ließ, seinem Kameraden Waska zurief, er solle ihn absatteln, das Tor zumachte und zu seinen Gevattersleuten ging. Ob nun deswegen, weil der Blesse, einer Urenkelin der berühmten Smetanka, von diesem „schäbigen Subjekt“, das auf dem Pferdemarkte gekauft war und weder Vater noch Mutter kannte, eine Beleidigung zugefügt und dadurch das aristokratische Empfinden des ganzen Gestütes verletzt war, oder weil der Wallach mit dem hohen Sattel ohne Reiter den Pferden ein seltsames, phantastisches Schauspiel bot – genug, es ereignete sich in dieser Nacht auf dem Pferdehof etwas Ungewöhnliches. Alle Pferde, junge und alte, liefen zähnefletschend hinter dem Wallach her und jagten ihn auf dem Hof herum. Man hörte das Dröhnen der Hufschläge gegen seine mageren Flanken und das schwere Ächzen des Getroffenen. Der Wallach konnte das nicht mehr ertragen und konnte den Hufschlägen nicht mehr ausweichen. Mitten im Hof blieb er stehen; auf seinem Gesicht malte sich in abstoßender Weise die kraftlose Wut des schwächlichen Greisenalters und dann die vollste Verzweiflung. Er legte die Ohren zurück, und plötzlich geschah etwas, was alle Pferde sofort veranlaßte, ihre Angriffe einzustellen. Die älteste Stute, namens Wjasopuricha, ging an den Wallach heran, beschnupperte ihn und seufzte. Der Wallach seufzte gleichfalls ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………...
V.
In der Mitte des hell vom Mond beleuchteten Hofes stand die hohe, hagere Gestalt des Wallachs mit dem hohen Sattel und dem emporstehenden Knopf am Sattelbogen. Regungslos und in tiefem Schweigen standen die Pferde um ihn herum, als ob sie etwas Neues, Ungewöhnliches aus seinem Munde erführen. Und sie erfuhren auch wirklich aus seinem Munde etwas Neues, Unerwartetes. Was er ihnen mitteilte, war folgendes ………………………………………….. ……………………………………………………………………………...
Die erste Nacht
„Ja, ich bin ein Sohn von Ljubesnü I. und Baba. Mein Name ist nach dem Stammbaum Muschik2 I. Ich heiße also Muschik I. nach dem Stammbaum, im gewöhnlichen Leben aber Leinwandmesser; diesen Beinamen haben mir die Leute wegen meines langen, weit ausholenden Schrittes gegeben, der in Rußland nicht seinesgleichen hatte. Was Abstammung anlangt, so gibt es in der Welt kein Pferd, das von edlerem Geblüte wäre. Ich hätte euch das nie gesagt. Wozu auch? Ihr hättet mich ja doch nie erkannt, wie mich auch Wjasopuricha, die doch mit mir zusammen in Chrenowo war, so lange nicht erkannt hatte und erst jetzt wiedererkannt hat. Auch jetzt würdet ihr mir nicht glauben, wenn mir nicht das Zeugnis dieser Wjasopuricha hier zur Seite stände. Ich hätte euch das niemals gesagt. Ich brauche kein Mitleid von den Pferden. Aber ihr habt es gewollt. Ja, ich bin jener Leinwandmesser, nach dessen Verbleib die Pferdekenner vergeblich forschen, jener Leinwandmesser, den der Graf selbst gekannt, aber aus dem Gestüt verwiesen hat, weil ich seinen Liebling Lebed überholt hatte ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………...
Als ich geboren wurde, wußte ich nicht, was das bedeutet: ein Schecke; ich meinte eben, ich sei ein Pferd. Die erste Bemerkung, die über mein Fell gemacht wurde, versetzte – darauf besinne ich mich noch sehr wohl – mich und meine Mutter in großes Erstaunen.
Ich wurde wahrscheinlich in der Nacht geboren; am Morgen stand ich, von meiner Mutter schon rein geleckt, bereits auf den Füßen. Ich erinnere mich, daß ich immer ein Verlangen nach etwas verspürte und daß mir alles höchst wunderbar und zugleich höchst selbstverständlich vorkam. Die Boxen lagen bei uns an einem langen warmen Korridor und hatten Gittertüren, durch die man alles sehen konnte.
Meine Mutter hielt mir das Euter hin; aber ich war noch so unerfahren, daß ich mit der Nase bald unter die Vorderbeine meiner Mutter, bald unter die Krippe stieß. Plötzlich blickte meine Muttersich nach der Gittertür um, trat mit einem Beine über mich fort und ging zur Seite. Der Knecht, der den Stalldienst hatte, sah durch das Gitter zu uns in die Box herein.
‚Ei, sieh da! Baba hat gefohlt!‘ sagte er und schob den Riegel zurück. Er kam herein, ging über das frische Stroh auf mich zu und faßte mich mit beiden Armen um. ‚Sieh mal, Taras!‘ rief er, ‚ein schnurriger Schecke, die reine Elster!‘
Ich riß mich von ihm los, stolperte und fiel auf die Knie nieder.
‚Ei, so ein kleines Teufelchen!‘ sagte er.
Meine Mutter wurde unruhig, machte aber keine Anstalten, mich zu schützen; sie seufzte nur schwer, sehr schwer und trat ein wenig zur Seite. Die Stallknechte kamen und besahen mich. Einer von ihnen lief hin, um es dem Stallmeister zu melden.
Alle lachten, sobald sie mein scheckiges Fell erblickten, und gaben mir allerlei sonderbare Benennungen. Der Sinn dieser Worte war nicht nur mir, sondern auch meiner Mutter unverständlich. Bisher war unter uns und allen meinen Verwandten kein einziger Schecke gewesen. Wir glaubten nicht, daß etwas Schlimmes dabei sei. Meinen Körperbau und meine Kraft lobten auch damals alle.
‚Sieh, was für ein flinkes Kerlchen‘, sagte einer der Stallknechte. ‚Man kann ihn kaum halten.‘
Nach einiger Zeit kam der Stallmeister; auch er wunderte sich über meine Farbe; er schien sogar darüber verdrießlich zu sein.
‚Von wem das kleine Scheusal das bloß hat?‘ sagte er. ‚Der Direktor wird ihn nun nicht im Gestüt behalten mögen. Ach, Baba, du hast mich schön angeführt‘, wandte er sich zu meiner Mutter. ‚Hättest du nur wenigstens einen Bleß zur Welt gebracht; aber einen ganz Scheckigen!‘
Meine Mutter antwortete nichts und seufzte nur wieder, wie immer in ähnlichen Fällen.
‚Von wem er das bloß hat?‘ fuhr er fort. ‚Wie ein Bauer sieht er aus! Im Gestüt können wir ihn nicht behalten; es ist eine wahre Schande! Aber von Gestalt ist er schön, sehr schön!‘ sagte er, und das sagten alle, die mich sahen.
Nach einigen Tagen kam auch der Gestütsdirektor selbst; er betrachtete mich, und wieder waren alle ganz entsetzt und schalten auf mich und auf meine Mutter wegen der Farbe meines Felles. ‚Aber von Gestalt ist er schön, sehr schön!‘ sagte jeder, der mich sah.
Bis zum Frühling wohnten wir Füllen alle im Stalle der Mutterstuten, aber gesondert, jedes bei seiner Mutter. Nur zu der Zeit, als schon der Schnee auf den Dächern der Stallungen von der Sonne zu schmelzen anfing, wurde ich mitunter mit meiner Mutter auf den geräumigen Hof hinausgelassen, der mit frischem Stroh belegt war. Dort lernte ich zum ersten Male alle meine Verwandten, nähere und entferntere, kennen. Dort sah ich, wie aus den verschiedenen Türen lauter damals hochberühmte Stuten mit ihren Füllen herauskamen. Da war die alte Hollandka, dann Muschka, eine Tochter von Smetanka, dann Krasnucha, ferner das Reitpferd Dobrochoticha, lauter Berühmtheiten jener Zeit; alle kamen sie da nebst ihren Füllen zusammen, gingen im Sonnenschein umher, wälzten sich auf dem frischen Stroh und beschnupperten einander ganz wie gewöhnliche Pferde. Den Anblick dieses Hofes, den die schönsten Stuten jener Zeit erfüllten, habe ich bis auf den heutigen Tag nicht vergessen können. Es wird euch sonderbar vorkommen, wenn ihr euch vorstellen und glauben sollt, daß ich einst jung und feurig war; und doch war es so. Da war auch diese selbe Wjasopuricha, die ihr hier seht, damals noch ein einjähriges Tierchen mit geschorener Mähne, ein liebes, lustiges, mutwilliges Pferdchen; aber – und das sage ich nicht etwa, um sie zu kränken – obgleich sie jetzt unter euch, was Geblüt anlangt, für eine Seltenheit gilt, gehörte sie damals zu den geringsten Pferden jener Zucht. Sie wird euch das selbst bestätigen.
Meine Buntscheckigkeit, die den Menschen so sehr mißfiel, gefiel dafür allen Pferden außerordentlich gut; alle umringten sie mich, bewunderten mich und spielten mit mir. Ich begann schon zu vergessen, was die Menschen über meine Buntscheckigkeit gesagt hatten, und mich glücklich zu fühlen. Aber bald lernte ich den ersten Kummer in meinem Leben kennen, und die Ursache dieses Kummers war meine Mutter. Als es schon zu tauen anfing, die Sperlinge unter den Vordächern zwitscherten und der Frühling sich immer stärker in der Luft spürbar machte, da begann meine Mutter, ihr Benehmen gegen mich zu ändern.
Ihr ganzes Wesen war wie umgewandelt; bald begann sie plötzlich ohne jeden Anlaß zu spielen und auf dem Hof herumzutollen, was zu ihrem gesetzten Alter ganz und gar nicht paßte; bald versank sie in Gedanken und wieherte dabei; bald biß sie die anderen Stuten und schlug mit den Hinterfüßen nach ihnen; bald beschnupperte sie mich und schnob unzufrieden; bald legte sie, wenn wir draußen im Sonnenschein waren, ihren Kopf über die Schulter ihrer Cousine Kuptschicha und kratzte ihr lange nachdenklich den Rücken; mich aber stieß sie vom Euter weg. Eines Tages kam der Stallmeister, ließ ihr ein Halfter anlegen, und dann wurde sie aus der Box hinausgeführt. Sie wieherte; ich rief ihr zu und wollte ihr nachstürzen; aber sie sah sich nicht einmal nach mir um. Der Stallknecht Taras ergriff mich mit beiden Armen in dem Augenblick, wo sich die Tür hinter meiner Mutter, die hinausgeführt wurde, schloß.
Ich riß mich los und warf den Stallknecht in das Stroh; aber die Tür war fest geschlossen, und ich hörte nur das sich immer weiter entfernende Wiehern meiner Mutter. Und in diesem Wiehern hörte ich nicht mehr einen Ruf nach mir, sondern ich merkte darin einen ganz anderen Ausdruck. Auf ihre Stimme antwortete in der Ferne eine mächtige andere Stimme, wie ich später erfuhr, die Stimme Dobrüs’ I., der, mit je einem Stallknecht rechts und links, zum Rendezvous mit meiner Mutter kam.
Ich erinnere mich nicht, wie Taras aus meiner Box hinauskam; mir war gar zu traurig zumute, denn ich fühlte, daß ich die Liebe meiner Mutter für immer verloren hatte. ‚Und alles nur deswegen, weil ich ein Schecke bin‘, dachte ich in Erinnerung an das, was die Menschen über mein Fell gesagt hatten, und es packte mich eine solche Wut, daß ich mit Kopf und Knien gegen die Wände der Box zu stoßen anfing und dies so lange fortsetzte, bis ich in Schweiß wie gebadet war und vor Erschöpfung aufhören mußte.
Nach einiger Zeit kehrte meine Mutter zu mir zurück. Ich hörte, wie sie in einem mir ungewöhnlich klingenden Trabe auf dem Korridor zu unserer Box gelaufen kam. Man öffnete ihr die Tür, und ich erkannte sie gar nicht wieder, so viel jünger und schöner war sie geworden. Sie beschnupperte mich, schnob und stieß ein lachendes Gewieher aus. An ihrem gesamten Ausdruck sah ich, daß sie mich nicht mehr liebte.
Sie erzählte mir von Dobrüs’ Schönheit und von ihrer Liebe zu ihm. Diese Zusammenkünfte dauerten fort, und das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter wurde immer kälter.
Bald darauf ließ man uns auf die Weide hinaus. Von diesem Zeitpunkt an lernte ich neue Freuden kennen, welche mir den Verlust der Liebe meiner Mutter ersetzten. Ich hatte Freunde und Kameraden. Wir lernten zusammen Gras fressen, ebenso wiehern wie die Großen und mit emporgehobenen Schweifen um unsere Mütter herumgaloppieren. Das war eine glückliche Zeit. Alles war mir gestattet; alle liebten mich, bewunderten mich und betrachteten alles, was ich tat, mit wohlwollender Nachsicht. Aber das dauerte nicht lange. Nach kurzer Zeit widerfuhr mir etwas Entsetzliches.“
Der Wallach stieß einen tiefen, schweren Seufzer aus und ging von den anderen Pferden weg.
Die Morgenröte war schon längst am Himmel erschienen. Das Tor knarrte. Nestor kam herein. Die Pferde gingen auseinander. Der Pferdehüter brachte den Sattel des Wallachs in Ordnung und trieb die Herde hinaus.
VI.
Die zweite Nacht
Sobald die Pferde am Abend in den Hof getrieben waren, drängten sie sich wieder um den Schecken.
„Im August trennte man mich von meiner Mutter“, fuhr der Schecke fort, „und ich empfand darüber keinen sonderlichen Kummer. Ich sah, daß meine Mutter schon einen jüngeren Bruder trug, den berühmten Usan, und ich war nicht mehr derselbe, der ich früher gewesen war. Ich war nicht eifersüchtig; aber ich fühlte, daß ich kühler gegen sie geworden war. Außerdem wußte ich, daß ich nach der Trennung von der Mutter in die allgemeine Füllenabteilung kam, wo wir zu zweien und dreien zusammen standen und täglich unsere ganze junge Schar ins Freie hinausgelassen wurde. Ich stand in einer Box mit Milü. Milü ist ein Reitpferd geworden, und es hat ihn später der Kaiser geritten, und er ist auf Gemälden und in Statuen dargestellt worden. Damals war er noch ein einfaches Füllen, mit glänzendem, zartem Fell, einem Schwanenhals und schnurgeraden, feinen Beinen. Er war immer vergnügt, gutmütig und liebenswürdig, immer bereit zu spielen, sich mit einem anderen zu belecken und mit einem anderen Pferd oder einem Menschen sein Späßchen zu treiben. Unwillkürlich befreundeten wir uns miteinander, da wir zusammen wohnten, und diese Freundschaft hat während unserer ganzen Jugendzeit fortgedauert. Er war lustig und leichtsinnig. Er fing schon damals an zu lieben, schäkerte mit den Stuten und lachte mich wegen meiner Unschuld aus. Und zu meinem Unglück begann ich, es ihm aus Ehrgeiz nachzumachen, und war sehr bald ganz toll verliebt. Und diese meine frühe Neigung wurde die Ursache zu der größten Veränderung meines Schicksals. Es kam manchmal vor, daß ich mich vor Liebe gar nicht zu fassen wußte … Wjasopuricha war ein Jahr älter als ich; wir waren miteinander sehr gut befreundet; aber gegen Ende des Herbstes bemerkte ich, daß sie anfing, mir auszuweichen …
Aber ich will nicht diese ganze unglückliche Geschichte meiner ersten Liebe erzählen; Wjasopuricha selbst wird sich erinnern, in welcher sinnlosen Weise ich mich von meiner Leidenschaft hinreißen ließ und wie dies mit der wichtigsten Veränderung in meinem Leben endete.
Die Pferdehüter stürzten herbei, um sie fortzujagen und mich zu schlagen. Am Abend wurde ich in eine besondere Box gebracht; ich wieherte die ganze Nacht hindurch, wie in einer Vorahnung dessen, was mir der folgende Tag bringen sollte.