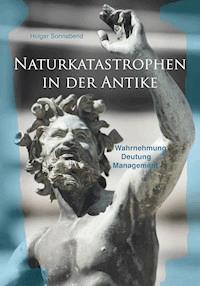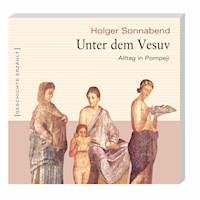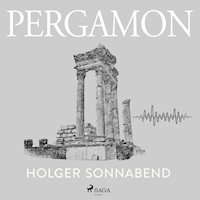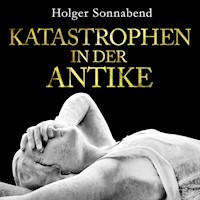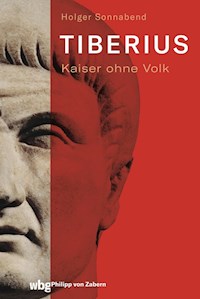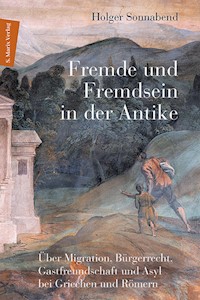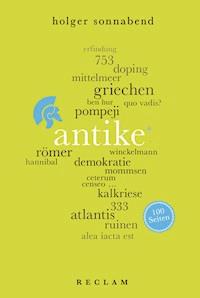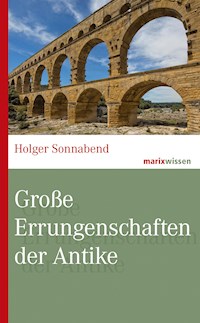
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Von Thales bis zu Frontinus: Das Buch stellt 21 Pioniere der Antike vor, die auf dem Gebiet von Naturwissenschaften und Technik Bahnbrechendes und Zukunftsweisendes leisteten. Anschaulich und verständlich werden den Lesern die wichtigsten Innovationen der Antike präsentiert, von der Mathematik über die Stadtplanung, die Medizin, die Verkehrsplanung und die Automatenherstellung bis hin zum Wasserbau. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich über das naturwissenschaftliche und technische Knowhow der Antike informieren und dabei jene klugen Köpfe kennenlernen wollen, die bis heute fortwirkende Entwicklungen angestoßen haben. Dabei geht es nicht nur um die Erfinder und die Erfindungen an sich. Es werden auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt, die diese Innovationen überhaupt erst möglich machten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Holger Sonnabend
Große Errungenschaften der Antike
Von Caesars Verkehrsplanung bis Demokrits Atomforschung
INHALT
Einführung
Mathematik: THALES (um 625–547 v. Chr.)
Tunnelbau: EUPALINOS (6. Jh. v. Chr.)
Brückenbau: DAREIOS (bis 486 v. Chr.)
Kanalbau: XERXES (bis 465 v. Chr.)
Stadtplanung: HIPPODAMOS (5. Jh. v. Chr.)
Atomforschung: DEMOKRIT (um 460–370 v. Chr.)
Medizin: HIPPOKRATES (um 460–370 v. Chr.)
Kriegswesen: EPAMINONDAS (bis 362 v. Chr.)
Meteorologie: ARISTOTELES (384–322 v. Chr.)
Straßenbau: APPIUS CLAUDIUS CAECUS (um 300 v. Chr.)
Signaltechnik: SOSTRATOS (3. Jh. v. Chr.)
Physik: ARCHIMEDES (um 287–212 v. Chr.)
Geographie: ERATOSTHENES (um 284–202 v. Chr.)
Landwirtschaft: CATO (234–149 v. Chr.)
Toxikologie: ATTALOS III. VON PERGAMON (171–133 v. Chr.)
Heiztechnik: GAIUS SERGIUS ORATA (1. Jh. v. Chr.)
Verkehrsplanung: IULIUS CAESAR (100–44 v. Chr.)
Feuerwehr: AUGUSTUS (63 v. Chr. – 14 n. Chr.)
Erdbebenforschung: SENECA (um 4 v. Chr. – 65 n. Chr.)
Automatenherstellung: HERON (1. Jh. n. Chr.)
Wasserbau: FRONTINUS (1./2. Jh. n. Chr.)
Literaturhinweise
EINFÜHRUNG
Eine der nachteiligen Eigenschaften der Antike scheint zu sein, dass sie schon so lange her ist. Insofern haftet ihr nicht ganz zu Unrecht das Etikett an, alt zu sein, und mit jedem neuen Tag wird sie auch wieder etwas älter. Alt (und sogar sehr alt) ist die Antike jedoch nur aus unserer heutigen, modernen Perspektive. Folgt man dem zeitlichen Verlauf der Geschichte, dann steht die Antike ganz am Anfang und ist insofern neu. Viel Geschichte hat die Antike jedenfalls nicht vor sich gehabt, und daher hatte sie auch die einzigartige und so nicht mehr wiederholbare Chance, auf vielen Gebieten Neuland zu betreten. Und diese Chance hat sie auch bestens genutzt.
Gerne und häufig verweist man auf die Leistungen von Griechen und Römern in Politik, Kunst, Literatur und Philosophie. Anders sieht es bei den Naturwissenschaften, bei der Technik und der Wirtschaft aus. Hier konstatiert man genauso gern und genauso häufig ein beträchtliches Defizit. Am deutlichsten zeigt sich dies an dem (manchmal etwas gönnerhaften) Erstaunen, mit dem man registriert, was die Antike an Errungenschaften und Leistungen auf diesen Feldern aufzuweisen hat – als ob man ihr so etwas gar nicht zugetraut hätte.
Das vorliegende Buch will aber nicht ins andere Extrem verfallen und die antiken Menschen zu naturwissenschaftlichen und technischen Heroen stilisieren. Vielmehr ist zu zeigen, was man aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gemacht hat. Erfindungen und Innovationen fallen nicht vom Himmel, und nur selten sind sie das Resultat ingeniöser Eingebungen großer Geister. Es bedarf dazu eines kreativen Gesamtklimas, der richtigen Zeit und des richtigen Ortes. Und häufig bedurfte es, in der Antike genauso wie in späteren Epochen der Geschichte, eines langwierigen Prozesses des Arbeitens, des Probierens und des Experimentierens, an dem viele kluge Geister beteiligt waren, bis der Durchbruch gelang und endlich das innovative Produkt vorlag.
Gewürdigt werden in diesem Buch die Leistungen und Errungenschaften der Perser, der Griechen und der Römer. Das hat den einfachen Grund, dass wir aufgrund vieler, vor allem auch schriftlicher Zeugnisse und Quellen, über deren Aktivitäten besonders gut im Bilde sind. Aber Perser, Griechen und Römer konnten schon auf den Innovationen des Alten Orients, insbesondere in Ägypten und Mesopotamien, aufbauen. Schließlich waren die Ägypter in der Lage, Wunderwerke wie die Pyramiden zu bauen, obwohl man heute immer noch nicht so genau weiß, wie sie das eigentlich angestellt haben. Und die Mesopotamier haben beispielsweise in der Astronomie Bahnbrechendes geleistet. Auch die Bewässerungstechnik hat ihre Ursprünge in den alten Staaten an Euphrat, Tigris und Nil. Nur müssen die Pioniere, die Ingenieure und Konstrukteure des Alten Orients aufgrund fehlender Quellen wohl für immer namenlos und unbekannt bleiben. Ihr Anteil an den Leistungen griechischer und römischer Wissenschaftler aber muss angemessen berücksichtigt werden.
Bei den Persern, vor allem aber bei den Griechen und den Römern sieht es mit den Möglichkeiten der Erkenntnis ganz anders aus. Hier können wir in den meisten Fällen viele Einzelheiten rekonstruieren, wir kennen das Umfeld, in dem sie ihre Leistungen vollbrachten, und auch die Biographien der Wissenschaftler selbst müssen nicht völlig im Dunkeln bleiben. Präsentiert werden in diesem Buch 21 Sachgebiete antiker Wissenschaft mit 21 jeweils dazugehörigen Persönlichkeiten, die auf diesen Gebieten Wesentliches und Bedeutendes geleistet haben. Vollständigkeit konnte nicht angestrebt werden, die Garde der 21 Auserwählten steht sozusagen stellvertretend für eine noch viel größere Zahl von Naturwissenschaftlern, Technikern und Tüftlern, die sich zu verschiedenen Zeiten den Kopf darüber zerbrochen haben, wie man die Menschheit technisch und zivilisatorisch voranbringen könne. Aufgenommen wurden solche Persönlichkeiten, deren innovative Tätigkeit eine über die Antike hinausgehende, am besten sogar bis in die Gegenwart reichende Wirkung hat. Vielleicht überraschen den ein oder anderen Namen wie Caesar oder Augustus, die man als erfolgreiche Feldherrn oder Politiker kennt, weniger aber mit so segensreichen Einrichtungen wie der Verkehrsplanung oder der Feuerwehr in Verbindung zu bringen pflegt. Auch Wissenschaftler wie Aristoteles oder Philosophen wie Seneca tauchen als Protagonisten von Disziplinen auf, in denen man sie ebenfalls nicht unbedingt erwarten würde. Gesellschaft leisten diesen zur antiken Prominenz gehörenden Persönlichkeiten aber auch eher unbekannte Menschen wie der römische Fischzüchter Gaius Sergius Orata, der in kaum einem Lexikon verzeichnet ist, obwohl er sich in der Sparte der Heiztechnik unsterbliche Verdienste erworben hat.
Wenn also bei dem Personal notwendigerweise eine Auswahl zu treffen war, so könnte man eine ganze Gruppe vermissen, die eigentlich in einer Parade kreativer Geister der Antike nicht fehlen sollte. Der Fischzüchter und Heiztechniker Orata ist vertreten, aber was ist mit Prometheus, mit Daidalos und Ikaros, mit Odysseus? Auch Prometheus machte sich um das Allgemeinwohl verdient, als er den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen schenkte. Ohne ihn hätten die antiken Menschen also nie heizen, kochen und für Licht sorgen können. Für seinen Diebstahl wurde er von dem erbosten Zeus zur Strafe an einen Felsen im Kaukasus gefesselt, und zu allem Überfluss fraß ein Adler täglich an seiner Leber, die daraufhin immer wieder nachwuchs. Befreit wurde er endlich vom Helden Herakles. Und Ikaros? Er machte den Traum vom Fliegen wahr, weil er das Glück hatte, über einen sehr patenten Vater zu verfügen. Jener Daidalos, der Prototyp des antiken Erfinders, baute als erster Statuen, die sich automatisch bewegten. Er konstruierte auch das berühmte Labyrinth im Palast von Knossos auf Kreta. Der König Minos zeigte sich allerdings wenig dankbar und setzte ihn dort gefangen. Da stellte Daidalos für sich und seinen Sohn Flügel her, deren Federn er mit Wachs zusammenklebte, und mit deren Hilfe erhoben sie sich in die Lüfte. Dem unbesonnenen Ikaros wurden aber gleich die Grenzen antiker Luftfahrt aufgezeigt: In seinem Übermut kam er zu nahe an die Sonne heran, da schmolz das Wachs, und Ikaros stürzte hinab ins Meer. Daidalos wenigstens glückte die Flucht, und er konnte nach Sizilien entkommen. Schließlich Odysseus, der griechische Trojaheld, »listenreich«, wie ihn Homer zu bezeichnen pflegt und unsterblich geworden als Architekt des »Trojanischen Pferdes«, das es den Griechen ermöglichte, Troja zu stürmen – darf er keinen Platz in der Reihe prominenter Protagonisten antiker Wissenschaft beanspruchen?
Aber das sind alles Figuren des Mythos – zumindest sind Zweifel angebracht, ob es einen Prometheus, einen Daidalos, einen Ikaros, einen Odysseus wirklich gegeben hat. Und doch zeugen diese von antiken Menschen produzierten Mythen von einem sehr realen Interesse daran, etwas Neues zu schaffen, Herausforderungen anzunehmen, die Welt zu verändern, die eigenen Grenzen zu überschreiten, die Natur in den Griff zu bekommen oder gar zu überlisten. Wie das in der Wirklichkeit funktioniert hat, soll der folgende, chronologisch angelegte Streifzug durch über 600 Jahre antike Geschichte zeigen.
MATHEMATIK
Thales
Griechischer Naturwissenschaftler, um 625 – um 547 v. Chr.
Pionierleistung: der »Satz des Thales«
Es gibt viele Persönlichkeiten der Antike, die man heute nicht mehr unbedingt kennen muss. Andere sollten einem schon etwas sagen, will man nicht in den Verdacht geraten, bei seinen Bemühungen um eine gediegene Allgemeinbildung Wesentliches versäumt zu haben. Dann aber gibt es glücklicherweise Namen, an denen man einfach nicht vorbeikommt, weil sie sich einem geradezu aufdrängen. Zu diesem illustren Kreis gehört zweifellos auch Thales, dessen berühmter, nach ihm benannter »Satz« fester Bestandteil eines jeden Mathematik-Unterrichts ist.
Thales – ein Phantom?
Wer aber war dieser Thales? Forscht man in den antiken Quellen nach gesicherten Informationen über sein Leben und sein Wirken, so ergibt sich ein höchst diffuses Bild. Zu unterschiedlich sind die wissenschaftlichen Großtaten, die man ihm zuschreibt, als dass man all diesen Nachrichten Glauben schenken mag. Thales als Pionier der Philosophie, Meister der Astronomie, Protagonist der Geometrie, Kenner der Meteorologie, Experte der Geographie, nebenbei auch noch Fachmann für Politik und Diplomatie – das scheint, bei allem Respekt vor antiken Forschungsleistungen, doch des Guten etwas zu viel zu sein. Und dann die vielen Anekdoten, die über ihn kursierten, die ihn einmal als weltfremden Sonderling, dann wieder als patenten, marktorientierten Kapitalisten porträtieren: Gehören diese Facetten tatsächlich zu ein und derselben Persönlichkeit? Oder ist dieser Thales am Ende nur ein Phantom, eine Chiffre für Leistungen, die in Wirklichkeit ganz andere erbracht haben?
Auf der Suche nach dem historischen Thales
Zur Beruhigung sei versichert: Die Bücher zur europäischen Wissenschaftsgeschichte müssen nicht neu geschrieben werden. Es entspricht nach wir vor den Tatsachen, wenn in den ersten Kapiteln dieser Bücher der Name Thales auftaucht. Allerdings kommt man nicht umhin, behutsam zu prüfen, was von dem historischen Thales übrig bleibt, wenn man die antiken Zeugnisse, die auf ihn Bezug nehmen, nach ihrem Wahrheitsgehalt befragt. Zuzutrauen ist ihm auf jeden Fall die postulierte wissenschaftliche Vielseitigkeit. In jener frühen Phase der griechischen Geschichte, in die Thales hineingehört, gab es noch keine Spezialisierung. Ein kluger Kopf, der über genügend Geld und Zeit verfügte, interessierte sich so ziemlich für alles, was es in der Welt zu erkunden gab. Andererseits hatten die Griechen die Angewohnheit, große Erfindungen und Errungenschaften im Rückblick gleich paketweise einzelnen Protagonisten wie eben Thales zuzuschreiben.
Heimat Milet
Was die Biographie des Thales angeht, so gibt es immerhin zwei unumstößliche Fakten: Er stammte aus der Stadt Milet, und er erlebte das Jahr 585 v. Chr. Die Herkunft ist in diesem Fall nicht unwichtig und geeignet, das Phänomen Thales zu erklären. Milet war eine alte griechische Gründung und entwickelte sich bald zur bedeutendsten Stadt in Ionien (wie die Griechen diese Landschaft im Westen Kleinasiens nannten). Im Gegensatz zu den mutterländischen Griechen empfingen die Ionier, wegen der räumlichen Nähe, viele Impulse von den hochentwickelten Kulturen des Orients.
Die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.
Und so dürfte Thales die Inspiration für eine erste, vielbewunderte Leistung aus dem babylonischen Raum empfangen haben: die Vorhersage einer Sonnenfinsternis, die nach modernen astronomischen Berechnungen am 28. Mai 585 v. Chr. stattgefunden hat. Die antiken Thales-Forscher rekonstruierten aus dieser Angabe ein Geburtsdatum 625 v. Chr., gemäß der vorherrschenden Auffassung, dass der Mensch im 40. Lebensjahr seine bedeutendste Tat vollbringt (eine für ältere Menschen, die glauben, noch nichts Besonderes geleistet zu haben, durchaus beunruhigende Einschätzung). Vermutlich hatte sich Thales bei seiner Prognose babylonischer Schaltzyklen bedient. Heutige Forscher sind allerdings skeptisch, ob er auch wirklich den genauen Tag und den genauen Monat und nicht nur das betreffende Jahr vorausgesagt hat. Aber das schmälert seine Verdienste um die wissenschaftliche Astronomie nur unwesentlich.
Die Suche nach der Grundsubstanz
Wahrscheinlich schon älter als 40 Jahre war Thales, als er zum Begründer dessen wurde, was man heute die ionische Naturphilosophie nennt. Wiederum unter dem Eindruck der innovativen geistigen Atmosphäre des Orients, machte er sich auf die Suche nach der Antwort auf eine wahrlich fundamentale Frage: Was ist die Grundsubstanz der Welt und allen Lebens? Das Ergebnis seines diesbezüglichen Nachdenkens: Der Ursprung und die Grundlage von allem Seienden ist das Wasser. Mit dieser revolutionären Meinung trat der Forscher geradezu eine Lawine los. Seine ebenfalls aus Milet stammenden Schüler und Kollegen Anaximander und Anaximenes wandelten auf seinen Spuren und kamen zu alternativen Resultaten: Anaximander ersetzte das Wasser des Thales etwas abstrakt durch eine Substanz, die er das ápeiron, das Grenzenlos-Unbestimmbare, nannte, Anaximenes hingegen tauschte das Wasser gegen ein anderes Element, die Luft, aus. Das Thema sollte die antiken Denker jedenfalls nicht mehr loslassen und wurde vor allem von Demokrit, dem Pionier der antiken Atomforschung, wieder aufgegriffen.
Die Geographie des Thales
Wie Thales ausgerechnet auf das Wasser gekommen ist, lässt sich nicht deutlich ausmachen. Doch spielte das Wasser in seinem Denken überhaupt eine große Rolle. Er fragte nicht nur nach der Substanz allen Seins, sondern – etwas pragmatischer – auch nach der geographischen Beschaffenheit der Erde. Diese dachte er sich als eine Scheibe, die auf dem unendlichen Weltmeer, dem Okéanos, schwimmt. Und zukünftigen Erdbebenforschern gab er als Anregung mit auf den Weg, doch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die seismischen Vorgänge durch stürmische Bewegungen auf dem Ozean hervorgerufen werden – eine unkonventionelle Deutung der Dinge (der Römer Seneca nannte sie schlicht »albern«), galten Erdbeben doch gemeinhin als Werk des Gottes Poseidon.
»Der Satz« – des Thales oder des Pythagoras?
Was ist aber nun mit Thales als Mathematiker? Hier gibt es Anlass zur Sorge. Schon in der Antike bestanden ernste Zweifel an den Urheberrechten des Thales für den »Satz des Thales«. Der »Satz des Thales«, so heißt es, sei in Wirklichkeit ein »Satz des Pythagoras«. Das kann etwas verwirren, weil, wie man ebenfalls aus dem Mathematik-Unterricht weiß, Pythagoras doch schon seinen »Satz« hat, nämlich die folgende grundlegende Erkenntnis der Geometrie: In einem rechtwinkligen Dreieck ist der Flächeninhalt des Quadrates über der Hypotenuse c (also die Langseite des Dreiecks) gleich der Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten (den Kurzseiten des Dreiecks) a und b – besser bekannt unter der Formel a2+ b22. Nun war Pythagoras, ein jüngerer Kollege des Thales, der im unteritalischen Kroton eine Gruppe von lernwilligen Schülern um sich geschart hatte, sicher noch mehr an Mathematik interessiert als der Gelehrte aus Milet. Mit seinem Namen sind unter anderem verbunden die Theorie der Proportionen und die Lehre von den geraden und den ungeraden Zahlen. Und so würde zu ihm durchaus auch die Entdeckung jenes nach Thales benannten Lehrsatzes passen, der sich ja ebenfalls mit den geometrischen Eigenschaften des Dreiecks beschäftigt: Wenn in einem Dreieck die Ecke gegenüber der Hypotenuse auf einem Halbkreis über dieser Seite liegt, dann bildet diese Ecke einen rechten Winkel, oder, anders formuliert: Die Scheitelpunkte aller rechtwinkligen Dreiecke liegen über dem auf der Hypotenuse errichteten Kreis.
Definitiv kann die Streitfrage nach dem Copyright auf den »Satz des Thales« nicht entschieden werden. Als Argument pro Thales wird kaum gelten, dass Pythagoras seinen »Satz« sicher hat und man deshalb auch Thales großzügig einen »Satz« überlassen sollte. Nicht zu unterschätzen ist die angesprochene Tendenz der antiken Schriftsteller, Thales mit allen möglichen – und auch mit ihm in Wirklichkeit nicht zustehenden – Lorbeeren zu versehen. Vielleicht kann man sich salomonisch auf den Kompromiss einigen, dass Thales auf jeden Fall das intellektuelle Rüstzeug gehabt hat, um einen solchen »Satz« aufzustellen. Sein treuester antiker Anhänger, der im 3. Jahrhundert n. Chr. schreibende Philosophie-Historiker Diogenes Laertios, der unerschütterlich an Thales als Erfinder des Thales-Satzes festhielt, wusste sogar noch von weiteren mathematischen Aktivitäten zu berichten. Während eines Aufenthaltes in Ägypten soll er die Höhe der Pyramiden aufgrund der Länge ihrer Schatten bestimmt haben, »indem er den Zeitpunkt benutzte, zu dem unser Schatten ebenso groß ist wie wir selbst.« Andere Quellen erzählen, Thales habe sich auch um die Seefahrt Verdienste erworben, als er ein Verfahren entwickelte, das es ermöglichte, die Entfernung zwischen Schiffen auf dem Meer zu errechnen. Gelungen sei ihm dies durch die konsequente Anwendung des sogenannten Zweiten Kongruenzsatzes, wonach Dreiecke dann kongruent sind, wenn eine Seite und die beiden angrenzenden Winkel gleich sind.
Platons Zorn auf die Mathematiker
Auf die weitere Geschichte der Mathematik in der Antike hat aber zweifellos Pythagoras den größeren Einfluss ausgeübt. Dafür steht vor allem der Name des Eudoxos aus dem kleinasiatischen Knidos, der im 4. Jahrhundert v. Chr. die Lehre von den Proportionen weiterentwickelte. Eudoxos ist allerdings auch ein Beispiel dafür, dass es in der Antike mitunter nicht ungefährlich war, Mathematiker zu sein. Wie der Schriftsteller Plutarch berichtet, nahm Eudoxos das an sich verdienstvolle Unternehmen in Angriff, die »Mathematik interessant zu machen«, indem er »Probleme, die durch theoretische und zeichnerische Beweisführung nicht zu lösen waren, durch ins Auge fallende mechanische Apparate unterbaute«. So führte er nach Plutarch das grundlegende Problem des Auffindens der zwei mittleren Proportionalen durch mechanische Instrumente zur Lösung, wobei er »ausgehend von krummen Linien und Schnitten nach deren Muster bestimmte Mittelwertzeichner konstruierte«. Dieser Versuch der Veranschaulichung mathematischer Probleme ließ den berühmten Philosophen Platon vor Zorn erbeben. Eudoxos und seine Anhänger, so wetterte er, zerstören den Adel und die Reinheit der Mathematik, »wenn sie aus der unkörperlichen Sphäre des reinen Denkens ins Sinnliche herabgleitet und sich körperlicher Dinge bediene, die vieler niedrigen, handwerklichen Tätigkeiten bedürfe«. Nach Plutarch war dieses harsche Verdikt die Geburtsstunde der Trennung von antiker Mathematik und antiker Mechanik. Gleichwohl gab es auch weiterhin Forscher wie Archimedes, für den mathematische Reinheit und praktische Anwendung in der Mechanik kein Widerspruch waren.
Der Tod der Mathematikerin Hypatia
Den Fortschritten in der Mathematik konnten solche akademischen Diskussionen nichts anhaben. Um 300 v. Chr. wirkte in der Wissenschaftsmetropole Alexandria Euklid, der wohl berühmteste Mathematiker der Antike, der auch die neuzeitliche Mathematik entscheidend beeinflusst hat. Die Planimetrie (die Lehre von der ebenen Geometrie), die Arithmetik und die Stereometrie zählten zu seinen bevorzugten Arbeitsgebieten. Einen Kommentar zu Euklid verfasste im 4. Jahrhundert n. Chr. der ebenfalls in Alexandria forschende Theon, der im Übrigen der Vater jener Hypatia gewesen ist, mit deren Name ein ziemlich düsteres Kapitel antiker Wissenschaft verbunden ist. Vom Vater erbte Hypatia das Interesse an der Mathematik und an der Philosophie, und in einer nach den damaligen Verhältnissen für Frauen singulären Weise engagierte sie sich öffentlich in der Forschung und in der Lehre. Bald geriet sie in Konflikt mit den führenden christlichen Kreisen in Alexandria – nicht so sehr, weil diesen eine solch exponierte Rolle einer Frau ein Dorn im Auge war, sondern eher, weil sie mit ihren philosophischen Überzeugungen den Interessen der Kirche in die Quere kam. Auf Anstiftung des Bischofs Kyrillos wurde Hypatia, der historische Prototyp aller Mathematikerinnen, im Jahre 415 n. Chr. von einer aufgebrachten Menge gelyncht.
Thales im Dienste des Kroisos
Thales von Milet war 1000 Jahre zuvor von solchen Anfeindungen verschont geblieben. Dazu bestand auch keinerlei Anlass, denn er hat sich, will man den Quellen einigermaßen Glauben schenken, den Herrschenden und den Mächtigen mehrfach als dienstbar erwiesen. Zu seinen speziellen Freunden zählte der Lyderkönig Kroisos, der in seiner latinisierten Namensform Krösus zum sprichwörtlichen Sinnbild für Reichtum wurde (den Kroisos im Übrigen durch die Ausbeutung der lydischen Bodenschätze und eine recht rigide Steuerpolitik erworben hatte). Im Jahre 547 v. Chr. unternahm Kroisos einen Feldzug gegen den Erzfeind, das östlich benachbarte Perserreich. Dabei ergab sich das Problem, wie das Heer über den Halys, den Grenzfluss zwischen Lydien und Persien, kommen solle. Die Lösung fand Thales, der sich in der Begleitung des Kroisos befand. Er legte einen Kanal an, in den er den Halys umleitete, und so konnte die lydische Armee bequem durch das nun trockengelegte alte Flussbett marschieren. Der Historiker Herodot, der offenbar nicht zur Fraktion der Thales-Freunde gehörte, wollte diese Leistung allerdings aus der Liste der Meriten des Wissenschaftlers aus Milet streichen. Seiner Meinung nach habe Kroisos mit seiner Armee den Halys ganz unspektakulär auf Brücken überquert. »Bei den Griechen aber«, so der missgünstige Geschichtsschreiber, »erzählt man sich überall, Thales aus Milet habe das Heer hinübergeschafft.«
Ein kapitales Missverständnis
Der Feldzug endete für Kroisos allerdings mit einer Katastrophe, sein Heer wurde vollständig aufgerieben, die Perser zerstörten seine Residenzstadt Sardes. Dabei war der Freund des Thales sehr optimistisch in den Krieg gezogen, hatte ihm doch das Orakel von Delphi, das er vor entscheidenden Aktionen regelmäßig zu konsultieren pflegte, prognostiziert, er würde, wenn er den Halys überschreitet, ein großes Reich zerstören. Zu spät erkannte der König, dass das Orakel immer zweideutige Antworten gab, was die Trefferquote der Auskünfte deutlich erhöhte. Als lydische Gesandte nach der Niederlage gegen die Perser mit einer Protest-Botschaft in Delphi erschienen, teilte ihnen das Orakel mit, Kroisos habe nicht richtig zugehört – das Reich, das er zerstören werde, sei nicht das der Perser, sondern sein eigenes gewesen.
Thales als politischer Ratgeber
Das Vordringen der Perser in Kleinasien stellte nicht nur für Kroisos ein Problem dar. Auch die Griechenstädte Ioniens sahen sich in ihrer Freiheit und Autonomie bedroht. In dieser schwierigen Lage soll Thales einen weisen politischen Rat gegeben haben. Dessen Authentizität darf als gesichert gelten, weil er ausgerechnet von dem Thales-Kritiker Herodot überliefert wird, der keinen Anlass hatte, über den Milesier unverdiente Lorbeeren auszustreuen. Die Ionier, so lautete die Empfehlung des Thales, sollten ihre Rivalitäten vergessen, nicht weiter auf die Autonomie einer jeden Stadt pochen, sondern sich in der Stunde der Gefahr zusammentun. Konkret plädierte er für die Installierung eines gemeinsamen Rates in der zentral gelegenen Stadt Teos. »Recht brauchbar« nannte der sich in Gönnerstimmung befindliche Herodot diesen Plan – befolgt wurde er freilich nicht, und so kamen die Ionier, allerdings erst nach dem Tod des Thales, unter die Herrschaft der Perser.
Die Sieben Weisen
Seine erwiesene Klugheit verschaffte Thales Zutritt zu einem exklusiven Club der Antike: den Sieben Weisen. Viel miteinander zu tun hatten diese jedoch nicht. Der Kreis wurde vielmehr erst im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. zusammengestellt, als man, auch unter dem Eindruck der Magie der Zahl Sieben, nach Männern suchte, die sich in der Vergangenheit durch Verstand und Intellekt ausgezeichnet hatten. Ganz einig war man sich nicht, wer dazugehören durfte – es kursierten konkurrierende Listen mit insgesamt 17 Namen, die man in den Olymp der »Sieben Weisen« erheben wollte. Thales aber war immer dabei, was erkennen lässt, welch bedeutenden Ruf er bei der Nachwelt hatte. Gleiches gilt für den Athener Solon, einen der Wegbereiter der attischen Demokratie, oder den Priener Bias, der in der Zeit der Bedrängnis der Ionier durch die Perser den Rat gegeben hatte, man solle doch nach Sardinien auswandern. Jedem der Sieben Weisen wurden eine Reihe von klugen Aussprüchen zugeschrieben, kurze, bedenkenswerte Sentenzen voller Lebenserfahrung. So gehen auch auf das Konto des Thales einige tiefgründige Einsichten. Konfrontiert mit der Frage: »Was ist schwierig?« gab er zur Antwort: »Sich selbst zu erkennen.« Und was ist einfach? »Anderen Ratschläge zu erteilen.« Und wie kann man am gerechtesten leben? »Wenn man selbst das unterlässt, was man an anderen auszusetzen hat.«
Der Philosoph im Brunnen
Früh musste Thales aber auch herhalten als der Prototyp des weltfremden, zerstreuten Gelehrten – die Kehrseite der Ehre, Mitglied der »Sieben Weisen« gewesen zu sein und sich auf so vielfältige Weise mit den Geheimnissen der Wissenschaft beschäftigt zu haben. Kolportiert wird in diesem Zusammenhang eine wenig schmeichelhafte Anekdote. Einmal sei Thales durch die Stadt spaziert, die Augen nach oben gerichtet, mit astronomischen Studien beschäftigt, und da sei er in einen Brunnen gefallen (wobei diese unfreiwillige Bekanntschaft mit dem Element Wasser wohl kaum in einem ursächlichen Zusammenhang mit seiner Theorie vom Wasser als der Grundsubstanz alles Seienden gestanden haben dürfte). Ein einfaches Bauernmädchen habe sich daraufhin über ihn lustig gemacht: Er strenge sich an, die Dinge im Himmel zu erkennen, dabei habe er aber keine Ahnung von dem, was ihm vor den Augen und den Füßen liege.
Die Intellektuellen schlagen zurück
Solche Geschichten wurden zweifellos von Leuten in Umlauf gebracht, die der Meinung waren, die Beschäftigung mit der Wissenschaft sei etwas Nutzloses. Im Alltag, im wirklichen Leben, finden sich die Gelehrten nicht zurecht. Es gereicht den antiken Intellektuellen zur Ehre, dass sie solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen wollten. Und so starteten sie ihrerseits eine Gegenoffensive, bei der einmal mehr Thales die argumentative Hauptrolle spielen musste. Sie zogen den Weisen gleichsam wieder aus dem Brunnen heraus und setzten ihn mit beiden Füßen in die Welt der Realitäten, in der es nach landläufiger Auffassung darauf ankam, clever zu sein und das Beste für sich herauszuholen. Kein Geringerer als Aristoteles machte sich dabei zum Anwalt des Thales und gleichzeitig zum Apologeten seiner selbst und der ganzen Zunft der Forscher und Wissenschaftler. Noch der Römer Cicero hat im 1. Jahrhundert v. Chr. die Geschichte vom gerissenen Geschäftsmann Thales nacherzählt. Genervt von der Kritik an seiner Armut und den Vorhaltungen, einer brotlosen Tätigkeit nachzugehen, schüttete Thales seine wenigen Sparstrümpfe aus, um über etwas Kapital zu verfügen. Dank seiner astronomischen Kenntnisse hatte er herausgefunden, dass es im folgenden Jahr zu einer Rekordernte bei den Oliven kommen würde. Noch im Winter mietete er, für einen niedrigen Preis, sämtliche Ölpressen in Milet und Umgebung. Als die Erntezeit kam, gab es eine starke Nachfrage nach Ölpressen. Die aber befanden sich alle im Besitz des Thales. »Da habe er«, erzählt Aristoteles, »seine Pressen so teuer verpachtet, wie er nur wollte, und auf diese Weise sehr viel Geld verdient.«
Die Moral von der Geschichte des Monopolkapitalisten Thales liegt auf der Hand: Wir Philosophen und Wissenschaftler können, wenn wir wollen, alle Reichtümer der Welt erwerben, aber darauf kommt es uns nicht an – oder in den Worten des Aristoteles: »Es ist für die Philosophen ein Leichtes, reich zu werden, wenn sie es wünschen, es ist aber nicht das, was sie interessiert.« Der Ruf der Gelehrten war gerettet und der Weg bereitet für viele weitere bahnbrechende Erfindungen und Errungenschaften.
TUNNELBAU
Eupalinos
Griechischer Ingenieur, 6. Jahrhundert v. Chr.
Pionierleistung: Bau eines Tunnels für eine Wasserleitung auf Samos
Welches sind die berühmtesten Bauwerke der Griechen? Die Akropolis von Athen? Der Zeustempel von Olympia? Das Theater von Epidauros? Der Historiker Herodot hatte im 5. Jahrhundert v. Chr. eine spezielle Meinung. Seine Favoriten befanden sich auf der Insel Samos: der Tempel der Göttin Hera, die imposante Hafenmole mit einer Länge von 300 Metern und – an allererster Stelle – der Tunnel des Eupalinos: Das waren, so urteilte Herodot, »drei der gewaltigsten Bauwerke der Griechen«. Mit seiner Euphorie stand Herodot nicht allein da: Kein Geringerer als der große Universalgelehrte Aristoteles stellte die Bauten des Polykrates in eine Reihe mit den Pyramiden in Ägypten.
Der Tyrann von Samos
Über die Wahl des durchaus kenntnisreichen Historikers und die Zustimmung einer wissenschaftlichen Koryphäe hätte sich Polykrates, eitel wie er war, zweifellos gefreut. Er war der Herrscher oder, besser gesagt, der Tyrann von Samos, als jene Meisterwerke der Architektur bzw. der Ingenieurkunst auf seiner Insel entstanden oder wenigstens vollendet wurden. Nun war Polykrates allerdings bereits im Jahre 522 v. Chr. gestorben und fiel daher als Direktempfänger der Laudatio des Herodot aus. Aber schon zu Lebzeiten dürfte er stolz darauf gewesen sein, was er aus der beschaulichen Insel vor der Küste Kleinasiens gemacht hatte. Nicht umsonst lässt ihn Friedrich Schiller in seiner bekannten Ballade vom »Ring des Polykrates« auf seines Daches Zinnen stehen und voller Wohlgefallen auf das beherrschte Samos herabblicken – in Gegenwart des ebenfalls höchst beeindruckten Amasis, des Königs von Ägypten.
Der Ring des Polykrates
Freilich gibt die Moral der Ring-Geschichte zu denken, hat sogar etwas Bedrohliches: Wer zu viel Glück hat, wird irgendwann dafür bestraft. Geborgt hat sich Schiller das Motiv bei Herodot, den das Schicksal des Tyrannen offenbar sehr beschäftigt hat. In seiner Erzählung ist Amasis nicht nur beeindruckt, sondern auch besorgt. Was war Polykrates in seinem Leben nicht alles geglückt: Erfolgreich hatte er die internen Rivalen um die Herrschaft ausgeschaltet, Samos zu einer Seemacht werden lassen, für Reichtum und Wohlstand gesorgt, kulturellen Glanz verbreitet und schließlich die von Herodot bewunderten Bauwerke in Auftrag gegeben. In einem Brief warnt Amasis den Freund: »Mir gefällt dein großes Glück ganz und gar nicht, denn ich weiß, dass die Götter neidisch sind.« Besser sei ein Leben mit all den Wechselfällen, die das Schicksal für die Normalmenschen bereitzuhalten pflegt. Und dann gibt er einen praktischen Ratschlag als Therapie gegen die trügerische Überdosis an Glück: Polykrates solle sich am besten von jenem Gegenstand trennen, dessen Verlust ihn am meisten schmerzen würde.
Der Tyrann entscheidet sich für einen wertvollen Siegelring. Er lässt sich weit aufs Meer hinausfahren und wirft ihn in die Fluten. Ein paar Tage später erscheint ein Fischer im Palast, um dem gegen sein Glück kämpfenden Polykrates einen wunderschönen Fisch zu überreichen, den er gerade gefangen hat. Diener schneiden den Fisch auf und finden in ihm den besagten Ring, der auf diese merkwürdige Weise wieder in den Besitz des Tyrannen gelangt. Er schreibt einen Brief an Amasis, erzählt ihm von dem Vorfall. Dieser ist aufs Höchste alarmiert: Jetzt findet Polykrates sogar das wieder, was er weggeworfen hat. Das kann kein gutes Ende nehmen, und um später nicht um den so gefährlich Beglückten trauern zu müssen, kündigt er ihm die Freundschaft auf.
Das traurige Ende eines Tyrannen
Die besten Geschichten haben meistens den Fehler, dass sie nicht wahr sind. Die Parabel vom Ring sollte letztlich nur eine Erklärung für das historische Faktum liefern, dass das Bündnis zwischen Samos und Ägypten bald in die Brüche ging und Polykrates dem persischen König Kambyses bei der Eroberung Ägyptens half. Doch mit seinem Glück war es jetzt tatsächlich vorbei. Die Perser zeigten sich wenig dankbar, lockten Polykrates in einen Hinterhalt auf dem kleinasiatischen Festland, töteten ihn und schlugen seine Leiche ans Kreuz.
Fundort Pythagorion
Wer sich heute auf die Spurensuche nach dem antiken Samos macht, fährt in eine Stadt an der Südküste der Insel, die seit 1955 Pythagorion heißt – eine späte Reverenz an den großen antiken Philosophen und Mathematiker Pythagoras, der hier um 575 v. Chr. geboren wurde und später, wegen des tyrannischen Regimes des Polykrates, seine Heimat in Richtung Kroton in Süditalien verließ. An dieser Stelle lagen die antike Inselhauptstadt Samos und die Residenz des Polykrates. Von dem einst so stolzen Hera-Tempel ist nur noch eine einzige Säule zu sehen. Dagegen ist der moderne Hafen viel kleiner als sein antiker Vorgänger, steht aber immer noch auf den alten Fundamenten. Am besten erhalten und erforscht ist das dritte der »gewaltigen Bauwerke«, der Tunnel des Eupalinos, ein Meisterwerk der Technik und der Ingenieurkunst.
Der Tunnel des Eupalinos
Über Eupalinos selbst ist so gut wie nichts bekannt. Man weiß nur, dass er aus Megara stammte und dass sein Vater Naustrophos hieß. In seiner Zeit aber muss er eine Berühmtheit gewesen sein, denn Polykrates engagierte ihn für ein äußerst kühnes Unternehmen. Im Prinzip ging es darum, die Stadt Samos mit Wasser zu versorgen – vor allem für den Fall einer Belagerung von außen. Das Problem war allerdings, dass die Quelle weit außerhalb der Stadt lag und, was die Sache noch schwieriger machte, dass sich dazwischen ein Berg befand. Der Ingenieur Eupalinos aber stellte sich dieser Aufgabe und löste sie, bis auf einige kleine Schönheitsfehler, mit Bravour.
Nach Abschluss der Arbeiten, die mehr als zehn Jahre in Anspruch genommen haben sollen, konnte der damals noch glückliche Polykrates, wenn er wieder einmal auf seines Daches Zinnen stand, wohlgefällig auf eine in der damaligen griechischen Welt einzigartige Anlage blicken (jedenfalls auf die Teile, die sichtbar waren). Zunächst hatte Eupalinos das Wasser der Quelle, die hoch in den samischen Bergen lag, in einem abgedeckten Reservoir gestaut. Ein ebenfalls gedeckter Leitungskanal von etwa 850 Metern Länge führte das Wasser dann, dem natürlichen Gefälle folgend, zu dem der Stadt Samos vorgelagerten Berg. Und hier vollbrachte Eupalinos nun sein Meisterstück: Quer durch den Berg legte er, über eine Länge von 1036 Metern, einen Tunnel – und dies, wie es scheint, mit relativ einfachen technischen Hilfsmitteln. Konstruiert wurde er im sogenannten Gegenortverfahren, das heißt, die Arbeiter begannen gleichzeitig an der Nord- und an der Südseite des Berges mit den Bohrungen. Das Verfahren ist nicht ganz ohne Risiko: Alles hängt davon ab, dass man dann, möglichst in der Mitte, auch zusammenkommt. Bei Eupalinos hat das fast funktioniert. Am geplanten Treffpunkt lag die Decke des südlichen Stollens gerade einmal einen Meter unter dem Boden der nördlichen Trasse und dazu auch noch ein paar Meter weiter westlich. Doch diese geringfügigen Abweichungen konnten nachträglich korrigiert werden. Die Höhe des Stollens betrug (wie übrigens auch die Breite) knapp zwei Meter, so dass, in Anbetracht der im Vergleich zu heute geringeren Körpergröße des antiken Menschen, man bequem durch den Berg spazieren konnte. Von diesem Hauptstollen separiert war die eigentliche Wasserleitung mit einem durchschnittlichen künstlichen Gefälle von 0,36 % An der Stadtseite des Berges mündete der Kanal in eine wiederum komplett gedeckte Zuleitung von 620 Metern Länge, die das Wasser direkt in eine Zisterne in der Nähe des Theaters von Samos führte.
Ein Vorläufer in Jerusalem
Ob sich Eupalinos jemals in Jerusalem aufgehalten hat, ist nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr groß. Und so dürfte er auch nicht jenen Tunnel gekannt haben, den fast 200 Jahre zuvor der judäische König Hiskia (725–697 v. Chr.) in der Stadt Davids und Salomos hatte anlegen lassen und der, wenn schon nicht als Vorbild, so doch als Vorläufer des Eupalinos-Tunnels gelten kann. Jerusalem befand sich damals in einer misslichen Lage. Hiskia hatte sich mit dem Reich der Assyrer überworfen. Es war zu befürchten, dass sich die zu diesem Zeitpunkt führende Militärmacht des Ostens eine solche Provokation nicht gefallen lassen würde. Also traf Hiskia umfassende Vorbereitungen zur Abwehr einer zu erwartenden Belagerung. Ein Schwachpunkt im Verteidigungssystem war die Wasserversorgung: Die Quelle lag weit außerhalb der Stadtmauern.
Dieses Schreckens-Szenario veranlasste Hiskia und seine Ingenieure zur Konstruktion des berühmten Siloah-Tunnels (benannt nach dem Abfluss der im Osten des Burgberges gelegenen Gihon-Quelle). So wie später Eupalinos auf Samos entschlossen sie sich dazu, die Wasserleitung direkt durch den Burgberg in die Stadt zu legen. Und das mutige Unternehmen gelang: Über eine Strecke von 533 Metern kam das Wasser nun direkt und sicher nach Jerusalem. Im Gegensatz zum Eupalinos-Tunnel verlief der Hiskia-Tunnel nicht geradlinig, sondern kämpfte sich in vielen Windungen durch den Berg. Für dieses Phänomen haben die Archäologen bis heute keine vernünftige Erklärung gefunden. Sicher ist dagegen, dass auch der Siloah im Gegenortverfahren angelegt wurde. Von beiden Seiten arbeiteten sich die Bohrtrupps aufeinander zu. Auch hier stellte sich die bange Frage, ob das Zusammentreffen gelingen würde. Kurz vor dem Treffpunkt wurden an beiden Seiten noch Richtungskorrekturen vorgenommen. Dann war es soweit: Knapp 300 Meter vom südlichen und 235 Meter vom nördlichen Eingang entfernt wurden die letzten Barrieren abgetragen und konnten sich die Arbeiter schließlich die Hände reichen. Von diesem Moment kündet eine stolze hebräische Inschrift, die man im Tunnel gefunden hat: »Der Durchbruch wurde vollendet. Und so kam der Durchbruch zustande: Die Steinhauer schwangen die Beile, jeder in Richtung seines Kameraden (auf der anderen Seite des Stollens). Als noch drei Ellen zu durchschlagen waren, konnten die Arbeiter auf beiden Seiten einander hören, denn es war ein Spalt im Felsen von rechts nach links. Und am Tag des Durchbruchs schlug jeder Steinhauer auf seinen Kollegen zu, Beil gegen Beil. Da floss das Wasser vom Ausgangspunkt zum Teich, über 1200 Ellen (= 533 Meter), und 100 Ellen (= 46 Meter) betrug die Höhe des Felsens über den Köpfen der Steinhauer.« Diese Inschrift ist insofern bemerkenswert, als sie den Anteil derjenigen, die die eigentliche Arbeit zu leisten hatten, entsprechend würdigt. Konventioneller fällt hingegen die Darstellung der Dinge bei dem jüdischen Schriftsteller Jesus Sirach aus, der, wie in der Antike üblich, das ganze Verdienst dem königlichen Auftraggeber zukommen lässt: »Hiskia sicherte die Stadt, indem er Wasser hineinleitete. Mit dem Eisen durchbrach er den Berg und dämmte den Teich zwischen dem Felsen ein.«
Das technische Meisterwerk war gerade fertiggestellt, als 701 v. Chr. tatsächlich die Assyrer vor der Stadt auftauchten. Offenbar hatte Hiskia doch weniger Zutrauen in die technischen Fähigkeiten seiner Leute als Furcht vor dem Gegner. Jedenfalls hielt er es für besser, es nicht auf eine Belagerung ankommen zu lassen. Stattdessen unterwarf er sich lieber freiwillig, und die Assyrer zogen mit reicher Beute wieder ab. Trösten konnte sich Hiskia mit der Einsicht, Jerusalem eine lange Belagerung oder gar die Zerstörung erspart zu haben – und mit der Tatsache, dass unter seiner Herrschaft eine der größten Ingenieurleistungen in der Geschichte des alten Palästina vollbracht worden war.
Tatort Numidien
Eine Wasserleitung durch einen Tunnel zu führen, stellte selbstverständlich auch für die Römer, die sich in unbescheidener Selbsteinschätzung nicht nur als Beherrscher der Welt, sondern auch als Bezwinger der Natur sahen, eine Herausforderung dar. Da die Römer ferner immer perfekt sein wollten, war es etwas peinlich, wenn ihnen einmal etwas misslang. Aber die Römer wären keine Römer gewesen, hätten sie nicht auch aus Rückschlägen noch Kapital geschlagen. Eine solche Situation ergab sich irgendwann um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in der nordafrikanischen Provinz Numidien, dem heutigen Algerien.
Militärarchitekten der Dritten Legion hatten den Auftrag erhalten, von einem Quellgebiet eine Wasserleitung über 21 Kilometer zur Hafenstadt Saldae zu legen. Wieder einmal stand ein Berg im Wege, und man war gezwungen, einen Tunnel zu bauen. Die Verantwortlichen hatten aber offenbar nicht das Kaliber eines Eupalinos, und vom Siloah-Tunnel hatten sie wahrscheinlich auch noch nichts gehört. Als man den Versuch unternahm, den Berg im Gegenortverfahren zu durchbohren, trieben die Arbeiter zwar eifrig Stollen in den Felsen, dies jedoch in völlig verschiedenen Richtungen, und das, obwohl die exakte Linienführung mit Pfählen über den Berg abgesteckt worden war.
Nonius Datus rettet die Ehre Roms
Sollte der Name »Saldae« zum Synonym für das Versagen römischer Technik werden? Zum Glück gab es noch Nonius Datus, pensionierter Landvermesser der römischen Armee. Er hatte das Saldae-Projekt einst geplant und war danach nach Lambaesis, dem Stützpunkt der Dritten Legion, zurückgekehrt – im Vertrauen darauf, dass die Ausführung des Projekts auch in seiner Abwesenheit keine Probleme bereiten dürfte. Doch dann erfuhr er von dem Desaster und eilte an den Ort des Geschehens zurück. Hier rettete der Krisenmanager Nonius Datus den Ruf der römischen Technik und brachte die Arbeiten am Tunnel, der eine Länge von 482 Metern hatte, doch noch zu einem guten Ende.
Die Inschrift des Nonius Datus
Als echter Römer begnügte sich Nonius Datus nicht damit, eine bedeutende Leistung vollbracht zu haben. Es kam ihm auch darauf an, alle Welt wissen zu lassen, was er getan hatte. Und so dokumentierte er auf einer weitschweifigen Inschrift in Lambaesis sein heroisches Rettungswerk. Jetzt konnte jeder nachlesen, wie es genau gewesen war. Nonius verschwieg nicht einmal, dass er auf dem Weg nach Saldae von Räubern überfallen worden war, dass man ihm Verwundungen zugefügt und ihn ausgeraubt hatte. Doch davon ließ er sich natürlich nicht beeindrucken. »Ich habe«, teilt er auf der Inschrift mit, »die Arbeiten genau zugeteilt, damit jeder wusste, welche Streckenlänge des Vortriebs er zu bearbeiten hatte.« Aber Nonius Datus war sich auch darüber im Klaren, dass es für die Arbeiter kein Vergnügen war, sich in den dunklen Berg hineinzubohren. Also verwandelte er sich in einen Motivationskünstler und veranstaltete einen Wettbewerb. Die Soldaten sollten das Ganze folglich sportlich sehen und versuchen, zwar sauber, aber doch möglichst schnell das Werk zu vollenden. Tatsächlich trafen sich die beiden Gruppen so ziemlich in der Mitte des Berges. »Und so kam man«, wie der Ingenieur auf der Inschrift stolz konstatiert, »zum Durchstich des Berges. Ich also«, fügt er dann hinzu, nun zu dem kommend, was er eigentlich mitteilen wollte, »der ich als erster das Niveau ermittelt, die Richtung gewiesen und die Arbeiten hatte machen lassen nach dem Plan, den ich dem Prokurator Petronius