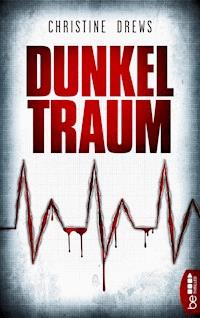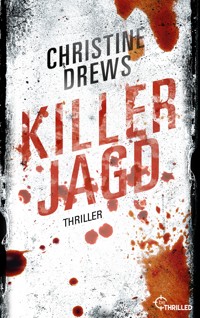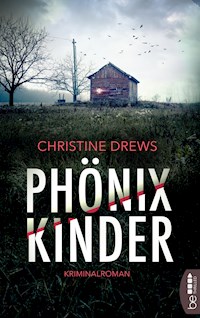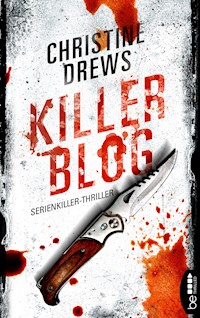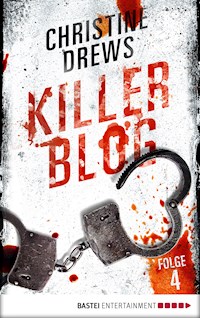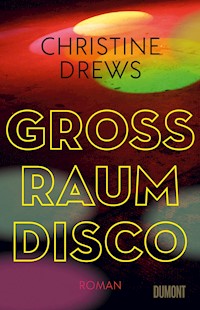
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
1986 in der norddeutschen Provinz. Anni Fehrmann feiert ausgelassen in der Großraumdisco mit ihrer besten Freundin Vera ihr Abitur. Doch ausgerechnet die vermeintlich größte Party ihres Lebens endet für sie in einem Desaster: Sie wird in der Abizeitung übel verspottet. Anni leidet unter Zwangshandlungen; ob Kaffeetrinken oder mit einem Jungen schlafen, sie muss alles drei Mal machen. Niemand hat davon gewusst – außer Vera. Anni kann nicht fassen, derart verraten worden zu sein, und sie flieht: vom Abiball, vor Vera, ihrer Heimat, ihrer Vergangenheit. Sie geht nach Bremen, um dort Psychologie zu studieren. Nach und nach kommt sie dabei den Ursachen ihrer Zwänge auf die Spur. Und sie beginnt schließlich, sich der Welt wieder zu öffnen. Anni findet Freunde, lernt in einer Disco den erfolgreichen Banker Christian kennen und nimmt einen Studentenjob bei einer beliebten Fernsehshow an. Alles scheint sich zum Guten zu wenden – doch ist es wirklich möglich, das Glück zu finden, wenn man sich den eigenen Dämonen nicht stellt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Ähnliche
1986 in der norddeutschen Provinz. Anni Fehrmann feiert ausgelassen in der Großraumdisco mit ihrer besten Freundin Vera ihr Abitur. Doch ausgerechnet die vermeintlich größte Party ihres Lebens endet für sie in einem Desaster: Sie wird in der Abizeitung übel verspottet. Anni leidet unter Zwangshandlungen; ob Kaffeetrinken oder mit einem Jungen schlafen, sie muss alles drei Mal machen. Niemand hat davon gewusst – außer Vera. Anni kann nicht fassen, derart verraten worden zu sein, und sie flieht: vom Abiball, vor Vera, ihrer Heimat, ihrer Vergangenheit. Sie geht nach Bremen, um dort Psychologie zu studieren. Nach und nach kommt sie dabei den Ursachen ihrer Zwänge auf die Spur. Und sie beginnt schließlich, sich der Welt wieder zu öffnen. Anni findet Freunde, lernt in einer Disco den erfolgreichen Banker Christian kennen und nimmt einen Studentenjob bei einer beliebten Fernsehshow an. Alles scheint sich zum Guten zu wenden – doch ist es wirklich möglich, das Glück zu finden, wenn man sich den eigenen Dämonen nicht stellt?
© Teresa Rothwangl
CHRISTINE DREWS ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Mit ›Schattenfreundin‹ veröffentlichte sie 2013 ihren ersten Roman, der in sechs Sprachen übersetzt und fürs ZDF verfilmt wurde. Neben Kriminalromanen und Thrillern schreibt sie auch Familienromane. Außerdem verfasst sie Drehbücher für Filme und TV-Serien. Nachdem Christine Drews einige Jahre in England gelebt hat, wohnt sie heute mit ihrer Familie in Köln. Bei DuMont erschien 2021 ihr Roman ›Freiflug‹.
Christine Drews
GROSSRAUMDISCO
Roman
Zu diesem Roman wurde ich durch wahre Begebenheiten inspiriert.
Trotzdem sind alle Personen frei erfunden und mögliche Ähnlichkeiten rein zufällig.
Christine Drews
Von Christine Drews ist bei DuMont außerdem erschienen:
Freiflug
eBook 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8283-0
www.dumont-buchverlag.de
–1–
Als ich in die Straße einbog, an deren Ende das Cincinnati lag, wurde mir übel. Ich fuhr rechts ran und stellte den Motor aus. Infekt oder Lebensmittelvergiftung konnte ich ausschließen. Ersteres, weil ich seit Tagen keinen Kontakt zu Menschen gehabt hatte, Letzteres, weil ich heute bis auf ein paar Liter Kaffee noch nichts hatte zu mir nehmen können. Die Aufregung war einfach zu groß.
Ich kam direkt aus dem Kloster Maria Laach, wo ich wie jedes Jahr eine Woche in völliger Abgeschiedenheit verbracht hatte, ohne Handyempfang, Netz oder Telefon. Nicht aus religiösen Gründen, sondern zum digital detox, das nirgendwo so perfekt umgesetzt werden konnte wie im Funkloch-Kloster am abgeschiedenen See. Diese Ruhe tat mir jedes Jahr gut, aber diesmal war es ganz besonders gewesen. Ich hatte mich mit etwas beschäftigt, das ich schon so viele Jahre vor mir hergeschoben, verdrängt, ja fast vergessen hatte. Jetzt war es endlich so weit, dieses Kapitel abzuschließen. Besser gesagt: Ich war so weit.
Und nun saß ich nach sieben Stunden Autofahrt am Straßenrand und versuchte mir einzureden, dass es keinen Grund gab, nervös zu sein. Ich hatte in meinem Leben weiß Gott andere Prüfungen hinter mich gebracht, die weitaus herausfordernder gewesen waren als dieses Abi-Treffen. Aber ich konnte noch so sehr versuchen, mich zu beruhigen, es half nichts. Mir war so schlecht wie damals.
Ich öffnete die Tür, schloss sie wieder, öffnete sie erneut und zog sie wieder zu, nur um dann beim dritten Mal endgültig aus dem Wagen zu kotzen. Geistesgegenwärtig hielt ich mir mit der einen Hand die Haare aus dem Gesicht, während ich mit der anderen meine Bluse zu schützen versuchte. Nichts machte sich auf dem hellblauen Seidenstoff schlechter als ein paar Spritzer Kaffee vermischt mit Magensäure.
Meine Güte. Wie einen die Schulzeit stressen konnte. Selbst wenn sie so viele Jahre zurücklag.
Ich lehnte mich im Sitz zurück, klappte die Sonnenblende herunter und kontrollierte im Spiegel mein Make-up. Ein bisschen Puder und Lipgloss stellten den ursprünglichen Zustand schnell wieder her, Wasser und Kaugummi sorgten dafür, dass der üble Geschmack aus meinem Mund verschwand. Ernst blickte ich in meine graublauen Augen, die immer mehr Grautöne bekamen. Wäre zu schön, wenn ich sie auch färben könnte, wie meine Haare, die seit Jahren dasselbe Dunkelblond hatten.
»Es wird toll werden«, sagte ich laut zu mir selbst. »Und wenn nicht, dann verschwindest du eben wieder.«
Ich war nicht zum zehnjährigen Abi-Treffen gegangen, nicht zum zwanzigjährigen und auch nicht zum dreißigjährigen. Ich hatte mit meiner Schulzeit, ja nach dem Tod meiner Eltern sogar mit ganz Bitterheide, vollkommen abgeschlossen. Und das schon seit Jahrzehnten. Bis vor Kurzem wäre ich auch niemals auf die Idee gekommen, zum fünfunddreißigjährigen Abi-Treffen zu fahren. Kein Mensch feierte ein fünfunddreißigjähriges Jubiläum, normalerweise warteten alle auf das vierzigste. Aber wegen der Pandemie hatte sich alles geändert, so jedenfalls hatten es die Organisatoren in die Einladung geschrieben. Fast ein Drittel unseres alten Jahrgangs sei bereits verstorben, weshalb man den Sommer unbedingt nutzen wollte, um endlich mal wieder richtig zu feiern.
Die so beiläufig eingestreute Information über meine verstorbenen Klassenkameraden war aber eigentlich nur ein Vorwand für mich gewesen, mich bei der Feier anzumelden, auch wenn ich zu niemandem den Kontakt gepflegt hatte. Wofür es gute Gründe gab. Aber trotzdem hatte ich mit diesen Menschen einen nicht unwichtigen Teil meines Lebens verbracht, und vielleicht lag es an meinem Alter, dass ich inzwischen mit etwas mehr Milde auf die Vergangenheit zurückblicken konnte. Das hatte ich jedenfalls versucht, mir einzureden.
Der wahre Grund, warum ich mich angemeldet hatte, war das Orga-Team, das unter der Einladung stand. Veras Name tauchte da zwischen einigen anderen auf, die mir immer noch vertraut waren. Das und die Tatsache, dass mein Keller vor einer Woche überschwemmt worden war, hatten mich heute hierhergebracht.
Es waren nur noch ein paar Hundert Meter bis zum Cincinnati, und ich beschloss, die restliche Strecke zu Fuß zurückzulegen. Ein bisschen frische Luft würde mir guttun.
Ich schnappte mir Mantel und Tasche und ging die Straße entlang, über die ich früher unzählige Male getorkelt, gelaufen und getanzt war und an deren Ende der große viereckige Bau stand, mitten in der Pampa.
Natürlich war das Cincinnati heute keine Großraumdisco mehr. Event- und Mehrzweckhalle Bremen Nord stand in großen Lettern über dem Eingang. Bremen Nord war ein fast dreister Euphemismus. Von Bremen musste man gut vierzig Kilometer bis zur Halle fahren; bis nach Bitterheide waren es dann noch mal zehn mehr. Angeblich feierte ja das Landleben ein großes Revival, aber bis hierhin schien sich dieser Trend noch nicht herumgesprochen zu haben. Wahrscheinlich betraf das nur das Berliner Umland, in das sich die gut verdienende Klientel vom Prenzlauer Berg zurückzog. Dass sich jemand von den hippen Städtern in das Zentrum der Schweinebauern nach Niedersachsen verirrte, war kaum vorstellbar. Auch wenn ich wusste, dass es mindestens einen solchen jemand gab.
Über der Eingangstür vom Cincinnati hing ein großes Plakat. Der beste Jahrgang – ohne Glykol, aber scharf im Abgang! Das war unser Slogan gewesen, den wir mit Edding auf unsere T-Shirts geschrieben hatten, als wir uns in der Abi-Nacht in der Schule verbarrikadiert und den Billigwein von der Tankstelle literweise in uns hineingekippt hatten. Ob man das Zeug bedenkenlos trinken konnte? Vermutlich nicht. Der Glykol-Skandal war zu der Zeit wortwörtlich in aller Munde gewesen. Aber obwohl wir von dem Frostschutzmittel gewusst hatten, hatten wir den Wein für nicht mal drei Mark den Liter getrunken wie andere Leute Wasser. Na ja, wir hatten es überlebt, das fehlende Drittel aus dem Jahrgang hatten wir mit Sicherheit nicht in diesen Tagen verloren.
Ich atmete noch einmal tief durch und sog die gute Landluft ein, die noch genauso ungut roch wie damals. Dann betrat ich die Großraumdisco, die keine mehr war.
Mein Maserati fährt 210! Schwupp, die Polizei hat’s nicht geseh’n! Das macht Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas!
Unser Abi-Song dröhnte aus dem großen Saal, zu dem mich der Gang rechts von der Eingangshalle führte. Die Raumaufteilung im ehemaligen Cincinnati schien sich nicht großartig verändert zu haben. Im Eingangsbereich befand sich heute wie damals die Garderobe. Früher war hier alles mit Spiegeln verkleidet gewesen, was wir wahnsinnig mondän gefunden hatten. Jetzt waren die Wände in nüchternem Weiß gehalten. Große Wegweiser erklärten mir, dass es links zu mehreren kleineren Besprechungsräumen, einem Café und einem Bistro ging. Auch kein großer Unterschied zu früher, als sich dort eine Pizzeria und ein Schnellimbiss um den nächtlichen Heißhunger der Gäste gekümmert hatten. Und rechts ging es in die Großraumdisco, die sich heute Großer Saal nannte und in dem die Feier stattfand.
Auf dem Weg dorthin kamen mir zwei grauhaarige Männer entgegen, die vor mir stehen blieben und mich hemmungslos anstarrten.
»Anni?«, fragte der eine nach einem Moment und streckte mir freudig die Hand entgegen. Er hatte einen Bauch, als hätte er einen Medizinball verschluckt, prall und kugelrund. Sein dunkelblaues Hemd saß darauf wie eine zweite Haut.
Ich hatte keine Ahnung, wer die Typen waren. »Ja. Ihr seid … Ihr seid doch …?«
»Volker! Aus dem Deutsch-LK!« Der Medizinball griff meine Hand und schüttelte sie begeistert. »Und an Chicken wirst du dich ja wohl noch erinnern?«
Langsam dämmerte es mir. »Natürlich. Der Hühnerbaron.«
Der andere Mann grinste. Er war deutlich schlanker als Volker und hatte sich zur Feier des Tages in einen grauen Anzug geschmissen. »Du kannst auch Michael zu mir sagen. Und mit Hühnern habe ich heute nichts mehr zu tun. Alles verkauft. Freut mich, dich zu sehen, Anni, also so hier und jetzt, meine ich.«
Volker kicherte, in genau demselben Tonfall wie früher, und wies mit dem Kopf in Richtung Toiletten. »Wir bringen kurz unser Bier weg, und dann trinken wir einen zusammen, okay? Oder zwei …«
»Oder drei?« Der Hühnerbaron grinste breit.
Ich nickte und versuchte, die ersten Fluchtgedanken zu verdrängen. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die beiden noch dieselben Arschgeigen waren wie früher. Okay, ein paar vielleicht schon, aber auch Typen wie Volker und Michael konnten sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben, das war jedenfalls nicht vollkommen ausgeschlossen.
Laura Branigans Gloria schallte aus den Boxen, als ich den Saal betrat. Die Organisatoren der Feier hatten sich alle Mühe gegeben, dem nüchternen Versammlungsraum ein 80er-Jahre-Flair zu verleihen. Ganz gelungen war es ihnen ehrlich gesagt nicht. Denn natürlich hatte der Schuppen früher ganz anders ausgesehen, niemals wären wir in eine Disco gegangen, in der die Wände mit Postern von Nena und Falco tapeziert waren. So etwas hatte es höchstens im Pfarrgemeindesaal gegeben, aber doch nicht in der angesagtesten Großraumdisco des ganzen Landkreises.
Einige Meter neben der Saaltür standen ein paar Bierzeltgarnituren, rechts daneben verlief die Theke, auf der das Büfett aufgebaut war. Auch eine Reminiszenz an unsere Schulzeit: Ich sah Nudelsalat mit Fleischwurststückchen in Mayonnaise, Platten mit an Zahnstochern aufgepickten Käsewürfeln mit Weintrauben, und die legendäre Schlammbowle durfte natürlich auch nicht fehlen. Wodka mit flüssigem Vanilleeis – meine Kalorienzähler-App würde sich vermutlich sofort selbst löschen, wenn ich davon auch nur ein Glas trank. Auch wenn ich nicht mehr neunzehn sein wollte, wirklich und beim besten Willen nicht, trauerte ich meinem Stoffwechsel von damals doch etwas hinterher, dem Alkohol- und Kalorieneskapaden nichts ausgemacht hatten.
Ein Tischchen mit einem großen Stapel Magazinen schloss sich dem Arrangement an, und ich erkannte mit einem Blick, dass es unsere alten Abizeitungen waren.
Irgendwie schaffte ich es, das Starren und Tuscheln der anderen zu ignorieren. Zielstrebig ging ich zu dem Tischchen, nahm mir eine der alten Abizeitungen und schlug sie auf …
–2–
Auf der Tanzfläche war es inzwischen unerträglich heiß. Kein Wunder, seit Tagen war das Thermometer nicht mehr unter fünfundzwanzig Grad gerutscht, selbst nachts blieb es meistens über der Zwanziger-Marke stehen. Das war viel, besonders hier im Norden. Aber die Temperaturen kamen genau zur rechten Zeit.
Es war unser letzter gemeinsamer Sommer hier. Die Hitze des Tages übertrug sich auf die Nächte, und wir feierten, als gäbe es kein Morgen mehr.
Und obwohl es nur unser letzter Sommer als Schüler war, hatten wir alle das Gefühl, kurz vor einer Zeitenwende zu stehen. Nie wieder würden sechs Wochen Sommerferien auf uns warten, nie wieder ein erster Schultag nach den Ferien, nie wieder ein letzter. Keine Klausuren, keine Hausaufgaben, keinen Herrn Fedler, der einen laut schimpfend ins Klassenbuch eintrug, wenn man nur eine Minute nach dem Gong in den Lateinunterricht eilte, keine durchgeknallte Frau Eckert, die einem das Kaugummikauen im Kunstunterricht verbot, weil man dadurch angeblich beim Zeichnen aus dem Takt kommen konnte. Keiner konnte uns mehr was sagen. Es war vorbei. Wir hatten unser Abitur in der Tasche, mit mehr oder weniger guten Noten bestanden. Das Leben wartete auf uns.
Die Lasershow heizte der ausgelassenen Stimmung auf der Tanzfläche noch zusätzlich ein. Wir tanzten, als hätten wir unsere Finger in die Steckdose gesteckt, und rauchten dabei Kette. Der Einsatz der Nebelmaschine war eigentlich völlig überflüssig, die dicke Nikotinwolke, die über der tanzenden Menge hing, war völlig ausreichend, um die funkelnden Laserblitze noch besser zur Geltung zu bringen.
Es gab nicht viele Popper bei uns im Jahrgang, die meisten von uns konnten sich so einen Style nicht leisten. Und die, die das nötige Kleingeld dafür hatten, stammten in der Regel aus stinkreichen Familien, die Schweine- oder Hühnermastbetriebe besaßen: Ihre Eltern waren durch die Bank so stockkonservativ, dass sie irgendwelche modischen Extravaganzen niemals erlaubt hätten. Daher hatten wir einen Haufen Halb-Popper, die zwar in Lacoste und Benetton rumrannten, ihre Haare aber mit anständigem Mittelscheitel trugen und nicht zur Tolle frisiert. Die meisten von ihnen waren von ihren Eltern mit einem VW Golf ausgestattet worden, ein Abi-Geschenk, das für mich der Inbegriff von Reichtum war und vollkommen jenseits meiner Lebensrealität lag.
Das Dumme am Popper-Dasein war allerdings, dass die meisten zu cool waren, um mit uns anderen auf der Tanzfläche richtig abzufeiern. Während sich der Geldadel also in die dunklen Ecken des Cincinnati zurückzog und eine JPS nach der anderen rauchte, zuckte die Palästinensertuchfraktion bekifft und mit geschlossenen Augen zu den Rhythmen, während der große Rest der Schülerschaft versuchte, so textsicher wie nur möglich jeden Song mitzusingen.
Zu diesem Rest zählte ich genauso wie meine beste Freundin Vera. Wir hatten uns beide in unsere hautengen Moonwashed-Jeans gezwängt und trugen neonfarbene Stretch-Oberteile, die wie eine zweite Haut anlagen. Vera in Gelb, ich in Orange. Für mich ein gewöhnungsbedürftiger Look, zu dem mich Vera tagelang hatte überreden müssen.
Normalerweise versuchte ich, so wenig wie möglich aufzufallen. Ich wollte nie die Ballkönigin sein, nie im Mittelpunkt stehen, sondern hatte mich bewusst für den Platz an der Seitenlinie entschieden. Die Aufmerksamkeit anderer hatte fast etwas Bedrohliches für mich. Wenn ich an die Tafel gerufen wurde, dann war es nicht die Aufgabe, die mir den Angstschweiß auf die Stirn trieb, auch weil ich sie in der Regel ohne große Probleme lösen konnte, sondern die Tatsache, dass in dem Moment alle Blicke auf mir ruhten. Es war die allgegenwärtige Sorge, dass die anderen plötzlich in mich hineinschauen konnten, als hätten sie einen Röntgenblick entwickelt, mit dem sie jede schützende Fassade durchbrechen konnten. Vera machte immer ihre Witzchen darüber und meinte, das sei vollkommen absurd. Aber das war es nicht. Denn die Gefahr, dass jemand etwas bemerken könnte, potenzierte sich, sobald ich im Mittelpunkt stand. Ein Zustand, den ich deshalb tunlichst zu vermeiden versuchte.
Aber Vera, der einzige Mensch auf der Welt, der alles von mir wusste, hatte mich schließlich davon überzeugt, dass die Abifeier ein angemessener Anlass war, einmal richtig auf die Kacke zu hauen. Deshalb hatten wir kurz nach den Prüfungen unsere Dauerwellen auffrischen lassen und mit hellen Strähnen effektvolle Akzente gesetzt. Kim Wilde war nichts gegen uns, auch wenn meine Spitzen jetzt vermutlich für die Ewigkeit zerstört waren.
»Words don’t come easy to me«, grölte Vera in mein Ohr, und ich beschloss, dass der Zeitpunkt für eine Pause an der Theke gekommen war.
»Ich brauch was zu trinken!«, rief ich ihr zu.
Vera nickte nur. »How can I find a way to make you see I love you …«, trällerte sie mit geschlossenen Augen, während ich mir einen Weg durch die Tanzenden bahnte.
»Curaçao mit O-Saft«, schrie ich dem Typen hinter der Theke entgegen, nachdem ich ihn dreimal angestupst hatte, damit er mich überhaupt bemerkte.
»Einmal Grüne Witwe!«, brüllte er seinem Kollegen zu, der sich daraufhin eine Flasche Blue Curaçao schnappte und mit Orangensaft vermischte. »Macht vier Mark«, rief er dann.
Ich zog mein Portemonnaie aus der Tasche und suchte die Münzen heraus. Da ich nur einen Heiermann fand, drückte ich ihm den mit den Worten »stimmt so« in die Hand. In dem Moment, in dem er mir das blaugrüne Gemisch mit einem Schirmchen versehen über die Theke schob, setzte die Musik plötzlich aus und das pfeifende Geräusch einer Mikrofonrückkopplung war zu hören. Dann ein lautes Räuspern, gefolgt von »eins, zwei – okay, ich glaub, es geht.«
Plötzlich erstrahlten Anke und Patrick im Scheinwerferlicht. Unsere beiden Jahrgangssprecher hatten sich auf die riesigen Boxen gestellt und versuchten krampfhaft, das Gleichgewicht zu halten, was mit der enormen Menge Alkohol, die die beiden intus hatten, offensichtlich nicht ganz einfach war.
»Leute, wir haben noch eine Überraschung für euch!«, rief Patrick lallend ins Mikro.
»Die gibt’s aber leider nicht umsonst«, ergänzte Anke. »Haltet also drei Mark bereit und macht euch auf den Weg zu Andreas, der dahinten neben der Theke seinen Stand aufgebaut hat. Und holt euch …«
»Eure Abizeitung!«, schrien beide gleichzeitig in ihre Mikrofone.
Die erneute Rückkopplung zerriss mir fast das Trommelfell. Das einsetzende Gekreische der anderen machte es nicht besser. Nahezu zeitgleich rannten alle auf Andreas zu, der so hacke war, dass er sich mit einer Hand am Tisch festhalten musste, während er mit der anderen die Zeitungen verteilte. Alle griffen begeistert zu, maximal jeder Zweite warf die geforderten drei Mark in das Sparschwein, das neben dem Zeitungsstapel stand.
Der DJ – der vermutlich coolste Typ der Welt, den ich noch nie ohne Kippe im Mundwinkel gesehen hatte – stoppte die Lasershow, ließ das Licht ein bisschen heller werden und Hot Chocolate leise im Hintergrund laufen, während er sich eine Jack-Daniel’s-Pause gönnte.
Innerhalb weniger Minuten hatten sich alle 127Abiturienten im Saal verteilt und blätterten in ihren Zeitungen. Die Stimmung war großartig. Überall wurde getuschelt und gelacht, erstauntes »Erinnerst du dich noch daran?« und »Das gibt’s doch nicht!« war aus jeder Ecke zu hören.
Endlich hatte ich auch mein Exemplar ergattert. Gemeinsam mit Vera ließ ich mich auf der Stufe, die zur Tanzfläche führte, nieder und begann, in der Zeitung zu blättern.
Es gab einen langen Bericht über die Abschlussfahrten, die je nach Leistungskurs entweder nach Rom, Paris oder London gegangen waren und von peinlichen Fotos nur so strotzten. Michael kotzte von der Engelsbrücke, Peter lag besoffen in den Grünanlagen am Eiffelturm, Birgit und Andrea tanzten vorm Buckingham Palace. Keine Frage, auch auf der Abschlussfahrt hatten wir alle ordentlich gebechert, offensichtlich von morgens bis abends, fünf Tage lang.
»Das war echt eine geile Fahrt!«, schwärmte Vera.
»Affengeil«, gab ich ihr recht.
»Schade, dass ich mich nur noch an so wenig erinnern kann«, fügte sie kichernd hinzu. Ich lachte und gab ihr einen Schluck von meinem grünen Getränk ab.
So lustig die Berichte über die Abschlussfahrten auch waren, am meisten interessierte uns alle der hintere Teil der Zeitung, in dem jeder von uns mit einem Foto und ein paar witzigen Sätzen vorgestellt wurde. So wie in den USA die Jahrbücher hervorgekramt wurden, wenn jemand ermordet wurde oder man auf der Suche nach einer verschollenen Person war, so würde man bei uns in solchen Fällen die Abizeitungen nehmen. Das bildeten wir uns jedenfalls ein, weshalb es für einige enorm wichtig war, auf den Bildern so gut wie nur irgend möglich auszusehen.
Außerdem waren diese kommentierten Fotos eine Art nachträgliches Beliebtheitsranking. Wer hatte den besten Spruch bekommen, wer nur Spott? Wer wurde als Erstes genannt, wer als Letztes? Wie würden wir den anderen für immer in Erinnerung bleiben?
Marens Foto war natürlich das erste. Kein Wunder, sie hatte an der Abizeitung mitgearbeitet und war außerdem zweifellos das schönste Mädchen des Jahrgangs. Da sie mit Naturlocken gesegnet war, brauchte sie keine Dauerwelle und hatte im Gegensatz zu uns gesundes, glänzendes Haar, keine Spitzen, die denen von Tannenbäumen ähnelten, und keine Strähnen, die so trocken waren wie Stroh. Schon seit zwei Jahren hatte sie ein Abonnement im Sonnenstudio und daher ganzjährig fabelhaft gebräunte Haut. Natürlich war sie auch auf den neuesten Fitnesstrend aufgesprungen und machte fleißig Aerobic, was nicht zu übersehen war. Auf dem Foto sah sie erwartungsgemäß atemberaubend aus, trug ein bauchfreies Oberteil und lachte in die Kamera. Darüber stand: »Unsere Schönste«.
Vera rollte mit den Augen. »Wie kann man sich denn selbst so eine Überschrift geben?!«
»Warum hast du sie nicht daran gehindert?« Vera hatte auch an der Abizeitung mitgearbeitet, allerdings nur sporadisch.
»Die Frau lässt sich an nichts hindern. Die will ganz groß rauskommen. Wird ihr bestimmt gelingen.«
»Lackiert sich sogar im Deutsch-LK die Nägel«, las ich laut die Unterschrift unter Marens Foto vor und zuckte mit den Schultern. Wir hatten zwar nie viel miteinander zu tun gehabt, aber ich hatte nichts gegen Maren. Sie war zu mir nie besonders freundlich gewesen, aber auch nie gemein. Ich würde ihre Karriere als Model oder Schauspielerin also neidlos vom heimischen Fernseher aus verfolgen können.
»Unser Sportgott!«, kreischte Ulrich hinter mir und brach im nächsten Moment lachend zusammen.
Das Foto, über das er sich so amüsierte, zeigte Frank in einer nicht gerade vorteilhaften Pose. Dank seines Übergewichts war er die ganze Schulzeit über grundsätzlich als Letzter im Sportunterricht gewählt worden, wenn wir Teams zusammenstellen mussten. Ich kannte niemanden, der jemals in Sport eine Fünf auf dem Zeugnis gehabt hatte, außer Frank. Er hatte mir immer ein bisschen leidgetan. Während ich es jahrelang geschafft hatte, unterm Radar zu fliegen, hatte er in dieser Zeit eindeutig im Mittelpunkt von Spott und Hänseleien gestanden. Nicht nur einmal war er von den anderen Jungs in den Mülleimer gesteckt worden, aus dem er sich allein nur schwer hatte befreien können. Zwar hatte Frank über diese Attacken immer gelacht, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er es wirklich witzig fand, in fast jeder zweiten großen Pause mit dem Hintern in diesen verdammten Mülleimern zu stecken.
Vermutlich hatte ihn das Lachen vor Schlimmerem bewahrt. Nicht auszudenken, wie die Jungs reagiert hätten, wenn er geheult oder gejammert hätte. Das wäre vermutlich sein Todesurteil gewesen. Und auch jetzt ließ Frank sich nichts anmerken, oder er amüsierte sich wirklich mit den anderen. Jedenfalls saß er breit grinsend bei Chicken und Volker. Was blieb ihm auch anderes übrig.
Ich blätterte weiter und ließ meinen Blick über die Seiten wandern. Anke, Patrick, Nadine, Kurt – wo war mein Foto?
Zuerst dachte ich, ich hätte mich verguckt. Die Aufnahme stammte von unserer Abschlussfahrt nach Rom. Ich konnte mich noch schemenhaft an den Abend auf der Spanischen Treppe erinnern. Wir hatten billigen Rotwein getrunken und bis in die Puppen die laue Sommernacht genossen. Auf dem Foto war ich schon ziemlich hinüber, blickte mit halb offenen Augen und verschmiertem Kajal in die Kamera. Die Hauptrolle in Ein Zombie hing am Glockenseil hätte ich so locker übernehmen können. Vera hatte das Foto gemacht, und ich erinnerte mich noch genau, wie wir uns schlappgelacht hatten, als sie die entwickelten Aufnahmen zehn Tage nach der Klassenfahrt vom Fotogeschäft abgeholt hatte.
Mir wurde schlecht. Nicht, weil sie eines der unvorteilhaftesten Fotos ausgesucht hatte, die von mir existierten, sondern wegen der Überschrift, die meine beste Freundin gewählt hatte.
Reflexhaft biss ich auf meine Unterlippe, beim dritten Mal so stark, dass ich Blut schmeckte.
»Unsere Irre«, stand über meinem Bild. Und darunter: »Muss sie ihr Abi jetzt dreimal machen?«
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich die Blicke der anderen, die inzwischen ebenfalls mein Foto entdeckt hatten und wahlweise kicherten oder laut lachten.
»Mir war gar nicht klar, dass sie so ballaballa ist«, hörte ich Maren laut sagen, und ihre Fangemeinde gackerte wie eine Horde aufgeregter Hühner.
Entsetzt starrte ich Vera an, die sich ebenfalls köstlich amüsierte und sich keiner Schuld bewusst schien.
»Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht!«, sagte sie lachend. »Ist doch nur ein Spaß!«
»Na, Psycho, soll ich dir noch ’nen Drink mitbringen?«, rief Volker mir zu, der gerade auf dem Weg zur Theke war.
»Bring ihr lieber drei!«, rief Frank ihm zu, und der Saal brach in schallendes Gelächter aus. Unser Sportgott strahlte über das ganze glänzende Gesicht.
Langsam stand ich auf. Ich bemühte mich um ein Lächeln, schaffte es aber eigentlich nur, die Lippen zusammenzupressen. Ich spürte, wie ich ein nervöses Zucken im rechten Auge bekam. Na super. Jetzt wirkte ich wahrscheinlich komplett irre. Ich fuhr mir mit dem Ärmel meines Oberteils über die Augen, und es war mir egal, dass der Stretch nun vermutlich für immer von meinem Make-up versaut war.
»Wo willst du denn hin?« Vera versuchte, mich an der Hose festzuhalten. Mit einem Ruck riss ich mich los und ging Richtung Ausgang. »Jetzt mach doch nicht einen auf beleidigte Leberwurst!«, rief sie mir hinterher. »Herrgott, es war nur ein Spaß!«
Das laute Lachen der anderen hallte hinter mir her, als ich durch den Gang in den Eingangsbereich eilte. Ich stieß die Tür auf und bemühte mich, relativ ruhig am Türsteher vorbeizugehen. Als ich draußen war, wurden meine Schritte immer schneller, und schließlich rannte ich mitten in die Felder hinein, auf denen das Korn inzwischen hüfthoch stand.
–3–
»Vera ist am Telefon.« Meine Mutter stand in der offenen Zimmertür und rümpfte die Nase. »Hier riecht’s wie im Pumakäfig. In einer halben Stunde gibt’s Mittag.«
»Sag ihr, ich bin krank.«
»Du bist nicht krank, sondern verkatert. Ihr Flieger geht morgen schon ganz früh. Willst du dich nicht von ihr verabschieden?«
Vera würde für ein Jahr als Au-pair in die USA gehen. Und nein, ich wollte mich nicht von ihr verabschieden. Ich wollte sie nie wiedersehen.
»Ich rufe sie zurück«, log ich.
»In Ordnung. Dann steh jetzt auf, Kind.«
Ich hörte die Schritte meiner Mutter auf der Holztreppe, die unten in die Diele führte. Dort thronte auf einem kleinen Tischchen der ganze Stolz meines Vaters: ein Tastentelefon in Beige, das unser graues mit Wählscheibe vor einem guten Jahr abgelöst hatte. Die Monatsmiete für den modernen Apparat war zwar etwas teurer, aber das war es Papa wert gewesen. Mit seinen dicken Fingern hatte er immer mehr Schwierigkeiten gehabt, die Wählscheibe zu bedienen, und jetzt flogen seine Finger geradezu über die Tasten. Früher hatte mal ein Sessel neben dem Telefon gestanden, den hatte Papa aber in sein Arbeitszimmer verbannt. Jetzt stand nur noch eine Sanduhr auf dem Tisch, die genau acht Minuten brauchte, bis sie durchgelaufen war. So lange, wie eine Telefoneinheit dauerte. Die Uhr war die ständige Mahnung, sich kurzzufassen, was besonders meiner Mutter und mir schwerfiel. Mamas Verwandtschaft kam aus dem Münsterland, und sie liebte es, sich regelmäßig am Telefon mit ihren Schwestern auszutauschen. Ferngespräche waren bei uns grundsätzlich erst ab 18Uhr erlaubt, und dabei musste man erst recht auf die Telefoneinheiten achten. Sonst wurde es schnell zu teuer, weshalb meine Mutter jedes Telefonat nach sieben Minuten dem Ende zuführte.
»Nein, Vera, sie ruft dich zurück. Ich wünsch dir einen guten Flug morgen! Schreib uns doch mal! Ich habe noch nie Luftpost bekommen. Und pass gut auf dich auf, ja? Gut. Tschüss dann.«
Ich konnte nicht aufstehen. Es lag nicht am Restalkohol und an den Kopfschmerzen, die das ganze süße Gesöff erwartungsgemäß hinterlassen hatte. Die waren zwar auch nicht schön, aber wenn wir Jugendlichen vom Land eines wegstecken konnten, dann war das ein ordentlicher Kater.
Nein, viel schlimmer war das Gefühl in meinem Magen, das ich eigentlich nur von Liebeskummer kannte. Und so etwas Ähnliches hatte ich ja auch. Meine Atmung ging flach, als wären meine Lungen irgendwie blockiert, und mein Herz schlug die ganze Zeit in einem Tempo, dass mir fast schwindelig wurde. Das jetzt war schlimmer als Liebeskummer, war ein geradezu körperlich spürbarer Schmerz, der es mir unmöglich machte, an etwas anderes zu denken als an das, was gestern passiert war.
Ich drehte mich auf die Seite und berührte mit meiner Zungenspitze mehrmals das Kopfkissen. Danach fummelte ich die Fusseln aus meinem Mund und zählte sie durch.
Es hatte mich viel Überwindung gekostet, Vera meinen Tick anzuvertrauen. Ich erinnerte mich noch genau, wie wir gemeinsam vor dem Spiegel gestanden und unsere Brüste miteinander verglichen hatten. Keine drei Jahre lag das zurück.
»Meine sind viel zu groß«, stöhnte Vera.
Ich zog mein Bustier wieder runter. »Ich wäre froh, wenn ich ein bisschen mehr hätte.«
»Bei dir werden sie später wenigstens nicht bis zu den Oberschenkeln baumeln! Ich bestehe den Bleistifttest doch jetzt schon nicht mehr.«
Tatsächlich wurde der Stift, den sie unter ihre Brust geklemmt hatte, perfekt gehalten, auch als sie mit ihrem Oberkörper demonstrativ hin- und herschaukelte.
Ich lachte und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Ab jetzt machen wir den Bleistifttest nur noch zusammen, okay? Alle zehn Jahre! Auch wenn wir alte Omis sind, treffen wir uns vorm Spiegel und checken die Brustsituation!«
Vera lachte laut auf. »Du bist verrückt! Abgemacht! Alle zehn Jahre, egal was ist!«
»Ich bin mir sicher, dass ich den Stift auch irgendwann festhalte wie euer Hund seinen Knochen!« Lachend zog ich den Bleistift unter ihrer Brust hervor und warf ihn auf den Schreibtisch.
Vera grinste und packte ihr D-Körbchen wieder in den BH. Dann sah sie mich ernst an. »Ich bin echt total froh, dass wir über alles quatschen können. Du bist der einzige Mensch, der wirklich alles über mich weiß.«
Für einen winzigen Moment wich ich ihrem Blick aus. »Ja«, sagte ich dann knapp.
Vera zog eine Augenbraue hoch. »Alles okay?« Sie ahnte sofort, wenn mit mir etwas nicht stimmte.
»Klar.«
»Du hast doch was.«
»Nein, alles roger.«
»Verheimlichst du mir etwas?« Sie fasste mich am Arm, so wie es meine Mutter früher gemacht hatte, wenn sie die Wahrheit aus mir hatte herausholen wollen. »Ich erzähle dir immer alles, absolut alles. Ich hab dich sogar in mein Benotungssystem eingeweiht.«
Vera hatte ein Ziffernsystem für Aktivitäten mit Jungs erfunden. Knutschen war eins, Fummeln oberhalb der Gürtellinie zwei, unterhalb drei, Petting vier und Bumsen fünf. Der Zusatz A oder B bewertete die Qualität der Ausführungen. So konnten wir am Telefon oder in der Schule ganz entspannt darüber reden, dass Torben ja eins A war und Guido eher drei B, ohne dass unsere Eltern oder Lehrer den Schimmer einer Ahnung hatten, über was wir wirklich sprachen.
»Und du hast Geheimnisse vor mir?«
»Habe ich nicht …«, antwortete ich leise. Schließlich seufzte ich. Vera hatte recht, wir vertrauten einander wirklich alles an. Warum sollte ich ihr ausgerechnet meinen Tick verschweigen? »Eine Sache habe ich dir vielleicht noch nicht gesagt …«
Stöhnend schwang ich meine Beine aus dem Bett und setzte mich auf die Bettkante. Die katerbedingten Beschwerden entfalteten erst in der aufrechten Position ihre volle Wirkung. Alka-Seltzer würde heute überlebenswichtig sein, so viel stand fest. Und so wenig Kontakt zu meinen Mitmenschen wie nur irgend möglich.
»Du hast Post bekommen«, sagte meine Mutter, als ich mich zu ihr an den Tisch setzte. Mein Vater war noch auf dem Feld, eine Erntemaschine machte Probleme und musste repariert werden. Mein Bruder Hajo war letztes Jahr nach Lornstedt gezogen, einem kleinen Ort nördlich von Bremen, wo er bei einem alten Freund von Papa eine Ausbildung zum Landwirt machte. Seitdem war es recht ruhig in unserem alten Bauernhaus geworden.
»Von wem denn?«, fragte ich nur, ohne aufzublicken.
»Lesen solltest du mit Abitur aber können«, sagte meine Mutter und nahm sich etwas von dem Grünkohl, der auf dem Tisch stand. »Extra mit Pinkel, das magst du doch so gerne.«
»Ich kann noch nichts essen«, stöhnte ich, schob meinen leeren Teller in blau-weißem Delft-Stil weg und griff nach dem Umschlag. Als ich das Logo der Uni Bremen auf dem Brief sah, riss ich ihn auf. Ich überflog die Zeilen und atmete schließlich tief durch, nachdem ich alles gelesen hatte. Dann blickte ich meine Mutter strahlend an.
»Ich habe einen Platz im Studentenwohnheim!«
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Die Wohnungsnot war überall im Land enorm, ich hatte Geschichten von Studenten gehört, die die ersten Wochen im Auto schlafen mussten. Ein Zimmer im Wohnheim kam mir vor wie ein Sechser im Lotto.
Meine Mutter lächelte. »Da wird unsere Kleine nun flügge«, sagte sie mit belegter Stimme.
Mir stiegen sofort die Tränen in die Augen.
»Bremen ist ja nicht weit. Ich komme euch eh permanent besuchen.« Das Gefühl, sie trösten zu müssen, übermannte mich. Bald waren alle drei Kinderzimmer verwaist, aus unterschiedlichen Gründen.
Meine Mutter wischte erst mir und dann sich selbst die Tränen weg. Sie griff nach meiner Hand und drückte sie.
»Das hier ist dein Zuhause, und es steht dir immer offen«, sagte sie mit warmer Stimme. »Aber du musst dich nicht verpflichtet fühlen, uns zu besuchen, es soll dir keine Last sein.«
»Das ist es doch nicht! Das wird es auch niemals sein.«
»Schön … Jetzt beginnt eine aufregende Zeit für dich, Anni. Freu dich darauf!«
Ich versuchte, meinen Kummer wegen Veras Verrat herunterzuschlucken, aber er blieb mir wie ein Kloß im Halse stecken. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den gestrigen Abend jemals vergessen und mich auf das, was vor mir lag, freuen sollte. Vielleicht würde mir Letzteres irgendwann gelingen. Aber vergessen würde ich niemals, das wurde mir in dem Moment sehr klar.
Dennoch. Meine Mutter hatte recht. Bald würde ich zwar nicht die letzte Nacht hinter mir lassen, aber alles andere schon. Die ganze ländliche Einöde, in der wir uns mit Dosenschießen im Bushaltestellenhäuschen die Abende vertrieben hatten und in der ein Besuch im Cincinnati das Größte war. Ich freute mich auf die Anonymität der Großstadt, auf den Neuanfang, auf Leute, die mich nicht kannten und nichts von mir wussten. Auf eine neue Zeit.
–4–
Kritisch musterte sie ihr Spiegelbild. Normalerweise saß das Etuikleid aus schwarzer Seide perfekt, aber heute spannte es sich merklich über ihrem Bauch. Man könnte meinen, sie wäre im fünften Monat. Tatsächlich war sie einfach nur verstopft. Und das schon seit Tagen. Gestern Mittag hatte sie dann ein Abführmittel genommen, aber weder am Abend noch heute Morgen hatte es die gewünschte Wirkung gezeigt, obwohl die laut Beipackzettel nach sechs Stunden einsetzen sollte. Zum Glück hatte sie noch eine passende Spanx in der Schublade, die den Bauch hoffentlich ein wenig wegdrücken würde. Mit Mühe und Not zwängte sie sich in die Bauchweghose und betrachtete sich von der Seite. Vierter Monat, dachte sie, immerhin.
Sie versuchte, das Magenkneifen zu ignorieren, das genau dann einsetzte, als sie am Arm ihres Mannes die Stufen zum Festsaal der Gemeinde hinaufstöckelte. Ein wichtiger Abend wartete auf ihn, vielleicht der wichtigste seiner Karriere.
»Ich bin ganz schön nervös.«
Sie lächelte ihm aufmunternd zu. »Was soll denn passieren, Schatz? Du wirst geehrt und ausgezeichnet, und alle werden dich feiern. Das ist dein Tag!«
Er atmete tief durch. »Ich weiß. Dann wollen wir mal.«
Mit Schwung öffnete er die große Tür, und gemeinsam betraten sie den Saal. Die Leute standen zum Teil noch vor ihren Tischen und plauderten, einige hatten sich schon gesetzt. Alle hatten sich herausgeputzt, die Damen im schicken Cocktailkleid, die Herren im dunklen Anzug. Grüßend gingen sie durch die Menge, und während er nicht mehr als ein freundliches »Guten Abend« hervorbrachte, scherzte sie im Vorbeigehen mit der Professorin aus Bremen und mit dem Landrat und seiner Frau.
Plötzlich begann jedoch ihr Magen lautstark zu grummeln, reflexhaft drückte sie eine Hand darauf. Sie versuchte, das Geräusch mit einem Lachen zu übertünchen, war sich aber gar nicht sicher, ob es überhaupt einen Anlass für ihren spontanen Heiterkeitsausbruch gab. Zum Glück schien ihre hilflose Fröhlichkeit niemandem besonders aufzufallen.
Ihr Tisch war in der ersten Reihe, direkt vor der Bühne, auf der die Reden gehalten wurden. Er würde heute den nationalen Innovationspreis im Bereich ökologische Landwirtschaft erhalten, der mit 20.000Euro dotiert war. Insgesamt würde es drei Preisträger geben. Neben ihm sollten noch ein Vertreter aus dem Bereich Naturschutz und einer aus der Kategorie Tierwohl ausgezeichnet werden.
Aber zunächst gab es einen Aperitif, dann wurde die Suppe serviert, bevor der erste Redner die Bühne betrat und mit seiner Laudatio begann. Leider schaffte sie es nicht, sich auf das zu konzentrieren, was er sagte. Ihr Magen-Darm-Trakt ließ es nicht zu, so sehr sie sich auch bemühte. Jetzt konnte sie das laute Grummeln nur noch schlecht mit einem ebenso lauten Lachen übertönen und begann deshalb, zu hüsteln und sich zu räuspern, und kam sich dabei so albern vor, dass sie fast schon wieder lachen musste.
Aber nach dem ersten Löffel Suppe war ihr klar, dass sie ernsthafte Probleme hatte. Das Kneifen und Grummeln in ihrem Bauch wurde immer schlimmer.
Würde etwa jetzt das Abführmittel wirken? Sechsunddreißig Stunden nach der Einnahme?
Nervös knetete sie die Serviette zwischen ihren Fingern. Das konnte doch nicht wahr sein.
Steiger dich jetzt bloß nicht in etwas hinein, ging es ihr durch den Kopf, während sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach. Sie konnte jetzt unmöglich aufstehen und zur Toilette gehen, doch nicht kurz vor der Preisverleihung!
Der laute Applaus unterbrach ihre immer panischer werdenden Gedanken.
Er gab ihr einen Kuss auf die Wange und stand auf, um nach vorn zu gehen. Strahlend blickte er von der Bühne in den Saal und nahm schließlich den Preis entgegen, der ihm gereicht wurde. Es war eine abstrakt gestaltete goldene Trophäe, auf der sein Name eingraviert worden war. Dann ging er ans Mikro, räusperte sich kurz und begann mit seiner Dankesrede.
Es wurde immer schlimmer. Ihre Haltung verkrampfte sich, ob sie wollte oder nicht. Sie verschränkte ihre Beine, rutschte auf dem Sitz hin und her, drückte immer wieder unauffällig eine Faust in den Bauch und versuchte dabei, ihm auf der Bühne zuzulächeln. Der Schweiß lief ihr inzwischen in Strömen den Rücken hinunter.
Es hatte keinen Zweck mehr, sie musste hier raus. Sonst würde eine Katastrophe passieren.
»Besonders danken möchte ich meiner lieben Frau …«
In dem Moment sprang sie auf und eilte aus dem Saal. Ihr Mann verstummte, und sie konnte seine Überraschung spüren.
»Die offensichtlich noch etwas anderes vorhat!«, scherzte er dann, und der Saal lachte.
Sie kam sich vor wie ein Model im Suff, als sie auf ihren High Heels durch die Menge wankte. Die Gesäßmuskulatur zusammengekniffen wie bei der schlimmsten Pilates-Übung, bemüht aufrecht, aber doch leicht nach vorn gebeugt, um die Krämpfe zu ertragen, dabei zwanghaft lächelnd und leicht schwankend, weil sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.
»Wo willst du denn hin, Schatz?«, rief er in dem Moment, und sie spürte, wie alle sie anstarrten.
Kurz vor der Saaltür blieb sie stehen und drehte sich zu ihm um, suchte nach einer charmanten Entschuldigung und lächelte verzweifelt in die Menge.
Dann passierte es.
–5–
»Guten Morgen, Chrissi«, flötete die Sekretärin am Empfang, als er in seinem Maßanzug durch die Eingangshalle schritt.
Wie immer strich er sich durch seine dunklen, nach hinten gegelten Haare und beugte sich lächelnd zu ihr über den Tresen.
»In der Bank bitte Herr Richter, Frau Franzen. Heute Abend sind wir dann gerne wieder Moni und Chrissi.« Er zwinkerte ihr zu und eilte in den Fahrstuhl, ohne eine Reaktion von ihr abzuwarten.
Christian war nicht der Typ, der zweimal mit derselben Frau schlief. Einige Kollegen behaupteten, dass er bereits mit allen weiblichen Angestellten des Hauses im Bett gewesen sei. Natürlich stritt Christian das vehement ab, was aber in erster Linie daran lag, dass er den Überblick verloren hatte. Möglicherweise hatte er sie schon alle gebumst, vielleicht fehlten ihm aber auch noch ein paar. Er wusste es nicht.
Grundsätzlich war es ihm egal, was andere über ihn dachten. Christian war jung, ungebunden, sah blendend aus und verdiente einen Haufen Geld. Frauen und Partys gehörten zu seinem Lifestyle wie der schwarze Kaffee am Morgen und die Line am Abend. Er war noch nicht mal dreißig und arbeitete in einer leitenden Position in der größten Privatbank der Stadt. Sein großes Ziel war, als Investmentbanker in die Dependance nach Frankfurt zu wechseln. Frankfurt war für Christian wie ein Heilsversprechen, der Traum aller Banker, der Himmel auf Erden für einen Workaholic wie ihn. Sein ganzes Leben drehte sich um den Job – und ums Ausgehen nach dem Job. Er hatte einen großen Bekanntenkreis, mit dem er regelmäßig feiern ging. Richtige Freunde besaß er aber nicht. Außer einen. Für mehr Vertrauenspersonen war in seinem Leben kein Platz.
Paul Linden arbeitete schon genauso lange bei der Bank wie er. Die beiden hatten sich am Anfang ein Büro geteilt und waren dann gemeinsam die Karriereleiter hinaufgeklettert.
»Die Bicolor habe ich mir nach dem letzten Abschluss gegönnt«, flüsterte Christian ihm in der morgendlichen Konferenz zu, als Paul ungeniert auf die neue Rolex an seinem Handgelenk starrte.
»Geil. Wie teuer?«
»Teuer genug.«
Paul nickte anerkennend. »Ich hab übrigens einen neuen Dealer. Viel zuverlässiger als der letzte, liefert sogar. Willst du’s probieren?«
Sie mussten aufpassen, dass man sie nicht hörte. Bremen war nicht Frankfurt, wo vermutlich jeder zweite Banker eine Koksnase war. Aber selbst dort sollte man so etwas nicht an die große Glocke hängen. Und hier schon mal gar nicht. Die alten Herren in der Chefetage konnten mit dem weißen Pulver garantiert nichts anfangen und würden vermutlich ganz schön Ärger machen, wenn sie von dem Konsum ihrer Mitarbeiter wüssten.
Aber für Christian war das Zeug ideal. Es half ihm, einiges zu vergessen und sich dafür auf anderes voll zu fokussieren. Wenn er nach einem Vierzehn-Stunden-Tag aus der Bank kam, brauchte er dringend eine Nase, bevor er sich ins Nachtleben stürzte. Oft genug legte er noch am nächsten Tag in der Mittagszeit nach, wenn die Müdigkeit zu stark wurde und seine Konzentration nachließ. In letzter Zeit hatte er allerdings häufig mit Nasenbluten zu tun gehabt, was er auf die mangelnde Qualität des Stoffs zurückführte. Man hörte immer wieder davon, dass die Dealer das Zeug streckten. Neulich erst hatte er gelesen, dass sie dem Koks meistens irgendein Tierentwurmungsmittel beimischten. Und dass ein Medikament, das Hunden und Katzen die Würmer aus dem Darm jagte, gut für seine Nasenscheidewand war, bezweifelte er doch stark.
»Nee, nee, das hier ist besser«, flüsterte Paul, nachdem Christian seine Stoffkritik geäußert hatte. »Der macht so ’n Scheiß nicht. Ist dafür natürlich auch teurer.«
»Das wäre es mir wert.«
»Dachte ich mir. Damit vögelst du die Nacht durch und bist am nächsten Tag topfit. Und wenn du morgens eine Line nachlegst, kannst du den ganzen Tag durcharbeiten, ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Klingt gut.«
»Ist es auch.«
Während Bankdirektor Schmidde, ein älterer Herr, der noch während des Ersten Weltkriegs geboren worden war, die neue Investmentstrategie der Bank erklärte, drückte Paul ihm unter dem Besprechungstisch ein Tütchen in die Hand.
»150.«
Christian nickte. »Gebe ich dir später.«
Unauffällig steckte er das kleine Tütchen in die Innentasche seines Jacketts und bemühte sich, den Worten des Seniors wieder einigermaßen aufmerksam zu folgen. Aber allein die Tatsache, dass er nun im Besitz dieses vermeintlichen Wunderstoffs war, ließ ihn Schmetterlinge im Bauch verspüren, die er das letzte Mal als 15-Jähriger gefühlt hatte, als er in das Nachbarsmädchen verliebt war, das er nur dreimal im Jahr sehen konnte, wenn er aus dem Internat nach Hause durfte.
In der Kaffeepause zog er sich sofort auf die Toilette zurück, schloss sich in der Kabine ein und klappte den Deckel herunter. Vorsichtig breitete er das Pulver darauf aus, nahm seine goldene American Express Card und formte zwei Lines. Dann holte er den abgeschnittenen Strohhalm aus seiner Tasche, den er inzwischen immer bei sich hatte, ging in die Knie und setzte an.
Der medizinische Geschmack, der ihm durch die Nase in den Rachen zog, war für ihn ein erstes Qualitätsmerkmal. Stark gestreckter Stoff schmeckte anders. Als Nächstes erhöhte sich seine Herzfrequenz, sein Puls schien sich zu verdoppeln. Trotzdem setzte er den Strohhalm erneut an. Die nächste Ladung schmerzte in der Nase, schien aber auf dem direkten Weg ins Gehirn zu gehen. Jedenfalls hatte er mit einem Mal das Gefühl, dass alle seine Hirnzellen schlagartig angeschaltet waren, so als würden sie unter Strom stehen.
»Na bitte!«, entfuhr es ihm. »Geht doch!«
Aus der Nebenkabine war ein leises, wohlwollendes Lachen zu hören. »Ja, ja, manchmal sind es die einfachen Dinge, die einen erfreuen. Bei mir klappt es auch nicht immer so gut. Ein starker Kaffee kann helfen!«
Für einen Augenblick erstarrte Christian. Die Stimme … das war doch Direktor Schmidde? Himmelherrgott, kokste er sich hier etwa gerade zu, während der alte Senior in der Nebenkabine sein Geschäft erledigte?
Hektisch packte Christian seine Koksutensilien zusammen und betätigte die Spülung. Bloß raus hier!
Er wusste, dass er im ersten Rausch zu Überreaktionen neigte. Dass das Zeug einem den Kopf klarpustete, war schließlich nicht mehr als eine Illusion, auch das war ihm klar. De facto sorgte es eigentlich nur dafür, dass er sich für den Größten hielt, was im Bankgeschäft zwar hilfreich sein konnte, beim nachbarschaftlichen Toilettengang mit dem Seniorchef aber zu Missverständnissen führen konnte.
Als er gerade an den Waschbecken vorbeistürmen wollte, hörte er die Stimme des Direktors hinter sich.
»Gehört das Ihnen?«
Langsam drehte Christian sich um und versuchte, möglichst viel Speichel in seinem Mund zu sammeln, um die betäubende Wirkung des Kokses hinunterschlucken zu können. Direktor Schmidde stand vor der Toilettenkabine und hielt ein Foto in der Hand, das er vom Boden aufgehoben hatte. Es musste aus Christians Portemonnaie geglitten sein, als er seine AmEx hektisch wieder eingepackt hatte.
»Ich glaube nicht«, brachte er mit bemüht fester Stimme hervor.
Stirnrunzelnd blickte der Direktor auf das kleine Foto. »Sind das nicht Sie in jungen Jahren? Gemeinsam mit Ihren Eltern? Ich kenne Ihren Vater doch noch von früher!« Er trat näher und hielt Christian das Bild unter die Nase.
Zögerlich blickte er darauf und sah innerhalb von wenigen Sekunden die längst vergangene Szene wieder vor sich. Er war neun Jahre alt, hatte die Grundschule gerade beendet und saß mit seinen Eltern beim Fotografen. Alle seine Freunde freuten sich auf sechs Wochen Sommerferien, aufs Freibad, den Strand, das Meer. Nur für ihn fiel der Urlaub aus. Schon in zwei Tagen wollten ihn die Eltern in die Schweiz bringen, wo er ein hervorragendes Internat besuchen würde, das beste im ganzen Land, vermutlich in ganz Europa. Bis zu seinem Abi sollte er da bleiben. Christian konnte die Angst, die ihn bei diesem Abschiedsfoto fast gelähmt hatte, in diesem Moment wieder deutlich spüren, und er hoffte, dass das Koks schnellstens seine volle Wirkung entfaltete, damit er wieder vergessen und sich auf das Wichtige fokussieren konnte.
»Ja, tatsächlich. Danke«, sagte er kurz angebunden, schnappte sich das Foto und steckte es in die Innentasche seines Sakkos.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eilte er aus dem Waschraum und stürmte in Pauls Büro. Der saß mit ernster Miene am Telefon und versuchte, Christian mit abwinkenden Handbewegungen zu signalisieren, dass es jetzt gerade schlecht war. Schweißflecke hatten sich unter seinen Armen gebildet. Sein Bauchansatz hing über den Gürtel, und Christian ging kurz der Gedanke durch den Kopf, dass sein Freund dringend abspecken müsste.
Außer Atem ließ er sich auf den Sessel vor Pauls Schreibtisch fallen. Sein Freund rollte mit den Augen und hielt kurz eine Hand vor die Sprechmuschel.
»Es ist gerade schlecht«, raunte er Christian zu.
»Kein Problem«, antwortete er. »Ich warte einfach, bis du fertig bist.«
Paul presste die Lippen aufeinander und lauschte noch mal kurz in den Hörer. »Carla, ich muss jetzt Schluss machen … Nein, es geht jetzt nicht mehr! Bis heute Abend.« Er legte auf und sah Christian genervt an. »Hatte ich nicht deutlich gemacht, dass ich in Ruhe telefonieren muss?«
»War doch nur Carla. Ich muss dir was erzählen, du glaubst nicht, was mir gerade auf dem Klo passiert ist!« Er kicherte und konnte sich kaum noch einkriegen. Dann erzählte er in atemberaubendem Tempo, was er gerade erlebt hatte, wobei er die Sache mit dem Foto ausließ. Sie war aus seinem Hirn verschwunden.
»Toll«, sagte Paul kühl, als Christian fertig war. »Dafür habe ich also gerade meinen Ehestreit unterbrochen.«
»Scheiß drauf.«
»Nee, tu ich nicht. Carla und ich … Ich befürchte, wir haben wirklich Probleme …«
»Ja, ja, die Weiber. Jetzt stell dir mal vor, der Schmidde hätte mitgekriegt, wie ich mir ’ne Nase ziehe!« Christian schüttelte sich vor Lachen. Dann sprang er voller Energie auf. »Geiles Zeug jedenfalls, tolle Sache, heute Abend gehen wir steil, das müssen wir feiern, lass uns ins Exil, da ist Ladies Night, für die Mädels alles zum halben Preis, für uns der größte Spaß, da können wir uns die Schnecken aussuchen …«
»Jetzt stopp mal!« Paul war sichtlich genervt. »Du redest wie ein Maschinengewehr. Ich kann heute Abend nicht.«
»Wir können uns ja etwas später treffen. Sagen wir um zehn? Vielleicht in der Bar um die Ecke?«
»Ich sagte: Ich kann nicht.« Paul atmete tief durch. »Ich muss heute Abend mit Carla sprechen …«
»Prima, dann kommst du nach! Ich warte auf dich!«
Christian klopfte Paul auf die Schulter und marschierte in demselben Eiltempo aus dem Büro, in dem er vor wenigen Minuten hereingekommen war.
–6–
Eine Jugend auf dem Dorf war ohne Dosenschießen im Bushaltestellenhäuschen kaum vorstellbar. Und natürlich hatten wir rund um unser Abi gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr.