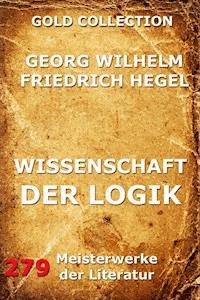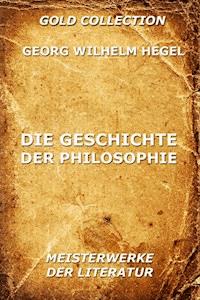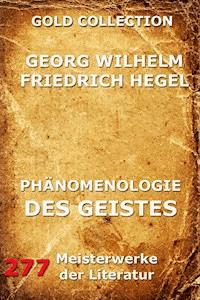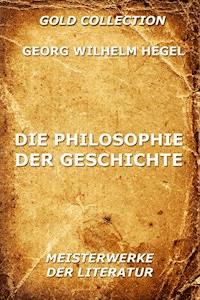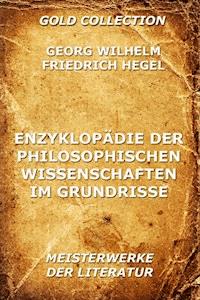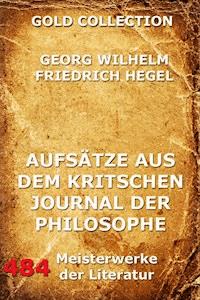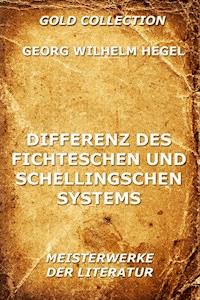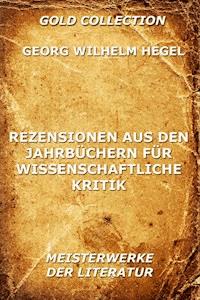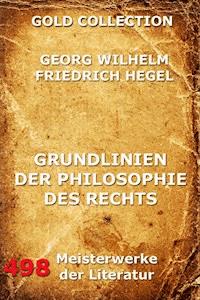
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Hegels Werk Grundlinien der Philosophie des Rechts wurde 1820 vollendet, aber wegen Zensurproblemen erst 1821 veröffentlicht. Es behandelt die Frage nach einem Rechtssystem, das historische Erfahrung und spekulative Vernunft verbindet. Der Rechtsphilosophie Hegels liegt eine Metaphysik zu Grunde, die alles aus der dialektischen Bewegung des Begriffes ableitet. Sein Gesamtwerk stellt einen absoluten Geist dar, der aus Kunst, Religion, und Philosophie resultiert. Das Recht ist ein Element des objektiven Geistes. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundlinien der Philosophie des Rechts
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Inhalt:
Georg Friedrich Wilhelm Hegel – Biografie und Bibliografie
Grundlinien der Philosophie des Rechts
Vorrede
Einleitung
Einteilung
Erster Teil. Das abstrakte Recht
Erster Abschnitt. Das Eigentum
Zweiter Abschnitt. Der Vertrag
Dritter Abschnitt. Das Unrecht
Zweiter Teil. Die Moralität
Erster Abschnitt. Der Vorsatz und die Schuld
Zweiter Abschnitt. Die Absicht und das Wohl
Dritter Abschnitt. Das Gute und das Gewissen
Dritter Teil. Die Sittlichkeit
Erster Abschnitt.
Die Familie
Zweiter Abschnitt. Die bürgerliche Gesellschaft
Dritter Abschnitt. Der Staat
Fußnoten
Grundlinien der Philosophie des Rechts, G. W. Hegel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617011
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Georg Friedrich Wilhelm Hegel – Biografie und Bibliografie
Geb. 27. August 1770 in Stuttgart, studierte in Tübingen Theologie und Philosophie, war erst Hauslehrer in Bern, dann in Frankfurt. a. M., habilitierte sich 1801 in Jena, wo er Mitherausgeber des »Kritischen Journal der Philosophie« wurde find eine außerordentliche Professur erhielt, die er 1805 aufgab. 1805-1808 war er Redakteur der »Bamberger Zeitung«, 1808-1816 Direktor des Ägidiengymnasiums in Nürnberg, 1816-1818 Prof. in Heidelberg, von da an Prof. in Berlin, wo er eine außerordentliche Zahl von Hörern hatte und als »preußischer Staatsphilosoph« galt. Er starb (an der Cholera) am 14. November 1831 in Berlin.
H. ist der bedeutendste Philosoph des 19. Jahrhunderts. Schwerfällig und in seiner Ausdrucksweise oft dunkel, beweist er doch eine gewaltige logisch-spekulative Kraft, mit der er den Erfahrungsinhalt zur Einheit eines Systems des absoluten Idealismus zu verarbeiten sucht. Von Heraklit, Plato, Aristoteles, dem Neuplatonismus, Spinoza, Leibniz, Herder. Kant, Fichte und Schelling beeinflusst, ist er der Begründer einer neuen Weltanschauung und Methodik geworden, des Panlogismus, der aus einer logischen (»dialektischen«) Denkbewegung den Erkenntnisinhalt ableitet und begreiflich macht und zugleich in der Welt selbst die Entfaltung eines objektiven Denkens oder Gedankengehaltes (»Begriffs«) erblickt. Alles Seiende ist Manifestation (objektive Erscheinung) einer absoluten Wirklichkeit, welche Idee, Vernunft, Denken ist und sich in der Natur wie im Bewusstsein entfaltet. Aus seiner abstraktesten, allgemeinsten Form entwickelt sich (logisch, nicht zeitlich) das Absolute (das Weltsubjekt) bis zur Stufe des selbstbewussten, sein Wesen erfassenden absoluten Geistes. Im philosophischen Erkennen wiederholt sich der Weltprozeß und so wird durch die Spekulation der Vernunft (das absolute Wissen) der Subjektivismus und Relativismus des mir auf endliche, »unwahre« Seinsbestimmungen gerichteten abstrakten Standpunktes der Reflexion, des Verstandes (vgl. Jacobi, Schelling) überwunden und auch der Kritizismus Kants nur als Durchgangsphase anerkannt. Das Vertrauen zur konstruktiv-deduktiven Macht des spekulativen Denkens erscheint bei H. in seiner höchsten Potenz, wenn H. auch den nicht zu überwindenden irrationalen Rest in der Natur anerkennt.
Die Philosophie ist formal »denkende Betrachtung der Gegenstände«, material »Wissenschaft des Absoluten«, als die sich denkende Idee, die wissende Wahrheit. Das Seiende zu begreifen ist die Aufgabe der Philosophie. Sie ist »zeitloses Begreifen, auch der Zeit und aller Dinge überhaupt, nach ihrer ewigen Bestimmung«, sie will erkennen, »was unveränderlich, ewig, an und für sich ist«, sie will den Gedanken, den Begriff mit der Wirklichkeit versöhnen. Sie zerfällt in Logik, Natur- und Geistesphilosophie, indem sie zuerst die Idee, das Logische an sich (als reines Denken, als Idealität, als System der Kategorien), dann die entäußerte, objektivierte Idee, d.h. die Natur, endlich die Idee in ihrem Beisichsein, ihrem An und für sich als Geist betrachtet. Die Identität von Denken und Sein, Natur und Geist, darf nicht wie bei Schelling »aus der Pistole geschossen« sein, sondern muss deduziert werden. Das Vernünftige muss als wirklich, das Wirkliche als vernünftig dargetan werden, wobei nicht alles Zufällige oder Vorübergehende als »wirklich« (im vollsten Sinne) zu gelten hat, so dass es natürlich in der Erfahrung auch Unvernünftiges gibt, das zu überwinden ist.
Die Methode der H.schen Philosophie ist die dialektische als Gegenstück zur objektiven Dialektik des Weltprozesses, der im philosophischen Denken zum Bewusstsein seiner selbst gelangt; denn das Sein selbst ist Denken, Denkentwicklung. Der »Widerspruch« (Gegensatz) ist die Triebkraft dieser Denkbewegung, die im Dreischritt von Thesis, Antithesis, Synthesis (vgl. Fichte, ferner Kants Antinomien, Heraklit) erfolgt und zur »Aufhebung« des Gegensatzes in einem höheren Begriff führt, der wieder seinen Gegensatz hat usw. Alles existiert zunächst »an sich«, in der Unmittelbarkeit der Potenz zu einem besonderen Sein (wie z. B, der Keim zu einer Pflanze), dann »für sich«, als Einzelnes, schließlich »an und für sich« als Konkret-Allgemeines, als Einheit in der Mannigfaltigkeit seiner Bestimmungen, als objektiver »Begriff«, der zugleich den Gehalt, das Wesen des Dinges bildet. Indem das philosophische Denken die Selbstentfaltung der Idee zum Gegenstände hat, macht es den Geheilt des Seins selbst zum Objekt; das System des Denkens erzeugt so aus sich das System der Erfahrung, der Panlogismus wird zu einem »Panempirismus« (Külpe). Das dialektische Denken ist ein »Totalitätsdenken« (M. Adler), in der die Tatsachen selbst zum Ausdruck kommen sollen. Die Idee ist das Denken »als die sich entwickelnde Totalität seiner eigentümlichen Bestimmungen und Gesetze, die es sich selbst gibt«. Die Dialektik entsteht dadurch, dass das Denken »sich in Widersprüche verwickelt, d. i. sich in die feste Nichtidentität der Gedanken verliert, somit sich selbst nicht erreicht, vielmehr in seinem Gegenteil befangen bleibt«.- Als Verstand muss das Denken in das »Negative seiner selbst, in den Widerspruch geraten«. Die Kategorien des Verstandes sind als solche beschränkte Bedingungen, Formen des Bedingten, abstrakt, unwahr. Das dialektische Moment ist nun »das eigene Sichaufheben solcher endlicher Bestimmungen und ihr Übergehen in ihre entgegengesetzte«. »Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben.« Durch Negation der Negation wird der Widerspruch beseitigt; so ist z.B. das Nichts die Negation des Seins, mit dem zusammen es im »Werden« aufgehoben wird. Diese Dialektik ist ein »Waltenlassen der Sache selbst oder der allgemeinen Vernunft in uns, die mit dem Wesen der Dinge identisch ist«. Das Denken selbst löst seine eigenen Widerspräche auf. Dem analog ist das Absolute die eine Idee, die als urteilend sich zum System der bestimmten Ideen besondert, die wieder in die eine Idee zurückgehen. Die Idee ist selbst die Dialektik, eine ewige Schöpfung, ewige Lebendigkeit, ewiger Geist, ewiges Anschauen ihrer selbst im andern.
Die Wissenschaft der »reinen Idee«, der Idee als solcher ist die Logik, die zugleich Erkenntnistheorie und Ontologie (Metaphysik) ist, da das Sein selbst Begriff ist. Sie enthält den »Gedanken, insofern er ebenso sehr die Sache an sich selbst ist«. Sie ist die Wissenschaft der Idee im abstrakten Elemente des Denkens, die Wissenschaft vom Logos, von der Vernunft als solcher, von der Wahrheit an sich, die »Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen, vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist«, die »Wissenschaft der Dinge in Gedanken gefasst«. Sie zerfällt in die Lehre vom Sein (vom Gedanken in seiner Unmittelbarkeit), die Lehre vom Wesen (vom Gedanken in seiner Reflexion) und die Lehre vom Begriff und der Idee (vom Gedanken in seinem Beisichsein). Oder (in der »Enzyklopädie«) in die »objektive« und die »subjektive« Logik. Diese »spekulative« Logik, 'welche Form und Inhalt des Denkens nicht isoliert, stellt die innerliche und apriorische Notwendigkeit der Gedanken und damit auch der Sachen dar. Es wird von H. betont, der Inhalt der Philosophie sei kein anderer als »der im Gebiete des lebendigen Geistes ursprünglich hervorgebrachte und sich hervorbringende, zur Welt, äußeren und inneren Welt des Bewusstseins gemachte Gehalt«, die Wirklichkeit im Unterschiede von der Erscheinung, d.h. dein, was »vorübergehend und bedeutungslos« ist. Die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und Erfahrung ist notwendig trotz alles Apriorismus und Rationalismus. Die spekulative Logik anerkennt den Inhalt der Erfahrung und die Gesetze der Wissenschaft, aber sie bildet sie mit weiteren Kategorien weiter und um. Das Aufnehmen des von den Wissenschaften verarbeiteten Inhalts durch die Philosophie ist zugleich ein »Entwickeln des Denkens aus sich selbst«, wodurch die Philosophie diesem Inhalte die Gestalt des Apriorischen und die Bewährung der Notwendigkeit gibt. Die Wissenschaft des Absoluten, der Idee ist System, »weil das Wahre als konkret nur als sich in sich entfaltend und in Einheit zusammennehmend und haltend, d. i. als Totalität ist«. Die Idee ist »das Denken nicht als formales, sondern als die sich entwickelnde Totalität seiner eigentümlichen Bestimmungen und Gesetze, die es sich selbst gibt, nicht schon hat und in sich vorfindet«. Das Denken als Tätigkeit ist das »tätige Allgemeine«, dessen Tat eben das Allgemeine ist; es ist von der Vorstellung scharf zu unterscheiden. Das Allgemeine als Produkt der Denktätigkeit ist die Sache, das Wesentliche, das Wahre. Nach der Subjektivität ist das Denken das Erzeugnis des Geistes als denkendes Subjekt, ein Akt der Freiheit. Insofern die Gedanken Ausdruck der Sachen sind, sind sie »objektive Gedanken«. »Dass Verstand, Vernunft in der Welt ist, sagt dasselbe, was der Ausdruck: objektiver Gedanke enthält.« Der objektive Gedanke bezeichnet die Wahrheit, welche »absolut an und für sich ist«. Der Empirismus ist insoweit berechtigt, als das, was wahr ist, »in der Wirklichkeit sein und für die Wahrnehmung da sein muss«. Der Kritizismus betont mit Recht, dass es die Kategorien sind, wodurch die bloße Wahrnehmung zur Objektivität, zur Erfahrung erhoben wird. Aber wie sie der Verstand festhält, sind die Kategorien »beschränkte Bestimmungen, Formen des Bedingten, Abhängigen, Vermittelten«. Die Einseitigkeit und Beschränktheit der Verstandesbestimmungen wird nun durch die Dialektik überwunden und die Kategorien werden jetzt zu Momenten der Denkentwicklung und damit zu Formen des Weltinhalts selbst.
Vom reinen Sein geht das Denken aus, weil jenes sowohl reiner Gedanke als das unbestimmte einfache Unmittelbare ist. Das Sein schlägt als die reine Abstraktion, als das absolut Negative (Inhaltslose) in das Nichts um. Dieses ist dasselbe wie das Sein und die Wahrheit beider; deren Einheit ist das Werden, die »Unruhe in sich«. Das Sein ist das Übergehen in nichts und das Nichts das Übergehen ins Sein, das Werden das Resultat von Sein und Nichts. Alles Sein ist Werden, Prozess. Aus dem Sein geht das Dasein hervor, das bestimmte Sein, welches seine Qualität hat, deren Sein als solches Ansichsein ist. Etwas wird ein Anderes, dieses ist selbst wieder ein. Etwas, das ein Anderes wird, und so fort; dies ergibt die (»schlechte«, »negative«) Unendlichkeit als bloße Negation des Endlichen, als Progress ins Unendliche. Indem das Etwas in seinem Übergehen in Anderes nur mit sich selbst zusammengeht, entsteht die wahre Unendlichkeit und das Dasein wird Fürsichsein. Die Wahrheit des Endlichen ist seine Idealität, denn das Wahre und Wirkliche an ihm ist das Unendliche (Absolute). Das aufgehobene Fürsichsein ist die Quantität als reine Quantität, Quantum, Grad. Das qualitative Quantum ist das Maß. Das Sein, welches aus seiner Unmittelbarkeit zu sich zurückgekehrt, mit sich selbst vermittelt ist, ist das Wesen, das »Sein als Scheinen in sich selbst«. Als Beziehung auf sich ist es Identität mit sich, als Abstehen seiner von sich selbst ist es Unterschied; die Einheit beider ist der Grund. Aus ihm geht die Existenz hervor. Das Existierende ist das Ding mit Eigenschaften; es zerfällt in Materie und Form. Als sich selbst aufhebend ist die Existenz Erscheinung.
Das Wesen muss erscheinen, das entwickelte Scheinen ist die Erscheinung. Das Wesen ist nicht hinter oder jenseits der Erscheinung. Die Form ist das »Gesetz der Erscheinung«, sie schlägt in Inhalt um und dieser in Form. So ergibt sich das Verhältnis. Das unmittelbare Verhältnis ist das des Ganzen zu den Teilen. Das mit sich identische Ganze ist die Kraft, deren Äußerung sie selbst zum Ausdruck bringt; das Äußere ist derselbe Inhalt wie das Innere. Die Identität beider ist die Wirklichkeit, die »unmittelbar gewordene Einheit, des Wesens und der Existenz«. Hierher gehört das Substantialitätsverhältnis. Die Substanz ist die »Totalität der Akzidenzen, in denen sie sich als deren absolute Negativität, d. i. als absolute Macht und zugleich als den Reichtum alles Inhalts offenbart«. Die Substantialität ist die »absolute Formtätigkeit«. Die Substanz ist Ursache als die ursprüngliche Sache und als die Wirkung setzend. Dieses Gesetztsein ist die Reflexion der Ursache in sich selbst, daher ist die Ursache an und für sich »causa sui«. Die Reihe der Ursachen und Wirkungen geht ins Unendliche. Dieser Prozess ist in der Wechselwirkung aufgehoben, zu einem in sich geschlossenen Verhältnis umgebogen. Die Wahrheit der Substanz ist der Begriff als die Wahrheit des Seins und des Wesens; das Sein ist nur ein Moment des Begriffs. – Der Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit ist damit gegeben und damit die »subjektive« Logik. Der Begriff ist »das Freie als die für sich seiende substantielle Macht und ist Totalität«. Das Fortgehen des Begriffes ist nicht mehr Übergehen, noch Scheinen in Anderes, sondern (logische) »Entwicklung«. Der Begriff tritt auf als subjektiver oder formeller Begriff, als »Objektivität«, als »Idee« (Subjekt – Objekt). Der Begriff ist das »schlechthin Konkrete«; Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit sind in ihm vereinigt. Das Bestimmen des Begriffes ist das Urteil, d.h. der »Begriff in seiner Besonderheit, als unterscheidende Beziehung seiner Momente«. Alle Dinge sind ein Urteil, d.h. sie sind einzelne, welche eine Allgemeinheit oder innere Natur in sich sind, oder ein Allgemeines, das vereinzelt ist. Die Einheit des Begriffe und des Urteils ist der Schluss. Er ist das Vernünftige: Alles ist ein Schluss, alles wird mit sich selbst zusammengeschlossen. Diese Realisierung des Begriffs, in welcher das Allgemeine diese eine in sich zurückgegangene Totalität ist, ist das Objekt. Dieses tritt auf als Mechanismus, Chemismus, Teleologie. Der Zweck ist der »in freie Existenz getretene, für-sich-seiende Begriff vermittelst der Negation der unmittelbaren Objektivität«. Die Zweckmäßigkeit ist eine innere. Der erreichte Zweck wird Mittel für andere Zwecke. Im Zweck vermittelt sich der Begriff mit sich selbst, – Es wird so die an sich seiende Einheit des Subjektiven und Objektiven als für sich seiend gesetzt: die Idee. Diese ist die »absolute Einheit des Begriffs und der Objektivität«. Das Absolute ist die Idee. Alles Wirkliche, sofern es ein Wahres ist, ist die Idee und hat seine Wahrheit nur durch diese. »Das einzelne Sein ist irgend eine Seite der Idee.« Das Absolute ist als Idee nicht bloß die allgemeine Substanz, sondern als entwickelte wahrhafte Wirklichkeit Subjekt, Geist. Die Idee ist die Vernunft, das Subjekt-Objekt, die Einheit des Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendlichen, der Seele und des Leibes, sie ist ewige Schöpfung, welche dies alles in sich unterscheidet, sie ist wesentlich »Prozess«. Die unmittelbare Idee ist das Leben. Der Begriff ist als Seele in einem Leibe realisiert. Der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ist das Hervorgehen des Geistes. Die Idee tritt ferner als das Erkennen auf, als theoretisches Erkennen und als Wollen, als Trieb, sich zu realisieren. Die absolute Idee ist die Einheit der subjektiven und der objektiven Idee, der Begriff der Idee, dem die Idee als solche der Gegenstand ist, die sich selbst denkende Idee. Als Form ist sie die Methode ihres Inhalts. Die Wissenschaft ist die reine Idee, für welche die Idee ist. – Die anschauende Idee ist Natur. »Als Anschauen aber ist die Idee in einseitiger Bestimmung der Unmittelbarkeit oder Negation durch äußerliche Reflexion gesetzt,«
So kommen wir zur Naturphilosophie, zur denkenden, begreifenden Betrachtung der Natur. Die Philosophie muss mit der Naturerfahrung übereinstimmen, ohne in Bezug auf die Notwendigkeit ihres Inhalts sich auf die Erfahrung zu berufen. Sie betrachtet diesen Inhalt »in seiner eigenen immanenten Notwendigkeit nach der Selbstbestimmung des Begriffs«. Die Naturphilosophie betrachtet, »wie die Natur an ihr selbst dieser Prozess ist, zum Geiste zu werden, ihr Anderssein aufzuheben«. Sie ist die »Wissenschaft der Idee in ihrem Anderssein«. Die Natur ist das »Aus-sich-heraustreten der Idee«, daher zeigt sie in ihrem Dasein keine Freiheit, sondern Notwendigkeit und Zufälligkeit. An sich, in der Idee, ist sie göttlich, aber wie sie ist, entspricht ihr Sein ihrem Begriffe nicht, sie ist der »unaufgelöste Widerspruch«, eine Art Abfall der Idee von sich selbst. »Die Natur ist der sich entfremdete Geist, der darin nur ausgelassen ist.« »Von der Idee entfremdet ist die Natur nur der Leichnam des Verstandes.« Die Natur ist ein »System von Stufen«, »deren eine aus der andern notwendig hervorgeht...., aber nicht so, dass die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der inneren, den Grund der Natur ausmachenden Idee«. Also kein eigentlicher Evolutionismus in der Natur, denn die »Metamorphose« kommt nur dem Begriffe (und Geiste) zu, dessen Veränderung allein »Entwicklung« ist. Es besteht eine »Ohnmacht der Natur, den Begriff in seiner Ausführung festzuhalten«. Die Natur ist an sich ein »lebendiges Ganzes«. Ihre Bewegung ist die, dass die Idee sich als das setze, was sie an sich ist (Potentialität-Aktualität) oder »dass sie aus ihrer Unmittelbarkeit und Äußerlichkeit, welche der Tod ist, in sich gehe, um zunächst als Lebendiges zu sein, aber ferner auch diese Bestimmtheit, in welcher sie mir Leben ist, aufhebe und sich zur Existenz des Geistes hervorbringe, der die Wahrheit und der Endzweck der Natur und die wahre Wirklichkeit der Idee ist«. Die Naturphilosophie ist Mechanik, Physik und Organik.
Zur Mechanik gehört die Betrachtung von Raum und Zeit. Der Raum ist die ganz abstrakte Allgemeinheit des Außersichseins der Natur, das »ganz ideelle Nebeneinander«. Die Zeit ist die »negative Einheit des Außersichseins«, ein Ideelles wie der Raum, das »angeschaute Werden«. Raum und Zeit sind Anschauungsformen. Nur das Natürliche ist der Zeit unterworfen, der Begriff (Geist) hingegen ist überzeitlich, ist die »Macht der Zeit«, der Geist ist ewig. Die Zeit ist ein Produkt des Weltprozesses selbst, nicht dessen Faktor. Die Zeit selbst ist das Werden, das »seiende Abstrahieren«. Sie ist der »aufgehobene Raum«. Das Vergehen und Sichwiedererzeugen des Raums in Zeit und der Zeit in Raum ist die Bewegung. Die unmittelbar identisch daseiende Einheit von Raum und Zeit ist die Materie. Die Substanz der Materie ist die Schwere. Die Einzelheiten der Mechanik und Physik übergehen wir hier. Der unendliche, sich selbst anfachende und unterhaltende Prozess ist der Organismus, als geologischer, vegetabilischer und animalischer Organismus. In letzterem erhält sich die selbstische Einheit. Das Lebendige ist nur, indem es sich zu dem macht, was es ist; es ist »vorausgehender Zweck, der selbst nur das Resultat ist«. Die auf bewusstlose Weise wirkende Zwecktätigkeit ist der Instinkt. Die Natur bildet die Organismen an die Umwelt an, schmiegt sie dieser an. Die Unangemessenheit des Lebewesens zur Allgemeinheit ist der angeborene Keim des Todes. Durch diesen wird die Unangemessenheit aufgehoben, das letzte Außersichsein der Natur fällt weg, der in ihr nur an sich seiende Begriff ist für sich geworden. Aus dem »Tode des Natürlichen« geht so der Geist hervor als die Wahrheit, das Ziel der Natur, das »Bei-sich-selbst-sein« der Idee, die »unendliche Subjektivität« derselben.
Die Philosophie des Geistes ist die Wissenschaft der Idee, die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt. – Schon in der »Phänomenologie« wird die Entwicklung des Geistes von seiner niedrigsten bis zu seiner höchsten Bewußtseinsstufe und die Notwendigkeit seines Fortgangs bis zum absoluten Standpunkt dargestellt. Diese Phänomenologie bildet auch einen Teil der Geistesphilosophie (in der »Enzyklopädie«). Die Geistes- und Geschichtsphilosophie ist die Hauptleistung Hegels. – Der Geist, der an sich das Prius der Natur ist, macht sich selbst zu dem, was er ist. Seine Tätigkeit ist »Hinausgehen über die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und Rückkehr in sich«. Das Wesen des Geistes ist die Freiheit, seine Bestimmtheit die Manifestation. Der Geist ist 1. subjektiver Geist (in der Form der Beziehung auf sich selbst), 2. objektiver Geist (»in der Form der Realität als einer von ihm hervorzubringenden und hervorgebrachten Welt.., in welcher die Freiheit als vorhandene Notwendigkeit ist«), 3. absoluter Geist (»in an und für sich seiender und ewig sich hervorbringender Einheit der Objektivität des Geistes und seiner Identität oder seines Begriffs.., der Geist in seiner absoluten Wahrheit«). Die verschiedenen Stufen der Geistestätigkeit sind Stufen seiner Befreiung, seines zu sich selbst Kommens.
Der subjektive Geist ist a) an sich oder unmittelbar als Seele oder Naturgeist (Anthropologie), b), für sich und vermittelt als Bewusstsein (Phänomenologie), c) der in sich bestimmende Geist als Subjekt für sich (Psychologie). Die Seele ist die »allgemeine Immaterialität der Natur, deren einfaches ideelles Leben« (der »passive Geist« des Aristoteles). Der Geist ist die »existierende Wahrheit der Materie«. In der natürlichen Seele lebt der Geist das allgemeine planetarische Leben mit. Die Empfindung ist »die Form des dumpfen Webens des Geistes in seiner bewusst- und verstandlosen Individualität, in der alle Bestimmtheit noch unmittelbar ist«. Das Gedächtnis ist der »Mechanismus der Intelligenz«, die Gewohnheit der »Mechanismus des Selbstgefühls« (Mechanisierung). Seele und Leib sind an sich identisch. Die Seele ist in ihrer Leiblichkeit als einzelnes Subjekt für sich und die Leiblichkeit ist die Äußerlichkeit, das Zeichen der Seele. Das Fürsichsein der freien Allgemeinheit ist das Erwachen der Seele zum Ich und zum Bewusstsein. »Ich« ist die unendliche Beziehung des Geistes auf sich, aber als subjektive, als Gewissheit seiner selbst. Der Geist ist als das Ich Wesen, als Bewusstsein aber nur das Erscheinen des Geistes (daher die »Phänomenologie« des Geistes). Die Stufen des Bewusstseins sind: Bewusstsein überhaupt, Selbstbewusstsein, Vernunft (Einheit beider). Das sinnliche Bewusstsein ist das reichste an Inhalt, das ärmste an Gedanken; dann folgen das Wahrnehmen und der Verstand. In Wirklichkeit ist alles Bewusstsein eines anderen Gegenstandes zugleich Selbstbewusstsein. Dieses tritt auf als Begierde, anerkennendes Selbstbewusstsein, allgemeines Selbstbewusstsein. Die Vernunft ist die Identität der Subjektivität und Objektivität, des allgemeinen Objekts und des »reinen Ich« (der »reinen Form«). Die »wissende Wahrheit« ist der Geist (im engeren Sinne), dessen Fortschreiten Entwicklung ist; Ziel des Geistes ist, die objektive Erfüllung und damit die Freiheit seines Wissens hervorzubringen. Der Begriff selbst ist der Endzweck, Der Geist ist theoretischer, praktischer und freier Geist. Der theoretische Geist ist die Intelligenz, das Wissen, Erkennen. Kein Wille ohne Intelligenz, keine Intelligenz ohne Willen. Das Erkennen tritt auf als Anschauung, Vorstellung (»erinnerte Anschauung«), Denken. Der praktische Geist, die Intelligenz sich wissend als das Bestimmende des Inhalts, ist Wille, als welcher der Geist in Wirklichkeit tritt. Die wahre Freiheit des (denkenden) Willens ist, dass er einen allgemeinen Inhalt zu seinen Zwecken hat. Der Wille tritt auf als praktisches Gefühl. Trieb und Willkür und wird endlich zum freien Geist (freien Willen), zum Geist, »der sich als frei weiß und sich als diesen seinen Gegenstand will, d. i. sein Wesen zur Bestimmung und zum Zwecke hat«. Es ist dies der »vernünftige Wille«. Die Idee erscheint hier im endlichen Willen, der die Tätigkeit ist, sie zu entwickeln und ihren sich entfaltenden Inhalt zu verwirklichen – als objektiver Geist.
Im objektiven Geiste erhält die Freiheit, zur Wirklichkeit einer Welt gestaltet, die Form der Notwendigkeit und Macht. Recht, Moralität, Sittlichkeit sind die Formen des objektiven Geistes. Das Recht ist das »Dasein der Freiheit im Äußerlichen«; es hat nur in der Gesellschaft seine Wirklichkeit, ist die Verwirklichung der Freiheit in der Gesellschaft. Das Verbrechen ist die Negation des Rechts, die Strafe die Negation dieser Negation (Vergeltung) das »Recht des Verbrechers«. Die Moralität ist die subjektive Sittlichkeit, die Sphäre der Gesinnung, des Charakters usw. Das Gute ist der Inhalt des allgemeinen Willens; es ist der absolute Endzweck der Welt, die Pflicht, des Subjekts. Das Gewissen ist der Wille des Guten. Die Sittlichkeit ist das objektivierte Gute, der objektivierte freie, vernünftige Wille. Die Gesetze der Sittlichkeit sind das Vernünftige selbst. Die Sittlichkeit ist »die Idee der Freiheit, als das lebendige Gute«. Die frei sich wissende Substanz, in welcher das absolute Sollen ebenso sehr Sein ist, hat als Geist eines Volkes Wirklichkeit, der sich in Personen vereinzelt. Die Sittlichkeit ist »der göttliche Geist als inwohnend dem Selbstbewusstsein in dessen wirklicher Gegenwart als eines Volkes und der Individuen derselben«. In sozialen und staatlichen Gebilden ist also nach H.s ethischem »Universalismus« die Sittlichkeit verkörpert; der Einzelne ist dem Ganzen untergeordnet. Die »sittliche Substanz« tritt auf als Familie, als bürgerliche Gesellschaft und als Staatsverfassung (d.h. als »der zu einer organischen Wirklichkeit entwickelte Geist«). Der Staat ist die »selbstbewusste sittliche Substanz«, »der vernünftige, göttliche Wille, der sich so organisiert hat«. Er ist eine Persönlichkeit, ein Individuum. Die Gesetze sprechen die »Inhalts-Bestimmungen der objektiven Freiheit« aus. Die Verfassung ist die »existierende Gerechtigkeit«; sie ist ein Produkt des Volksgeistes und dessen Geschichte, nichts Künstliches. – Der Volksgeist geht in die allgemeine Weltgeschichte über, deren Begebenheiten die »Dialektik der besonderen Volksgeister, das Weltgericht« darstellt. Die Geschichte ist »der Weg zur Befreiung der geistigen Substanz, die Tat, wodurch der absolute Endzweck der Welt sich in ihr vollführt, der nur erst an sich seiende Geist sich zum Bewusstsein und Selbstbewusstsein und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für sich seienden Wesens bringt und sich auch zum äußerlich allgemeinen, zum Weltgeist, wird«. Die einzelnen Momente und Stufen der historischen Entwicklung sind die Völkergeister, deren jeder seine ganz besondere Leistung hat, so dass Vernunft in der Geschichte herrscht. Der Zweck jedes Volkes liegt in seiner Staatlichkeit. Das Selbstbewusstsein eines besonderen Volkes ist Träger der jedesmaligen Entwicklungsstufe des allgemeinen Geistes. Die Weltgeschichte ist der »vernünftige, notwendige Gang des Weltgeistes«. Sie ist der »Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit«. Es ist die »List der Vernunft«, die Interessen und Leidenschaften der Individuen für ihre Zwecke arbeiten, den Willen des Weltgeistes erfüllen zu lassen, den besonders die »Heroen« realisieren. Die erste Stufe der Geschichte ist das »Versenktsein des Geistes in die Natürlichkeit«, die zweite das »Heraustreten desselben in das Bewusstsein seiner Freiheit«, die dritte das »Selbstbewusstsein und Selbstgefühl des Wesens der Geistigkeit«. Bei den Orientalen ist einer, bei den Griechen mehrere frei, bei den Germanen (im Christentum) ist der Mensch als Mensch, die ganze Menschheit frei.
Der absolute Geist ist der sich als solchen wissende Geist, der Geist in seiner absoluten Wahrheit, als an und für sich seiende und sich ewig hervorbringende Einheit der Objektivität des Geistes und seiner Idealität oder seines Begriffs. In der Kunst, Religion und Philosophie stellt er sich auf verschiedene Weise (in der Anschauung, in der Vorstellung, im Denken) dar.
Die Ästhetik ist »Philosophie der Kunst«. Die Kunst ist die sinnliche Vorstellung des Absoluten und tritt als klassische, symbolische, romantische Kunst auf. Nur als den Geist bedeutende, charakteristische, sinnvolle Naturform ist die Wirklichkeit durch die Kunst nachzuahmen. Die Ästhetik H.s ist eine spekulativ-idealistische Gehalts-Ästhetik. Das Schöne ist das »sinnliche Scheinen der Idee«. Die Gestalt ist hier Zeichen, unmittelbarer Ausdruck der Idee, des Geistigen. In der klassischen Kunst liegt die Vollendung der Schönheit, in der symbolischen die Erhabenheit; hier ist die der Idee angemessene Gestaltung noch nicht gefunden. Die romantische Kunst stellt das Göttliche als Innigkeit in der Äußerlichkeit dar.
In der Religion ist der Inhalt der Idee als absoluter Geist für den Geist. Die Religion ist das »Wissen des endlichen Geistes von seinem Wesen als absoluter Geist«, das »Selbstbewusstsein Gottes« im Menschen, die vorstellungsmäßige (nicht rein begriffliche) Erfassung des absoluten Geistes, der sich im Bewusstsein des Menschen offenbart. »Gott ist nur Gott, insofern er sich selber weiß; sein Sichwissen ist ferner sein Selbstbewusstsein im Menschen.« Der Mensch weiß nur von Gott, sofern Gott im Menschen von sich weiß. Die Stufen der Religion sind: die Naturreligion, die Religion der geistigen Individualität, die absolute Religion. Gott ist (analog der christlichen Dreieinigkeit) a) als in seiner Manifestation bei sich selbst bleibender, ewiger Inhalt, Gedanke (Gott als Vater), b) als Unterscheidung des ewigen Wesens von seiner Manifestation in Natur und endlichem Geist (Sohn); c) als unendliche Rückkehr und Versöhnung der entäußerten Welt mit dem ewigen Wesen. Schöpfung, Sündenfall, Erlösung sind ewige Prozesse, welche auf dem Standpunkte der Vorstellung zu einmaligen Vorgängen werden (Spekulative Dogmendeutung), Gott ist nicht eins mit der Welt, sondern die Geisteseinheit, die die Welt ewig von sich unterscheidet. (Idealistischer Pantheismus im Gegensatze zum naturalistischen »Pantheismus«.) Das »ontologische« Argument für das Sein des Absoluten steht in Kraft.
Die Einheit der Kunst und Religion ist die Philosophie, deren Definition wir oben anführten. Sie ist »die sich denkende Idee«, die »wissende Wahrheit«, die »sich wissende Vernunft«, die noêsis noêseôs des Aristoteles. In der Philosophie wird das Absolute durch reines, unsinnliches Denken erfasst; das philosophische Denken ist geradezu eine Reproduktion der Dialektik des Weltprozesses, in dem sich Gott offenbart, das Absolute zu sich kommt. Die Geschichte der Philosophie wiederholt die Phasen des philosophischen Denkens. Die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie ist dieselbe wie die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee. Die letzte Philosophie ist das Resultat aller früheren, die als aufgehobene Momente in ihr erhalten bleiben: daher ist sie, wenn sie wahrhafte Philosophie ist, die entfaltetste, reichste und konkreteste. Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte des Sichselbstfindens des Gedankens.
Nachdem die Hegelsche Philosophie lange Zeit eine gewaltige Herrschaft ausgeübt hatte, geriet sie infolge der Reaktion der naturwissenschaftlichen, positivistischen, realistischen, materialistischen Tendenzen schon bald nach H.s Tode in Verfall und wurde sogar vielfach sehr verachtet, wozu auch Schopenhauers Angriffe beigetragen haben. Seit einiger Zeit aber hat sie (in modifizierter Form) in England und Amerika eine Erneuerung gefunden und gegenwärtig ist sie auch wieder in Deutschland im Emporkommen, ganz abgesehen von dem Einflusse, den sie auf viele Philosophen schon geübt hat. – Das Organ der Hegelschen Schule waren die »Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.« (1827-47). Nach H.s Tode trat eine Spaltung der Hegelschen Schule in eine »Rechte« (orthodox-theistische), gemäßigte und »Linke« (Junghegelianer), pantheistische oder geradezu naturalistische ein, deren Organ die »Hallischen Jahrbücher« (1838-43) waren. Zur »Rechten« bzw. zur »Mitte« gehören Gabler, Göschel, Hinrichs, Vatke, Daub, Marheineke, Conradi, K. Rosenkranz, J. E. Erdmann, G. Biedermann, A. E. Biedermann, K. Fischer, Schaller u. a., zur »Linken« Richter, Ruge, Bruno Bauer, D. Fr. Strauß, Feuerbach u. a. Von Hegel beeinflußt sind C. H. Weisse, Chalybaeus u. a., auch E. v. Hartmann, Wundt, Cohen, Kohler, Stirling, Höijer, Green, Bradley, Mc Taggart, Vera, Ceretti, Spaventa, Fiorentino, Croce, Monrad, Bolland, Cieszkowski, Bjelinskij, Strachow, Gogozkij, Tschitscherin und viele andere deutsche und ausländische Philosophen (vgl. Ueberweg-Heinze, Grundriß der Geschichte der Philosophie IV10, 1906).
SCHRIFTEN: Das Leben Jesu (1795; erschien erst 1906). – System der Sittlichkeit (erschien erst 1893). – Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, 1801 (Schellings Identitätslehre wird dem »subjektiven« Idealismus als »absoluter« Idealismus gegenübergestellt). – Phänomenologie des Geistes, 1807; hrsg. von G. Lasson 1907 (Philos. Bibl.) u. Bolland 1907. – Wissenschaft der Logik, 1812-16. – Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817; 2. A. 1827; 3. A. 1830; 1905 (Philos. Bibl.), 1906. – Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821; 1902. – Vermischte Schriften, 1834 f. – Die Vorlesungen über die Naturphilosophie, über die Philosophie der Geschichte (auch in der Univ.-Bibl.), über die Ästhetik, über die Philosophie der Religion (auch 1901 und, hrsg. von Drews, 1905), über die Geschichte der Philosophie, die philosophische Propädeutik, die Briefe u. a. finden sich in der Gesamtausgabe von H.s Werken (19 Bde.), 1832 ff. – Vgl. K. ROSENKRANZ, G. W. F. Hegels Leben, 1844; H. 1870. – R. HAYM, Hegel und seine Zeit, 1857. – DILTHEY, Die Jugendgeschichte H.s, 1905. – H. NOHL, H.s theologische Jugendschriften nach den Handschriften der kgl. Bibliothek zu. Berlin, 1907. – K. KÖSTLIN, H., 1870. – E. CAIRD, H., 1883. – P. BARTH, Die Geschichtsphilosophie H.s u. der Hegelianer, 1890. – K. FISCHER, Gesch. d. Philosophie VIII. – VERA, Introduct. à la philos. de H., 1855. – STIRLING, The Secret of H., 1898. – CROCE, Lebendiges u. Totes in H.s Philosophie, 1909. – WINDELBAND, D. Erneuer. d. Hegelianism., 1910.
Grundlinien der Philosophie des Rechts
(Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Zum Gebrauch für seine Vorlesungen)
Vorrede
Die unmittelbare Veranlassung zur Herausgabe dieses Grundrisses ist das Bedürfnis, meinen Zuhörern einen Leitfaden zu den Vorlesungen in die Hände zu geben, welche ich meinem Amte gemäß über die Philosophie des Rechts halte. Dieses Lehrbuch ist eine weitere, insbesondere mehr systematische Ausführung derselben Grundbegriffe, welche über diesen Teil der Philosophie in der von mir sonst für meine Vorlesungen bestimmten Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (Heidelberg 1817) bereits enthalten sind.
Daß dieser Grundriß aber im Druck erscheinen sollte, hiermit auch vor das größere Publikum kommt, wurde die Veranlassung, die Anmerkungen, die zunächst in kurzer Erwähnung die verwandten oder abweichenden Vorstellungen, weiteren Folgen und dergleichen andeuten sollten, was in den Vorlesungen seine gehörige Erläuterung erhalten würde, manchmal schon hier weiter auszuführen, um den abstrakteren Inhalt des Textes zuweilen zu verdeutlichen und auf naheliegende, in dermaliger Zeit gang und gäbe Vorstellungen eine ausgedehntere Rücksicht zu nehmen. So ist eine Anzahl weitläufigerer Anmerkungen entstanden, als der Zweck und Stil eines Kompendiums sonst mit sich bringt. Ein eigentliches Kompendium jedoch hat den für fertig angesehenen Umkreis einer Wissenschaft zum Gegenstande, und das ihm Eigentümliche ist, vielleicht einen kleinen Zusatz hier und da ausgenommen, vornehmlich die Zusammenstellung und Ordnung der wesentlichen Momente eines Inhalts, der längst ebenso zugegeben und bekannt ist, als jene Form ihre längst ausgemachten Regeln und Manieren hat. Von einem philosophischen Grundriß erwartet man diesen Zuschnitt schon etwa darum nicht, weil man sich vorstellt, das, was die Philosophie vor sich bringe, sei ein so übernächtiges Werk als das Gewebe der Penelope, das jeden Tag von vorne angefangen werde.
Allerdings weicht dieser Grundriß zunächst von einem gewöhnlichen Kompendium durch die Methode ab, die darin das Leitende ausmacht. Daß aber die philosophische Art des Fortschreitens von einer Materie zu einer andern und des wissenschaftlichen Beweisens, diese spekulative Erkenntnisweise überhaupt, wesentlich sich von anderer Erkenntnisweise unterscheidet, wird hier vorausgesetzt. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen Verschiedenheit kann es allein sein, was die Philosophie aus dem schmählichen Verfall, in welchen sie in unseren Zeiten versunken ist, herauszureißen vermögen wird. Man hat wohl die Unzulänglichkeit der Formen und Regeln der vormaligen Logik, des Definierens, Einteilens und Schließens, welche die Regeln der Verstandeserkenntnis enthalten, für die spekulative Wissenschaft erkannt, oder mehr nur gefühlt als erkannt, und dann diese Regeln nur als Fesseln weggeworfen, um aus dem Herzen, der Phantasie, der zufälligen Anschauung willkürlich zu sprechen; und da denn doch auch Reflexion und Gedankenverhältnisse eintreten müssen, verfährt man bewußtlos in der verachteten Methode des ganz gewöhnlichen Folgerns und Räsonnements. – Die Natur des spekulativen Wissens habe ich in meiner Wissenschaft der Logik ausführlich entwickelt; in diesem Grundriß ist darum nur hier und da eine Erläuterung über Fortgang und Methode hinzugefügt worden. Bei der konkreten und in sich so mannigfaltigen Beschaffenheit des Gegenstandes ist es zwar vernachlässigt worden, in allen und jeden Einzelheiten die logische Fortleitung nachzuweisen und herauszuheben. Teils konnte dies, bei vorausgesetzter Bekanntschaft mit der wissenschaftlichen Methode, für überflüssig gehalten werden, teils wird aber es von selbst auffallen, daß das Ganze wie die Ausbildung seiner Glieder auf dem logischen Geiste beruht. Von dieser Seite möchte ich auch vornehmlich, daß diese Abhandlung gefaßt und beurteilt würde. Denn das, um was es in derselben zu tun ist, ist die Wissenschaft, und in der Wissenschaft ist der Inhalt wesentlich an die Form gebunden. Man kann zwar von denen, die es am gründlichsten zu nehmen scheinen, hören, die Form sei etwas Äußeres und für die Sache Gleichgültiges, es komme nur auf diese an; man kann weiter das Geschäft des Schriftstellers, insbesondere des philosophischen, darein setzen, Wahrheiten zu entdecken, Wahrheiten zu sagen, Wahrheiten und richtige Begriffe zu verbreiten. Wenn man nun betrachtet, wie solches Geschäft wirklich betrieben zu werden pflegt, so sieht man einesteils denselben alten Kohl immer wieder aufkochen und nach allen Seiten hin ausgeben – ein Geschäft, das wohl auch sein Verdienst um die Bildung und Erweckung der Gemüter haben wird, wenn es gleich mehr als ein vielgeschäftiger Überfluß angesehen werden könnte, – »denn sie haben Mosen und die Propheten, laß sie dieselbigen hören«. Vornehmlich hat man vielfältige Gelegenheit, sich über den Ton und die Prätention, die sich dabei zu erkennen gibt, zu verwundern, nämlich als ob es der Welt nur noch an diesen eifrigen Verbreitern von Wahrheiten gefehlt hätte und als ob der aufgewärmte Kohl neue und unerhörte Wahrheiten brächte und vornehmlich immer »in jetziger Zeit« hauptsächlich zu beherzigen wäre. Andernteils aber sieht man, was von solchen Wahrheiten von der einen Seite her ausgegeben wird, durch eben dergleichen von andern Seiten her ausgespendete Wahrheiten verdrängt und weggeschwemmt werden. Was nun in diesem Gedränge von Wahrheiten weder Altes noch Neues, sondern Bleibendes sei, wie soll dieses aus diesen formlos hin-und hergehenden Betrachtungen sich herausheben – wie anders sich unterscheiden und bewähren als durch die Wissenschaft!
Ohnehin über Recht, Sittlichkeit, Staat ist die Wahrheit ebensosehr alt, als in den öffentlichen Gesetzen, der öffentlichen Moral und Religion offen dargelegt und bekannt. Was bedarf diese Wahrheit weiter, insofern der denkende Geist sie in dieser nächsten Weise zu besitzen nicht zufrieden ist, als sie auch zu begreifen und dem schon an sich selbst vernünftigen Inhalt auch die vernünftige Form zu gewinnen, damit er für das freie Denken gerechtfertigt erscheine, welches nicht bei dem Gegebenen, es sei durch die äußere positive Autorität des Staats oder der Übereinstimmung der Menschen, oder durch die Autorität des inneren Gefühls und Herzens und das unmittelbar beistimmende Zeugnis des Geistes unterstützt, stehenbleibt, sondern von sich ausgeht und eben damit fordert, sich im Innersten mit der Wahrheit geeint zu wissen?
Das einfache Verhalten des unbefangenen Gemütes ist, sich mit zutrauensvoller Überzeugung an die öffentlich bekannte Wahrheit zu halten und auf diese feste Grundlage seine Handlungsweise und feste Stellung im Leben zu bauen. Gegen dieses einfache Verhalten tut sich etwa schon die vermeinte Schwierigkeit auf, wie aus den unendlich verschiedenen Meinungen sich das, was darin das allgemein Anerkannte und Gültige sei, unterscheiden und herausfinden lasse; und man kann diese Verlegenheit leicht für einen rechten und wahrhaften Ernst um die Sache nehmen. In der Tat sind aber die, welche sich auf diese Verlegenheit etwas zugute tun, in dem Falle, den Wald vor den Bäumen nicht zu sehen, und es ist nur die Verlegenheit und Schwierigkeit vorhanden, welche sie selbst veranstalten; Ja diese ihre Verlegenheit und Schwierigkeit ist vielmehr der Beweis, daß sie etwas anderes als das allgemein Anerkannte und Geltende, als die Substanz des Rechten und Sittlichen wollen. Denn ist es darum wahrhaft, und nicht um die Eitelkeit und Besonderheit des Meinens und Seins zu tun, so hielten sie sich an das substantielle Rechte, nämlich an die Gebote der Sittlichkeit und des Staats, und richteten ihr Leben danach ein. – Die weitere Schwierigkeit aber kommt von der Seite, daß der Mensch denkt und im Denken seine Freiheit und den Grund der Sittlichkeit sucht. Dieses Recht, so hoch, so göttlich es ist, wird aber in Unrecht verkehrt, wenn nur dies für Denken gilt und das Denken nur dann sich frei weiß, insofern es vom Allgemein-Anerkannten und Gültigen abweiche und sich etwas Besonderes zu erfinden gewußt habe.
Am festesten konnte in unserer Zeit die Vorstellung, als ob die Freiheit des Denkens und des Geistes überhaupt sich nur durch die Abweichung, ja Feindschaft gegen das öffentlich Anerkannte beweise, in Beziehung auf den Staat eingewurzelt [sein] und hiernach absonderlich eine Philosophie über den Staat wesentlich die Aufgabe zu haben scheinen, auch eine Theorie und eben eine neue und besondere zu erfinden und zu geben. Wenn man diese Vorstellung und das ihr gemäße Treiben sieht, so sollte man meinen, als ob noch kein Staat und Staatsverfassung in der Welt gewesen noch gegenwärtig vorhanden sei, sondern als ob man jetzt – und dies Jetzt dauert immer fort – ganz von vorne anzufangen und die sittliche Welt nur auf ein solches jetziges Ausdenken und Ergründen und Begründen gewartet habe. Von der Natur gibt man zu, daß die Philosophie sie zu erkennen habe, wie sie ist, daß der Stein der Weisen irgendwo, aber in der Natur selbst verborgen liege, daß sie in sich vernünftig sei und das Wissen diese in ihr gegenwärtige, wirkliche Vernunft, nicht die auf der Oberfläche sich zeigenden Gestaltungen und Zufälligkeiten, sondern ihre ewige Harmonie, aber als ihr immanentes Gesetz und Wesen zu erforschen und begreifend zu fassen habe. Die sittliche Welt dagegen, der Staat, sie, die Vernunft, wie sie sich im Elemente des Selbstbewußtseins verwirklicht, soll nicht des Glücks genießen, daß es die Vernunft ist, welche in der Tat in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht habe, darin behaupte und inwohne. Das geistige Universum soll vielmehr dem Zufall und der Willkür preisgegeben, es soll gottverlassen sein, so daß nach diesem Atheismus der sittlichen Welt das Wahre sich außer ihr befinde und zugleich, weil doch auch Vernunft darin sein soll, das Wahre nur ein Problema sei. Hierin aber liege die Berechtigung, ja die Verpflichtung für jedes Denken, auch seinen Anlauf zu nehmen, doch nicht um den Stein der Weisen zu suchen, denn durch das Philosophieren unserer Zeit ist das Suchen erspart und jeder gewiß, so wie er steht und geht, diesen Stein in seiner Gewalt zu haben. Nun geschieht es freilich, daß diejenigen, welche in dieser Wirklichkeit des Staats leben und ihr Wissen und Wollen darin befriedigt finden – und deren sind viele, ja mehr als es meinen und wissen, denn im Grunde sind es alle –, daß also wenigstens diejenigen, welche mit Bewußtsein ihre Befriedigung im Staate haben, jener Anläufe und Versicherungen lachen und sie für ein bald lustigeres oder ernsteres, ergötzliches oder gefährliches, leeres Spiel nehmen. Jenes unruhige Treiben der Reflexion und Eitelkeit, sowie die Aufnahme und Begegnung, welche sie erfährt, wäre nun eine Sache für sich, die sich auf ihre Weise in sich entwickelt; aber es ist die Philosophie überhaupt, welche sich durch jenes Getreibe in mannigfaltige Verachtung und Mißkredit gesetzt hat. Die schlimmste der Verachtungen ist diese, daß wie gesagt jeder, wie er so steht und geht, über die Philosophie überhaupt Bescheid zu wissen und abzusprechen imstande zu sein überzeugt ist. Keiner anderen Kunst und Wissenschaft wird diese letzte Verachtung bezeigt, zu meinen, daß man sie geradezu innehabe.
In der Tat, was wir von der Philosophie der neueren Zeit mit der größten Prätention über den Staat haben ausgehen sehen, berechtigte wohl jeden, der Lust hatte mitzusprechen, zu dieser Überzeugung, eben solches von sich aus geradezu machen zu können und damit sich den Beweis, im Besitz der Philosophie zu sein, zu geben. Ohnehin hat die sich so nennende Philosophie es ausdrücklich ausgesprochen, daß das Wahre selbst nicht erkannt werden könne, sondern daß dies das Wahre sei, was jeder über die sittlichen Gegenstände, vornehmlich über Staat, Regierung und Verfassung, sich aus seinem Herzen, Gemüt und Begeisterung aufsteigen lasse. Was ist darüber nicht alles der Jugend insbesondere zum Munde geredet worden? Die Jugend hat es sich denn auch wohl gesagt sein lassen. Den Seinen gibt Er's schlafend, ist auf die Wissenschaft angewendet worden, und damit hat jeder Schlafende sich zu den Seinen gezählt; was er so im Schlafe der Begriffe bekommen, war denn freilich auch Ware danach. – Ein Heerführer dieser Seichtigkeit, die sich Philosophieren nennt, Herr Fries1, hat sich nicht entblödet, bei einer feierlichen, berüchtigt gewordenen öffentlichen Gelegenheit in einer Rede über den Gegenstand von Staat und Staatsverfassung die Vorstellung zu geben: ›in dem Volke, in welchem echter Gemeingeist herrsche, würde jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten das Leben von unten aus dem Volke kommen, würden jedem einzelnen Werke der Volksbildung und des volkstümlichen Dienstes sich lebendige Gesellschaften weihen, durch die heilige Kette der Freundschaft unverbrüchlich vereinigt‹, und dergleichen. – Dies ist der Hauptsinn der Seichtigkeit, die Wissenschaft, statt auf die Entwicklung des Gedankens und Begriffs, vielmehr auf die unmittelbare Wahrnehmung und die zufällige Einbildung zu stellen, ebenso die reiche Gliederung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik seiner Vernünftigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung der Kreise des öffentlichen Lebens und ihrer Berechtigungen und durch die Strenge des Maßes, in dem sich jeder Pfeiler, Bogen und Strebung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht, – diesen gebildeten Bau in den Brei des »Herzens, der Freundschaft und Begeisterung« zusammenfließen zu lassen. Wie nach Epikur die Welt überhaupt, so ist freilich nicht, aber so sollte die sittliche Welt nach solcher Vorstellung der subjektiven Zufälligkeit des Meinens und der Willkür übergeben werden. Mit dem einfachen Hausmittel, auf das Gefühl das zu stellen, was die und zwar mehrtausendjährige Arbeit der Vernunft und ihres Verstandes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden Begriffe geleiteten Vernunfteinsicht und Erkenntnis erspart. Mephistopheles bei Goethe – eine gute Autorität – sagt darüber ungefähr, was ich auch sonst angeführt:
Verachte nur Verstand und Wissenschaft,
des Menschen allerhöchste Gaben –
so hast dem Teufel dich ergeben
und mußt zugrunde gehn.
Unmittelbar nahe liegt es, daß solche Ansicht sich auch die Gestalt der Frömmigkeit annimmt; denn mit was allem hat dieses Getreibe sich nicht zu autorisieren versucht! Mit der Gottseligkeit und der Bibel aber hat es sich die höchste Berechtigung, die sittliche Ordnung und die Objektivität der Gesetze zu verachten, zu geben vermeint. Denn wohl ist es auch die Frömmigkeit, welche die in der Welt zu einem organischen Reiche auseinandergeschlagene Wahrheit zur einfacheren Anschauung des Gefühls einwickelt. Aber sofern sie rechter Art ist, gibt sie die Form dieser Region auf, sobald sie aus dem Innern heraus in den Tag der Entfaltung und des geoffenbarten Reichtums der Idee eintritt, und bringt aus ihrem inneren Gottesdienst die Verehrung gegen eine an und für sich seiende, über die subjektive Form des Gefühls erhabene Wahrheit und Gesetze mit. Die besondere Form des üblen Gewissens, welche sich in der Art der Beredsamkeit, zu der sich jene Seichtigkeit aufspreizt, kundtut, kann hierbei bemerklich gemacht werden; und zwar zunächst, daß sie da, wo sie am geistlosesten ist, am meisten vom Geiste spricht, wo sie am totesten und ledernsten redet, das Wort Leben und ins Leben einführen, wo sie die größte Selbstsucht des leeren Hochmuts kundtut, am meisten das Wort Volk im Munde führt. Das eigentümliche Wahrzeichen aber, das sie an der Stirne trägt, ist der Haß gegen das Gesetz. Daß Recht und Sittlichkeit, und die wirkliche Welt des Rechts und des Sittlichen, sich durch den Gedanken erfaßt, durch Gedanken sich die Form der Vernünftigkeit, nämlich Allgemeinheit und Bestimmtheit gibt, dies, das Gesetz, ist es, was jenes sich das Belieben vorbehaltende Gefühl, jenes das Rechte in die subjektive Überzeugung stellende Gewissen mit Grund als das sich feindseligste ansieht. Die Form des Rechten als einer Pflicht und als eines Gesetzes wird von ihm als ein toter, kalter Buchstabe und als eine Fessel empfunden; denn es erkennt in ihm nicht sich selbst, sich in ihm somit nicht frei, weil das Gesetz die Vernunft der Sache ist und diese dem Gefühle nicht verstattet, sich an der eigenen Partikularität zu wärmen. Das Gesetz ist darum, wie im Laufe dieses Lehrbuchs irgendwo angemerkt worden, vornehmlich das Schiboleth, an dem die falschen Brüder und Freunde des sogenannten Volkes sich abscheiden.
Indem nun die Rabulisterei der Willkür sich des Namens der Philosophie bemächtigt und ein großes Publikum in die Meinung zu versetzen vermocht hat, als ob dergleichen Treiben Philosophie sei, so ist es fast gar zur Unehre geworden, über die Natur des Staats noch philosophisch zu sprechen; und es ist rechtlichen Männern nicht zu verargen, wenn sie in Ungeduld geraten, sobald sie von philosophischer Wissenschaft des Staats reden hören. Noch weniger ist sich zu verwundern, wenn die Regierungen auf solches Philosophieren endlich die Aufmerksamkeit gerichtet haben, da ohnehin bei uns die Philosophie nicht, wie etwa bei den Griechen, als eine private Kunst exerziert wird, sondern sie eine öffentliche, das Publikum berührende Existenz, vornehmlich oder allein im Staatsdienste, hat. Wenn die Regierungen ihren diesem Fache gewidmeten Gelehrten das Zutrauen bewiesen haben, sich für die Ausbildung und den Gehalt der Philosophie auf sie gänzlich zu verlassen – wäre es hier und da, wenn man will, nicht so sehr Zutrauen als Gleichgültigkeit gegen die Wissenschaft selbst gewesen und das Lehramt derselben nur traditionell beibehalten worden (wie man denn, soviel mir bekannt ist, in Frankreich die Lehrstühle der Metaphysik wenigstens hat eingehen lassen) –, so ist ihnen vielfältig jenes Zutrauen schlecht vergolten worden, oder wo man, im andern Fall, Gleichgültigkeit sehen wollte, so wäre der Erfolg, das Verkommen gründlicher Erkenntnis, als ein Büßen dieser Gleichgültigkeit anzusehen. Zunächst scheint wohl die Seichtigkeit etwa am allerverträglichsten wenigstens mit äußerer Ordnung und Ruhe zu sein, weil sie nicht dazu kommt, die Substanz der Sachen zu berühren, Ja nur zu ahnen; sie würde somit, zunächst wenigstens, polizeilich nichts gegen sich haben, wenn nicht der Staat noch das Bedürfnis tieferer Bildung und Einsicht in sich schlösse und die Befriedigung desselben von der Wissenschaft forderte. Aber die Seichtigkeit führt von selbst in Rücksicht des Sittlichen, des Rechts und der Pflicht überhaupt, auf diejenigen Grundsätze, welche in dieser Sphäre das Seichte ausmachen, auf die Prinzipien der Sophisten, die wir aus Platon so entschieden kennenlernen, – die Prinzipien, welche das, was Recht ist, auf die subjektiven Zwecke und Meinungen, auf das subjektive Gefühl und die partikuläre Überzeugung stellen, – Prinzipien, aus welchen die Zerstörung ebenso der inneren Sittlichkeit und des rechtschaffenen Gewissens, der Liebe und des Rechts unter den Privatpersonen, als die Zerstörung der öffentlichen Ordnung und der Staatsgesetze folgt. Die Bedeutung, welche dergleichen Erscheinungen für die Regierungen gewinnen müssen, wird sich nicht etwa durch den Titel abweisen lassen, der sich auf das geschenkte Zutrauen selbst und auf die Autorität eines Amtes stützte, um an den Staat zu fordern, daß er das, was die substantielle Quelle von den Taten, die allgemeinen Grundsätze, verdirbt, und sogar dessen Trotz, als ob es sich so gehörte, gewähren und walten lassen solle. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, ist ein alter Scherz, den man wohl in unsern Zeiten nicht gar für Ernst wird behaupten wollen.
In der Wichtigkeit der Art und Weise des Philosophierens, welche durch die Umstände bei den Regierungen aufgefrischt worden ist, läßt sich das Moment des Schutzes und Vorschubs nicht verkennen, dessen das Studium der Philosophie nach vielen anderen Seiten hin bedürftig geworden zu sein scheint. Denn liest man in so vielen Produktionen aus dem Fache der positiven Wissenschaften, ingleichen der religiösen Erbaulichkeit und anderer unbestimmter Literatur, wie darin nicht nur die vorhin erwähnte Verachtung gegen die Philosophie bezeigt ist, daß solche, die zugleich beweisen, daß sie in der Gedankenbildung völlig zurück sind und Philosophie ihnen etwas ganz Fremdes ist, doch sie als etwas bei sich Abgetanes behandeln, – sondern wie daselbst ausdrücklich gegen die Philosophie losgezogen und ihr Inhalt, die begreifende Erkenntnis Gottes und der physischen und geistigen Natur, die Erkenntnis der Wahrheit als für eine törichte, Ja sündhafte Anmaßung erklärt, wie die Vernunft, und wieder die Vernunft, und in unendlicher Wiederholung die Vernunft angeklagt, herabgesetzt und verdammt, – oder wie wenigstens zu erkennen gegeben wird, wie unbequem bei einem großen Teile des wissenschaftlich sein sollenden Treibens die doch unabwendbaren Ansprüche des Begriffes fallen, – wenn man, sage ich, dergleichen Erscheinungen vor sich hat, so möchte man beinahe dem Gedanken Raum geben, daß von dieser Seite die Tradition nicht mehr ehrwürdig noch hinreichend wäre, dem philosophischen Studium die Toleranz und die öffentliche Existenz zu sichern.2 – Die zu unserer Zeit gang und gäben Deklamationen und Anmaßungen gegen die Philosophie bieten das sonderbare Schauspiel dar, daß sie durch jene Seichtigkeit, zu der diese Wissenschaft degradiert worden ist, einerseits ihr Recht haben und andererseits selbst in diesem Elemente wurzeln, gegen das sie undankbar gerichtet sind. Denn indem jenes sich so nennende Philosophieren die Erkenntnis der Wahrheit für einen törichten Versuch erklärt hat, hat es, wie der Despotismus der Kaiser Roms Adel und Sklaven, Tugend und Laster, Ehre und Unehre, Kenntnis und Unwissenheit gleichgemacht hat, alle Gedanken und alle Stoffe nivelliert, – so daß die Begriffe des Wahren, die Gesetze des Sittlichen auch weiter nichts sind als Meinungen und subjektive Überzeugungen und die verbrecherischsten Grundsätze als Überzeugungen mit jenen Gesetzen in gleiche Würde gestellt sind, und daß ebenso jede noch so kahlen und partikularen Objekte und noch so strohernen Materien in gleiche Würde gestellt sind mit dem, – was das Interesse aller denkenden Menschen und die Bänder der sittlichen Welt ausmacht.
Es ist darum als ein Glück für die Wissenschaft zu achten – in der Tat ist es, wie bemerkt, die Notwendigkeit der Sache –, daß jenes Philosophieren, das sich als eine Schulweisheit in sich fortspinnen mochte, sich in näheres Verhältnis mit der Wirklichkeit gesetzt hat, in welcher es mit den Grundsätzen der Rechte und der Pflichten Ernst ist und welche im Tage des Bewußtseins derselben lebt, und daß es somit zum öffentlichen Bruche gekommen ist. Es ist eben diese Stellung der Philosophie zur Wirklichkeit, welche die Mißverständnisse betreffen, und ich kehre hiermit zu dem zurück, was ich vorhin bemerkt habe, daß die Philosophie, weil sie das Ergründen des Vernünftigen ist, eben damit das Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines Jenseitigen ist, das Gott weiß wo sein sollte – oder von dem man in der Tat wohl zu sagen weiß, wo es ist, nämlich in dem Irrtum eines einseitigen, leeren Räsonierens. Im Verlaufe der folgenden Abhandlung habe ich bemerkt, daß selbst die Platonische Republik, welche als das Sprichwort eines leeren Ideals gilt, wesentlich nichts aufgefaßt hat als die Natur der griechischen Sittlichkeit, und daß dann im Bewußtsein des in sie einbrechenden tieferen Prinzips, das an ihr unmittelbar nur als eine noch unbefriedigte Sehnsucht und damit nur als Verderben erscheinen konnte, Platon aus eben der Sehnsucht die Hilfe dagegen hat suchen müssen, aber sie, die aus der Höhe kommen mußte, zunächst nur in einer äußeren besonderen Form jener Sittlichkeit suchen konnte, durch welche er jenes Verderben zu gewältigen sich ausdachte und wodurch er ihren tieferen Trieb, die freie unendliche Persönlichkeit, gerade am tiefsten verletzte. Dadurch aber hat er sich als der große Geist bewiesen, daß eben das Prinzip, um welches sich das Unterscheidende seiner Idee dreht, die Angel ist, um welche die bevorstehende Umwälzung der Welt sich gedreht hat.
Was vernünftig ist, das ist wirklich;
und was wirklich ist, das ist vernünftig.
In dieser Überzeugung steht jedes unbefangene Bewußtsein wie die Philosophie, und hiervon geht diese ebenso in Betrachtung des geistigen Universums aus als des natürlichen. Wenn die Reflexion, das Gefühl oder welche Gestalt das subjektive Bewußtsein habe, die Gegenwart für ein Eitles ansieht, über sie hinaus ist und es besser weiß, so befindet es sich im Eitlen, und weil es Wirklichkeit nur in der Gegenwart hat, ist es so selbst nur Eitelkeit. Wenn umgekehrt die Idee für das gilt, was nur so eine Idee, eine Vorstellung in einem Meinen ist, so gewährt hingegen die Philosophie die Einsicht, daß nichts wirklich ist als die Idee. Darauf kommt es dann an, in dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das gegenwärtig ist, zu erkennen. Denn das Vernünftige, was synonym ist mit der Idee, indem es in seiner Wirklichkeit zugleich in die äußere Existenz tritt, tritt in einem unendlichen Reichtum von Formen, Erscheinungen und Gestaltungen hervor und umzieht seinen Kern mit der bunten Rinde, in welcher das Bewußtsein zunächst haust, welche der Begriff erst durchdringt, um den inneren Puls zu finden und ihn ebenso in den äußeren Gestaltungen noch schlagend zu fühlen. Die unendlich mannigfaltigen Verhältnisse aber, die sich in dieser Äußerlichkeit, durch das Scheinen des Wesens in sie, bilden, dieses unendliche Material und seine Regulierung ist nicht Gegenstand der Philosophie. Sie mischte sich damit in Dinge, die sie nicht angehen; guten Rat darüber zu erteilen, kann sie sich ersparen; Platon konnte es unterlassen, den Ammen anzuempfehlen, mit den Kindern nie stillezustehen, sie immer auf den Armen zu schaukeln, ebenso Fichte die Vervollkommnung der Paßpolizei bis dahin, wie man es nannte, zu konstruieren, daß von den Verdächtigen nicht nur das Signalement in den Paß gesetzt, sondern das Porträt darin gemalt werden solle. In dergleichen Ausführungen ist von Philosophie keine Spur mehr zu sehen, und sie kann dergleichen Ultraweisheit um so mehr lassen, als sie über diese unendliche Menge von Gegenständen gerade am liberalsten sich zeigen soll. Damit wird die Wissenschaft auch von dem Hasse, den die Eitelkeit des Besserwissens auf eine Menge von Umständen und Institutionen wirft – ein Haß, in welchem sich die Kleinlichkeit am meisten gefällt, weil sie nur dadurch zu einem Selbstgefühl kommt –, sich am entferntesten zeigen.
So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält, nichts anderes sein als der Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. Als philosophische Schrift muß sie am entferntesten davon sein, einen Staat, wie er sein soll