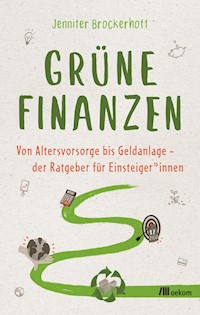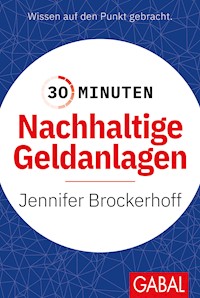Jennifer Brockerhoff
GrüneFinanzen
Von Altersvorsorge bis Geldanlage –der Ratgeber für Einsteiger*innen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2021, oekom verlag Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: Vanessa WeuffelIllustrationen: Angela GerlachLektorat: Christian WölleckeInnenlayout & Satz: Ines SwobodaKorrektorat: Maike Specht
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96238-811-9
Für Karin – raggio di sole
Haftungsausschluss
Die Verwendung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Dieses Buch dient als reine Informationsquelle und nicht als Anlageempfehlung. Die Autorin sowie der Verlag übernehmen daher keine Verantwortung für das Nichterreichen der im Buch beschriebenen Ziele. Haftungsansprüche gegen den Verlag und die Autorin für finanzielle oder ideelle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen beziehungsweise durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Der Verlag und die Autorin übernehmen jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Druckfehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es können keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandene Folgen vom Verlag beziehungsweise der Autorin übernommen werden.
Jede Geldanlage, finanzielle Investition und jedes Wertpapier ist grundsätzlich mit Risiken behaftet. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann grundsätzlich nicht übernommen werden.
Die steuerlichen Ausführungen basieren auf unserem Verständnis der derzeit bekannten deutschen Gesetzeslage für deutsche Anleger*innen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerlichen Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände der einzelnen Anleger*innen von Bedeutung sein können. Interessierten Anleger*innen wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerlichen Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, das Halten oder die Veräußerung von Wertpapieren und Geldanlagen beraten zu lassen.
Einleitung
Nachhaltigkeit: Reine Frauensache?
Erstes Kapitel
Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit
Zweites Kapitel
Die Wirkung Ihres Geldes
Drittes Kapitel
Die Planung – bevor es losgeht
Viertes Kapitel
Anlageklassen und Anlagehorizont
Fünftes Kapitel
Das magische Viereck der Vermögensanlage
Sechstes Kapitel
Gedanken zu Sicherheit und Risiko von Geldanlagen
Siebtes Kapitel
Der meteorologische Börsenbericht
Achtes Kapitel
Siegel und Ratings: Nützliche Orientierungshilfen im Dschungel der nachhaltigen Anlagen?
Anlagepraxis: So könnte Ihr Portfolio aussehen
Resümee und Schlussgedanken
»Entweder wir ändern uns, oder wir werden geändert.«
Interview mit Niko Paech
Nachschlagewerk für Fachbegriffe
Weiterführende Literatur und Informationsquellen
Quellenverzeichnis
Einleitung
Kennen Sie die Serie Bad Banks? Darin geht es um die steile Karriere einer jungen Bänkerin, um Macht, Intrigen und natürlich um jede Menge Geld. Geld, das irgendwo angelegt werden muss. Nachhaltig, ökologisch? Nun ja.
»Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße?!« Dieser Satz stammt aus der 2. Staffel der Serie und spiegelt wider, was in der Investmentbranche noch fest in den meisten Köpfen verankert ist: Nachhaltigkeit ist nur ein Trend. Nachhaltigkeit bringt weniger Rendite. Nachhaltigkeit ist nur für Ökos. Nachhaltigkeit bedeutet mehr Risiko. Nachhaltigkeit ist ein Fake.
Doch wie sieht es in anderen Branchen aus? In der Bekleidungsindustrie ist eine immer größer werdende Fair-Fashion-Bewegung entstanden, die Kosmetikindustrie wirbt für Produkte ohne Mikroplastik und versucht sich mehr und mehr am Konzept von Zero Waste, also der kompletten Vermeidung von Müll: Als Kund*in kann man Seifenstücke statt Duschgelflaschen oder Zahnputztabletten statt Zahnpastatuben in den Regalen finden. Auch regionale Lebensmittel werden immer gefragter, und ein prominenter Wursthersteller verdient mittlerweile mehr Geld mit Ersatzprodukten statt mit echtem Fleisch. Immer mehr Konsument*innen hinterfragen Herstellungsprozesse, informieren sich über Verbraucherportale und treffen nachhaltigere Konsumentscheidungen. Andere Branchen sind also schon weit gekommen, wenn es um nachhaltigere Lösungen und den Umweltschutz geht.
Wir alle kennen den Spruch: »Geld regiert die Welt.« Dabei sind große Konzerne, Institutionen und Staaten gemeint. Wo investieren sie ihr Geld, wie wird Rendite erzielt? Und spielt Nachhaltigkeit in den Investitionsentscheidungen überhaupt eine Rolle? Das zeigt sich beim Blick auf das Geld der großen Finanzplayer am Markt. Der norwegische Staatsfonds zum Beispiel ist der größte Staatsfonds der Welt und legt die Einnahmen aus den norwegischen Erdölverkäufen für die Einwohner*innen Norwegens an. Seine Anlagepolitik verbietet seit 2015 die Investition in Firmen, die mehr als 30 Prozent ihrer Einnahmen durch Kohle erwirtschaften. Der deutlich kleinere irische Staatsfonds investiert seit 2016 weder direkt noch indirekt in Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern. Der größte Versicherer Europas, die Allianz SE, versichert keine neuen Kohlekraftwerke oder Kohleminen und wird bestehende Verträge nicht verlängern und bis 2040 versicherte Kohlerisiken vollständig auslaufen lassen. Bezeichnend war außerdem die 2021er-Ausgabe des Briefes, den BlackRock-CEO Larry Fink jährlich an Unternehmenslenker verschickt.1 Der einflussreiche Chef des größten Vermögensverwalters der Welt mahnte die größten Konzernchefs darin zu mehr Ökodenken. Dies meinte er vor allem aus Sicht eines Kapitalisten, der durch die Folgen des Klimawandels die zukünftigen Renditen bestehender Wertpapierportfolios in Gefahr sieht. Es verändert sich also so einiges im Hintergrund.
Wie sieht es aktuell mit dem Anlageverhalten der »normalen« Anleger*innen aus?
Die Zahlen sprechen für sich: In nur einem Jahr haben Privatanleger*innen in Deutschland ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen fast verdoppelt – von 9,4 auf 18,3 Milliarden Euro. So steht es im letzten Marktbericht des Fachverbands »Forum Nachhaltige Geldanlagen«, kurz FNG.
Das Volumen von nachhaltigen Fonds und Mandaten ist insgesamt um über 37 Prozent angestiegen – von 133 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 183 Milliarden Euro bis Ende 2019. Das hört sich nach viel an, ist es in Wahrheit jedoch noch nicht. Denn es entspricht gerade einmal einem Marktanteil von 5,4 Prozent.2 Da geht noch einiges! Die Dynamik des Wachstums ist beachtlich und zeigt, wie sehr nachhaltiges Investieren in den letzten fünf Jahren aus der Nische auf die Hauptbühne katapultiert worden ist. Noch sind die Hauptinvestor*innen vor allem die sogenannten institutionellen Anleger*innen, also die Pensionskassen, Stiftungen, Banken oder Investmentgesellschaften mit fast 90 Prozent Marktanteil.
Aber das wird sich in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich ändern. Hier hilft die Politik, besser gesagt, eine Reihe von neuen Gesetzen in der Anlageberatung. Bald müssen Sie gefragt werden, ob nachhaltige Aspekte in Ihrer Anlageentscheidung eine Rolle spielen, und wenn ja, welche im Einzelnen. Ein Novum. Und so wird endlich das Henne-Ei-Problem gelöst. Wie es genau aussah? Nun, Menschen, die sich für nachhaltige Geldanlagen interessierten, bekamen sie nur sehr selten von ihren Finanzberater*innen angeboten. Umgekehrt sahen die Finanzberater*innen keinen Bedarf und boten nachhaltige Geldanlagen nicht an, schließlich fragte kein Mensch danach!
Aber wie gesagt, der Wind dreht sich. Besonders seit 2020 kann man eine wahre Lawine an neuen Presseartikeln rund um das Thema grünes Geld feststellen. Befeuert wird diese Nachfrage ganz gewiss auch durch den von der EU in 2018 vorgelegten »Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums«. Dieser Plan ist ein Gamechanger für den Finanzmarkt: ein nachhaltigeres, ökologisch und sozial verantwortlicheres Finanzwesen.
Mit etwas Verspätung müssen ab 2022 alle Finanzberater*innen und Portfoliomanager*innen ihre Kund*innen zu Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und diese bei Beratungen und Vermögensverwaltungen berücksichtigen. Ein echtes Novum und eine Erweiterung der bestehenden Finanzmarktrichtlinie MiFiD II.
Der EU-Aktionsplan Sustainable Finance umfasst dabei drei wesentliche Aktionsfelder: die Neuausrichtung von Kapitalströmen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die Einbettung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement und Förderung von Transparenz und Langfristigkeit. Hinzu kommen weitere Unterziele, exemplarisch sei hier das relativ sperrige Wort »Taxonomie« genannt. Bezogen ist es auf die Ausrichtung der Kapitalströme und steht für ein Klassifizierungssystem für ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften.
Kern der Taxonomie sind sechs EU-Umweltziele: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Überleitung zu einer Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung und Recycling, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.
Die Details der Umsetzung sind teilweise noch offen und sorgen daher vielerorts für Kopfzerbrechen. Derzeit stehen die Klimaziele im Fokus. Eine Ausdehnung der Taxonomie auf soziale Aspekte und neue Vorgaben der Unternehmensberichterstattung sollen folgen. Zusätzlich traten ab März 2021 Transparenzpflichten in Kraft. Diese weitere EU-Verordnung verpflichtet Produktanbieter*innen und Anlageberater*innen dazu, darüber zu berichten, wie sie mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen, sowohl auf Gesellschafts- als auch auf Produktebene. Greenwashing soll damit deutlich eingedämmt werden. Diejenigen Produktanbieter*innen, die sich als Nachhaltigkeitspionier*innen dargestellt haben, müssen es jetzt auch nachweisen.
Es herrscht viel Unsicherheit unter den Finanzmarktakteur*innen und teilweise viel Widerstand. Welche Signalwirkung haben die EU-Verordnungen für die globalen Finanzmärkte? Kritiker*innen führen an, dass es für Nachhaltigkeit keine politisch motivierte Blaupause geben kann. Ihrer Meinung nach führt die massive Lenkung von Geldern in grüne Produkte am ehesten zu einer neuen gefährlichen Finanzblase. Andererseits steigt das Bewusstsein der Anleger*innen, welche positiven wie negativen Auswirkungen das investierte Geld haben kann. Es bleibt also eine Gratwanderung für alle Beteiligten, wo ganz sicher noch sehr viel nachjustiert werden muss.
Fest steht: Schon heute kann es sich keine namhafte Zeitung mehr leisten, das Thema »nachhaltige Finanzen« zu übergehen. Durch den medialen Fokus steigt automatisch das Interesse der Menschen an den Investitionsmöglichkeiten. Blöd nur, dass mehr als die Hälfte der Bankberater*innen und Finanzdienstleister*innen sich fachlich noch nicht fit genug fühlt, um Kund*innen eine qualifizierte Beratung in dieser Sache anzubieten.3 Erschwerend kommt hinzu, dass die stark gestiegene Nachfrage auch weniger seriöse Anbieter anlockt. Diese vermeintlichen Ökopionier*innen kommen mit heilsbringenden Broschüren von Produkten daher, die unsere Welt im Handumdrehen zu einem besseren Ort machen sollen.
Genau deshalb habe ich diesen Ratgeber geschrieben. Er richtet sich an alle, die sich für eine nachhaltige Geldanlage interessieren. In den folgenden Kapiteln möchte ich Ihnen Basiswissen vermitteln, mit gängigen Vorurteilen aufräumen und einzelne Schritte und Ideen für eine Umsetzung vorstellen. Um das oft als trocken bezeichnete Thema spannender zu gestalten, habe ich die folgenden Kapitel in Teilen thematisch an eine Wandertour in den Bergen angelehnt. Es gibt nämlich eine Vielzahl an Parallelen, unter anderem dass das Interesse an Wanderwegen seit Ausbruch der Pandemie im Vergleich zu 2019 um 62 Prozent angestiegen ist. Zusätzlich finden Sie am Beginn eines jeden Kapitels eine grafische Zusammenfassung sowie ein Etappenziel am Ende. Zudem ist nachhaltige Geldanlage verbunden mit vielen Fremdwörtern. Am Ende des Buches finden Sie deshalb ein Nachschlagewerk der gängigsten Begrifflichkeiten.
»Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun.«
Mark Twain
Nachhaltigkeit: Reine Frauensache?
Bevor wir uns mit nachhaltiger Geldanlage beschäftigen, möchte ich noch ein kurzes Kapitel voranstellen, das mit meinen Beobachtungen zu tun hat: Ich habe bemerkt, dass das Thema »Nachhaltigkeit« häufig mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert wird. Auf Social-Media-Kanälen überwiegen Eco-Influencerinnen, die zu massenkompatiblen Themen wie Kosmetik, Mode oder Nahrungsmitteln posten und Rezepte teilen. Meine Beratungsleistungen werden vorwiegend von Frauen in Anspruch genommen, die mich gezielt aufgrund meiner Qualifikation als Fachberaterin für nachhaltiges Investment auswählen. Die bekanntesten Gesichter der Fridays-for-Future-Bewegung sind Greta Thunberg, Luisa Neubauer oder Carla Reemtsma. Interessanterweise werden Umweltschutzthemen in abendlichen Talkshows überwiegend von Frauen vertreten, während die Gegenseite aus Wirtschaft, Automobilindustrie und Energiesektor oft von männlichen Vertretern geprägt ist.
Genau diese Tatsache mag uns eine tiefere Einsicht in den Mythos der »nachhaltigen Frau« liefern. Ich meine, dass unsere Sozialisierung eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob wir mit nachhaltigen Themen konfrontiert werden und somit Entscheidungen treffen müssen. Genauso wirkt die traditionelle Rollenverteilung, die im Land noch allerorten anzutreffen ist: Wir mögen zwar eine Bundeskanzlerin haben, jedoch liegt Deutschland seit vielen Jahren stabil auf Platz zwölf im EU-Gleichstellungsranking. Laut der AllBright Stiftung sitzen in den Geschäftsführungen der hundert größten deutschen Familienunternehmen nur sehr wenige Frauen. Außerdem liegt in diesem Land der Anteil der Start-up-Gründerinnen bei nur 15,7 Prozent. Weil Frauen weniger Geschäftsideen haben? Wohl kaum!
Sobald eine Familie gegründet wird, bleiben eher Mütter als Väter zu Hause, um sich um Kinder und Haushalt zu kümmern, oder steigen in Teilzeit wieder in den erlernten Beruf ein. Oft mit dem Argument, dass frau weniger verdient (der Gender-Pay-Gap lässt grüßen). Zudem wird eine längere Elternzeit bei Vätern nach wie vor als exotisch angesehen. Unbezahlte Hausarbeiten wie Einkaufen, Putzen, Waschen und Mülltrennung bleiben somit gezwungenermaßen Frauensache. Und hier kommt der Trend zu nachhaltigen Konsumentscheidungen ins Spiel. Der soziale Druck von gut situierten Familien des globalen Nordens hat sogar einen Eco-Lifestyle erschaffen. Die neue Gruppenzugehörigkeit definiert sich dann unter anderem darüber, phosphatfreies Waschmittel zu kaufen, Kosmetik ohne Mikroplastik zu nutzen und die Einkäufe möglichst plastikfrei und unverpackt zu erledigen.
Diese Kaufentscheidungen weiten sich automatisch auf weitere Personengruppen aus. Denn es sind meistens Frauen, die sich um die älter gewordenen Eltern, Großeltern oder andere pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern und wiederum Kaufentscheidungen für sie treffen.
Zu diesem Umstand lieferten die drei amerikanischen Wissenschaftlerinnen Ruth Meinzen-Dick, Chiara Kovarik und Agnes Quisumbing in einer Veröffentlichung im Jahr 2014 am International Food Policy Research Institute in Washington, D. C. eine weitere interessante Erkenntnis.4
Durch die tradierte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist der Bewegungsradius von Frauen, gerade auch länderübergreifend gesehen, deutlich eingeschränkter als der von Männern. Männer besitzen circa zweimal so häufig wie Frauen einen eigenen Pkw, obwohl die Zahl der Menschen mit Führerschein geschlechterübergreifend ähnlich hoch ist. Frauen nutzen häufiger den ÖPNV, das Fahrrad oder gehen zu Fuß. Geht weniger Mobilität mit weniger Status, weniger Karrierechancen und – auf andere Länder bezogen – mit einem eingeschränkten Zugang zu Ressourcen und damit auch Macht einher? Millennials sehen das anders und legen deutlich weniger Wert auf Führerschein und Auto – vielleicht eine Trendumkehr als heimliche Unterstützung der Geschlechtergleichheit.
Unbestritten gibt es natürlich viele männliche Umweltschützer, die uns das geheime Leben der Bäume erklären oder Dokumentationen über unsere faszinierende Erde drehen sowie sich unermüdlich wissenschaftlich und politisch engagieren. Die Verantwortung für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ist selbstverständlich geschlechterübergreifend. Umso wichtiger ist es, alte Denkmuster zu verändern und die Macht der Wörter zu begreifen. Daher richtet sich dieser Ratgeber explizit an alle Geschlechter. Denn das, was am meisten fehlt, um gute Finanzentscheidungen zu treffen, ist Basiswissen. Männer trauen sich auch ohne tief greifendes Wissen in risikoreichere Geldanlagen, während Frauen, häufig bedingt durch Familienzuwachs, deutlich risikoscheuer sind und dann sicherheitshalber Rücklagen auf unverzinsten Tagesgeldkonten horten.5 Ich verstehe mein Buch als Anreiz, dass dies endlich ein Ende hat, und starte mit einer kurzen Übersicht zur Historie der Nachhaltigkeit.
Erstes Kapitel
Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit
Es ist heutzutage kaum vorstellbar, dass die Alpen im 17. Jahrhundert noch als »hässlich«, »bedrohlich« und »widerwärtig« galten und vielen Menschen sogar unheimlich waren. Die Berge als Urlaubsziel anzusteuern oder sogar aus Wellness-Gründen zu besuchen, auf diese Idee wäre damals kaum jemand gekommen. Wer es sich leisten konnte, der ging nicht zu Fuß, sondern ließ sich mit der Kutsche von A nach B transportieren. Dem bedrohlichen Anblick der Berge entkam man durch hübsche Gardinen an den Kutschenfenstern.