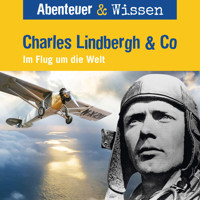16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Am 18. Oktober 1977 wurde in der Wüste Somalias ein deutscher Mythos geboren: Auf dem Flughafen von Mogadischu befreite die GSG9 aus einer entführten Lufthansa-Maschine 86 Menschen. Es war der erste große Einsatz der Antiterroreinheit, und er machte sie schlagartig weltbekannt. Der Mythos zerbrach 16 Jahre später auf dem Bahnhof von Bad Kleinen, als die Festnahme von RAF-Mitgliedern mit zwei Toten endete, und eine Staatskrise auslöste.
50 Jahre nach ihrer Gründung erzählt Martin Herzog von den Anfängen der GSG9, von Erfolgen und Fehlschlägen, aber auch von fragwürdigen Indienstnahmen durch Außenpolitik und Geheimdienste. Gestützt auf Archivrecherchen und Interviews mit Zeitzeug:innen liegt damit erstmals eine fundierte Geschichte dieser mythenumrankten Polizeieinheit vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Ähnliche
Martin Herzog
GSG 9Ein deutscher Mythos
MARTIN HERZOG
GSG 9EIN DEUTSCHER MYTHOS
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeAngaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Aufbau Digital,veröffentlicht in der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
Die Originalausgabe erschien 2022 im Ch. Links Verlag, einer Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
www.christoph-links-verlag.de
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unter Verwendungeines Fotos von einer Abseilübung von GSG-9-Beamtenauf dem Flugplatz Hangelar 1975, © Bundespolizei
Lektorat: Dr. Ludger Ikas, Berlin
ISBN 978-3-96289-142-8
eISBN 978-3-8412-3098-0
INHALT
Einleitung: Diesseits des Mythos
1 »Heitere Spiele« in München
2 Eine Truppe gegen den Terror
3 Wegener in Israel
4 Ein Anfang mit Nadel und Faden
Exkurs: Die GSG 9 und das Recht
5 Die Djangos vom Bundesgrenzschutz
6 Trainingsweltmeister
7 1977 – Ein ganzes Jahr lang Herbst
8 Schleyer-Fahndung
9 Die Landshut – Odyssee nach Afrika
10 »Feuerzauber« in Mogadischu
11 Heldenmythos
12 Zirkus Wegener
Exkurs: Die GSG 9 und die Frauen
13 Das große Loch
14 Exportschlager GSG 9
15 Aufbauhilfe Nahost
16 Föderale Befindlichkeiten
Exkurs: Die »GSG 9 der DDR«
17 Bittere »Weinlese« in Bad Kleinen
18 Ein Mythos zerbricht
19 Eine ganz normale Spezialeinheit
Exkurs: Die GSG 9 und der Korpsgeist
20 Jenseits des Mythos
AnhangAbkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Verzeichnis der interviewten Personen
Quellen
Der Autor
EINLEITUNGDIESSEITS DES MYTHOS
Wer zum Mythos möchte, muss einen Umweg nehmen. Die Bundesgrenzschutzstraße führt von der B 56 Sankt Augustin-Hangelar zwischen Wiesen und Buschbewuchs entlang der umzäunten Liegenschaft der Bundespolizeidirektion. Nach einem Kilometer, just bevor die Straße in einem Acker zu enden droht, macht sie einen scharfen Knick nach rechts. Dann steht der Besucher vor dem Haupttor. Die Sicherheitsmaßnahmen: unaufgeregt – Maschendrahtzaun, offener Schlagbaum, Hauptwache. Nach Anmeldung und Umtausch des Personalausweises gegen einen Besucherpass: Begrüßung durch die »Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit«, so heißt die Mitarbeiterin des GSG-9-Leitungsbüros in klassischer Beamtenprosa. Sie ist gelernte Polizistin, trägt aber nicht die blaue Uniform der Bundespolizei, sondern das Olivgrün des alten Bundesgrenzschutzes – so wie die meisten ihrer Kollegen – samt Dienstpistole im Gürtelholster. Ja, auch die Beamten im Innendienst tragen sie ständig, ja, auch der Kommandeur, erklärt sie auf dem Weg zum Auto und bedeutet, man möge ihr hinterherfahren.
Von der Hauptwache sind es kaum hundert Meter geradeaus bis zum Hauptgebäude der GSG 9. Eigentlich. Denn die Straße endet bald vor schweren Betonblöcken. Sicherheitsgründe. Stattdessen führt der Weg zunächst rechts ab und dann anderthalb Kilometer im Karree durch das Kasernengelände, vorbei an Kantine, Unterkünften, Lkw-Stellplätzen und Werkstatthallen der Bundespolizei, bis die Straße schon wieder Richtung Ausfahrt an ein Gelände heranführt, das noch einmal von einem Zaun umgeben ist, deutlich höher als der erste, bewehrt mit NATO-Draht. Überwachungskameras, ein massives Rolltor vor dem Schlagbaum, eine weitere Wache, bei der der Besucherausweis von der Hauptwache gegen einen speziellen Hausausweis für die GSG 9 getauscht wird – eine Kaserne in der Kaserne.
Der schmucklose Verwaltungsbau mit der beigen Waschbetonfassade stammt noch aus der Anfangszeit der GSG 9. Nach einem halben Jahrhundert soll einen Steinwurf entfernt bald ein neues Gebäude entstehen, das den Anforderungen – und der Größe – einer modernen Spezialeinheit gerecht werde, erklärt die Presse-Dame. Dann soll die GSG 9 über zwei Standorte verfügen: das Hauptquartier hier in Hangelar und eine Dependance in Berlin, wo die neue, vierte Einheit bereits einsatzfähig ist und, wie man hört, auch häufig angefordert wird.
Der Hauptsitz wird aber hier bleiben, bei Bonn zwischen Rhein und Siebengebirge. Über dem niedrigen Portal prangt groß und golden der Bundesadler mit ausladenden Eichenlaub-Garben links und rechts, das Verbandsabzeichen der GSG 9. Im Eingangsbereich innen an der Wand: großformatig gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos, Porträts der vier im Einsatz getöteten Beamten. Für den Verband sei es wichtig, das Gedenken wachzuhalten, erklärt die Pressesprecherin.
Der Kommandeur empfängt mit herzhaftem Handschlag, Kaffee und Keksen. Und in der Tat: Auch er trägt den Dienstrevolver zu seiner olivgrünen Grenzschutzuniform, immer alarmbereit. »Gewohnheit«, kommentiert der Chef schulterzuckend. Jérôme Fuchs kam 1997 zur GSG 9 und leitet die Spezialeinheit seit 2014. Wer einen schrankgroßen Haudegen erwartet hat, wird enttäuscht – smart und sportlich beschreibt es besser. Wenn das Wetter es zulässt, radelt er täglich zur Arbeit. In Rolli und Jackett statt Polizeiuniform könnte man ihn sich auch als Keynote-Speaker bei internationalen Wirtschaftskongressen vorstellen, und tatsächlich wird er immer mal wieder angefragt, um über das Management der GSG 9 zu referieren. Sein Thema: Leadership. Fuchs spricht viel von intrinsischer Motivation, Vertrauen in seine Mitarbeiter, Kommunikations- und Teamfähigkeit, einem positiven Menschenbild, dem richtigen Mindset – und von Kreativität, einer Qualität, die man bei einer Polizeieinheit zunächst nicht zwingend erwarten würde.
Klingt weniger nach Terroristenschreck als nach gefühligem Start-up. Fuchs betont aber, dies seien genau die Dinge, die seit fünfzig Jahren den Erfolg der GSG 9 ausmachten. International gelten die Beamten aus Sankt Augustin spätestens seit dem Deutschen Herbst 1977 als eine der besten, wenn nicht die beste Spezialeinheit der Welt, in Dutzenden Ländern gern gesehen für Aufbau und Ausbildung eigener Spezialtruppen. Wenige Beschreibungen über den kleinen Verband kommen ohne das Attribut »legendär« aus. Ein Mythos eben.
Das weiß die GSG 9 zu nutzen und so inszeniert sie sich als Marke im Antiterrorkampf. Darauf verweisen nicht nur die Kaffeebecher mit Verbandslogo auf dem Konferenztisch und der GSG-9-Fotokalender an der Wand, sondern auch die Tatsache, dass im Jahr 2005 bei der Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei einzig die GSG 9 ihren alten Namen behalten durfte (mit dem Zusatz »… der Bundespolizei«).
Eine Marke braucht ein Gesicht, ein Mythos braucht ein Geheimnis. Das Gesicht ist Jérôme Fuchs – im wörtlichen Sinne. Seit den 80er-Jahren will es die Hauspolitik, dass ausschließlich Name und Aussehen des jeweiligen Kommandeurs in der Öffentlichkeit bekannt werden sollen. Bis auf wenige Ausnahmen dürfen Klarnamen der Mitarbeiter nicht genannt werden, selbst der Ruf- und Spitzname, den jeder Einsatzbeamte zu Beginn seiner Laufbahn erhält, soll nirgends abgedruckt zu lesen sein. Fotos, auf denen Gesichter zu erkennen sind, selbstverständlich auch nicht. Immer wieder mal lässt die GSG 9 Filmaufnahmen für Fernsehdokus zu, die Gesichter der Akteure stets versteckt unter schwarzen Sturmhauben. Der Grund: Die Nennung von Klarnamen oder unverpixelte Gesichter würden die jeweiligen Beamten und ihre Familien in Gefahr bringen – die GSG 9 hat nicht nur Freunde. Der Verband fürchtet Vergeltungsaktionen, zum Beispiel aus Kreisen von Clan- oder Organisierter Kriminalität. In der Regel wissen lediglich die Ehefrauen und Partner/-innen, was genau ihre Männer beruflich so treiben. Selbst Geschwister und Eltern ahnen oft nur, was sie bei der Bundespolizei machen. Auch über Einsatztaktiken, Ausrüstung und Bewaffnung soll nicht zu viel in die Öffentlichkeit gelangen: Feind liest mit.
Und so grätschen die Pressekollegen bei Interviews immer wieder dazwischen, wenn Einheitsführer oder Ausbildungsleiter beim Erzählen zu sehr ins Detail gehen: »Sorry, das lassen wir mal lieber weg.« Selbst der Kommandeur wird zurückgepfiffen, als er bei der Frage nach Herausforderungen im Feld der Cyberkriminalität zu viel preiszugeben droht. Das passiert natürlich immer dann, wenn die Geschichte gerade spannend wird. Was selten genug passiert. Nicht etwa, weil sie nichts Spannendes zu erzählen hätten. Aber zu ihrem Selbstverständnis gehört der Anspruch auf Selbstbeherrschung, Disziplin und vor allem das Bemühen, das, was sie machen, als nicht sensationell zu verkaufen, sondern als zwar hochprofessionell, aber als Spezialisierung und ansonsten nicht weiter bemerkenswert. Motto: Wir sind gewöhnliche Polizisten mit ungewöhnlichen Aufgaben.
Das stimmt natürlich so nicht. Das zeigt nicht nur der Identitätsschutz ihrer Mitarbeiter. Auch Eckdaten über diese Einheit werden nicht oder nur sehr ungefähr bekanntgegeben, selbst die Personalstärke bleibt geheim. Bei der Gründung 1972 waren es rund 120 Mann. In den 80er-Jahren wurde eine der Einsatzeinheiten in eine maritime Gruppe umgewidmet und die Einsatz- und Unterstützungseinheiten personell immer mal wieder aufgestockt. Schätzungen sprechen von inzwischen rund 500 Mann, doch offizielle Zahlen gibt es nicht, weder über die Einsatzbeamten noch über die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Technikabteilungen, im medizinischen und im Fahrdienst, im Führungsstab und in der Verwaltung dafür sorgen, dass diese Männer (bis heute keine Frauen) ihren Job machen können. Wie diese Zahlen bleiben viele Fakten über den Verband im Dunkeln, über den heutigen wie den einstigen. »Aus einsatztaktischen Gründen …«, heißt es dann stereotyp aus dem Verband. Das fördert den Mythos, aber nicht die Erkenntnis.
Natürlich gibt es Akten, aber wenige. Und davon wiederum bleibt einiges unter Verschluss. Viele Dokumente unterliegen noch den archivalischen Schutzfristen und einem komplizierten Freigabeverfahren, das auch nach etlichen Monaten nur zu mageren Ergebnissen führt. Einiges ist zudem von den beteiligten Behörden und Ministerien als »geheim« eingestuft und wird nicht freigegeben, anderes hat nie den Weg in die Archive gefunden. Nach Auskunft des Bundesarchivs wurden bis heute nur vereinzelt Unterlagen der GSG 9 abgegeben – trotz wiederholter Aufforderung und eindeutiger Gesetzeslage, die alle Bundeseinrichtungen dazu verpflichtet, relevante Unterlagen zur Archivierung weiterzuleiten.1 Was zu finden ist, sind die abgegebenen Unterlagen von Ministeriumsseite. Allerdings ergibt sich daraus nicht wirklich der Eindruck von Vollständigkeit. Oft handelt es sich um Einzelaspekte wie die häufigen Unfälle bei Abseilübungen in der Anfangszeit des Verbandes. Berichte über Einsätze hingegen tauchen nur sporadisch auf.
Die GSG 9 ist eben keine normale Polizeieinheit. Wer historisch zu diesem Spezialverband vordringen will, muss deshalb einen ähnlichen Umweg nehmen wie den zum Hauptquartier in Hangelar, muss sie einkreisen, diejenigen fragen, die dabei gewesen sind, und – wo das nicht möglich ist, wie beim 2017 verstorbenen Gründungskommandeur Ulrich Wegener – deren Zeugnisse und Bekenntnisse nutzen. Natürlich besteht dabei die Gefahr, dass die ein oder andere Geschichte pointierter ausfällt, als sie sich damals zugetragen hat. Auch das Interesse, die eigene Rolle in der Rückschau möglichst gut aussehen zu lassen, ist nicht zu unterschätzen. Allerdings: Bei schriftlichen Dokumenten verhält es sich ja nicht anders. Nur weil etwas als »Verschlusssache« zwischen zwei Aktendeckeln abgeheftet ist und einen amtlichen Stempel trägt, handelt es sich nicht um die unmittelbare historische Wahrheit.
Die Beamten der ersten Stunde sehen vieles entspannter als die heutigen: Auch sie sind immer noch verpflichtet, bestimmte einsatzrelevante Fakten nicht in der Öffentlichkeit auszubreiten, obgleich ihre aktive Zeit Jahrzehnte her ist. Aber der zeitliche Abstand gewährt ihnen eine gewisse Abgeklärtheit und Freiheit – auch Freiheit zur Selbstkritik.
In ihrer Geschichte schwankte der Ruf der Polizeieinheit zwischen berühmt und berüchtigt, zwischen Heldenverklärung und schießwütiger Killertruppe. Zu Beginn als »Django-Typen« und »Revolverhelden« selbst bei ihren Kollegen im Bundesgrenzschutz verschrien, schlug die Stimmung gegenüber der obskuren Polizeitruppe fünf Jahre später in ungebremste Heldenverehrung und mythologische Verklärung um. Die Befreiung der 86 Geiseln aus der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu und die Bilder von den coolen Jungs in Jeans, Turnschuhen und Lederjacke bei ihrer Rückkehr auf dem Köln-Bonner Flughafen verstellten für lange Zeit die nüchterne Sicht auf den BGS-Verband aus Sankt Augustin. Noch heute wird die Geschichte der GSG 9 gern als Geschichte der »Helden von Mogadischu« erzählt. Selbst kritische Artikel und Fernsehdokus bedienen sich dieser Folie, um Fallhöhe zu schaffen und die Helden umso tiefer vom künstlich erhöhten Sockel stürzen zu können.
Solch Theaterdramaturgie taugt wenig beim Versuch, sich der historischen Wahrheit zu nähern. Hollywoods Superheldengeschichten von James Bond bis zu den Avengers erfreuen sich zwar nachhaltiger Beliebtheit beim Publikum. Doch mit dem einsamen Rächer, der die Regeln nach Bedarf biegt und gelegentlich bricht – um der Gerechtigkeit willen –, haben die Neuner wenig gemein. Dieses Abziehbild passte schon nicht, als der Mythos der »Helden von Mogadischu« entstand, wo nicht ein paar Rambos wild um sich schießend die Landshut stürmten, sondern 19 hoch spezialisierte, hoch disziplinierte Polizeibeamte in einer hoch arbeitsteiligen Aktion die Geiselnahme in kaum mehr als einer Minute beendeten. Über vierzig weitere Beamte sicherten die Stürmung außen ab: Scharfschützen, Sanitäter, Fernmeldetechniker, Sprengstoffexperten. Während die Soziologie darüber streitet, ob das Konzept des Helden angesichts aktueller autoritärer Entwicklungen in der Weltpolitik wirklich überholt ist oder nicht, ob wir also in einem postheroischen Zeitalter leben, oder Helden nach wie vor brauchen, stand diese Frage für die GSG 9 seit ihrer Gründung nie zur Debatte. Zu einer Heldentruppe wurde sie von anderen gemacht.
Unbestritten ist, dass die GSG 9 zum wichtigen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte geworden ist, was vor allem ihrer Rolle im Deutschen Herbst zuzuschreiben ist. Über die Mythologisierung der Truppe hinaus geriet die Befreiungsaktion zum Baustein für einen zweiten Gründungsmythos der Bundesrepublik. Der katastrophal fehlgeschlagene Einsatz in Bad Kleinen wiederum, der Tod des GSG-9-Manns Michael Newrzella und des RAF-Mitglieds Wolfgang Grams lösten anderthalb Jahrzehnte später eine Staatskrise aus, wie sie die Bundesrepublik noch nicht erlebt hatte: Ministerrücktritte, Entlassung von hochrangigen Staatsbeamten, massives Misstrauen – in die Behörden, in die Rechtsprechung, in die Medien. Deutschland geriet in Aufruhr. Der Mythos GSG 9 zerbröselte.
1993 war das, auch schon wieder drei Jahrzehnte her. Seitdem ist die GSG 9 weitgehend im allgemeinen Rauschen der Aufmerksamkeitsökonomie versunken. Nur ab und an vermelden die Medien Festnahmen und Razzien unter Beteiligung der »Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerster Gewaltkriminalität«. Oft aber wohl deshalb, weil sich die Schlagzeile »GSG 9 stürmte …« besser macht als »LKA Rheinland-Pfalz nahm Verdächtige fest«. Und nicht wenige Leser dürften bei solcher Lektüre murmeln: »GSG 9 … – ach, die gibt’s noch?«
Ja, die gibt es noch. Und ihre Beamten sind weiter im Einsatz, mehr denn je. Im Schnitt ein Mal pro Woche rücken sie aus, seit ihrer Gründung 1972 zu 2200 Einsätzen – eine der wenigen konkreten Zahlen über die Truppe, zu denen sich das Innenministerium hinreißen lässt. Die meisten dieser Einsätze sind freilich wenig spektakulär: Sicherung von Gerichtsverfahren, Überstellung von Gewaltverbrechern, Festnahmen mutmaßlicher Terroristen oder gewöhnlicher Krimineller.
Fünfzig Jahre nach ihrer Gründung schwebt die Erinnerung an die GSG 9 irgendwo im historischen Niemandsland zwischen verblasstem Mythos und gnädigem Vergessen. Im kollektiven Gedächtnis ist der Name zur Chiffre geronnen, zum Sammelbegriff für »Eingreiftruppe« jedweder Art. Der Ruf nach einer »GSG 9 für …« ist eine seit Jahrzehnten gern genutzte Floskel: Ob es um die Rheinverschmutzung der 80er-Jahre ging (»Umwelt-GSG 9« – Express), um Steuerbetrug (»fiskalische GSG 9« – taz) oder jüngst um Hackerangriffe (»GSG 9 für den Cyber-Notfall« – Wirtschaftswoche). Der Satz »Da muss man (ja nicht gleich) die GSG 9 rufen« brachte es zum geflügelten Wort. Fernsehdokumentationen erzählen von der ersten deutschen Spezialeinheit, auch ist der eine oder andere Roman erschienen. Ein Playstation-Game gibt es und sogar Actionfiguren mit erstaunlicher Detailgenauigkeit von Uniform bis Bewaffnung – nichts zum Spielen, eher nerdige Sammlerstücke. Was es allerdings nicht gibt, ist eine angemessene Darstellung der GSG-9-Geschichte diesseits und jenseits des Heldenmythos.
Ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung ist es Zeit für einen möglichst genauen Blick auf diesen sehr speziellen Spezialverband und für einen Realitätscheck der Mythen und Legenden, die sich in diesen Jahrzehnten um die GSG 9 gebildet haben.
Die Zahl solcher Mythen ist groß. Das beginnt bei harmlosen Gerüchten in Internetforen, wonach »GSG-9-Beamte ihre Zivilkleidung stets unter ihrer Uniform tragen, um im Alarmfall schneller reagieren zu können« (tun sie nicht), über die unausrottbare Legende, bei der GSG 9 handele es sich um eine Spezialeinheit der Bundeswehr (sie gehört zur Bundespolizei), bis zur raunenden Vermutung, die GSG 9 habe besondere Rechte oder gar eine »Lizenz zum Töten« à la James Bond (hat sie nicht). Die GSG 9 selbst ist an diesem Geraune nicht ganz unschuldig, hält sie doch viele Zahlen und Fakten über sich gern im Ungefähren. Und wo Fakten fehlen, sprießen die Spekulationen.
Die folgenden Seiten sollen die historischen Fakten liefern – soweit sie zugänglich sind und sich aus Zeitzeugenaussagen und Autobiografien, Medienberichten und überlieferten Akten rekonstruieren lassen. Die Erfolge. Die Niederlagen. Vor allem aber auch die Geschichte davor, dazwischen und danach. Der Schlüssel zum Verständnis der GSG 9 jenseits aller Mythen liegt hier. Denn die großen Ereignisse zeitigten oft unerwartete, gegenläufige Folgen. Der spektakuläre Einsatz in Mogadischu bescherte dem Verband nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Personalmangel und falsche Ehrfurcht bei den anfordernden Behörden. Die Einsatzbeamten drehten zwar nicht gerade Däumchen, aber herausfordernde Einsätze blieben lange Zeit die Ausnahme. Umgekehrt brach nach der Katastrophe am Bahnhof von Bad Kleinen nicht nur der Heldenmythos in sich zusammen, es fielen auch die Hemmungen, die GSG 9 anzufordern. Die Zahl der Einsätze für die Spezialisten aus Sankt Augustin stieg steil an.
Hier, in den öffentlich kaum beachteten Zwischenzeiten, zeigt sich auch, welche Bedeutung die GSG 9 hat. Als Vorbild für Spezialeinheiten in Deutschland und weltweit. Als dezentes außenpolitisches Instrument für zwischenstaatliche Gefälligkeiten. Als prestigeträchtiges Schmiermittel im diplomatischen Getriebe. Als Zankapfel im Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern. Und als Spielball zwischen Bundesministerien in internationalen Krisen.
So wichtig die großen Ereignisse waren, so maßgeblich für die Mythenbildung um diesen Verband – in diesen Zwischenphasen zeigte sich, dass die Geschichte der GSG 9 weit mehr ist als Mogadischu und Bad Kleinen. Und wie jede gute Geschichte, beginnt sie nicht am Anfang. Sondern davor. In diesem Fall drei Wochen vor ihrer Gründung, im September 1972.
1
»HEITERE SPIELE« IN MÜNCHEN
Ein wenig albern kamen sie sich schon vor in ihren türkisen Designer-Anzügen, den hochgeschlossenen Jacketts über weißen Polohemden. Und dann noch diese Altherren-Schiebermützen! Dieter Tutter und einige Kameraden vom Bundesgrenzschutz hatten sich freiwillig nach München gemeldet. Nun saßen sie in ihren Uniformen, die nicht nach Uniform aussehen sollten, in der Einsatzzentrale Abschnitt Olympiapark-Mitte vor Monitoren und Funkgeräten und warteten als Eingreifreserve darauf, dass es etwas zum Eingreifen gab. Nicht, dass sie in einem solchen Fall viel hätten tun können: Ihre Bewaffnung bestand aus Walkie-Talkies, für jeden Sicherheitsbeamten eines. Dazu ein Englisch-Wörterbuch, um sich mit ausländischen Gästen und Sportlern verständigen zu können. Oberleutnant i. BGS1 Tutter und seine Kollegen waren an den Sportstätten und im olympischen Dorf nicht als Grenzschutzbeamte eingesetzt, sondern als Ordnungsdienst. »Wir hatten keine polizeilichen Befugnisse, keine Bewaffnung, kein gar nichts. Wir haben Besucherströme geleitet und Auskünfte erteilt. Das war alles.«2 Potenzielle Störer sollten sie durch Klamauk verunsichern, mit Süßigkeiten beschießen oder gegebenenfalls umringen und sanft abdrängen. Diese eher unkonventionellen Polizeitaktiken mussten sie vorher eigens trainieren.3 Denn es sollten ja unbeschwerte Spiele werden, »fröhlich und heiter«, wie es allenthalben hieß. Deutschland wollte der Welt sein freundliches, demokratisch-offenes Gesicht zeigen – ein bunter Kontrast zu den grimmen Spielen von Berlin anno ’36.
Die Beziehungen zu Israel waren noch fragil, ein Vierteljahrhundert nach Shoa und Zweitem Weltkrieg. Immer wieder hatte es gewalttätige Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gegeben, gerade auch in den vorausgegangenen Jahren. Und doch hatte der jüdische Staat die größte Delegation seiner jungen Geschichte in das Land des Holocausts geschickt, ein deutliches Zeichen für die internationale Rehabilitierung des einstigen Parias Deutschland. Polizisten in grauen Uniformen und mit Maschinenpistolen hätten sich da nicht gut gemacht.
Der unbedingte Wille, der Welt die neue Friedfertigkeit der Bundesrepublik zu demonstrieren, endete nicht beim Sicherheitspersonal. Dessen farbenfrohe Nichtuniform und die fehlende Bewaffnung waren nur der demonstrative Ausdruck für eine allgemeine Unbekümmertheit. »Die ersten Fehler bei der Planung bestanden darin, dass man das Olympische Dorf nicht vernünftig sicherte«, berichtete Ulrich Wegener später von den Planungstreffen des Olympischen Organisationskomitees. Dorthin begleitete der BGS-Offizier regelmäßig seinen Chef Hans-Dietrich Genscher. Der wiederum war in seiner Funktion als Bundesinnenminister zugleich auch Sportminister und damit Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK). Die Polizeihoheit aber und folglich die Verantwortung für das Sicherheitskonzept lagen beim Freistaat Bayern und bei der Münchner Stadtpolizei. Wegener war davon wenig beeindruckt: »Es gab lediglich einen Zaun – der war lächerlich. […] Es gab keinerlei Sicherheitsinstitutionen für das Olympische Dorf, die entsprechend ausgerüstet waren. Das war der zweite Fehler. Die Polizei betrachtete das alles mehr als Zeitvertreib. Es war ein unmöglicher Zustand.«4
Genscher hatte Wegener 1969 ins Innenministerium nach Bonn geholt als seinen persönlichen Verbindungsoffizier zum Bundesgrenzschutz. Während der Spiele sollte er eigentlich an einem Fortbildungsseminar der NATO in Rom teilnehmen, aber Anfang September hatte Genscher ihn aus Italien zurückbeordert, damit er ihn in München unterstützte.5 Zum Sicherheitsbeauftragten für die Olympischen Spiele hatte man den Münchner Polizeipräsidenten Manfred Schreiber ernannt. Genscher, Wegener und die anderen Vertreter von Bundesbehörden und -ministerien sollten lediglich beraten. Ihr Einfluss auf grundsätzliche Entscheidungen war entsprechend begrenzt. Wegener und Horst Herold, der Chef des Bundeskriminalamtes, gaben zu bedenken, »dass wir auf diese Weise nur mit einem Minimum an Polizeikräften unsere ausländischen Gäste schützen würden, das würde niemals ausreichen – wir wurden leider nicht ernst genommen«.6
Auch an den Sportstätten stellten sich die Sicherheitsvorkehrungen als lasch bis nicht existent heraus. »Mein Vater hatte so ein Batch, einen Anstecker, aber da stand nur drauf, dass er Zugang zur Ehrentribüne hatte.«7 An irgendwelche Sicherheitskontrollen kann Jörg Schleyer sich nicht erinnern, selbst bei den hochrangigen Veranstaltungen, zu denen die gesamte Familie des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer regelmäßig eingeladen war: »Wir waren einige Male im Bayerischen Hof, weil dort immer die Empfänge stattfanden für die deutschen Medaillengewinner. Da gab es keine Sperren oder Checkpoints. Man ging einfach rein und konnte die Sportler treffen.«
Zu den Olympischen Spielen war die gesamte Familie Schleyer angereist, weil Mutter Waltrude aus München stammte und weil Vater Hanns Martin als Personalvorstand des Daimler-Konzerns und hoher Verbandsvertreter zu den Ehrengästen zählte. So fieberten die sportbegeisterten Schleyers Wettkampftag für Wettkampftag mit den Athleten. Zusammen mit einer Milliarde Fernsehzuschauer in aller Welt verfolgten sie unter dem geschwungenen Zeltdach des Olympiastadions gebannt, wie Heide Rosendahl die Goldmedaille im Weitsprung holte und sich die gerade 16-jährige Ulrike Meyfarth im Hochsprung mit 1,92 Metern zum Weltrekord floppte. 4000 Journalisten und 2000 Fernsehleute berichteten aufgeregt, live und in Farbe, wie in der Olympia-Schwimmhalle der Amerikaner Mark Spitz von Gold zu Gold schwamm und dabei jedes Mal auch noch den Weltrekord verbesserte. Und wie im legendären Basketballfinale der Fast-schon-Olympiasieger USA zusehen musste, wie der Russe Alexander Below in den letzten Sekunden des Spiels den Ball von ganz hinten im Korb versenkte – in der Eiszeit des Kalten Krieges auch eine politische Demütigung für das Heimatland des Basketballs durch den Erzfeind UdSSR. »Das war unglaublich!«, schwärmt der jüngste Schleyer-Sohn. »Auch die Atmosphäre im Stadion: Die Architektur war überragend. Und dann das Wetter: jeden Tag Sonne! Ich kann mich an keinen einzigen Regentag erinnern. Bis zu jenem 5. September – das war, als würde jemand den Hebel von Sonne auf Regen umstellen.«
Im Morgengrauen dieses 5. September klettern acht Männer mit Sporttaschen und in Trainingsanzügen über den schlecht beleuchteten Zaun des olympischen Dorfes.8 Das ist nichts Ungewöhnliches: Immer wieder war in den vergangenen Tagen zu beobachten, wie angetrunkene Athleten nach feuchtfröhlicher Feier auf diese Weise in ihre Quartiere zurückgekehrt sind. Deshalb kommt auch jetzt niemand auf die Idee, diese Männer von ihrer Kletteraktion abzuhalten oder auch nur zu fragen, ob sie dorthin gehören. Auf ihrem Weg ins olympische Dorf treffen sie auf eine Gruppe alkoholisierter US-Sportler. Angeregt unterhalten sie sich mit ihren vermeintlichen Co-Athleten und helfen sich gegenseitig über den Zaun. Das fällt nicht weiter schwer, denn das Hindernis ist gerade mal zwei Meter hoch, ohne Stacheldraht. Bewacht ist er ohnehin nicht, vom spärlichen Wachpersonal fehlen in dieser Nacht zwölf Mann. Mehrere Personen beobachten die Gruppe bei ihrer Aktion, aber weil die unorthodoxe Methode sich im Lauf der Olympischen Spiele etabliert hat, schöpft niemand Verdacht.
Nachdem man sich freundlich verabschiedet hat, machen sich die acht Männer auf zur Conollystraße 31, der Unterkunft für die 21 Mitglieder der israelischen Delegation. Sie kennen sich aus, zwei von ihnen haben zuvor im olympischen Dorf gearbeitet. Sich selbst bezeichnen sie als Fedayin (arab. »Opferbereite«), sie gehören zur Terrorgruppe Schwarzer September, einem Ableger von Jassir Arafats Guerilla-Organisation Fatah. In ihren Sporttaschen finden sich automatische Waffen und Handgranaten, versteckt unter ihrer Einsatzkleidung, in die sie nun schlüpfen, nur eine Häuserecke vor ihrem Ziel entfernt. Dann dringen sie in das Apartment 1 des Wohnblocks ein, in dem jetzt um 4:30 Uhr sieben israelische Sportler schlafen.
BÖSES ERWACHEN
Anderthalb Stunden später reißt ein Anruf Hans-Dietrich Genscher aus dem Schlaf: Angriff auf die Unterkunft der israelischen Delegation mit Geiselnahme. »Die Nachricht traf mich wie ein schwerer Schlag. Das bedeutete, Juden waren in Deutschland wieder in Gefahr.«9 Genscher hat seinen Stab im Hotel Grand Continental in der Nähe des Münchner Bahnhofs eingerichtet. Er springt aus dem Bett, telefoniert kurz mit Bundeskanzler Willy Brandt, Außenminister Walter Scheel sowie dem israelischen Botschafter und alarmiert dann BGS-Mann Wegener. Der versucht, nähere Informationen zu bekommen. »Ich fragte: ›Was ist genau passiert?‹ Man konnte mir gar nicht richtig sagen, was geschehen war. Das war katastrophal.«10 Gemeinsam fahren sie ins olympische Dorf, wo Polizeipräsident Manfred Schreiber bereits einen improvisierten Krisenstab gebildet hat, zusammen mit dem Bürgermeister des olympischen Dorfes, Walther Tröger.11 Kurz vor Genscher und Wegener ist der bayerische Innenminister Bruno Merk eingetroffen. »Der meinte nur: ›Ja, wir müssen mal verhandeln‹«, erinnerte sich Wegener später. »Ich fragte: ›Was ist denn bisher an Einsatzmaßnahmen geschehen?‹ Gar nichts war geschehen, absolut nichts. Es standen lediglich Polizisten herum. […] So lief das ganze auch weiter.«12
Zu diesem Zeitpunkt sind bereits zwei israelische Athleten tot, einer konnte fliehen. Insgesamt befinden sich neun Geiseln in der Gewalt der Palästinenser. Doch davon weiß der Krisenstab noch nichts. Auch wie viele Terroristen ins olympische Dorf eingedrungen sind, ist unbekannt – und bleibt es fatalerweise bis zum Schluss. Klar dagegen sind die Forderungen der Terroristen: Freilassung von 130 inhaftierten Palästinensern aus israelischen Gefängnissen, darunter auch eine deutsche Gefangene: »We demand of F. G. R. immediate release of: ULRIKA MEINHHOF«, steht abgesetzt unter der Namensliste.13 Gemeint ist Ulrike Meinhof, einer der Köpfe der Rote Armee Fraktion (RAF). Kaum drei Monate zuvor ist sie verhaftet worden. In der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf wartet sie nun auf ihren Prozess. Bis spätestens neun Uhr sollen sie und die Palästinenser freigelassen werden, so lautet das Ultimatum der Geiselnehmer. Sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie alle Geiseln sofort erschießen, sollte ein Befreiungsversuch unternommen werden.
Inzwischen sind Polizeikräfte aufgezogen. Polizisten mit Jagdgewehren haben sich auf den umliegenden Gebäuden in Stellung gebracht, das olympische Dorf ist abgeriegelt worden. Wobei »abgeriegelt« die tatsächlichen Verhältnisse nicht trifft: Nur um einen kleinen Bereich um das Gebäude Conollystraße 31 bilden Dieter Tutter und seine Kollegen eine Kette aus Sicherheitsleuten. »Wir hatten dann die Aufgabe, die Zuschauer und Touristen und auch die Presse von dem Geschehen fernzuhalten, das haben wir schlecht und recht versucht. Die strömten natürlich alle da hin, die wussten, was los ist. Denn es kam über die Medien.« Tutter selbst hat die Nachricht auch zuerst per Fernsehen erreicht, obwohl er wenige Meter entfernt im Funkraum der Einsatzzentrale sitzt.
Die besten Plätze sind schnell belegt. Die kleinen umliegenden Hügel bieten Neugierigen und Fernsehkameras einen fast ungehinderten Blick auf das israelische Quartier. Fotografen, Kameraleute, Schaulustige versammeln sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo die israelischen Geiseln um ihr Leben bangen. Am Nachmittag berichtet ARD-Journalist Lothar Loewe in einer Live-Reportage, dass die Absperrung des Geländes völlig ungenügend sei: »Sollten […] die Terroristen entschlossen sein, mit Sprengstoff sich und die Geiseln selbst in die Luft zu sprengen, dann wären auch die Schaulustigen und auch die Journalisten und Angehörigen des Bundesgrenzschutzes hier in dieser Situation sehr gefährdet.«14 Bis dahin ist die Menge auf über 75 000 Menschen angewachsen. Eine Art Volksfeststimmung macht sich breit: Kinder klettern ungehindert über den Zaun zum olympischen Dorf auf der Jagd nach Autogrammen von Athleten, die sich auf den umliegenden Wiesen sonnen oder auf ihre Wettkämpfe vorbereiten.
Denn die Spiele laufen zunächst ganz regulär weiter: Im Reitstadion hat am Morgen der Wettbewerb im Dressurreiten angefangen, die Kanuten, die Basketballer und die Boxer treten wie geplant an und auch das Volleyball-Turnier beginnt ungeachtet der Terrorlage. Erst am späten Nachmittag ringt sich das Olympische Komitee auf Druck Israels dazu durch, die Wettkämpfe wegen der Geisellage zu unterbrechen.
Über 180 internationale Fernsehsender haben bis dahin live von den Olympischen Spielen berichtet – nun berichten sie live vom Schauplatz der Tragödie, übertragen die Bilder von München aus in Echtzeit in die Wohnzimmer in aller Welt – womöglich auch in das Olympia-Quartier der Israelis. Denn dort gibt es ebenfalls Fernsehgeräte. »Auf der anderen Seite von dem Bereich, wo die Palästinenser waren, waren ungefähr dreißig Kameras aufgebaut«, erinnert sich der damals 18-jährige Jörg Schleyer. So wurden die Bilder aus der Conollystraße zum ersten global und in Echtzeit übertragenen Terrorakt der Geschichte. »Wir hatten ja auch in diesem Land keine Erfahrung mit solchen Gewalttaten. Man hatte das Thema Baader-Meinhof – da gab es acht Wochen vorher die große Verhaftungswelle in Frankfurt. Aber das war ›Lokal-Terrorismus‹. Und jetzt hast du plötzlich ein Weltereignis.« Es wäre ein Leichtes gewesen, die Übertragungen zu stoppen, denn die Leitungen liefen in einem eigens errichteten Gebäude der Bundespost zusammen. Daran dachte aber offenbar im Krisenstab niemand.15
HEKTISCHER STILLSTAND
Bis der deutsche Behörden- und Regierungsapparat in Gang kam, war das erste Ultimatum bereits verstrichen, das zweite auf 12 Uhr festgesetzt. Grundlegende Maßnahmen wurden spät oder gar nicht eingeleitet. Erst im Lauf des Vormittags kam jemand auf die Idee, Hubschrauber anzufordern, falls sie benötigt würden. Wegener orderte gleich eine ganze Staffel. Allein eine Telefonleitung zu den Palästinensern einzurichten, hatte eine kleine Ewigkeit gedauert. Die Kopflosigkeit betraf nicht nur Technik und Logistik. Der ad-hoc zusammengewürfelte Krisenstab zeigte sich heillos überfordert. Pläne für die Bildung eines solchen Gremiums im Krisenfall hatte es nicht gegeben. Dass jetzt Vertreter aller Parteien und aller Kompetenzebenen einbezogen waren, war wohl eher Zufall. Den Verantwortungsträgern kam das in der Situation gelegen, weil es einen möglichst großen Konsens ermöglichte. Wo aber alle beteiligt sind, wollen auch alle mitreden. So stellte sich der scheinbare Vorteil in der Retrospektive als Nachteil heraus, »da dies […] zu höchst komplizierten Entscheidungsstrukturen führte und ein effizientes Reagieren eher verhinderte«, wie der Historiker Matthias Dahlke feststellt.16
Angebote über Lösegeld in unbegrenzter Höhe für die Freilassung der israelischen Geiseln lehnten die Terroristen kategorisch ab. Umgekehrt hatte die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir deutschen Regierungsvertretern unmissverständlich klargemacht, dass Israel den Forderungen der Geiselnehmer nach Gefangenenaustausch keinesfalls nachgeben werde: »Wenn wir einlenken, dann kann sich kein Israeli auf der ganzen Welt mehr sicher fühlen.«17 Hektische Telefonate zwischen deutschen Ministerien und israelischer Botschaft brachten keine Fortschritte – was man den Geiselnehmern wohlweislich verschwieg. Die israelische Regierung ließ über ihren Bonner Botschafter ausrichten, dass die Deutschen nach eigenem Gutdünken handeln und verhandeln könnten. Dabei sei aber zu bedenken, dass eine Freilassung der palästinensischen Gefangenen keinesfalls infrage komme. Daran änderte auch die Drohung der Terroristen nichts, zwei Geiseln vor den Übertragungskameras zu erschießen, live vor den Augen der Welt.
In Bonn kam Kanzler Willy Brandt mit seinem Kabinett zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Bundesregierung saß in der Zwickmühle, fast ohne Handlungsoptionen außer: reden, verhandeln, Zeit gewinnen. Bundesinnenminister Genscher wurde »autorisiert, im Zusammenwirken mit der bayerischen Staatsregierung alles Notwendige zur Rettung der Geiseln zu tun«. Das war schön bedeutsam formuliert, aber von wenig praktischem Wert. »Ich befand mich in einer Situation, die in jeder Hinsicht unbefriedigend war«, resümierte der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher später: »Erstens war ich örtlich nicht zuständig für die Schutzmaßnahmen und die nach der Geiselnahme zu ergreifenden Maßnahmen. Aber dominierend war für mich, Zeuge zu werden der Geiselnahme israelischer Sportler. Nach allem, was in der Zeit des Dritten Reiches unseren jüdischen Mitbürgern geschehen war, empfand ich das als eine ganz schreckliche Erfahrung. Es war für uns das erste Mal, dass wir uns mit dem internationalen Terrorismus konfrontiert sahen.«18
In den folgenden Stunden machten sich immer wieder Verhandlungsgruppen in unterschiedlicher Besetzung auf den Weg zur Conollystraße 31, um mit den Terroristen zu sprechen, sie zum Aufgeben zu bewegen, bei Freilassung der Geiseln freien Abzug zu garantieren. All das in dem Wissen, dass Israel einem Austausch niemals zustimmen werde. »Ich glaube, wir waren alle ein wenig naiv«, gab Ulrich Wegener später zu. »Auch die Minister glaubten, dass es helfen würde zu reden. Sie gingen tatsächlich davon aus, dass es ihnen gelingen würde, [die Terroristen] davon zu überzeugen, die Israelis freizulassen. Doch das war völlig ausgeschlossen. Ihre Forderungen waren klar und deutlich.«19
In mühsamen Gesprächen mit Polizeipräsident Schreiber stimmten die Geiselnehmer einem neuen Ultimatum zu: 13 Uhr. Sollten ihre Forderungen bis dahin nicht erfüllt sein, drohten sie mit der Erschießung zweier Geiseln. Um Zeit zu gewinnen, bat Schreiber Innenminister Genscher und seinen bayerischen Gegenpart Bruno Merk, direkt mit den Palästinensern zu verhandeln. Zu Fuß gingen sie zur Conollystraße 31. Dort trafen sie auf den Anführer der Geiselnehmer. Er nannte sich Issa, trug einen weißen Anzug und einen weißen Hut, aus den ausgebeulten Brusttaschen ragte der Abzugsriemen je einer Handgranate, einer links, einer rechts. Eine weitere Granate hielt er abzugsbereit in der Hand. »Er machte einen außerordentlich entschlossenen, aber auch ruhigen Eindruck«, so Genscher. »Gleichzeitig gewann ich mehr und mehr den Eindruck, daß er durch kein Argument, durch keinen Appell von seinen Bedingungen abzubringen war.«20 Genscher versuchte es trotzdem. In den Stunden zuvor hatte er eine Entscheidung getroffen, die er mit niemandem abgesprochen hatte: Er würde sich im Austausch gegen die Israelis als Geisel anbieten. Nachdem er kurz mit seiner Frau und seiner Tochter telefoniert hatte, ging er mit Merk zum Anführer der Geiselnehmer: »Er antwortete, er habe nicht die Befugnis, eine solche Entscheidung zu treffen. Es gehe ihm aber nicht um deutsche Geiseln, es gehe ihm um Israelis.«21
Genscher und Merk erreichten zumindest, dass das Ultimatum ein weiteres Mal verlängert wurde: bis 17 Uhr. Die Geiselnehmer wirkten durchaus geschmeichelt von den hochrangigen Regierungsvertretern. In der Nachbetrachtung allerdings war die Entscheidung Genschers und Merks, persönlich mit den Palästinensern zu verhandeln, taktisch nicht sonderlich klug, »weil damit das Ende der Befehlskette erreicht war«, wie Ulrich Wegener später resümierte. »So etwas tun wir heute nicht mehr.« Grundsätzlich müsse immer ein rangniedriger Beamter mit den Geiselnehmern sprechen. »Dieser kann immer behaupten: ›Das kann ich nicht entscheiden. Ich muss erst bei einem meiner Vorgesetzten nachfragen.‹ Das kann endlos so weitergehen. Auf diese Weise gewinnt man Zeit, was immens wichtig ist.«22
Immerhin bekam Genscher die Erlaubnis, kurz mit den Geiseln zu sprechen. »Wir gingen die Treppe hinauf und einen langen Flur entlang, bis wir den Raum schließlich erreichten. Zwei Terroristen mit Maschinenpistolen bewachten das Zimmer. Sie öffneten die Tür und dahinter bot sich uns ein Bild des Grauens.«23 Auf dem Fußboden in der Mitte lag in einer Blutlache der tote Gewichtheber Josef Romano. Ein Israeli war an einen Stuhl gefesselt, die anderen acht Geiseln standen drum herum, an den Armen untereinander festgebunden. In den Wänden Einschusslöcher. »Den Anblick dieses Zimmers … werde ich mein Lebtag nicht vergessen«, bekannte Genscher. »Ich werde diese Gesichter nie mehr vergessen können – angsterfüllt, aber auch hoffnungsvoll.«24 Als sie wieder heraustraten, bot sich Genscher erneut als Austauschgeisel an, erfolglos. Bei seiner Rückkehr zum Krisenstab erlebte Wegener seinen Chef als tief bewegt und schockiert. »Als er wiederkam, war er sehr deprimiert. Ich kann mich noch genau daran erinnern … wir sprachen miteinander, und er sagte: ›Sie meinen es ernst, keine Frage.‹ Er war überzeugt, dass wir es mit Fanatikern zu tun hatten.«25
Allein, selbst die Frage, mit wie vielen Fanatikern sie es zu tun hatten, war zu diesem Zeitpunkt immer noch unklar. Zuvor war bereits ein Versuch gescheitert, Räumlichkeiten und genaue Anzahl der Geiselnehmer auszukundschaften, indem als Küchenpersonal verkleidete Polizisten mit Verpflegung für die Geiseln in die Conollystraße geschickt wurden. Genscher und Tröger berichteten nun von vier, vielleicht fünf Terroristen, die sich in der israelischen Unterkunft aufhielten. Diese Zahl wurde als verlässlich eingestuft und diente als Grundlage für die Planung möglicher Rettungsversuche. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte.26
Eine gewaltfreie Lösung der festgefahrenen Situation wurde immer unwahrscheinlicher. Parallel zu den immer verzweifelteren Verhandlungsversuchen war der stellvertretende Münchner Polizeichef mit Vorbereitungen für eine bewaffnete Geiselbefreiung beauftragt worden. Bereits seit dem Vormittag wurde über eine Stürmung des Gebäudes beraten, aber das Ergebnis war eindeutig: zu gefährlich, weil zu viele zu gut bewaffnete Terroristen. Die Bundesrepublik verfügte über keinerlei Polizeieinheit (auch keine militärische), die in der Lage gewesen wäre, selbst mit verschwindend geringer Aussicht auf Erfolg in einer solchen Situation zu bestehen. Oder etwa doch?
SPEZIALEINHEIT IN WARTESTELLUNG?
Im Jahr 2012 behauptete ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes in einer ZDF-Dokumentation, Spezialkräfte des BND hätten zum Einsatz bereitgestanden. Es habe sich um Agenten einer sogenannten Stay Behind-Einheit gehandelt, einer geheim operierenden Gruppe, die sich im Kriegsfall von der Front überrollen lassen sollte, um hinter den feindlichen Linien zu operieren. In der gleichen Dokumentation wird ein angebliches Mitglied dieser Gruppe zitiert: »Wir waren uns sicher, dass wir mit den Palästinensern fertig werden. Wir waren darauf vorbereitet und wir wollten es machen. Jetzt könnten wir es endlich beweisen.«27 Diese Behauptungen ließen sich bis heute allerdings nicht untermauern, weder durch Akten noch durch Zeitzeugen. Auch scheint das Szenario nicht besonders plausibel. Stay Behind-Agenten hatten die Aufgabe, im Ernstfall Brücken und Straßen zu sprengen, Personen über Grenzen und durch die Front zu schleusen. Ihre Handfeuerwaffen besaßen sie ausschließlich zur Selbstverteidigung.28 Als Scharfschützen oder für eine Befreiungsaktion waren sie nicht ausgebildet. Wegener gab denn auch bei einem Vortrag in Fürstenfeldbruck zu dem Thema knapp zu Protokoll: »Nicht zutreffend«.29
Gerüchte über die Existenz einer solchen Spezialgruppe des BND geisterten bereits kurz nach München durch deutsche Sicherheitskreise. Die Ursache für diese Gerüchte könnte ein Angebot aus Israel gewesen sein. Denn dort stand tatsächlich eine Einheit bereit. Ihr Name: Sajaret Matkal, die Elitetruppe der israelischen Armee, damals unter dem Befehl von Ehud Barak (dem späteren israelischen Regierungschef). Ministerpräsidentin Golda Meir ließ sie umgehend in Gefechtsbereitschaft versetzen. Die Sajeret Matkal gehörte zu dem Zeitpunkt zu den wenigen Spezialeinheiten weltweit, die in Antiterrorkampf und Geiselbefreiung trainiert waren. Einheitsführer Barak meldete sich dem Kommandeur des Nachrichtendienstes bereits mittags abmarschbereit. Barak hatte im Sechs-Tage-Krieg gekämpft und zahlreiche Geheimoperationen geleitet. Vier Monate zuvor hatte er mit seiner Einheit in Tel Aviv eine entführte Boeing 707 der belgischen Linie Sabena gestürmt. Eine Geisel kam dabei ums Leben, aber 87 wurden unverletzt befreit. Aus seiner professionellen Sicht hielt er die deutschen Sicherheitskräfte für völlig überfordert: »Keine Chance, dass die Deutschen das hinbekommen, die nicht einmal wissen, was sie da haben. Die Deutschen haben keinerlei Erfahrung im Kampf gegen solche Terroristen, wo es um Geiselbefreiung geht, und dann auch noch an einem Ort wie dem olympischen Dorf. […] Sie werden alle möglichen Anfängerfehler machen, die jeder macht, wenn er nicht genug ausgebildet ist. Und das könnte sehr teuer werden.«30
Mehrere Dutzend Männer warteten an diesem Tag am Flughafen von Tel Aviv, verfolgten am Fernseher die Ereignisse in München und warteten auf den Marschbefehl. Der aber kam nie. Warum, ist nicht eindeutig nachvollziehbar. In den Erinnerungen der Zeitzeugen stehen die Aussagen damaliger Angehöriger von Sajeret Matkal gegen die deutscher Politiker. Einheitsführer Barak erhielt als Antwort, dass er in München kaum von Hilfe sein könnte, denn man habe bereits mit den Deutschen gesprochen. »›Oh nein, das ist völlig undenkbar, fremde Einheiten einzusetzen […], und das auf deutschem Boden, um einen Einsatz durchzuführen, der auch noch gegen das Grundgesetz geht«, beschied ihm der Kommandeur des Nachrichtendienstes, »die deutsche Regierung verweigerte die Erlaubnis.«31
Innenminister Genscher hingegen beschreibt es in seinen Memoiren explizit anders. Gegen Mittag habe der israelische Botschafter angekündigt, ein israelischer Spezialist für Sicherheitsfragen werde nach München kommen. Von einem Angebot, die israelische Eliteeinheit einzusetzen, sei nie die Rede gewesen. »Meine Frage, ob Israel eigene Kräfte zur Befreiung einsetzen wollte, verneinte er. Mir gegenüber übte er auch keine Kritik an den von dem polizeilichen Krisenstab eingeleiteten und vorbereiteten Maßnahmen.«32 Bei dem hohen Sicherheitsbeamten handelte es sich um Zvi Zamir, den Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. BGS-Mann Ulrich Wegener holte ihn vom Flughafen ab. Israels oberster Geheimdienstler musste allerdings feststellen, dass sein Rat wenig gefragt war, namentlich bei den bayerischen Vertretern. Geradezu feindselig seien die ihm begegnet, berichtete er später.33
Gab es ein Angebot der Israelis, die Befreiungsaktion durchzuführen? Und zwar mit Beteiligung und unter dem offiziellen Banner des BND, um das Gesicht der BRD zu wahren? So jedenfalls Wegeners Vermutung in der Nachbereitung des Münchner Attentats in der Runde seiner Mitarbeiter. Nach dem gleichen Modell würde Wegener später der somalischen Regierung die Zusage abringen, mit deutschen Polizisten auf somalischen Boden ein Flugzeug zu befreien: Wir erledigen den Job, aber offiziell unter eurer Führung. Doch sollte es ein solches Angebot aus Israel gegeben haben, ging jedenfalls niemand darauf ein.
BIZARRES LIVE-TV
So blieben die deutschen Sicherheitskräfte auf sich gestellt – und verfielen in Aktionismus. Am Nachmittag postierten sich Polizeibeamte in und auf den benachbarten Gebäuden der israelischen Unterkunft. Unter dem hoffnungsfrohen Decknamen »Operation Sonnenschein« sollten sie durch die Lüftungsschächte in das Gebäude eindringen und die Geiseln befreien. Weitere Anweisungen: keine. »Das war alles sehr vage und ungewiss«, berichtete später einer der Beamten. »Ich wusste nur, wenn das Signal kommt – ›Sonnenschein‹ –, aufspringen, zum Fenster rein, hoffen, dass nicht gleich einer mit einer Handgranate dahinter steht.«34 Doch schon ihr Aufmarsch wurde von den allgegenwärtigen Kameras live in alle Welt übertragen – auch in den Kommandoturm der Sicherheitskräfte. Dort schaute Grenzschützer Dieter Tutter am Fernseher zu, wie seine unbedarften Kollegen von der Münchner Schutzpolizei in Stellung gingen: »Ich hatte kein Training für eine Spezialeinheit absolviert, die gab es ja nicht. Aber die erkennbar stümperhafte Form der Annäherung mit Sportklamotten und Stahlhelm noch aus dem Weltkrieg am helllichten Tag hat mich schon sehr gestört. Ich war ausgebildet beim Bundesgrenzschutz, Gelände-Einsatz, Angriff aus der Bewegung, Übungen mit Maschinengewehr und Granatwerfer. Wir waren eine militärähnliche Polizeitruppe. Wenn man dann sieht, wie Polizisten in Halbzivil schwankend über die Dächer klettern, dann graut’s einem. Was soll der Unfug?«
Auch Berater Ulrich Wegener sträubten sich die Haare angesichts der bizarren Bilder von Polizisten in Trainingsanzügen mit MP und Stahlhelm: »Ich war entsetzt. Zu Genscher meinte ich: ›Das widerspricht allen taktischen Grundregeln.‹ Er antwortete: ›Davon wissen allerdings viele von der Polizei nichts.‹«35 Der untaugliche Befreiungsversuch wurde abgebrochen, noch bevor er angefangen hatte. In jedem Zimmer der israelischen Unterkunft gab es ein Fernsehgerät. Ob eines davon eingeschaltet war, ist bis heute unklar. Jedenfalls blieben die Polizei-Aktivitäten nicht unentdeckt. Als der Anführer der Terroristen drohte, zwei Geiseln auf der Stelle zu erschießen, falls die Polizeikräfte nicht sofort abgezogen würden, blies Polizeichef Schreiber die Kamikaze-Aktion ab – zur großen Erleichterung auch der beteiligten Beamten.
Nach dieser Pleite sah der Krisenstab die Unmöglichkeit ein, unter den gegebenen Umständen das Gebäude zu stürmen. Die Planungen für eine Befreiungsaktion konzentrierten sich nun auf den Weg zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Die Palästinenser hatten ein Flugzeug gefordert, um mit den Geiseln nach Kairo auszufliegen. Um Zeit zu gewinnen, bestärkten die Deutschen die Terroristen in dem Glauben, man tue alles, um sie ausfliegen zu können. Tatsächlich aber war sich der Krisenstab bald einig, dass man das unter keinen Umständen zulassen könne: Die israelischen Geiseln durften deutschen Boden nicht verlassen.
Inzwischen ebenfalls in München eingetroffen, versuchte Willy Brandt, doch noch eine Lösung in letzter Minute zu finden: Ägypten sollte die Geiselnehmer ins Land lassen. Doch kurz vor 21 Uhr teilte der Kanzler seinem Innenminister mit, der ägyptische Ministerpräsident habe rundheraus abgelehnt, die diplomatischen Bemühungen waren gescheitert. Da das Ultimatum um 21 Uhr ablaufe, bestehe eine Überlebenschance für die Geiseln nur noch, wenn man sie gewaltsam zu befreien versuche, teilte er Genscher mit.36
Die Frage war bloß, wie und wo? Terroristen und Geiseln sollten per Hubschrauber nach Fürstenfeldbruck gebracht werden. Den Weg bis zum Landeplatz auf dem Olympiagelände sollten sie zu Fuß durch ein unterirdisches Parkhaus zurücklegen und dort überwältigt werden. So jedenfalls der Plan. Er brach in sich zusammen, als Issa, der Anführer der Gruppe, die Örtlichkeit inspizierte und Verdacht schöpfte. Auch für ihn war es offenbar klar, dass sie aus den unübersichtlichen Gängen und unbeleuchteten Ecken heraus leicht angreifbar sein würden. Ulrich Wegener berichtete später zudem, dass Issa mehrere verschanzte Polizisten mit Gewehren entdeckte, was in einen Wutanfall mündete. Er forderte daraufhin einen Bus, um Geiseln und Geiselnehmer zum Hubschrauber zu bringen. All die hilflosen Versuche, die Terroristen zu überrumpeln, führten dazu, dass sie immer misstrauischer wurden.
Die Optionen für einen Zugriff schwanden und die Zeit verstrich unerbittlich. Während die Terroristen auf den Bus warteten, liefen die Vorbereitungen für die Geiselbefreiung in Fürstenfeldbruck. Eine bereitgestellte Boeing 727 der Lufthansa wartete mit laufenden Turbinen auf dem Vorfeld. Eine Reihe von freiwilligen Beamten sollte als Besatzungsmitglieder verkleidet zwei der Terroristen in der Kabine überwältigen, wenn sie die Maschine inspizierten. Zugleich sollten draußen die drei anderen Terroristen von Präzisionsschützen außer Gefecht gesetzt werden. Rund um den Landeplatz der Helikopter wurden deshalb fünf Beamte mit Präzisionsgewehren postiert.
EIN EINZIGES FIASKO
Als die Terroristen mit ihren Geiseln kurz nach 22 Uhr vor die Tür der israelischen Unterkünfte traten, stand Hans-Dietrich Genscher in einem benachbarten Gebäude am Fenster und zählte: eins, zwei, drei … acht! Acht Geiselnehmer stiegen in den bereitstehenden Bus, nicht fünf, wie bisher vermutet. Eine entscheidende Information, die aber nie die Einsatzkräfte in Fürstenfeldbruck erreichen sollte. Auch nach der Landung in Fürstenfeldbruck würde niemand daran denken, sie an die Einsatzleitung weiterzuleiten, und zwar in der irrigen Annahme, dies sei bereits geschehen.
Kurz darauf ließen zwei Bell-Hubschrauber ihre Triebwerke an und stiegen unter dem Blitzlichtgewitter der Fotoreporter über die Köpfe der Schaulustigen auf Richtung Flughafen Fürstenfeldbruck. An Bord: acht Palästinenser, neun israelische Geiseln und je zwei Piloten. Ein dritter Hubschrauber mit Genscher, Merk, dem CSU-Vorsitzenden Strauß und Geheimdienstchef Zamir startete umgehend danach, landete aber als Erster am Flughafen, denn die Piloten der anderen Hubschrauber hatten Anweisung, möglichst langsam und Umwege zu fliegen, um Zeit für die Vorbereitungen auf den Zugriff zu gewinnen.
Diese Vorbereitungen allerdings stellten sich als Desaster heraus: Bei den 16 Einsatzkräften, die für den Zugriff im Flugzeug vorgesehen waren, handelte es sich mitnichten um Freiwillige, sondern um dorthin beorderte Streifenpolizisten. Bewaffnung: Dienstpistole samt 17 Schuss Munition. Erst nach erregter Diskussion wurden ihnen drei Maschinenpistolen zugestanden. Danach hatten sie sich in der Maschine umgeschaut und waren einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass ihre Überlebenschancen bei einem Feuergefecht äußerst überschaubar wären. Und dazu würde es in jedem Fall kommen: 16 Besatzungsmitglieder für eine relativ kleine Maschine mussten Verdacht bei den Terroristen schüren. Obendrein standen nicht einmal genügend Lufthansa-Uniformen zur Verfügung, einige Beamten mussten stattdessen ihre normalen Polizeiuniform-Hosen tragen. Gemeinsam entschieden sie, dass sie für ein solches »Himmelfahrtskommando« (einer der beteiligten Polizisten) nicht zur Verfügung stünden, und verließen die Maschine – just in dem Augenblick, als am Horizont die Positionslichter der anderen beiden Hubschrauber auftauchten.
Nun hing es an den Präzisionsschützen, die immer noch nicht wussten, dass es sich um acht Terroristen handelte und nicht um fünf. Mindestens zwei von ihnen hätten es aber auch nie erfahren können, denn sie hatten keine Funkgeräte. Angeblich standen keine zur Verfügung. Später würde es heißen, man habe nicht genug Zeit gehabt, um sie zu besorgen. Dabei gab es im olympischen Dorf ausreichend Walkie-Talkies, Ordnungskräfte wie Dieter Tutter waren ja damit ausgestattet. Auch die Bewaffnung war unzureichend, die Gewehre keine Präzisionswaffen und für die große Distanz nicht geeignet. Zielfernrohre – Mangelware, von Infrarot- oder Nachtsichtgeräten nicht zu sprechen. Kugelsichere Westen, Stahlhelme – Fehlanzeige, trotz frühzeitiger Anforderung durch den Einsatzleiter (der offizielle Bericht wird später die Bewaffnung als »optimal« beschreiben). Drei ausgebildete Scharfschützen waren zudem im olympischen Dorf zurückgeblieben. Zwei hatte man offenbar schlicht vergessen, einem weiteren wurde beschieden, er werde nicht mehr gebraucht, woraufhin er nach Hause fuhr. Dabei rechneten bereits damals Antiterrorexperten üblicherweise mit mindestens zwei Scharfschützen pro Terrorist (heute drei). Das heißt, selbst bei »nur« fünf Entführern hätte man zehn, bei acht mindestens 16 Scharfschützen in Position bringen müssen.
Zu allem Überfluss lag der Landeplatz in funzeligem Licht.37 »Als wir in Fürstenfeldbruck eintrafen, war es stockfinster«, erinnerte sich später Zvi Zamir. »Ich konnte es kaum glauben. Wir hätten das Areal mit Flutlicht hell erleuchtet.« Das war auch so geplant, doch die Hubschrauber hatten einige Dutzend Meter entfernt von der vorgesehenen Stelle im Dunkeln aufgesetzt. Damit lag ein Scharfschütze nun direkt im Schussfeld von zwei anderen.38 Mossad-Chef Zamir war irritiert: »Ich dachte, dass sie vielleicht zusätzliche Scharfschützen oder Panzerwagen im Dunkeln verborgen hatten. Doch dies war nicht der Fall. Die Deutschen waren schlichtweg überfordert. Auf der ganzen Linie überfordert.«39
Was nun folgt, lässt sich nur noch als heilloses Chaos beschreiben: Als Anführer Issa und ein weiterer Terrorist die verlassene Lufthansa-Maschine inspizieren, wird ihnen klar, dass es sich um einen Hinterhalt handeln muss. Beim Verlassen des Flugzeuges geben sie den anderen mit erhobenen Kalaschnikows Signale. Daraufhin fallen die ersten Schüsse aus deutschen Gewehren. Einer der Terroristen sinkt getroffen zu Boden, aber nicht Anführer Issa. In einer Fernsehdokumentation gibt einer der Beamten später anonym zu Protokoll: »Es ist so, wie man’s im Krimi sieht: Ich hab das Fadenkreuz vor mir und da ist der Kopf mittendrin. Und es funktioniert nicht ohne Weiteres. Es ist diese Beißhemmung […]. Man muss das trainiert haben. Und das hatten wir nicht trainiert.«40
Einige Terroristen retten sich unter die Hubschrauber, wo sie für die deutschen Scharfschützen nicht mehr zu sehen sind, und feuern von dort aus Maschinengewehrsalven ab – scheinbar wahllos, aber erfolgreich: Einen Bereitschaftspolizisten, der mit seinem Trupp den Scharfschützen Rückendeckung geben soll, trifft eine Kugel im Kopf. Er ist auf der Stelle tot. Mehrere Projektile durchschlagen auch die Fenster des Kontrollturms, in dem sich Genscher und der Rest des Krisenstabes aufhalten und wo sie nun unter Schreibtischen Deckung suchen.
Die Minuten vergehen, ohne dass sich die Lage ändert. Die Deutschen kommen nicht an die verschanzten Terroristen heran, zum Teil stehen sie sich gegenseitig in der Schusslinie. Man hofft auf eilig angeforderte Panzerwagen aus dem olympischen Dorf. Die aber stecken im Stau. Und im Zentrum des Feuergefechts stehen die Hubschrauber und sämtliche Geiseln darin. Verzweifelt wendet sich Ulrich Wegener an einen Hundertschaftsführer der Bereitschaftspolizei: »Wollt ihr nun nicht endlich eingreifen? Wollt ihr nicht rausgehen und einen Angriff durchführen, um wenigstens einige Geiseln zu retten?« Doch der antwortet lediglich, er habe keine Weisung und müsse warten, bis jemand einen Befehl erteilt. »Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er froh war, keine Weisung zu haben«, meinte Wegener später nur.41
Es geht nicht vor und nicht zurück. Nach über einer Stunde erreichen die georderten Panzerwagen den Schauplatz. Als sie sich nähern, beginnen die Terroristen die Geiseln in den Hubschraubern zu beschießen. Bevor die Kugel eines Scharfschützen ihn trifft, gelingt es Anführer Issa, eine Handgranate in einen der Hubschrauber zu werfen. In der Explosion kommen sämtliche Geiseln dort ums Leben. Die Geiseln im zweiten Hubschrauber werden von einem der anderen Terroristen erschossen. Im Tower muss Wegener neben Genscher hilflos dabei zusehen, wie die israelischen Olympiateilnehmer ermordet werden. »Es war ein einziges Fiasko. Das war für mich das traumatischste Ereignis meiner Laufbahn. In dem Augenblick schwor ich mir, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde.«42 Noch während geschossen wird, versuchen Männer der Flughafenfeuerwehr, den brennenden Hubschrauber zu löschen, werden aber von den Terroristen unter Feuer genommen. Sie fliehen aus ihrem Löschfahrzeug, während das Wrack, die Toten und die Terroristen in einem Schaumteppich versinken.
»Ich nehme an, dass die deutschen Einsatzkräfte ihr Bestes getan haben, aber sie hatten einfach keine Chance«, analysierte Ehud Barak den »amateurhaften Einsatz« in der Rückschau. »Ihre Kenntnisse waren sehr beschränkt. Es ist, als würden wir beide uns in einer Extremsituation befinden, in der wir an jemandem eine Gehirnoperation vornehmen müssen. Die Chancen, dass der Patient am Ende noch lebt, sind sehr gering. Aber wir sind doch intelligente, fähige Leute, wir haben sehr viel Erfahrung in vielen anderen Gebieten. Aber wir haben nun mal keinerlei Erfahrung darin, eine Gehirnoperation durchzuführen und es ist eine heikle Operation, die auf Details basiert.«
Um 0:30 Uhr, fast zwei Stunden nach der Landung der Hubschrauber, wird der letzte Schuss abgefeuert. Als es endlich still wird auf dem Vorfeld, sind alle neun Geiseln tot, außerdem fünf Terroristen und ein deutscher Polizist. Ein weiterer Polizist und ein Pilot sind schwer verletzt, und zwar durch versehentliche Schüsse der eigenen Leute. Drei palästinensische Attentäter haben überlebt, einer von ihnen leicht verletzt.
Genscher und Wegener fliegen umgehend zurück zum olympischen Dorf. Dort gab es bereits eine Pressekonferenz, in der fälschlicherweise von einem erfolgreichen Einsatz und der Befreiung aller Geisel die Rede war. Übernächtigt und gezeichnet, obliegt es nun dem Innenminister, den verdutzten Reportern und der Weltöffentlichkeit den verheerenden Ausgang des Geiseldramas mitzuteilen – um drei Uhr morgens, mehr als 22 Stunden nachdem die Palästinenser über den Zaun im olympischen Dorf geklettert sind. »Genscher hatte ich selten so mitgenommen gesehen, wie an diesem Tag«, wird sich BGS-Mann Wegener später erinnern. »Er wollte gar nicht mehr angesprochen werden. Es ging ihm sehr nahe, dass er mit seinen eigenen Kräften die Katastrophe nicht hatte verhindern können. Nach der Pressekonferenz sagte er zu mir: ›Ich habe das inzwischen dem Kanzler gemeldet und wir müssen jetzt überlegen, was wir zu tun haben.‹ Ich erwiderte: ›Wir müssen eines tun, Herr Minister, das habe ich Ihnen schon früher gesagt: Wir brauchen eine Anti-Terror-Spezialeinheit, die in Zukunft mit solchen Situationen fertig wird.‹«43 Das sah Genscher genauso.
2
EINE TRUPPE GEGEN DEN TERROR
Am nächsten Morgen standen eigentlich Biologie und Deutsch auf dem Stundenplan von Jörg Probstmeier.1 Stattdessen lauschte der Realschüler seiner sichtlich mitgenommenen Klassenlehrerin: »Sie teilte uns mit, dass die Befreiung der israelischen Sportler missglückt war, dass es dort viele Tote gegeben hat. Und sie erinnerte an unsere historische Verantwortung und Schuld für die Verfolgung Menschen jüdischen Glaubens im Dritten Reich.« Als sie geendet hatte, herrschte betretenes Schweigen in der Abschlussklasse, einigen standen Tränen in den Augen – auch Probstmeier. Wie alle hatte er von der Geiselnahme gehört, doch diese Schulstunde geriet für den 16-Jährigen zum Schlüsselerlebnis. Ein halbes Jahr später bewarb er sich beim Bundesgrenzschutz, um schließlich bei dem Verband zu landen, der als Konsequenz aus der Katastrophe gegründet werden sollte. »An diesem Morgen wurde mir bewusst, dass auch wir als Enkelgeneration eine Mitverantwortung dafür hatten, dass sich so etwas nicht wiederholt.«
Das »Massaker von München«, wie es bald allenthalben hieß, sandte eine Schockwelle um die Welt, in Echtzeit. Hunderte Millionen Menschen auf allen Kontinenten hatten einen ganzen Tag lang live mitverfolgen können, wie sich das Geiseldrama im olympischen Dorf entfaltet hatte, und sahen tags darauf die ersten Aufnahmen aus Fürstenfeldbruck. Das Bild vom ausgebrannten Hubschrauberwrack gerann zur zeitgeschichtlichen Ikone, ein im Moment gefrorenes Symbol des Schreckens. Es offenbarte eine bis dahin unbekannte Dimension des Terrorismus.
Doch fast ebenso schockierend wie die Tat war die völlige Unfähigkeit bundesrepublikanischer Amtsträger und Sicherheitskräfte, mit der Situation fertigzuwerden. Die fahrlässige Unbekümmertheit im Vorfeld, das staatliche Kompetenzwirrwarr in der Krisensituation, das Kommunikationschaos, die geballte polizeiliche Inkompetenz, während sich die Lage entfaltete, angefangen bei den Absperrungen über Ausrüstung und Bewaffnung der Einsatzbeamten, grundlegende Fehlentscheidungen in der Einsatztaktik bis hin zur Zahl der eingesetzten Scharfschützen – vieles von dem, was in der Summe zur Katastrophe geführt hatte, würde sich erst in den kommenden Monaten und Jahren herausstellen. Eines war aber klar: Der deutsche Staat hatte erbärmlich versagt. Die einflussreiche israelische Zeitung Ha’aretz konstatierte bitter: »Unsere Mannschaft ging nach München unter der Voraussetzung, dass das Gastgeberland für ihre Sicherheit sorgen würde […]. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Die Verantwortung dafür liegt bei den westdeutschen Behörden.«2 Der italienische Staatsrundfunk zeigte sich dagegen verständnisvoll: »Es ist ein überaus bitterer Preis, den die Deutschen gerade dafür bezahlen müssen, daß sie sich vom alten Klischee lösen wollten, daß sie ihre Grundeinstellung entmilitarisierten und die Kontrollen im Olympischen Dorf vielleicht etwas zu weich, locker und herzlich handhabten.« Und die Londoner Times konstatierte: »Dies waren Fehler, die von den Sicherheitskräften begangen wurden; Versäumnisse der Unzulänglichkeit und der Verwirrung und des Versagens, mit Umständen von außergewöhnlicher Problematik fertigzuwerden. Es waren Fehler, aber keine Verbrechen.«3
Die deutsche Presse war nicht so milde gestimmt und stellte unangenehme Fragen nach Verantwortung und Verantwortlichen. »War es zu vermeiden?«, bohrte Der Spiegel auf seinem Titel. Rudolf Augstein kommentierte im Leitartikel fassungslos: »Ich verstehe nicht, wieso die Israelis und die gastgebenden Deutschen für die Mannschaft Israels einen so unzulänglichen Schutz durchexerziert haben. Man hätte doch wohl annehmen dürfen, daß neben jedem israelischen Mannschaftsmitglied ein als Sportler oder Betreuer getarnter Sicherheitsbeamter schlief oder besser wachte.«4 Günther Grass beklagte in einem Brief an den Bundeskanzler ein »Scherbengericht«, und der angesprochene selbst sprach von »einem erschreckenden Dokument deutscher Unfähigkeit«5. Der internationale Terrorismus hatte die Bundesrepublik eiskalt erwischt.
DAS JAHRZEHNT DES TERRORS
Doch der Horror, der so unvermittelt über die »heiteren Spiele« hereingebrochen war, kam nur scheinbar aus heiterem Himmel. Die blutige Geiselnahme bildete lediglich den traurigen Höhepunkt in einem Jahr voller Attentate und das Jahr 1972 den Höhepunkt in einer Ära voller Attentate. Seit Jahren schon rumorte es in ganz Europa: Bomben der Roten Brigaden in Italien, Brandanschläge der Irish Republican Army (IRA) in Nordirland, Flugzeugentführungen der Palästinensischen Befreiungsorganisation PFLP – der internationale Terrorismus war seit Ende der 1960er höchst aktiv und steigerte sich von Jahr zu Jahr in Häufigkeit wie Dimension: Die Zahl der Angriffe stieg innerhalb von zehn Jahren weltweit um das Fünffache, von knapp über 100 im Jahr 1968 auf rund 500 Attentate Ende der 1970er (wobei das Olympiajahr 1972 mit 600 Anschlägen einen traurigen Rekord verzeichnete). Auch die Zahl der Toten und Verletzten vervielfachte sich und stieg von Anschlag zu Anschlag.6 Der Terrorismus wurde vernetzter, schlagkräftiger, professioneller und in der Wahl seiner Opfer wahlloser. Nicht nur Politiker und Amtsträger liefen Gefahr, Anschlagsziele zu werden, sondern auch Geschäftsreisende, Touristen oder – wie in München – Athleten.
Und der »hausgemachte« Terrorismus? Allein bei den sechs Bombenanschlägen in der sogenannten Mai-Offensive der RAF waren im Frühjahr 1972 vier Menschen getötet und über vierzig verletzt worden – innerhalb von zwei Wochen. Immerhin war in den Sommermonaten vor dem Olympia-Attentat das zerschlagen worden, was der politisch interessierte Zeitgenosse je nach persönlicher Präferenz wahlweise »Baader-Meinhof-Gruppe« oder »Baader-Meinhof-Bande« zu nennen pflegte. So zumindest die allgemeine Annahme. Aber es war kein Zufall, dass sich unter der Liste mit 130 palästinensischen Häftlingen, die freigepresst werden sollten, die Forderung nach Freilassung von Ulrike Meinhof fand, intellektueller Kopf der ersten, langlebigsten und gefährlichsten deutschen »Homegrown«-Terroristengruppe. Kein Zufall auch, dass Meinhof in ihrem Pamphlet »Zur Strategie des antiimperialistischen Kampfes« die »historische Mission« der Münchner Terroristen vom Schwarzen September als »gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch« und »avantgardistisch« bejubelte.7 Strippenzieher und Auftraggeber hinter den Geiselnehmern vom Schwarzen September war Palästinenserführer Ali Hassan Salameh, genannt Abu Hassan. Er galt als meistgesuchter Terrorist der Welt. Der Oberkommandierende der palästinensischen Ausbildungslager von Al Fatah hatte Ulrike Meinhof zwei Jahre zuvor in Jordanien im Guerillakampf trainiert, zusammen mit Andreas Baader, Horst Mahler und Gudrun Ensslin.8 Nach der ersten spektakulären Aktion des Schwarzen September – der Entführung des Sabena-Fluges 571 von Brüssel nach Tel Aviv im Mai 1972, gewaltsam beendet durch ein israelisches Kommando – vereinbarte die Terrorgruppe mit Mitgliedern der IRA, der japanischen Roten Armee sowie Vertretern der RAF in einem libyschen Flüchtlingslager gegenseitige Unterstützung bei weltweiten terroristischen Aktionen. Darüber hinaus planten sie Aktionen im jeweils eigenen Land in »Vertretung« für die anderen Gruppen. So sollte die RAF im Namen der Palästinenser Anschläge in Westdeutschland verüben.9 Der Nahe Osten bot umgekehrt den deutschen Terroristen in dieser Zeit immer wieder Rückzugsräume. Wenn die Luft in Deutschland zu dick wurde, wichen sie nach Beirut, Bagdad oder Aden aus, warteten ab und bereiteten sich auf neue Aktionen vor.10
Dieses Gebräu aus deutschem und internationalem Terrorismus sollte in den kommenden Jahren weiter köcheln. 1972 wurde es noch kaum gesehen. Aber auch ohne dieses Wissen war klar, dass eine Situation wie in München jederzeit wieder passieren könnte.
Hans-Dietrich Genscher kehrte tief erschüttert aus München in die Hauptstadt zurück. In seinen Memoiren bezeichnet er die Ereignisse in Fürstenfeldbruck als »die schrecklichste Erfahrung meiner ganzen Amtszeit«.11 Noch in München hatte er Bundeskanzler Brandt seinen Rücktritt angeboten. Der aber lehnte ab. Genscher habe sich keinen Vorwurf zu machen, er habe alles getan, was getan werden konnte.12 Im Kreis seiner Mitarbeiter kam der Minister schnell zu der Erkenntnis, dass »die Münchner Stadtpolizei und auch die bayrische Landespolizei nicht vorbereitet waren – das wäre an jedem anderen Ort in Deutschland genauso gewesen«.13 Die Analyse war ebenso niederschmetternd wie eindeutig. Für diese neue Stufe der gewaltsamen Auseinandersetzung waren »neue Formen polizeilicher Reaktion« notwendig. Aber ebenso eindeutig erschien es Genscher, dass die Sicherheitsbehörden der Länder allein dazu nicht in der Lage sein würden. Denn wie beim Bund unterhielt kein Bundesland speziell ausgebildete Polizeieinheiten, die einer solchen Terrorbedrohung gewachsen gewesen wären. Zwei Tage nach Fürstenfeldbruck gab der Innenminister deshalb Weisung, »innerhalb einer Woche Konzeptionen einer Spezialeinsatzgruppe« zu erarbeiten.14 Das Vorhaben war ebenso eilig wie heikel, denn für den 13. September 1972 war eine Sondersitzung der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern einberufen worden und eine Spezialeinheit des Bundes würde die Polizeihoheit der Länder infrage stellen.
Am Vorabend der Konferenz äußerte sich Bundeskanzler Willy Brandt in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau dazu – in Absprache mit dem Innenminister, wie zu vermuten ist: »Für die Zukunft ist es sicher richtig, daß wir, gestützt auf die Münchner Lehren, zu noch effektiveren Formen kommen müssen, auch zum Vorhandensein von mobilen Einheiten, die für solche Fälle ausgebildet sind, die vermutlich einen höheren Wahrscheinlichkeitsgrad des Erfolges haben.«15