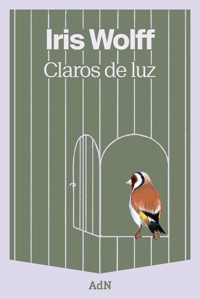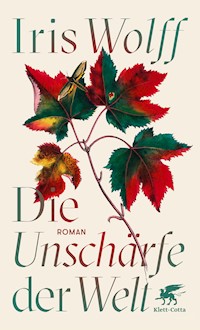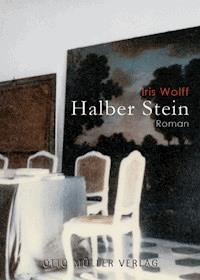
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sine, eine junge Frau, die nach Abschluss ihres Studiums auf der Suche nach ihrem beruflichen Weg ist, kehrt nach über 20 Jahren an den Ort ihrer Kindheit zurück. Ihre Großmutter Agneta ist gestorben, und gemeinsam mit ihrem Vater Johann ist sie zu deren Begräbnis nach Siebenbürgen gereist. Das Haus der Großmutter zieht sie vom ersten Augenblick an in ihren Bann: das Gebäude mit seiner geheimnisvollen Architektur, dem vermauerten Eingang zur ehemaligen Familienfärberei, den verschiedenfarbigen Räumen, Winkeln, Aufböden und Treppen erinnert sie an ihre Kindheit, die Zugehörigkeit zu Natur und Landschaft, das Spiel in Haus und Garten. In die Trauer um ihre Großmutter mischt sich die Trauer über die verloren geglaubte Heimat. Die Wiederbegegnung mit Julian, dem Freund der Kindheit, die Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte der Großmutter und die Erzählungen der Dorfbewohner lassen ein Bild der reichen kulturellen Vergangenheit Siebenbürgens entstehen. Details der Landschaft werden zu Metaphern einer Suche nach der eigenen Identität, und setzen in Sine einen Reifeprozess in Gang, der sie auch sich selbst näher bringt. Der in Michelsberg gelegene Halbe Stein, ein jahrhundertealtes Naturmonument, öffnet Sine den Blick für das Wesentliche: Wenn man erinnert, kann man nicht verlieren. Iris Wolff gelingt in ihrem literarischen Debüt ein Roman von großer erzählerischer Stärke. In poetischen Landschaftsbildern wird die Familiengeschichte Sines geschildert, die Orte und Menschen werden druch die große Sprachkraft mit allen Sinnen erlebbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Iris Wolff
Halber Stein
Roman
OTTO MÜLLER VERLAG
ISBN 978-3-7013-6197-7© 2012 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.atUmschlagbild aus: Cy Twombly, Drawings© by Cy Twombly 2008/courtesy Schirmer/MoselE-Book Erstellung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Meinen Eltern und Großeltern
Prolog
Jede Geschichte hat ihren Anfang in der Geschichte,die ihr vorangeht.
„Was denkst du, gibt es Orte, die uns in die Vergangenheit blicken lassen und uns gleichzeitig die Zukunft zeigen?“
Blinzelnd, gegen das Sonnenlicht sah ich, dass Julian ein Buch in der Hand hielt. Ein schmales, hellgraues Bändchen mit zerschlissenem Einband und geprägten Lettern. Meine Großmutter Agneta hatte es ihm geschenkt, als er ihr geholfen hatte, den Mais in der Scheune zu stapeln. Golden lagen die Kolben aneinander gereiht, als der Sommer anfing, sich mit seiner ganzen Kraft gegen den beginnenden Herbst zu stemmen.
Heuwägen durchbrachen die Stille, die sich über die Mittagszeit auf die Felder geschlichen hatte. Wir saßen unter einer der Kastanien, die den Weg zum Dorf säumten. Hinter unserem Rücken lagen die letzten Häuser Michelsbergs, der Kirchturm ragte aus dem Dächer- und Ziegelmeer hervor, berührte mit seiner Spitze den Burgberg und die Basilika. Die Sonne wanderte in hohem Bogen über die Ausläufer der Südkarpaten, über die Kornfelder und das aufgetürmte Stroh. Sensen und Sicheln blitzten auf. Das letzte Heu wurde gemäht und jenes geerntet, das in den vergangenen Wochen auf den Feldern getrocknet war.
Das Blätterdach des Baumes warf wandernde Schatten auf Julians Buch. Ich sah auf seine Hände, die über den Buchrücken strichen, als gelte es, die zeitlichen Spuren zu glätten. Er war mir auf eine Weise vertraut, die sich über alle Zeit hinwegsetzte, die seit unserer Kindheit vergangen war. In seiner Nähe war mir die Trauer und Einsamkeit der letzten Tage fern – wäre da nicht die Scham gewesen, dass ich dies alles hatte vergessen wollen.
„Es gibt solche Orte“, beantwortete ich seine Frage und griff nach dem Bändchen. Ich überflog das Inhaltsverzeichnis und entdeckte, dass ich es kannte. Mein Vater hatte es mir vor langer Zeit mit den Worten gegeben, dass ihn die kurzen Episoden an seine Kindheit in diesem Landstrich erinnerten. An die eisenbeschlagenen Türen der Kirchenburgen und die weiß gekalkten Bäume der Dorfstraßen. An die runden Hoftore der Bauernhäuser und ihre schattigen, steingepflasterten Höfe. An die Verstecke im Heuschober und die Geheimnisse der dämmrigen Aufböden.
Als ich Julian meine Gedanken mitteilte, machte er ein nachdenkliches Gesicht.
„Dann werden die Geschichten zu deiner eigenen Geschichte?“
„Ist das nicht immer so bei guten Büchern?“
Er nickte, doch seine Augen sahen grüblerisch, fast ein wenig spöttisch aus.
„Warum bist du dann erst jetzt zurück gekommen?“
Ich beschirmte die Augen und sah auf die Felder. Wie gelbes, kurz geschorenes Fell überzogen die Ähren das Land. Dazwischen einzelne Baumreihen, die diese blassen Quadrate zerteilten. Die Hügel am Horizont waren kaum mehr als blaue, glashelle Schatten. Ein Klingeln und Rufen bündelte sich zu einem ansteigenden Akkord. Die Arbeiter begannen, vor der Mittagshitze auf den Feldern zu fliehen.
Julian hatte bemerkt, dass mich seine Frage getroffen hatte, stand auf und reichte mir die Hand: „Komm, gehen wir zurück.“
Ich klopfte mir das Gras von den Kleidern und folgte ihm auf dem breiten Schotterweg, der in ausladendem Bogen zum Dorf führte. Außerhalb der Schattendächer der Kastanien war es drückend heiß. Die Luft am Horizont vibrierte. Mir machte die Hitze nichts aus. Im Gegenteil, ich fühlte mich geborgen in ihren weichen Armen. Was mich verwirrte, war Julians Frage, war die Schönheit der Landschaft, die vertrauten und gleichzeitig fremden Gerüche und Geräusche. Übervoll beladene Heuwägen rollten an uns vorbei. Strohhalme bedeckten die Straße mit einem hellen Flaum. Gesprächsfetzen der rumänischen und deutschen Feldarbeiter drangen zu mir. Melodische Silben zweier ungleicher Sprachen und mit ihnen das Gefühl, einen längst vergangenen Traum erneut zu träumen. War es möglich, dass ich noch Anfang der Woche in Deutschland gewesen war? Dort waren die Tage bereits kürzer, und am Morgen verbarg kühler Nebel die Straßenläufe. Hier war der Vormittag von trockenem Dunst geprägt gewesen, der sich über den Wiesen verteilte, bis er sich zu Mittag aufzulösen begann. Er wich einer Hitze, die sich wie eine Fieberglut übers Land senkte. Das Blau der Berge verblasste und wurde erst am Abend wieder dunkler. Allein die Nacht brachte ein Vorgefühl des Herbstes, ein frischer Wind hatte an den Hoftoren gerüttelt und die Kälte der Berge über das transsilvanische Hügelland gestreut. Wie erstarrte Wolken lag der Schnee des letzten Winters auf den Karpaten. Unten in den Tälern aber wohnte der Sommer. Ein später, schwüler Sommer, der voll war von einem fremden, welken Duft. Nüsse und aufgeplatzte Kastanien säumten die Wege, und in den Gärten lagen Zwetschken auf dem ersten Laub. Quitten leuchteten hellgelb und violett die Herbstzeitlosen auf den Weiden. Die letzten Tage des Septembers umfingen Flussläufe und Bäche, Wiesen und Äcker und die buckligen, waldigen Hügel.
Vor uns schlängelte sich der Silberbach entlang der breiten, ungeteerten Hauptstraße. Strommasten spannten sich wie Spinnennetze über die Straßen. Auf den Schornsteinen nisteten Störche. Die Häuser mit ihren gähnenden Torbögen und zugeklappten Fensterläden wirkten schläfrig. Hühner liefen über die Straße und verschwanden zwischen den losen Brettern eines Zauns. Ein Heuwagen fuhr so dicht an uns vorbei, dass Julian mich zur Seite zog. Ich sah Holzräder, denen ein paar Speichen fehlten, und schwarze Stiefel unter einem Rock. Auf dem Kutschbock saß eine alte Frau, die Zügel locker in der Hand. Eine Haube verbarg ihre Haare und gab über dem Nacken zwei geflochtene Zöpfe frei. Unsere Blicke begegneten sich, und für einen Moment schien es, als würde der Pferdewagen anhalten. Ihr Gesichtsausdruck schwankte zwischen Neugier und Erkennen. Ich blieb stehen und sah ihr nach, bis der Wagen hinter den Linden verschwand.
Als wir auf der Höhe des Pfarrhauses waren, sprach ich Julian nochmals auf das Buch an.
„Vielleicht hat jeder Mensch solche Erinnerungsorte.“
„Was meinst du mit Erinnerungsort?“
Er sprach das Wort ganz langsam und mit einer Melodie, als könnte es in der Mitte zerbrechen.
„Ein Bruchstück aus der Vergangenheit, an das man sich oft erinnert. Einen prägenden Ort, der einen nicht loslässt“, auch wenn man ihn hinter sich lassen will, fügte ich in Gedanken hinzu.
„Ich habe mich gewundert, dass Agneta es mir geschenkt hat. Schau, es hat eine Widmung.“
Als er die erste Seite aufschlug, entdeckte ich einen silbernen Aufkleber, den ich übersehen hatte: Überreicht vom Institut für Auslandsbeziehungen. Darunter ein Datum und in sorgfältiger Schreibschrift: ‚Agneta Maria in Liebe von A.‘.
Ich berührte nachdenklich die dunkelblaue Tinte. Wer konnte meiner Großmutter vor vierzig Jahren ein Buch aus Deutschland überreicht, und mit dieser Widmung versehen haben?
„Gab Agneta dir oft Bücher?“
„Ja, hast du dir ihre Bibliothek im Roten Zimmer angesehen?“
Ich nickte.
„Agneta wusste um meinen Lesehunger. Zur Hermannstädter Bibliothek komme ich nicht oft, und ich habe keine Lust, die Bücher, die ich zusammengetragen habe, zum dritten Mal zu lesen.“
Er sagte das ohne Bitterkeit, und doch empfand ich eine Mischung aus Mitleid und Unbehagen.
„Ich kann dir meine Bücher geben, ich habe fünf…“, ich stockte, „drei Bücher mit.“
Ich hatte fünf Bücher dabei, doch die zwei, die ich verschwieg, gehörten zu der Sorte Buch, die man nur ungern mit anderen Menschen teilt. Manche Bücher sind schon nach einmaligem Lesen unbrauchbar für ein zweites Leseerlebnis. Wenn man mit Bleistift Sätze unterstreicht, wenn man Worte mit Ornamenten verziert, ganze Passagen herausstellt, die einem einprägsam, wichtig und schön erscheinen. Wenn die Zettel, Stichworte und Randbemerkungen zu einem heimlichen Register herangewachsen sind und eine eigene, ganz andere Geschichte erzählen. Sie verraten, welche Themen uns beschäftigen, welche Fragen wir uns stellen, und sind wie eigene Ansichten und Gedanken, die jemand anders eindrücklicher und treffender formuliert hat. – Diese persönlichen, offenbarenden Lesespuren mochte ich Julian noch nicht zeigen.
Ein kleines Lächeln, das ich nicht einordnen konnte, zog sich um seinen Mund, als er erwiderte, dass er meine Bücher gerne haben würde.
Zwei Männer überholten uns, Julian wechselte einige Worte auf Rumänisch mit ihnen. Sie lachten, und ich spürte eine leichte Ungeduld, da ich ihrem Gespräch nicht folgen konnte. Betont gleichgültig stieß ich mit der Schuhspitze ein paar Steinchen über die Straße. Als die Männer sich verabschiedet hatten, setzten auch wir unseren Weg fort. Der letzte Heuwagen näherte sich. Die Torbögen hatten alles verschluckt. Menschen, Pferdewägen und Heu. Stimmengewirr, Hufgeklapper und den Geruch des Strohs. Die Kirchturmglocken schlugen zwölf Mal.
„Wollen wir heute Nachmittag zusammen zur Basilika hinauf gehen?“
Ich nickte erfreut. Über dem Dorf, vor das massive Gebirge der Südkarpaten, schmiegte sich die kleinere Hügelkette des Zibinsgebirges mit dem kreisrunden Burgberg. Die Kirchenburg mit ihrer Wehrmauer und der sandsteinfarbenen Basilika sah aus wie ein kleines Wunder. Julian nannte die Uhrzeit, zu der wir uns vor dem Gemeindewirtshaus treffen würden, und küsste mich zum Abschied auf die Wange.
„Julian?“
Er drehte sich noch einmal um.
„Wie hast du mich gestern Abend eigentlich erkannt?“
„Von den Familienfotos im Blauen Zimmer.“
„Die sind schon alt“, antwortete ich verlegen.
„Ich hätte dich auch so erkannt. Du hast dieselben Augen wie Agneta.“
Zeichen
In den frühen Morgenstunden waren wir am Tag zuvor angekommen. Der Wagen preschte über löchrigen Asphalt, durch den Wald brach aufflackernd das Morgenlicht, und tief verschleiert tauchten auf einer Hügelkuppe die ersten Kirschbaumfelder Michelsbergs auf. Hinten, noch in blaugraue Pastelltöne gehüllt, lagen die Ausläufer der Südkarpaten, die Gipfel schneebedeckt.
Der Schlüssel zu Agnetas Haus war für uns beim Pfarrer hinterlegt. Ich wartete im Wagen. Nach wenigen Minuten trat Vater aus dem Tor. Ich kurbelte die Fensterscheibe weiter herunter und hielt das Gesicht in den Wind. Schaukelnd überquerten wir eine Brücke. Ein schnatternder, gemächlicher Gänsezug versperrte uns den Weg. Hunde kläfften hinter Hofmauern und rannten unserem Wagen hinterher. Mit einem Ruck blieben wir schließlich stehen.
Vaters Hände zitterten leicht, als er das Hoftor öffnete. Wir betraten das Haus, als würden wir eine geheime Schwelle überwinden. Wir gingen behutsam über den Korridor, sahen aus den Fenstern zum Hinterhof, zu den Rebstöcken und dem Kirschbaum. In der Hauptwohnung war es stickig. Unschlüssig blieb ich stehen, bis mir die Topografie der Zimmer wieder gegenwärtig war. Vater ging, ohne ein Wort, nach rechts ins Blaue Zimmer. Ich betrat die Küche, öffnete ein Fenster, spürte, wie ein frischer Luftzug durchs Haus ging, und lehnte mich hinaus. Weit hinter den letzten Häusern, wenige Kilometer entfernt in einem Hermannstädter Bestattungsinstitut, war sie. Als am Montag eine Nachbarin gekommen war, um ihr Milch und Eier zu bringen, hatte sie Agneta tot in ihrem Bett gefunden. Das Haus indessen schien auf sie zu warten, war noch so, wie sie es hinterlassen hatte. Es ruhte in der Erinnerung ihrer letzten Tage.
Ein Blumenstrauß stand entblättert auf dem Küchentisch. Verloren ragten die Stängel aus dem bräunlichen, abgestandenen Wasser der Vase auf. Die Blütenköpfe lagen welk über das Tischtuch verstreut. Im Hausflur, nachlässig abgestreift, ausgediente Hausschuhe. Durch die angelehnte Tür sah ich ins Rote Zimmer mit seiner Bibliothek. Die Vorhänge waren zugezogen, die bestickten Kissen akkurat auf dem Sofa drapiert. Es sah aufgeräumt aus. Anders das Blaue Zimmer.
Ich blieb zögernd an der Türschwelle stehen. Vater sah kaum hoch. Er legte Kleidung zusammen, zog das Tischtuch glatt, und rückte die Familienbilder auf der Kommode gerade. Er sammelte Papiere ein, sortierte Umschläge und Briefe, konzentriert und gewissenhaft, als wäre diese Arbeit unaufschiebbar, als gelte es, Ordnung zu schaffen für ihre Rückkehr. Ein Stapel Zeitschriften fiel ihm aus der Hand. Er fluchte leise.
Befangen betrat ich das größte und herrschaftlichste Zimmer des Hauses. Die Schubladen des Schranks waren offen, die Stühle des Tisches zur Seite gerückt. Eine aufgeschlagene Zeitung lag auf dem Vorsprung des Kachelofens, daneben Stricknadeln und hellblaue Wolle. Auf dem Nachttisch entdeckte ich einen siebenbürgischen Hauskalender. Aus den Septemberseiten lugte eine getrocknete Taglilie heraus.
Ich sah alles ganz genau, die gepolsterten Rauten des Morgenmantels auf dem Bett, die schroffe und zugleich glänzende Struktur des aufgewickelten Knäuels. Die Wachsflecken neben dem Kerzenständer, den Teerand einer zur Hälfte ausgetrunkenen Tasse, den festen Stoff der Vorhänge – und doch blieb alles zusammenhanglos und fremd. Ich konnte meine Scheu nicht überwinden. Nichts lag mir ferner, als die Sachen meiner Großmutter zu berühren.
Die Bettdecken knisterten, als ich meinen Koffer im Grünen Zimmer auf den Turm aus Daunenkissen und -decken hob. Ich setzte mich daneben und schloss die Augen. Der Holzfußboden knackte unter der hereinfallenden Sonne. Nebenan hörte ich Vater telefonieren, vor den Fenstern pfiff jemand im Vorübergehen ein Lied. Als Vater nach einer halben Stunde immer noch nicht aus dem Blauen Zimmer gekommen war, zog ich die Schuhe aus und ging durch den Garten zum Kirschbaum. Über sonnige Steinplatten, Gras und trockene Erde. Ich tauchte die Hände in die Mehlsäcke im Schuppen, öffnete die Tür zum Maisschober, besah die Kolben, die, akkurat gestapelt, einen Meter hoch reichten. Ich pflückte ein paar Trauben und setzte mich auf die Treppenstufen vor der Eingangstür.
Das verfärbte Grün der Bäume und Sträucher erzählte von den langen, heißen Sommermonaten, doch es war noch kein Loslassen darin, nur die Astern in Agnetas Garten erinnerten daran, dass das kleine Paradies, an dem sie sich noch vor wenigen Tagen erfreut hatte, verwelken würde. Der Herbst würde kommen und dann der Winter und wieder ein Frühling. Immer so fort. Doch ohne sie.
Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Vater sah mich traurig lächelnd an.
„Komm, ich möchte dir etwas zeigen.“
Er führte mich durch den Korridor zu einem der vielen Werkräume. Unsere Schritte hallten gedämpft auf dem Linoleumboden wider. Wir blieben vor einer Türe stehen, an deren Rahmen die Farbe bereits abgeplatzt war. Vater entriegelte die Tür, und wir betraten ein dunkles Zimmer, dessen einziges Mobiliar aus einem großen Nähtisch bestand. Er war gänzlich mit Furchen übersät, die sich wie Straßen über die Tischplatte zogen. Aus den vielen Näharbeiten hervorgegangen, die hier angefertigt worden sein mussten, sponnen sie ihre Netze nun, um den alten Tisch zusammenzuhalten.
„Das war der Nähraum deiner Oma“, sagte Vater mit heiserer Stimme und klappte die Fensterläden auf. Licht fiel auf den Dielenboden. Ich fragte mich, warum er mir ausgerechnet dieses Zimmer zeigte. Das Haus versteckte viele Räume, die ich noch nicht gesehen hatte, hinter seiner ungewöhnlichen Architektur. Wie ein großes L spannte es sich um eine Straßenecke, und gut die Hälfte wurde von dem rechtwinkligen Korridor ausgefüllt, der diesen Buchstaben gleich einer Galerie nachformte. Betrat man das Haus durch die Eingangstür, so lag linker Hand der Abstieg zum Keller, der Aufstieg zum Dachboden, und zuletzt die Hauptwohnung. Auf der anderen Seite, hinter den Fabrikfenstern des Korridors, geschützt vom rechten Winkel des Hauses, lagen Hinterhof und Garten. Ging man weiter, so kam man zu jenem sonderbaren Knick, mit dem der Korridor eine andere Richtung nahm. Diese geheimnisvolle Mitte teilte das Haus. Agneta hatte seit längerer Zeit nur die Hauptwohnung genutzt, das zeigten die Spinnweben vor den Türen und die staubigen Fenster. Der Nähraum, in dem wir uns befanden, gehörte zu den vielen Arbeits- und Abstellräumen, die ungeöffnet jenseits des rechten Winkels lagen. Sie atmeten eine abgestandene Luft, die sie nur durch die dünnen Schlitze unter den Türen ab und zu ausspucken konnten, lagen still und mahnend da, es war fast, als verhöhnten sie uns, die wir auch zu zweit nicht einmal einen so kleinen Teil des Hauses mit Leben füllen konnten.
„Hier, diese Zeichnungen sind von dir. Du hast sie als kleines Mädchen in den Mörtel geritzt.“ Vater ging in die Hocke und wies auf eine Stelle an der Wand. Ich bemerkte seine sauberen Hände. Ohne farbige Pinselspuren auf dem Handrücken sahen sie fremd und bloß aus. Seine hellbraunen, von grauen Strähnen durchsetzten Haare fielen offen auf die Schultern. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, in den Einkerbungen eine Zeichnung zu erkennen. Da klopfte es an der Haustür. Ich hörte Vaters Schritte, die sich entfernten, und das Öffnen der Tür. Eine Frauenstimme, die auf Sächsisch sprach, dann Stille.
Die Kugellampe aus Milchglas, die in der Mitte des Zimmers hing, begann sich leicht zu drehen, als ich auf die Wand zuging. Das untere Drittel der Tapete war efeugrün gestrichen und schlang sich wie ein großes Band um die Zimmerwände. Der restliche Raum war in einem Weiß gehalten, das im Laufe der Jahre gelbstichig geworden war. Nur die Spuren an der Tapete erzählten von der einstigen Möblierung – und doch wirkte der Raum nicht leer. Vielleicht war es das Licht, das von der Lindenallee auf Boden und Wände fiel, oder der Nähtisch unter der Lampe, in den sich die Stunden eingegraben hatten, die Agneta an ihm gesessen hatte. Vielleicht war es das Gefühl, das mich begleitete, seit wir das Haus betreten hatten. Die Zimmer waren voller Leben, und gleichzeitig wohnte ein Schweigen darin, als währte ihr Verlassensein schon viele Jahre.
Ich kniete vor der Zeichnung und berührte die eingeritzten Spuren mit den Fingern. Doch ich konnte nichts als verschlungene Linien erkennen, die sich zu keinem Bild zusammenfügen wollten. Mörtel bröckelte meine Handinnenflächen hinunter und rieselte auf den Fußboden. Irgendwo im Haus hörte ich Vaters Schritte. Eine Welle von Traurigkeit schnürte mir die Kehle zu. Wie ein kleines Boot, das auf dem grünen Streifen der Zimmerwand gestrandet war, verschwand die Zeichnung in der Dämmerung, als ich die Fensterläden wieder verhakte und die Tür hinter mit zuzog.
Ich saß mit angewinkelten Beinen auf dem Fensterbrett der Küche und blickte auf die Straße und die Kirche, deren Turm langsam in der Dunkelheit verschwand. Die Striche im Mörtel der Wand waren das erste Zeichen meiner Anwesenheit in diesem Haus, in diesem Land gewesen. Zwanzig Jahre waren seit unserer Auswanderung vergangen, waren vorbeigezogen, ohne dass ich ein einziges Mal den Mut besessen hatte, das Land meiner frühen Kindheit zu besuchen. Mutter hatte mit Siebenbürgen abgeschlossen. Sie wurde nicht müde, dies zu beteuern, und so fuhr Vater alle zwei Jahre für mehrere Wochen allein nach Michelsberg. Als kleines Mädchen blieb ich mit Mutter in Deutschland zurück, und dies wurde, als könne es nicht anders sein, zur Gewohnheit.
Agneta war nicht ausgewandert, ihr Haus war die letzte Heimstätte in Siebenbürgen, die unserer Familie geblieben war. Mein Elternhaus in Hermannstadt war längst verkauft. Frieda und Wolfgang, meine Großeltern mütterlicherseits, waren kurz nach uns ausgereist. Gegenwärtig wollte sich Mutter nicht auf diese lange Reise begeben, da Großvater nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus lag. Es war ihr nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Und doch meinte ich, auch eine Spur Erleichterung wahrgenommen zu haben.
Das Haus meiner Großmutter war mir immer noch vertraut. Zimmer, Garten und Kirschbaum so, wie ich sie in Erinnerung hatte, und doch hatten die Jahre eine Trennung vollzogen, die mir jetzt schmerzlich bewusst wurde. Meine Weigerung, hierher zu kommen, schien mir mit einem Mal töricht und dumm. Wie oft hatte Vater versucht, mir eine Tür in die Vergangenheit zu öffnen. Manchmal waren es Gedichte gewesen, die er mir auf den Schreibtisch legte, ein anderes Mal Bildbände oder Fotos, die er auf seinen Reisen gemacht hatte. Vielleicht hatte ihn meine ständige Zurückweisung gekränkt, doch diese stillen Zeichen hatten bis zum heutigen Tag nicht aufgehört.
Einzelne Rufe und Pfiffe hallten über den Marktplatz. Ich ging hinaus, um den Geräuschen näher zu sein. Das Gefühl der Einsamkeit verlor sich, als ich das Tor hinter mir zuzog. In den Fenstern war Licht, die Hoftore standen offen, viele Einwohner saßen auf den Bänken vor ihren Häusern. Auch Kinder waren noch draußen. In verschwörerischen Gruppen saßen sie auf den Trottoirs oder am Ufer, tauchten an zugänglichen Stellen ihre Füße in den Bach. Aus Hinterhöfen klang Musik, Gesprächsfetzen wehten über die Straße, und die vom Tag aufgeheizte Luft war durchsetzt von einer milden Kühle. Ich fühlte mich in diesen Geräuschen, in diesem klingenden, gebändigten Tumult aufgehoben. Ich konnte mich zwischen den schwatzenden Gruppen und spielenden Kindern bewegen, als wäre ich unsichtbar. Nur manchmal sah ich jemanden auf mich deuten und hörte die geflüsterte Frage, ob das nicht Agnetas Enkeltochter sei.
Ich folgte dem Lauf des Silberbachs, der das Dorf der Länge nach teilte. Eine Mondsichel trieb schwerelos auf der spiegelnden Wasseroberfläche. Abrupt blieb ich stehen, als ich auf dem Weg ein tiefes Loch entdeckte, in das jemand zur Warnung einen Ast hinein gesteckt hatte. Die Straßen dieses Landstrichs waren so belassen worden, wie sie einmal gebaut wurden. Wenn jemand Teer übrig hatte, mochte es sein, dass er ein Loch auf dem Gehweg oder der Straße damit zugoss, aber meist fühlte sich niemand für den Erhalt der Straßen verantwortlich. Die Fahrt auf der Landstraße von Arad über Deva Richtung Hermannstadt würde ich nicht so schnell vergessen. Kühn und abenteuerlich waren die Autofahrer auf den vernachlässigten Straßen unterwegs. Vater schien sich den Gepflogenheiten anzupassen und überholte die Lastwagenkolonnen auf der zweispurigen Fahrbahn so waghalsig, dass ich begann, mir die Chancen auszurechnen, das Land, in dem ich geboren war, auch wieder zu verlassen.
Als ich auf einer Brücke über dem Silberbach Halt machte, hatte Julian mich angesprochen. Ich hatte ihn schon bemerkt, als ich vor Agnetas Haus die Straßenseite gewechselt hatte. Er löste sich aus einer Gruppe, die unter den Linden des Marktplatzes stand, folgte mir in einigem Abstand, blieb stehen, wenn ich etwas betrachtete und kam nach, wenn ich weiterging. Ich war überrascht, dass ich keine Angst hatte. Ich fühlte mich geborgen in der Geschäftigkeit des abendlichen Dorfes und beschloss, abzuwarten, bis er auf mich zukam. Er lehnte sich in einigem Abstand ans Geländer und rauchte eine Zigarette. Verstohlen betrachtete ich sein Profil: die schmale Nase, dichten Augenbrauen und langen Haare. Er kam mir bekannt vor, doch ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein Blick wanderte zu dem Strommast, der am Ende der Brücke in die Höhe ragte, und weiter die Dorfstraße hinab, entlang der Straßenlaternen, bis zu den umliegenden Hügeln und Obstfeldern.
„Du bist Sine“, sagte er, und seine Stimme färbte jene sachte, siebenbürgische Melodie.
Er fragte, ob ich mich an ihn erinnern könne.
Ich schüttelte zögernd den Kopf.
„Wir waren Nachbarn“, sagte er und sah mich abwartend an. „Weißt du noch, als wir mit Hilfe eines Holzkreuzes die Mauer von Agnetas Garten hochgeklettert sind und Dorfbewohner mit Sand beworfen haben?“
Er ließ die Zigarette auf den Boden fallen, drückte sie mit der Schuhspitze aus und lachte. Erstaunt sah ich ihn an. Ich erinnerte mich mit einem Mal genau: Während ein Fußgänger mit hochrotem Kopf auf die Haustür zugeeilt war, waren wir schnell von der Mauer gesprungen und hatten uns im Geräteschuppen versteckt. Der Geruch von feuchter Erde und Sand, von rostigem Eisen und vergorenen Trauben begleitete meine Erinnerung. Das Gefühl einer Hand tauchte in ihr auf, einer Kinderhand, die hinter einigen ausrangierten Weinfässern meine fest drückte.
‚Copii, copii şi haine rupte‘, war die Reaktion von Agneta gewesen, die uns einige Zeit später im Schuppen entdeckt hatte. Mit gesenkten Köpfen folgten wir ihr zur Eingangstür. Schuldbewusst warteten wir unter dem Vordach auf unsere Strafe. Der Fußgänger hob drohend die Hand, doch Agneta legte beschützend die Hände auf unsere Köpfe. Mein Spielgefährte hatte die Gelegenheit genutzt und war mit schnellen Schritten hinaus auf die Gasse gerannt.
„Julian“, sagte ich wiedererkennend.
Die Basilika
„Das Wasser kocht“, übertönte die Stimme von Frau Piringer das Brodeln des Teekessels.
Ich setzte mich auf den Sessel unter dem Fenster, das zum Korridor zeigte, und wartete, bis der Tee gezogen hatte. Vater war zu Pfarrer Roth gegangen, um die Einzelheiten der Beerdigung zu besprechen. Er hatte bereits von Deutschland aus veranlasst, Agneta in ein Bestattungshaus zu überführen. Großmutter hatte für ihren Tod ein Sparbuch angelegt, und so blieb es an ihm, die Behördengänge und den Schriftverkehr zu erledigen.
Wir hatten gemeinsam zu Mittag gegessen. Ganz in die Vorbereitungen für Agnetas Begräbnis versunken, hatte Vater nur kurz von seinem Teller aufgesehen, als ich ihm von Julian erzählte.
„Julian Eminescu…“, sagte er nachdenklich. „Seine Eltern wohnten damals in der Konradgasse. Die Mutter ist Deutsche, den rumänischen Nachnamen hat er von seinem Vater. – Ihr ward früher unzertrennlich. Wenn wir aus Hermannstadt zu Besuch kamen, führte dich dein erster Gang zum Kirschbaum, dann hast du die Tür zum Schuppen und zum Maisschober geöffnet und bist danach schnurstracks zu den Eminescus gerannt. Es war gleich, ob es Sommer war oder Winter, ob es regnete oder stürmte: Wir konnten dich nicht davon abhalten, alles auf diese Weise zu begrüßen.“
Ich dachte lächelnd daran, dass ich gestern auf eben diesen Wegen den Garten erkundet hatte. Nur Julians Haus hatte ich nicht aufgesucht – er hatte mich gefunden.
„Eigentlich sollte dich der Name an etwas erinnern. Hatte ich dir nicht die Gedichte von Mihai Eminescu ans Herz gelegt?“
Wir wussten es beide: Seine Bemühungen hatten mir bislang die Geschichte und Kultur des Landes nicht nahebringen können. Mutter bestätigte mich in dieser Hinsicht. „Es ist vergangen, was vergangen ist“, sagte sie stets in solchen Momenten, „niemand wird es dir verargen, wenn du Mihai Eminescu nicht kennst.“
Frau Piringer, eine Nachbarin, deren Hilfe im Haushalt Vater angenommen hatte, räumte das Geschirr vom Mittagstisch und ließ es ins Spülbecken sinken. Sie hatte mürrisch dreinblickende Augen, ein spitzes Kinn und presste die Lippen so fest aufeinander, dass der Mund fast nicht auszumachen war. Rock und Bluse waren beide aus braunem Stoff, darüber trug sie eine gestreifte Schürze. Ihr graues Haar war zu einem Zopf geflochten und um einen Mittelpunkt sorgsam aufgerollt. Viele unsichtbare Spangen hielten das kleine, schneckenförmige Geflecht in seiner Form.
„Wer wird morgen alles zur Beerdigung kommen?“ fragte ich, um ein Gespräch bemüht.
„Was weiß denn ich. Frag lieber jemand anders.“
Ihre Antworten waren knapp gehalten und von der starken Färbung ihres Dialekts geprägt. Sie zog die Wörter in die Länge, und das ‚r‘ klang hart und rollend.
„Aus Deutschland werden nicht viele Verwandte anreisen können“, sagte ich unbeirrt. „Hatte meine Großmutter viele Freunde hier im Dorf?“
„Ja“, sagte sie einsilbig und tauchte ihre Hände ins Spülwasser.
„War sie denn… Ging es ihr in der letzten Zeit gut?“
Meine Frage blieb unbeantwortet. Frau Piringer fuhr unbeeindruckt mit dem Spülen fort und klapperte mit dem Geschirr. Ich unterließ einen weiteren Anlauf, mit ihr ins Gespräch zu kommen, und sah aus dem Fenster. Hinter den Rebstöcken erhob sich der Kirschbaum mit ausladenden, knorrigen Ästen. Zwei zerfranste Seile hingen an einem besonders dicken Ast, reglos in der Windstille des Mittags. Vor vielen Jahren war eine Schaukel daran befestigt gewesen. Hatte nicht ein kleines Mädchen darin gesessen, sich im Kreis gedreht statt zu schaukeln, den Kopf so weit nach hinten gebeugt, dass Äste und Himmel ineinander übergingen? Und war nicht eine alte Frau dazugetreten, um die verdrehten Seile wieder aufzuwickeln?
Zwanzig Jahre waren vergangen, ohne dass ich Agneta in diesem Garten wiedergesehen hatte. Manches ist einem so selbstverständlich, als gehörte es auf alle Zeit dorthin, wo wir es lieben gelernt hatten. Als wäre es nicht vergänglich. Doch vielleicht waren wir zum letzten Mal Gäste dieses Hauses, und wenn wir die Türen am Ende unserer Reise schlossen, würden fremde Menschen einziehen. Vermutlich würden sie die alte Kirsche fällen und auf dem Acker bei den Quittenbäumen einen Neubau errichten. Oder das Haus bliebe sich selbst überlassen. Staub würde alles zudecken, Zimmerböden und Möbel. Fenster würden zersplittern und Türen aus den Angeln brechen. Dann würde der Wind den Regen ins Haus peitschen, die Holzbalken würden zerfallen, und das Laub der Bäume würde zuletzt alles zudecken.
Ich stand auf und öffnete das Fenster, um mir alles genau einzuprägen.
Nach einer Weile ließ Frau Piringer das Wasser ablaufen, wrang den Spüllappen aus und ging mit schnellen Schritten aus der Küche. Am Türabsatz drehte sie sich dienstfertig um: „Der Tee ist lange fertig.“
Am Nachmittag, zur vereinbarten Stunde, wartete ich auf dem Marktplatz. Der Boden war trocken und staubig, da es lange nicht geregnet hatte. An den Wegseiten wuchs Gras, an vielen Stellen von abgetretenen Pfaden durchsetzt. Die Fensterläden der Häuser standen inzwischen offen, die Anstriche der renovierten Fassaden leuchteten im satten Nachmittagslicht. Giebel- und Fensterschmuck verzierte die Bauernhäuser, Mauern wechselten sich mit Holzzäunen ab, Wohnhäuser mit Scheunen und Torbögen mit Eisentoren – ohne Lücke schloss eins ans andere an und schuf das eigentümliche, behagliche und ein wenig trotzige Straßenbild siebenbürgischer Dörfer.
Ich setzte mich auf eine Bank. Von diesem ausladenden Platz gingen die Straßen nach Heltau und Hermannstadt ab. Zwei überdachte Trinkwasserbrunnen standen einander gegenüber. Der Silberbach begleitete die Hauptstraße stromaufwärts. Einst war der Reichtum Michelsbergs das Silber, das aus dem Bach gewaschen wurde. An der ausgespülten Böschung, wo die Ufer noch nicht mit Betonmauern befestigt waren, konnte man erahnen, dass er mit eintretender Schneeschmelze viel Wasser mit sich führte. Augenblicklich glich er eher einem dünnen Faden, der sich durchs Dorf schlängelte.
Julian kam auf mich zu. Wir begrüßten uns mit einem Kuss auf beide Wangen, dann ließ er seinen Rucksack auf die Bank gleiten und ging in das Wirtshaus direkt vor der Anhöhe der Burg. Ich hörte die Holztür aufgehen und wenige Augenblicke später wieder zufallen, dann übergab mir Julian einen schweren, gusseisernen Schlüssel.
Wir gingen den leicht ansteigenden, von wilder Kamille und Gras eingefassten Weg hinauf. Ich blieb stehen und schloss die Augen. Die Weichheit des Bodens weckte ein unbestimmtes Gefühl. Ich ging in die Hocke, zupfte einen Kamillenstängel und drehte ihn zwischen den Fingern. Die gelben Blütenköpfe verbreiteten einen feinen, aromatischen Duft. Ich hatte den Eindruck, als würde Julian etwas sagen wollen, doch er drehte sich um und setzte seinen Weg fort.
Unweit des Waldes stand die Ruine eines Hauses. Durch Sprossenfenster, in denen das Glas geborsten war, konnte man geradewegs ins Unterholz sehen. An den Seiten ragten verloren Holzbalken auf, als würden sie zu den Baumstämmen gehören. Auf der einzig erhaltenen Wand, der Front, war ein Spruch in sächsischer Mundart aufgemalt: „Ech bän e Sachs. Des Stuw äs meng. Aser Härrgott mege Wächter sen!“ – Ich bin ein Sachse. Diese Stube ist mein. Unser Herrgott möge der Wächter sein.
Es war das Haus der Burgwächterin gewesen, die den Schlüssel zur Ringmauer der Basilika verwahrte. Ich hatte in Vaters Heimatkalender, der in seinem Atelier hing, ein Bild davon gesehen. Vor dem hellgelben Haus mit dem Rosenbusch saß eine Frau in siebenbürgischer Tracht. Sie hatte die Hände locker in den Schoß gelegt, die Handinnenflächen leicht geöffnet – eine Geste alter Menschen, die zeitlebens gearbeitet hatten. Hinter ihr, die Ellenbogen auf der Bank, stand ein blonder Junge. Geflochtene Weidenäste umzäunten den Garten. Von der Hauswand bröckelte der Putz. In den Fenstern hingen, halb zugezogen, karierte Vorhänge. Wie schnell alles verfallen war. In zwei Jahrzehnten hatte sich der Wald ins Haus gestohlen.
Augenblicklich umschloss uns die Kühle des Eichenwaldes. In den ansteigenden Pfad, der zunächst so breit war, dass wir ihn nebeneinander gehen konnten, waren Bretter als Treppenstufen eingelassen. Nachdem wir ein Viertel des Weges hinter uns gebracht hatten, fragte Julian nach der ersten Stadt, in die wir nach der Auswanderung gezogen waren.
„Von Hermannstadt aus ging es zunächst, wie für viele Auswanderer, nach Nürnberg“, sagte ich, und dachte dabei an die Holztruhen, in denen meine Eltern unseren Hausstand nach Deutschland verschickt hatten. Ein Bruchstück dieser Truhen lehnte, wie ein angeschwemmtes Stück Holz, noch heute in unserem Flur. Darunter vermerkt, die Adresse unserer ersten Bestimmung: Nürnberg, R. F. Germania.
Julian bat mich, mehr zu erzählen.
„In Nürnberg blieben wir nur kurze Zeit. Wir sind danach noch einige Male umgezogen.“
Ich hoffte, Julian würde bemerken, dass ich nicht darüber sprechen mochte. Ich hatte mich am Anfang nirgends wohlgefühlt. Nicht in Nürnberg oder in unserem zweiten Übergangswohnheim, in dem wir ein Jahr blieben, und auch nicht in unserer ersten Wohnung am Stadtrand. Erst in meiner Studentenstadt, mit ihren engen Gässchen und dem Fluss mit seiner Uferpromenade, hatte sich ein Gefühl des Zuhause-Seins eingestellt, doch nun hatte ich sie vor vier Monaten verlassen, da mein Studium zu Ende war. Ich wohnte übergangsweise wieder bei meinen Eltern, bis ich wusste, welchen Berufsweg ich einschlagen wollte.
Wir gingen schweigend weiter, unter unseren Füßen knackten heruntergefallene Äste. Die Stille dehnte sich zwischen uns. Sie tat es zuerst unmerklich, dann wurde sie stärker. Sie war schon lange bei mir. Auf der Schwelle in ein künftiges Berufsleben trat sie ein, verbarg sich hinter Gratulationen und Glückwünschen, nun stehe uns Absolventen alles offen. Nichts war in diese Offenheit eingezeichnet, keine Richtung, nur diese Stille. Wochen hatte ich wie gelähmt in meinem Zimmer verbracht, unfähig, einen Gedanken, außerstande, einen Plan zu fassen. Als gäbe es keine beständig rauschende Welt, die einen zum Handeln ermahnt. Als könne man der Angst mit Gleichgültigkeit beikommen.
Das Knattern eines Motorrads stieg aus dem Dorf herauf und übertönte unsere Schritte.
„Das letzte Bild auf Agnetas Blauer Kommode zeigt euch beide im Türrahmen einer Wohnung. Du trägst deine Haare länger als jetzt. Agneta legt einen Arm um deine Schultern, in der anderen hält sie einen Schirm“, hörte ich Julians Stimme.
Ich nickte, ohne ihn anzusehen.
Vater hatte das Bild während Agnetas letzten Besuchs vor vier Jahren gemacht. Am Tag ihrer Abreise. Das Gepäck stand schon bereit, versteckt hinter der offenen Türe, nur wenn man genau hinsah, konnte man den Handlauf des Koffers sehen. Agneta kam in regelmäßigen Abständen nach Deutschland, blieb für zwei, drei Wochen – länger, so sagte sie, konnte sie ihren Garten nicht in fremde Obhut geben. Sie bezog unser Gästezimmer, übernahm das Kochen, und fügte sich wie selbstverständlich in unser Familienleben ein.
Ich hatte das Bild gestern lange betrachtet. Agneta lächelte, nur die hellblauen Augen verrieten ihren Abschiedsschmerz. Ein Arm umfasste meine Schultern, der andere war angewinkelt, ein roter Regenschirm hing darin wie eine Handtasche. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wie ich mich an jenem Tag gefühlt oder was ich gedacht hatte. Und auch nach diesem Bild lag so vieles im Dunkeln. Ich hatte Abstand von Agneta genommen, unmerklich aber stetig, ohne bewusste Entscheidung. Eine törichte und doch brennende Frage war beim Anblick des Bildes aufgetaucht: Wieso wusste man nicht, dass man einem Menschen zum letzten Mal begegnete?
Julian räusperte sich, es war offensichtlich, dass er mich beobachtete. „Wenn man die Bilder auf der Kommode der Reihe nach ansieht, fällt auf, dass Agneta sich in den letzten Jahren kaum verändert hat. Die Haare deiner Eltern werden grau, du bist in jedem Rahmen anders, nur sie nicht. Als habe sie irgendwann aufgehört, zu altern…“
„Wie kommt es, dass ihr einander so gut kanntet?“ Meine Stimme klang laut und fremd, als spräche jemand anderes.
„Was heißt schon kennen“, sagte Julian überrascht. Der vorwurfsvolle Ton meiner Frage war ihm nicht entgangen. „Wenn sie Hilfe im Garten brauchte, bat sie mich darum. Sie lieh mir Bücher und manchmal lud sie mich zum Essen zu sich herein. Und weißt du“, er stockte, „irgendwie ist es auch so, dass eine Verbindung über dich da war. Sie erzählte oft von dir.“
„Dann muss ich ja einiges nachholen“, sagte ich leichthin und versuchte mein Unbehagen zu verbergen, „sonst hast du einen Wissensvorsprung, den ich nicht aufholen kann.“
„Nein, so meine ich das nicht. Ich weiß nicht viel darüber, wie es dir in den letzten Jahren gegangen ist. Sie sprach gern über die Ferien, die du als Kind in Michelsberg verbracht hast. Über die Streiche, die wir ausgeheckt haben, und den Ärger, den sie von uns abwenden musste.“
Nun sah er geradeaus, zog das Tempo an, als wolle er einen Gedanken hinter sich lassen. Der Wald lichtete sich, durch die Bäume blitzten die rötlichen Ziegeldächer des Dorfes hervor.
„Wie alt ist die Burg?“, fragte ich, als, einige Zeit später, die Ringmauer zwischen den Baumkronen sichtbar wurde.
Julian erzählte, dass die Basilika in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut wurde. Nachdem sie später im Besitz des Zisterzienserordens gewesen sei, diente sie, wie alle Wehrkirchen, als Befestigungsanlage für die Dorfbewohner.
Als ich fragte, woher er alles wisse, fiel seine Antwort schlicht aus: Er sei hier geboren und noch nie woanders gewesen, wie solle er das nicht wissen.
„Weil meist das anziehender ist, was weit weg ist, und selten das, was vor uns liegt“, antwortete ich und zerpflückte nachdenklich ein Baumblatt mit den Fingern.
„Was ist das für eine Logik?“, fragte er skeptisch und blieb stehen.
„Es ist durchaus logisch“, antwortete ich, verwirrt angesichts seines energischen Widerspruchs. „Es ist reizvoll, weil es weit weg ist, und in der Vorstellung nicht mit Alltäglichem belastet wird.“
„Was liegt näher, als dem Beachtung zu schenken, was vor einem liegt. – Wieso träumen die Menschen immer von besseren Orten?“
Ich fragte mich, welche wunde Seite dieses Thema in ihm berührt haben mochte. Manchmal glaubte ich, eine versteckte Ungeduld an ihm zu bemerken. Ob er zufrieden war? Julian hatte mir auf den Feldern erzählt, dass er mit seiner Mutter zusammenlebte. Sie bewirtschafteten einen Hof, der kaum genügend abwarf, dass es zum Leben reichte. Sein Vater hatte die Familie verlassen. Seine jüngere Schwester lebte bei einer Tante in Mediasch und besuchte eine Hauswirtschaftsschule. Julian träumte davon, eines Tages Geschichte studieren zu können. Mehr wusste ich bislang nicht. Ich hatte eine gewisse Scheu, ihn auszufragen. Im Augenblick war mir das Gefühl lieber, ihn auf eine andere Art zu kennen. Eine vertrautere, stillere, die sich an die Zeit knüpfte, die wir als Kinder zusammen verbracht hatten. All die Jahre, die dazwischen lagen, rührten an Fragen, über die ich jetzt nicht sprechen mochte.
Wir erreichten die Wehrmauer. Das Holztor, eingefasst in einen steinernen Bogen, war mit einer Kette an einem Ring in der Mauer befestigt. Julian nahm den Schlüssel, und nach einigen Versuchen ließ die Kette sich öffnen. Im Burghof sah ich, dass die Mauer an dieser Stelle erhöht und von zwei Fenstereinlassungen durchbrochen war. Ich streifte die Schuhe ab und nahm sie in die Hand. Der Boden war weich, an einigen Stellen von Moos durchwirkt. Der Wind schüttete eine tonlose, klare Luft über dem Burgberg aus.
Die zweigeschossige Kirche wirkte schlicht und anziehend. Sie war aus Sandstein und hatte ein leuchtend orange-rotes Dach. Das Hauptportal war mit Eisenbeschlägen verziert, die auf den eichenen Türflügeln wie horizontale Bänder aussahen. Das Portal war auf jeder Seite von vier Säulen flankiert, als Halbkreis wölbten sich sieben Vorsprünge über der Tür. Die Vier war die Zahl der Himmelsrichtungen, der Elemente und der menschlichen Temperamente. Die Sieben die Zahl der Schöpfungstage, der Vollendung, der Tugenden und Todsünden. Julian blieb an den Treppen des Portals zurück. Ich ging weiter in den hinteren Teil der Befestigung, wo ein Brunnen lag, setzte mich an seinen Rand und hob das Gesicht in den wolkenlosen Septemberhimmel.
Die niedrige Wehrmauer gab den Blick frei auf die Kirschbaumfelder bis weit ins transsilvanische Hügelland hinein. Einzelne, dunkle Tannen durchbrachen das helle Grün der Berge. Seitlich ragte der Bergrücken des Hendrich auf. In seinem Schatten wohnte bereits die Frische der kürzer werdenden Herbsttage.
Die Nachricht von Agnetas Tod hatte uns Anfang der Woche überrascht.
„Johann“, hatte Mutter laut ins Obergeschoss unseres Hauses gerufen, und etwas Raues belegte dabei ihre Stimme. „Johann, Telefon für dich.“ Wenig später, ich saß auf der Terrasse und las, ging Vater an mir vorbei, als wäre ich nicht da, und lehnte sich an die Brüstung. Minutenlang sah ich nur seine Hände, wie sie sich an dem Geländer festhielten, sah, dass er gerade gemalt hatte, ein Backsteinrot und ein Buttergelb hatten sich auf seinen Handrücken verteilt. Minutenlang sah ich diese fleckigen Hände, sah das halblange Haar, die schmalen, runden Schultern, die ab und zu wie unter einer Last zuckten, und wusste nicht, ob ich das Wort an ihn richten sollte.
Mutter kam schließlich durch die Terrassentür, sah mich mit großen Augen an, ging zu Vater und legte die Arme um seine Schultern.
Agneta war tot. Ich wusste es, noch bevor sich beide zu mir umdrehten. Ein Gefühl der Leere breitete sich in mir aus. In unserem Wohnzimmer zeigte ein Foto Agneta mit roten Herbstastern, und wenn ich versuchte, sie mir in diesen Tagen vorzustellen, rückten all unsere gemeinsamen Erlebnisse fort, ich sah sie in ihrem Garten, als wäre sie dort für alle Zeit gebannt, mit offenem Haar, lächelnd, einen Strauß voller roter Astern über die Armbeuge gelegt.
Heute kam es mir vor, als wäre all dies mehr als ein Abschied von ihr. Ich sah über die Hügel, über die angrenzenden Dörfer und den hellen, gewellten Karpatenbogen, spürte die Sonne auf meinem Gesicht, die Grashalme an den Fußsohlen und wusste, dass ich dies alles vermisst und mir dieses Gefühl doch nie eingestanden hatte. Ich warf die Schuhe ins Gras. War es meine Schuld gewesen? Hatte ich beschlossen, alles zurückzulassen? Ich war an die Entscheidungen meiner Eltern gebunden, hatte mich an unser neues Leben gewöhnt, und war sogar, abgesehen von den vergangenen Monaten, recht glücklich gewesen. Meine Wurzeln in einem fremden Land hatte ich immer weniger gespürt. Wieso fühlte sich plötzlich alles anders an?
Ich hob die Schuhe auf und ging an der Wehrmauer entlang. Nach einigen Schritten entdeckte ich mehrere zentnerschwere, runde Steine, die über den Hof der Kirchenburg verstreut waren. Wie Planeten umkreisten sie das ovale Rund der Mauer. Ich sah einen besonders großen Stein, in den ein Kreuz und eine verwitterte Jahreszahl eingemeißelt waren, und ging in die Hocke, um ihn mir genauer anzusehen. Moos umschloss das Kreuz wie ein in die Jahre gekommenes Siegel. Die kleineren Steine schienen sich um ihn versammelt zu haben. Ich blinzelte ein paar Mal, da das Kreuz anfing, vor meinen Augen zu verschwimmen.