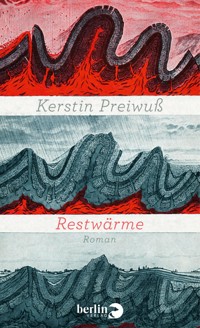19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, über etwas, das mich betrifft, so sprechen zu können, als ginge es alle etwas an«, erklärt das Ich dieses Textes, »weil ich schon lange in der Welt lebe, in die jetzt alle geraten sind. Ich bin ruhig in diesem Ausnahmezustand. Ich bin beisammen.« Kerstin Preiwuß, vielfach ausgezeichnete Autorin von Romanen, Gedichten und Essays, legt einen wichtigen Text vor, der Selbstvergewisserung und Sprachkraft auf eindrucksvolle Weise zusammenführt und ein Zeitempfinden in den Blick nimmt, das unsere Gegenwart bestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Von vorn betrachtet …
Beinahe hätte uns …
Habe ich je …
Angst zum Beispiel.
Das denke ich …
Ist es das, …
Ich erfuhr von …
Die Angst kommt …
Ich bin wohl …
Die Angst kommt …
Daher rührt also …
Mit der Zeit …
Ich bin danach …
Am Ende kürzt …
Eben lasse ich …
Zeit heilt alle …
Dieser Zwang, immer …
Schon immer kam …
Man muss wissen, …
Sehr vieles geschieht …
Die Störche sind …
Jetzt ziehen wir …
Liebe Kinder,
Liebe Emily,
Liebe Simone,
Lieber M.,
Briefe schreibe ich …
Ich dachte, es genügte …
Ich begann …
Früher wird zu …
Petition der Kunst
Anfangs war ich …
Als sich vor …
Es gibt Tage …
Noch jede Katastrophe …
Es sind nicht die Nebeneffekte.
Sagen wir …
Ich will auf …
Jetzt fängst du …
Plötzlich haben es …
Begreifen lässt sich …
Bis eben war …
Dieses Rumgeeiere bisher …
So geht das …
Die Angst sprang …
Die Angst nahm …
Jetzt starrst du …
Ich verstehe meine …
Dein Koffer wartet …
Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Von vorn betrachtet erscheint es beliebig.
Immer ist der Anfang notgedrungen, und ist er einmal gesetzt, wirkt er bereits überholt.
Aber die Enden lösen einander nur ab, und so gesehen ist jedes Ende der Abbruch von etwas, das einmal seinen Anfang genommen hat.
Etwas anderes rückt in der Aufmerksamkeit nach vorn.
Jedes Kind unterbricht den Gedankengang seiner Mutter.
Mein Anlass, das hier auszubreiten, ist längst vorbei.
Ich habe das alles schon so oft gedacht, was fehlt, ist die Erinnerung.
Beinahe hätte uns der Bus erwischt, hättest du die Panik in meiner Stimme nicht gehört, aber du hast die Panik in meiner Stimme gehört; beinahe hätten wir den Bus nicht bemerkt, als wir mit Skates über den für den Autoverkehr erstmals gesperrten Ring liefen. Aber die Öffentlichen fuhren weiterhin, und die Ampeln blieben im Takt, nur wir waren nicht in der Frequenz, wir waren zu langsam dafür, und ich sah aus den Augenwinkeln, wie der Bus kam, und schrie nach dir. Meine Stimme muss ein anderes Timbre gehabt haben, was wäre, wenn du jetzt weiterliefst, du warst ein paar Meter vor mir. Das verdoppelt die Wahrnehmung, in diesem Moment sah ich uns zu und lief etwas vor mir ab, an dem ich nicht mehr ganz beteiligt war. Das bleibt auch in der Erinnerung so, selbst nachdem es gut gegangen ist, bleibe ich Zuschauer.
Du hast mich gehört und eine scharfe Kurve nach rechts eingeschlagen. Wir kamen zum Stehen und warteten gerade so den Bus ab, der viel zu dicht an uns vorbeischoss. Beinahe wäre es kein Warten mehr gewesen.
Wie viele Beinahe-Unfälle kann es in einem Leben geben? Wie viel ist gerade noch mal gut gegangen, was bedeutet gerade im Vergleich zu beinahe? Bei und nahe wirken wie verklumpt, hängen aneinander fest, sind unauflösbar und unaufhörlich miteinander verbunden. Der Raum wird gerichtet, etwas rückt sehr dicht an uns heran, aber es geschieht uns nichts, immer kommen wir gerade so davon. Dagegen der Unfall, der nicht gestoppt werden kann, sondern eintritt, und sich vor unseren Augen abspielt. Dann ist es nicht mehr die Situation, vor der man immer warnt. Die wenigsten Unfälle bekommt man zu Gesicht, meist sieht man nur, was sich ereignet hat, oder erhält Nachricht davon.
Habe ich je erzählt von dem Vorfall in der Provence, als ich mich einmal zum Trampen entschloss, weil das letzte Stück zwischen Orange und dem Ferienhaus, in dem ich erwartet wurde, nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar war; habe ich erzählt, wie ich in Orange aus dem Bus stieg und anfing, die Straße entlangzuwandern, eine junge Frau mit Rucksack; habe ich je erzählt, wie das Auto hielt und mich ein älterer Mann zum Einsteigen einlud, ohne mich nach meinem Weg gefragt zu haben, wie er also nur anhielt, um mir zu sagen, steig ein, ich nehm dich mit, und ich mir nichts dachte, nur dass der Rucksack schwer war und der Weg nicht ganz klar; habe ich das je erzählt, wie ich vorn neben ihm einstieg und ihm sagte, wo ich hinwollte, und es nicht lange brauchte, wahrscheinlich nur Minuten, bis ich bemerkte, dass ich plötzlich wusste, wo es nicht langging, denn ich musste die Frage stellen, die unvermeidbar wurde: Wohin fahren wir? Habe ich das schon erzählt, wie er darauf nicht antwortete und mich zwang, meine Frage zu wiederholen, lauter im Ton, denn um die Panik zu unterdrücken, gab ich mir eine laute Stimme, und er mir dann ausweichend antwortete, dass wir in den Wald fahren würden, woraufhin ich weiter fragte, wofür, als wäre das nicht klar, dieser Dialog, der zu etwas führt, was man vermeiden möchte, was so nicht eintreten soll, es gibt Wortgruppen für diesen wahr gewordenen Albtraum. Aber er antwortete nur, ich solle dort nachsehen, ob noch alles natürlich wäre, ob noch alles funktionierte an ihm, und das habe ich sicher nicht erzählt, aber ich weiß es bis heute, wie ich ab dann alles überdeutlich sah und dachte und in dieser Situation die zwei Möglichkeiten abglich, es mitzumachen und zu ertragen, oder die Tür bei laufender Fahrt zu öffnen und mich rauszuwerfen. Ich wurde kühl im Innern, ich war ganz bei mir und handlungsfähig, ich würde handeln, wusste ich in diesem Moment, nur noch nicht, wie. Man könnte sich abrollen, auch war das Auto zu alt für eine automatische Verriegelung, das Auto war so alt wie der Mann, der mich nicht überwältigen würde, eher dass ich ihm irgendwohin trat und entkam, also, und das würde ich immer so wiedergeben, schrie ich, ich brüllte ihn an, in exaktem Französisch, noch nie ging mir das so flüssig über die Lippen, das schwöre ich, dass ich absolut nicht interessiert sei und er mich sofort rauslassen solle, ich schrie, und es bewirkte, dass er anhielt, da waren wir schon von der Straße abgebogen und auf einem schmaleren Weg am Rande des Wäldchens. Er hielt an, und sofort öffnete ich die Tür und, daran erinnere ich mich übergenau, das muss ich jetzt mal sagen, stieg aus und öffnete noch die Hintertür, um meine Sachen rauszuholen, denn wenn ich hier entkam, dann vollständig, und vielleicht war es genau diese kleine Geste in ihrer Selbstverständlichkeit, man nimmt alles von sich mit, die verantwortlich dafür war, dass er mir nicht nachstellte, wie man altmodisch sagt, ich nahm also auch mich wieder mit, würdigte ihn dabei keines Blickes, wie man so sagt, ich weiß also auch nicht mehr, wie er aussah, nur dass er alt war, vielleicht sechzig, und offensichtlich bei Gegenwehr die Lust verlor. Ich konzentrierte mich nur auf mich und entkam, ich schlug die Tür zu und er muss abgefahren sein, wie, weiß ich nicht, ab hier wird die Erinnerung undeutlich, sie wird sowieso eher von der Selbstbeobachtung dominiert, als wäre ich mein Kommentar, um zu beweisen, dass mir nichts geschehen war in einer Situation, die darauf angelegt war. Ich weiß noch, ich hatte mir sämtliche Wege und Abzweigungen eingeprägt und vollzog sie ab dem Moment, wo ich allein war, rückwärts wieder nach, so fand ich von den Nebenwegen wieder auf die Landstraße zurück und setzte meinen Weg einfach fort, und was soll ich sagen, das nächste Auto hielt an, es war ein jüngerer Mann, und er sprach so wie ich Französisch mit Akzent. Er sagte, los steig ein, ich nehm dich mit, und ich blieb stehen und sagte sehr laut und entschieden Nein, und wissen Sie, warum, holte ich aus und erzählte ihm alles, was mir eben widerfahren war. Er hörte es sich an und sagte nur, bist du blöd, ich mach so was nicht, ich hab Kinder, und das überzeugte mich, also stieg ich ein. Er fragte, wohin, ich nannte die Adresse, er drehte um und fuhr zurück ins Dorf bis zur Kneipe, dort gingen wir hinein, und er sprach mit dem Wirt, während ich wartete, bis auch der Wirt mit rauskam, in sein Auto stieg und wir ihm folgten und ich am Ende mit zwei Autos, quasi eskortiert, ankam. Weit war es nicht, vielleicht zehn Minuten, bis wir beim Ferienhaus waren, wo ich erwartet wurde, man freute sich außerordentlich, wunderte sich nur, warum ich so bleich war, fragte aber nicht nach, denn mein Vater war kurz zuvor gestorben.
So habe ich das noch nie erzählt, sondern immer nur abgekürzt und zusammengefasst, was geschehen kann, womit ich hätte rechnen müssen. Die klassische Situation, die man nicht wahrhaben möchte, aber die dann folgt, das glückliche Entrinnen, die wundersame Begebenheit danach, was wäre das, würde ich es erzählen, was würde daraus, wenn nicht eine unglaubwürdige Geschichte. Ich habe das also noch nie erzählt, schloss ich meine Erzählung gegenüber meiner Freundin ab, als wir in Orange den Kreisverkehr passierten, den ich wiedererkannte, weil ich damals hier mit dem Bus vorbeigekommen war, es war im Prinzip vorhersehbar gewesen.
Warum war mir das nur nicht klar, was ist die Zeit nur für eine Verzögerin, die immer für diese bestimmten Momente ihr Band abspielt, als würde man ständig auf der Owl Creek Bridge stehen, die ganze kurze Zeitspanne lang wird die Zeit mit Hoffnung überdehnt, aber Hoffnung findet nicht statt, Hoffnung ist nur der Wunsch, der nicht eintreten kann. Und was heißt dann plötzlich und unerwartet, aus heiterem Himmel? War der Himmel heiter? Die New Yorker sagten, nach 9/11 ja, kaum zu ertragen, was für ein schöner blauer schneidend klarer Himmel das war, der den ganzen Herbst füllte, sie hätten sich Regen gewünscht und bekamen blauen Himmel bis Weihnachten, es war alles surreal.
Kann es sein, dass wir nicht nur an die Situationen gebunden sind, die sich ereignet haben, sondern auch an die, die sich hätten ereignen können? Was geschieht im Gegensatz dazu mit den Situationen, die sich ereignet haben, sind wir in ihnen enthalten, bleiben wir zurück? Wie kann es sein, dass man mit der Zeit geht, ohne dass die Zeit sich in einem vollzieht? Entgegen allen Befürchtungen schreibe ich aus der Vergangenheit, obwohl ich erst seit Kurzem wieder fähig bin, sie zu empfinden. Die Zeitspanne zwischen der Gegenwart des letzten Jahres und ihrer Vergangenheit ist bislang nur ein schmaler Spalt, eine gerade sich öffnende Tür. Ich bin noch frisch im Nicht-mehr-hier, zwar hat die Gegenwart mich nicht mehr ganz, aber sie sitzt mir immer noch im Genick, diese endlose Starre löst sich nur langsam auf. Aber der Reihe nach.
Ich schreibe aus einer Erfahrung heraus, die mich erstaunt. Sie lässt sich schnell in Worte fassen. Die Katastrophe erschreckt mich nicht. Was bedeutet das? Das muss bedeuten, ich bin abgehärtet. Das kann bedeuten, dass ich mich so weit zurückgezogen habe, dass mir nicht mehr viel etwas kann, und darum geht mich auch nicht mehr viel etwas an. Eine merkwürdige Deckungsgleichheit bestimmt die Tage, ich lebe, denke, schlafe mit ruhiger Hand und ordne meine Angelegenheiten. Ich scheine nichts mehr zu erwarten, denn keine Erwartung fühlt sich enttäuscht. Ich werde nicht ungeduldig, denn ich habe es schon vorher aufgegeben, Wünsche zu hegen. Jeden Tag erfüllt sich etwas Neues nicht, wird uns wieder etwas genommen, nur mir nicht, ich habe es vorher schon unterlassen, mich an etwas zu binden. Als hätte ich schiffbrüchig gelernt, von meinen Ausscheidungen zu leben, und triebe jetzt als Perpetuum mobile in einem Ozean voller Schiffbrüchiger. Das Schlimme ist nur, es fühlt sich nach nichts an. Und das viel Schlimmere ist, das Leben vorher fühlte sich auch nach nichts an.
Nicht mal mehr vor der Angst erschrecke ich, sondern betrachte interessiert, wie sie die Situationen dominiert, in denen sie aufkommt. Als würde ich zuschauen, wie ich mich verhalte. Es ist ein andauerndes Handeln, das keine vereinzelten Tatsachen kennt, als hätte man längst diesen endlosen Tag des Jüngsten Gerichts erreicht, als stromere man durch die Apokalypse und könne sie sogar bewerten. Die ganze Zeit ist eine Katastrophe und so in nichts auffällig oder unterscheidbar von den anderen Zeiten, in denen man das Paradies verorten könnte.
Wie kam es zu diesem Zustand, dass die Katastrophe auf mich nicht wirkt? In dem Moment, wo sich eigenes Unglück und allgemeine Katastrophe decken, ist das Unglück auf paradoxe Art nicht mehr privat, sondern wird mitteilbar, denn an der Katastrophe leiden alle. Kann sein, ich habe Kenntnisse erlangt, und es bietet sich gerade an, sie preiszugeben. Wer weiß, wozu das gut ist.
Ich hatte nie vor, über mich zu schreiben oder die Liste meines Unglücks, die ich in Gedanken zu jeder Tag- und Nachtzeit herunterbeten kann, der Welt zu offenbaren. Das Persönliche bleibt besser privat. Als wäre jede Erinnerung eine Zurschaustellung. Besser, man lässt es gar nicht erst dazu kommen. Aber auf merkwürdige Art und Weise ist das jetzt hinfällig geworden. Es hat lange gedauert, bis ich dahin kam, nichts mehr zu erwarten. Aber jetzt fahren wir alle auf Sichtweite, und es zeigt sich vieles, was sonst im Verborgenen gehalten wird. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, über etwas, das mich betrifft, so sprechen zu können, als ginge es alle etwas an. Weil ich schon lange in der Welt lebe, in die jetzt alle geraten sind. Ich bin ruhig in diesem Ausnahmezustand, mir ist alles, was ich fühle, bekannt. Ich bin beisammen.
Das muss bedeuten, meine Grenzen sind schon seit Langem verschoben, und immer, wenn sich etwas Beunruhigendes ereignet, erlebe ich es in den Ausmaßen einer Katastrophe. Die Spannung, in die ich dann gerate, ist stets die eines Menschen, der überleben will. Immer im Alarmzustand, alle Neuronen feuern, und das Gehirn zieht blank. Und nun fügt sich diese Spannung erstmals in den öffentlichen Rahmen ein, sie unterscheidet sich nicht mehr von der anderer und erlaubt mir, auf paradoxe Art zur Ruhe zu kommen. Die Katastrophe erlaubt mir, mich in ihren Grenzen einzuordnen. Was ich immer schon gefühlt habe, gilt jetzt für alle und überall gleich, das hebt mich aus der Isolation. Mein Mangel ist keiner mehr. Es hilft, wenig zu erwarten und aus dem Nichts zu leben. Was ich bis eben schmerzlich vermisste, kommt mir jetzt zugute. Meine Grenzen waren weit verschoben, jetzt können sie nicht weit genug sein für das, was die Gegenwart für uns bereithält. Ich fürchte, ich muss das erklären. Aber der Reihe nach.
Angst zum Beispiel. Damit fängt es an.
Die Angst kommt beim Autofahren.
Die Angst kommt mit den Kindern.
Die Angst kommt von der Krankheit.
Die Angst kommt von der Diagnose.
Die Angst kommt von meinem Cousin.
Die Angst kommt von meinem Stiefvater.
Die Angst kommt von meinem Vater.
Die Angst kommt von meiner Mutter.
Die Angst kommt von meiner Geburt.
Die Angst kommt von allein.
Das denke ich nicht mal, das ist so. Diese Liste, die ich abspulen kann, heißt Angst. Die Angst kommt von ganz allein. Eigentlich müsste es heißen, sie kommt allein, denn wenn sie auftritt, beherrscht sie die Szenerie. Sie steckt schon in der Erwartung. Wir sehen das Unglück kommen und fürchten uns davor, aber ist es erst einmal da, werden wir wieder handlungsfähig. Demnach ist Angst immer schon vorher da, aber auch nur dort mächtig.
Die Angst kommt beim Autofahren. In der Erwartung, einen Unfall zu bauen oder an einem beteiligt zu sein. In unnatürlicher Position zu liegen oder jemanden dorthin gestoßen zu haben, dass er reglos und verkrümmt auf dem Asphalt liegt oder halb unter dem Wagen. So habe ich es jedenfalls mal in Marseille gesehen. Oft habe ich davon geträumt, dass ich fahre und nicht mehr weiß, wie ich bremse. Oder dass die Bremse nicht mehr funktioniert. Also vermeide ich es, selbst zu fahren, und denke verzweifelt: Aber das kriegen doch alle hin. Schreie deswegen im Straßenverkehr die Kinder an, denn sie sind mein erweiterter Umriss.
Die Angst kommt also mit den Kindern. Vielleicht liegt es daran, dass ich das erste Kind verloren habe. Es ist ein Riss, der sich plötzlich auftut, wenn man dem Ultraschallbild folgt und die Ärztin erst freundlich Dann wollen wir mal sehen sagt, und dann länger braucht und nichts mehr sagt und man sich noch nichts denkt dabei, denn ich hatte diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber dann hält sie inne und formuliert Sätze. Es tue ihr leid, aber es sei kein Herzschlag mehr da. Die Sprachlosigkeit vor dem Ultraschallbild wiederholt sich noch ein paarmal, und immer sieht mein Kind vollkommen aus, ist alles da, schon so groß, sagt eine andere Ärztin. Die nächste sagt, Sie wollen doch auch nicht hier sein, bevor die Anästhesie wirkt und mir meine Antwort abreißt. Man träumt nicht, hat man mir gesagt, aber das stimmt nicht, denn im Traum bin ich am Meer langgegangen, es war ein schöner Tag ohne Wind und alles vollkommen blau und klar. Das erzählte ich beim Aufwachen sofort, weil es schön gewesen war. Danach erst begannen die Vorwürfe, die ich gegen mich selbst richtete, weil es meinem Gefühl entsprach. Was, wenn das jetzt immer so war? Was für eine Zukunft deutete sich da an? Jahrelang hatte ich dafür gesorgt, Leben zu verhindern, nun wusste ich nicht, ob ich in der Lage war, es auf die Welt zu bringen. Die Fragen verhielten sich zentrifugal und brachten mich ins Schleudern. Es setzte mit diffusen Kopfschmerzen ein, die ins MRT führten und ergaben, dass meine Schläfenstellen überdeutlich akzentuiert waren. Irgendwie vorhersehbar, dachte ich und löste diesen Knoten anders. Ich fuhr in den Wald, nahm einen Stock und schlug wie wild auf Bäume ein, es half. Andere lassen Wassermelonen platzen oder verbrennen ihre Manuskripte in der Badewanne, so ist das dann. Ich habe danach zwei Kinder gut auf die Welt gebracht, auch wenn mir während der Schwangerschaften immer die Angst im Nacken saß, ich Frühwehen hatte oder monatelang liegen musste. Es reicht, hatte ich mir damals beim Frühstück im Café gesagt, als ich wieder hemmungslos Rohmilchkäse und Wurst verschlang und damit irgendwie auch mein Kind aufaß. Dass sich immer etwas ereignet, was die Freude nimmt, und es keine Wende zum Guten gibt, ist Blödsinn.
Die Angst kam wohl von meinem Cousin, der keine dreiunddreißig geworden ist und, kurz bevor ich schwanger wurde, an dem Tumor starb, den Wolfgang Herrndorf publik machte, bevor er sich ihm entzog. Daher wusste ich, noch während es Herrndorf geschah, wie es bei meinem Cousin zu Ende gegangen war, nämlich chancenlos. Ich wusste vorher schon, wie es zu Ende gehen würde, ich trug die Zukunft als Vorwissen mit, und sie fühlte sich grässlich an. Natürlich gab es Operationen und Chemo und all das, was den Körper zu Veränderungen einlud. Immerhin wurde er vom besten Gehirnchirurgen Hamburgs operiert, sodass er danach weiterhin beisammen und ihm kein einziges Hirnareal verloren gegangen war. Sogar etwas dazubekommen hatte er, etwas, das nur er sehen konnte, ein Mädchen, das im Krankenzimmer immer den Boden wischte, und eine alte Frau, die nicht von der Toilette kam, aber was kann man schon tun, wenn der Tumor nachwächst und sich wie ein Myzel mit dem Stammhirn verbindet und von dort aus als böses Zentrum seine Bilder sendet. Ich verrecke, röchelte mein Cousin, als ich ihn im Hospiz besuchte und die Ärzte ihm den Kiefer wieder einrenkten, der Tod ist so ein Arschloch. Danach haben wir noch, sooft es ging, telefoniert, obwohl es von seiner Seite nur noch Schlucken war, während ich vielmehr mit seinem Mann sprach und beiden sagte, dass wir jetzt eine Bande seien, denn dass er weiterhin alles hören konnte, war ganz klar. Er wollte einen blauen Sarg mit goldenen Streifen, er hat alles bekommen, was er für sein Ende brauchte, sogar eine Hose riss auf seiner Beerdigung. Nur ging er nicht friedlich, und für uns Hinterbliebene ist die Gewalt, mit der das Ende seinen Lauf nahm, für immer.
Die Angst kam ganz plötzlich von meinem Stiefvater. Sie sprang mich an dem Tag an, als meine Mutter mich anrief und bat, so schnell wie möglich nach Berlin zu kommen. Sie ließ mich zu Boden gehen, bevor ich in die S-Bahn stieg. Bevor ich in den ICE stieg. Bevor ich in Berlin ausstieg. Bevor ich ins Taxi stieg und zur Charité fuhr. Bevor ich ausstieg und ins nächste Taxi stieg, weil es doch das Virchow war. Bevor ich aus dem Taxi stieg und schlafwandlerisch sicher bis zur entsprechenden Station ging. Bevor ich vor der Tür zur Intensivstation stand und sie vor mir zurückwich. Bevor ich durch die Flure glitt wie durch Wasser. Bevor ich ankam, und da lag er dann. Er war mit dem Fahrrad abends unterwegs gewesen, als ihn beim Überqueren einer Straße ein Auto auf die Motorhaube nahm und meterweit durch die Luft schleuderte, bis er mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Seinem Rad sah man die Wucht des Aufpralls an, der Rahmen war verbogen, ebenso waren die Frontscheibe des Wagens zersplittert und die Dachvorderkante eingedellt.
Normalerweise lässt man einen doch nicht so ohne Weiteres auf die Intensivstation, denke ich, als ich vor der Tür stehe und klingle, aber man lässt mich sofort dorthin, wo meine Mutter schon ist. Man lässt uns dort sein, so, wie wir sind, und wir entscheiden auch, wann wir gehen, obwohl noch einige mehr dort liegen. Als gehörte man dazu. Als arbeitete man mit. Sofort hatten wir das EKG geortet und verfolgten es mit unseren Blicken. Bei jeder Veränderung griff meine Mutter nach seiner Hand und stand dabei auf. Man sah ihm nichts an, er war gesäubert worden. Nur die Schläuche, an denen er hing, verrieten, dass sein regelmäßiger Atem künstlich war. Wir saßen drei Tage dort, wir gingen abends und kamen morgens, es gab einen Rückweg und einen Hinweg, fast schon Routine. Das Gefühl, in die Klinik nicht nur zu fahren, sondern dort zu sein, jeden Tag, als würde man arbeiten, unterteilt in Vormittag und Nachmittag, nur nachts kehrten wir in die Wohnung zurück, um zu schlafen. Um am nächsten Tag aufzustehen und wieder hinzugehen, um dort zu sitzen und schon mal zu planen, was ab jetzt geregelt werden muss. Was danach kam.
Dann fuhr meine Mutter wieder nach Hause, da mein Bruder noch ein Kind war. Als ich zur Station zurückkehrte, sagte man mir, dass mein Stiefvater plötzlich verlegt worden war, und wie ein zurückgelassenes Haustier folgte ich seiner Spur zur nächsten Station, auf der scheinbar alles wie gehabt seinen Lauf nahm, bis die Ärzte sich plötzlich um ihn versammelten und mit der Lampe seine Pupillen überprüften. Sie behandelten mich freundlich, aber gleichgültig, sie hatten zu tun, das war der Moment, der mich spüren ließ, dass es an der Zeit war, zu gehen. Die Ärzte arbeiteten mit ruhiger Hand. Ich lief irgendwie durch Berlin, bis ich bei einer Freundin unterkam.
Noch im Krankenhaus löschte ich meine SMS aus seinem Diensthandy, bevor es an die Firma zurückging. Seine Antworten auf meine Nachrichten waren doppelt gespeichert, auf seinem Telefon und auf meinem. Ich las, was ich schon einmal gelesen hatte, Eingang und Ausgang. Im Ausgang stand, was vor einem Jahr bei mir eingegangen war: Ein Gruß aus dem Urlaub, wir stehen auf der Spitze des Gipfels … Wie waren die Prüfungen, du schaffst das … Wunderbar, vergiss nicht, die Pflanzen zu gießen, Grüße von uns allen.
Ende der Leseprobe