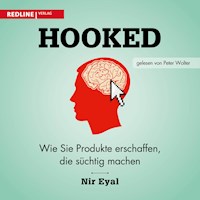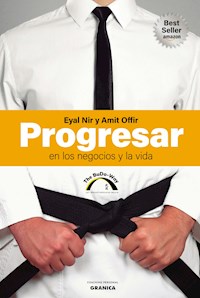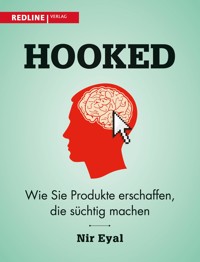
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie kommt es, dass manche Produkte sofort von jedem erkannt werden und andere völlig floppen? Und wie ist es möglich, dass manche Apps, Onlineshops oder ähnliche Internetprodukte innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich werden, dass sie aus dem Alltag der meisten Menschen gar nicht mehr wegzudenken sind? Für jeden, der ein Produkt auf den Markt bringen möchte, das im Alltag nicht mehr wegzudenken ist – wie Essen, Fernsehen oder Zähneputzen – hat Nir Eyal diesen Ratgeber verfasst. Anschaulich erklärt er, worauf es bei der Produktentwicklung ankommt, ergänzt durch erläuternde Praxisbeispiele. Dieses Buch ist die perfekte Lektüre für Produktmanager, Designer und Unternehmer, aber auch für alle, die dem modernen Phänomen, dass Kunden zu abhängigen Usern und Fans mutieren, auf die Spur kommen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Fragen und Anregungen:
7. Auflage 2024
© 2014 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
© der Originalausgabe 2014 by Nir Eyal
Die englische Originalausgabe erschien 2014 bei Sunshine Business Development unter dem Titel Hooked.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Jordan T. Wegberg, Berlin
Redaktion: Desirée Šimeg, Stadtbergen
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, München; unter Verwendung von shutterstock.com
Satz: Fotosatz Pfeifer
ISBN Print 978-3-86881-536-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-424-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-425-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unterwww.redline-verlag.deBeachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Einleitung
Wer zuerst kommt …
Wie ich an den Haken geriet
1. Auslöser
2. Handlung
3. Variable Belohnung
4. Investition
Eine neue Supermacht
Wie Sie dieses Buch nutzen
Der Gewohnheitsbereich
Warum Gewohnheiten gut fürs Geschäft sind
Erhöhung des Customer-Lifetime-Value
Preisbildungsflexibilität
Virales Wachstum
Erhöhung des Wettbewerbsvorteils
Das Monopol des Geistes
Gewohnheit als Strategie
Im Gewohnheitsbereich
Vitamine versus Schmerztabletten
Einblick in das Hakenmodell
Auslöser
Gewohnheiten werden nicht geschaffen, sondern ausgebaut
Äußere Auslöser
Arten von äußeren Auslösern
Innere Auslöser
Auslöser schaffen
Die Auslöser von Instagram
Handlung
Handlung vs. Untätigkeit
Motivation
Beispiele für Motivation in der Werbung
Fähigkeit
Einloggen bei Facebook
Teilen mit dem Twitter-Button
Suchen mit Google
Fotografieren mit dem iPhone von Apple
Scrollen mit Pinterest
Motivation oder Fähigkeit – was sollten Sie zuerst verbessern?
Die Evolution der Twitter-Homepage
Über Heuristik und Wahrnehmung
Der Knappheitseffekt
Der Rahmeneffekt
Der Ankereffekt
Der Vorsprungeffekt
Variable Belohnung
Belohnungen verstehen
Das Geheimnis der Variabilität
Die Belohnungen des Stammes, der Jagd und des Selbst
Belohnungen des Stammes
Belohnungen der Jagd
Belohnungen des Selbst
Wichtige Überlegungen für die Entwicklung von Belohnungssystemen
Variable Belohnungen sind kein Freibrief
Autonomie bewahren
Vorsicht vor der begrenzten Variabilität
Welche Belohnungen sollten Sie bieten?
Investition
Die Einstellung ändern
Die irrationale Wertschätzung von Bemühungen
Wir streben nach Übereinstimmung mit früheren Verhaltensweisen
Wir vermeiden kognitive Dissonanz
Ein bisschen Arbeit
Das Speichern von Werten
Content
Daten
Follower
Ruf
Fachkenntnis
Den nächsten Auslöser vorbereiten
Any.do
Tinder
Snapchat
Was fangen Sie jetzt damit an?
Der moralische Aspekt von Manipulation
Der Erleichterer
Der Hausierer
Der Entertainer
Der Dealer
Fallstudie: Die Bibel-App
Am Anfang
Wie man eine göttliche Gewohnheit schafft
Heilige Auslöser
Gepriesen seien die Daten
Belohnungen durch den Herrn
Gewohnheiten testen und die Suche nach gewohnheitsprägenden Gelegenheiten
Gewohnheiten testen
Schritt 1: Identifizieren
Schritt 2: Nachvollziehen
Schritt 3: Modifizieren
Die Entdeckung von gewohnheitsprägenden Gelegenheiten
Aufkeimende Verhaltensweisen
Basistechnologien
Schnittstellenwechsel
Anhang
Was nun?
Über die Autoren
Danksagungen
Mitwirkende
Anmerkungen und Quellen
Einleitung
79 Prozent aller Smartphone-Benutzer checken jeden Morgen innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufwachen ihr Gerät.1 Was vielleicht noch mehr erstaunt: Ein Drittel aller Amerikaner gibt an, sie würden lieber auf Sex verzichten, als ihr Handy zu verlieren.2 Eine Universitätsstudie von 2011 ergab, dass die Nutzer ihre Telefone 34 Mal am Tag überprüfen.3 Branchenkenner gehen allerdings davon aus, dass die Zahl eher bei überwältigenden 150 täglichen Kontrollen liegt.4
Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Wir hängen am Haken. Die Technologien, die wir verwenden, sind zum Zwang geworden, wenn nicht gar zu einer ausgewachsenen Sucht. Es ist der Impuls, einer SMS-Benachrichtigung nachzugehen. Es ist der Drang, »nur für ein paar Minuten« auf Youtube, Facebook oder Twitter zu gehen – um dort eine Stunde später immer noch zu klicken und zu scrollen. Es ist ein Trieb, den Sie vermutlich den ganzen Tag über verspüren, aber kaum zur Kenntnis nehmen.
Kognitive Psychologen definieren Gewohnheiten als »automatische Verhaltensweisen, die durch situationsbedingte Reize ausgelöst werden«: Dinge, die wir ohne oder mit nur geringem bewussten Vorsatz tun.5 Die Produkte und Dienstleistungen, die wir gewohnheitsmäßig nutzen, verändern unser Alltagsverhalten – so wie ihre Schöpfer es beabsichtigt haben.6 Unsere Handlungen werden manipuliert. Doch wie können Unternehmen, die kaum mehr als ein paar Bits Programmcode auf einem Bildschirm produzieren, augenscheinlich die Gehirne der Nutzer kontrollieren? Was macht einige Produkte so gewohnheitsprägend?
Für viele Produkte ist das Bilden von Gewohnheiten überlebensnotwendig. Da unzählige Zerstreuungen um unsere Aufmerksamkeit buhlen, setzen die Unternehmen immer neue Taktiken ein, um im Gedächtnis des Nutzers relevant zu bleiben. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, Millionen von Usern anzuhäufen. Die Unternehmen erkennen zunehmend, dass ihr wirtschaftlicher Wert sich aus der Stärke der Gewohnheiten ableitet, die sie erzeugen. Um die Loyalität ihrer Nutzer zu gewinnen und ein Produkt zu schaffen, das regelmäßig genutzt wird, müssen sie nicht nur lernen, wohin ihre User gerne klicken, sondern auch wie sie ticken.
Manche Unternehmen haben diese neue Realität gerade erst erkannt, andere profitieren bereits davon. Durch ihre Meisterschaft in gewohnheitsprägendem Produktdesign haben die Firmen in diesem Buch ihr Angebot zu etwas Unverzichtbarem gemacht.
Wer zuerst kommt …
Unternehmen, die intensive Nutzergewohnheiten prägen, haben unter dem Strich verschiedene Vorteile. Diese Firmen verbinden ihr Produkt mit »inneren Auslösern«. Im Ergebnis tauchen Kunden ohne jede äußere Veranlassung auf. Statt sich auf teures Marketing zu verlassen, verknüpfen gewohnheitsprägende Unternehmen ihre Dienstleistungen mit den täglichen Gewohnheiten und Emotionen ihrer Nutzer.7Von einer Gewohnheit kann man sprechen, wenn Anwender ein klein wenig gelangweilt sind und sofort Twitter öffnen. Sie verspüren einen Stich der Einsamkeit, und noch ehe sie bewusst darüber nachdenken, scrollen sie sich durch ihre Facebook-Einträge. Eine Frage kommt ihnen in den Sinn, und noch ehe sie ihr Gehirn anstrengen, googeln sie die Antwort. Es gewinnt diejenige Lösung, die einem als Erstes einfällt. In Kapitel 1 untersucht Hooked die Wettbewerbsvorteile von gewohnheitsprägenden Produkten.
Wie können Produkte Gewohnheiten schaffen? Die Antwort: Sie produzieren sie. Fans der Fernsehsendung Mad Men wissen, wie die Werbebranche während des goldenen Zeitalters der Madison Avenue einst Kundenwünsche erzeugte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Multiscreen-Welt der werbefeindlichen Konsumenten hat Don Drapers kostenintensive Gehirnwäsche – außer für die größten Marken – nutzlos werden lassen. Heutzutage können kleine Start-up-Teams tiefgreifende Verhaltensänderungen hervorrufen, indem sie Anwendern eine Reihe von Erfahrungen verschaffen, die ich als »Haken« bezeichne. Je öfter die Nutzer mit diesen Haken in Berührung kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich bei den Konsumenten Gewohnheiten bilden.
Wie ich an den Haken geriet
2008 gehörte ich zu einem Team von Stanford-MBAs, die ein Unternehmen gründeten. Es wurde von einigen der brillantesten Investoren des Silicon Valley unterstützt. Unsere Mission lautete, eine Plattform zu schaffen, um in der boomenden Welt der Online-Spiele Werbung zu platzieren. Namhafte Unternehmen verdienten Milliarden, indem sie virtuelle Kühe auf digitalen Bauernhöfen verkauften, während Inserenten gewaltige Summen ausgaben, damit die Leute das kauften, was immer sie feilboten. Ich gebe zu, dass ich das zunächst nicht begriffen habe und mich staunend fragte: »Wie machen die das bloß?«
An der Schnittstelle dieser beiden Branchen, die von der Manipulation leben, trat ich eine Entdeckungsreise an, um zu lernen, wie Produkte unser Handeln verändern und gelegentlich innere Zwänge auslösen. Wie manipulierten diese Unternehmen das Konsumentenverhalten? Welche moralischen Implikationen hatte die Schaffung potenziell süchtig machender Produkte? Und was am wichtigsten war: Konnten dieselben Kräfte, die diese Erfahrungen so unwiderstehlich machten, auch genutzt werden, um Produkte zu schaffen, die das Leben der Menschen verbessern?
Wo sollte ich nach den Blaupausen für die Ausbildung von Gewohnheiten suchen? Zu meiner Enttäuschung fand ich keine Leitlinien. Unternehmen, die Meister der Gewohnheitsbildung waren, hüteten ihre Geheimnisse, und obwohl ich Bücher, Berichte und Blogbeiträge fand, die das Thema anrissen, gab es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Entwicklung von gewohnheitsprägenden Produkten. Ich begann daher, meine Beobachtungen bei Hunderten von Firmen zu dokumentieren, um Muster in der Schaffung und Funktionalität von Konsumentenerfahrungen zu entdecken.
Obwohl jede Branche ihre eigene Vorgehensweise hat, wollte ich die Gemeinsamkeiten der Gewinner herausfinden und verstehen, was den Verlierern fehlt. Ich suchte nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und stützte mich auf die Konsumentenpsychologie, die Interaktion zwischen Computer und Mensch sowie auf die Forschung zur Verhaltensökonomie. 2011 begann ich zu veröffentlichen, was ich herausgefunden hatte, und arbeitete als Berater für eine Reihe von Silicon-Valley-Firmen, von kleinen Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. Jeder Kunde bot mir die Chance, meine Theorien zu überprüfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und meinen Denkansatz zu verfeinern. Ich schrieb Blogposts auf NirAndFar.com über meine Einsichten, und meine Betrachtungen wurden an andere Websites verkauft. Bald schon steuerten die Leser ihre eigenen Beobachtungen und Beispiele bei. Im Herbst 2012 unterrichteten Dr. Baba Shiv und ich eine Gruppe an der Stanford Graduate School of Business zum Thema Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Im Jahr darauf schloss ich mich mit Dr. Steph Habif zusammen, um einen ähnlichen Kurs am Hasso-Plattner-Institut für Design zu geben.
Diese Jahre der konzentrierten Forschung und der Erfahrungen in der wirklichen Welt führten zur Kreation des sogenannten Hakenmodells: ein vierstufiger Prozess, den Unternehmen nutzen, um Gewohnheiten zu prägen. Durch aufeinanderfolgende Hakenzyklen erreichen erfolgreiche Produkte ihr ultimatives Ziel der unaufgeforderten Kundenbindung, das heißt die Konsumenten kommen von selbst immer wieder zurück, ohne dass dafür teure Anzeigenkampagnen oder aggressive Werbung notwendig wären.
Auch wenn ich aufgrund meines Branchenhintergrunds zahlreiche Beispiele aus Technologieunternehmen liefere, gibt es überall solche Haken – in Apps, beim Sport, in Filmen oder Spielen und sogar an unserem Arbeitsplatz. Haken können sich tatsächlich in jeder Erfahrung verbergen, die sich in unsere Gedanken (und häufig auch in unsere Brieftaschen) hineindrängt. Die vier Phasen des Hakenmodells bilden den Rahmen für die Kapitel dieses Buchs.
1. Auslöser
Ein Auslöser ist der Antrieb eines Verhaltens – sozusagen der Zündfunke im Motor. Es gibt zwei Typen von Auslösern: äußere und innere.8 Gewohnheitsprägende Produkte wecken die Aufmerksamkeit der Nutzer zunächst durch äußere Auslöser wie etwa eine E-Mail, einen Link oder ein App-Icon auf einem Telefon.
Nehmen wir einmal an, dass Barbra, eine junge Frau aus Pennsylvania, zufällig ein Foto in ihren Facebook-Statusmeldungen sieht, das von einem Verwandten im ländlichen Teil des Bundesstaats aufgenommen wurde. Es ist ein hübsches Bild, und da sie mit ihrem Bruder Johnny eine Reise dorthin plant, folgt sie dem Handlungsaufruf des externen Auslösers, das Foto anzuklicken.
Das Durchlaufen aufeinanderfolgender Hakenzyklen lässt den Konsumenten Assoziationen zu inneren Auslösern herstellen, die an existierende Verhaltensweisen und Emotionen gekoppelt sind. Wenn die Nutzer anfangen, automatisch ihre nächste Verhaltensweise auszulösen, wird die neue Gewohnheit zu einem Teil ihrer Alltagsroutine. Im Laufe der Zeit verbindet Barbra demnach Facebook mit ihrem Bedürfnis nach sozialen Bindungen.
Kapitel 2 untersucht äußere und innere Auslöser und beantwortet die Frage, wie Produktdesigner bestimmen, welche Auslöser die effektivsten sind.
2. Handlung
Im Anschluss an den Auslöser erfolgt die Handlung: das Verhalten in Erwartung einer Belohnung. Die einfache Handlung des Klickens auf das interessante Bild in ihrem Newsfeed bringt Barbra zu einer Website namens Pinterest, einer Art »Pinnwand für das Teilen von Fotos«.9
Diese Phase des Hakens, die in Kapitel 3 beschrieben wird, stützt sich auf die Kunst und die Wissenschaft der Benutzerfreundlichkeit, die enthüllt, wie Produkte bestimmte Nutzerhandlungen lenken. Unternehmen nutzen zwei grundlegende Antriebskräfte des menschlichen Verhaltens, um die Wahrscheinlichkeit einer Handlung zu erhöhen: die Mühelosigkeit der Durchführung einer Handlung und die psychologische Motivation.10
Nachdem Barbra die einfache Handlung »Klick auf das Foto« ausgeführt hat, ist sie beeindruckt von dem, was sie als Nächstes sieht.
3. Variable Belohnung
Was das Hakenmodell von einer herkömmlichen Feedbackschleife unterscheidet, ist die Fähigkeit des Hakens, ein Bedürfnis zu schaffen. Feedbackschleifen sind überall, aber die vorhersagbaren erzeugen keine Wünsche. Die wenig überraschende Reaktion Ihres Kühlschranks, beim Öffnen der Tür das Licht im Inneren einzuschalten, treibt Sie nicht dazu, ihn immer und immer wieder aufzumachen, oder? Wenn Sie dieser Mischung jedoch eine gewisse Variabilität hinzufügen – zum Beispiel indem wie durch Zauberhand bei jedem Öffnen ein anderer Leckerbissen in Ihrem Kühlschrank auftaucht –, kommt im Handumdrehen Faszination ins Spiel.
Variable Belohnungen sind eines der machtvollsten Werkzeuge, die Unternehmen einsetzen, um Nutzer an den Haken zu bekommen; Kapitel 4 beschreibt sie ausführlich. Forschungen zeigen, dass der Neurotransmitter Dopamin rapide zunimmt, wenn das Gehirn eine Belohnung erwartet.11 Variabilität steigert diesen Effekt und schafft eine Fokussierung, welche diejenigen Gehirnareale unterdrückt, die mit Urteilsfähigkeit und Vernunft verknüpft sind, während sie diejenigen Bereiche aktiviert, die für Wünsche und Sehnsüchte zuständig sind.12 Obwohl die klassischen Beispiele Geldspielautomaten und Lotterien sind, finden sich variable Belohnungen auch in vielen anderen gewohnheitsprägenden Produkten.
Als Barbra auf Pinterest landet, sieht sie dort nicht nur das Bild, das sie gesucht hat, sondern darüber hinaus eine Vielzahl weiterer glitzernder Objekte. Die Bilder haben mit dem zu tun, woran sie allgemein interessiert ist – nämlich sehenswerten Zielen auf ihrer bevorstehenden Reise ins ländliche Pennsylvania –, aber auch andere Dinge fallen ihr ins Auge. Der aufregende Mix aus Relevantem und Irrelevantem, Aufreizendem und Schlichtem, Schönem und Gewöhnlichem überflutet das Dopaminsystem ihres Gehirns mit dem Versprechen einer Belohnung. Jetzt verbringt sie mehr Zeit auf Pinterest und hält nach dem nächsten herrlichen Fund Ausschau. Ehe sie es merkt, hat sie 45 Minuten dort verbracht.
In Kapitel 4 wird auch untersucht, warum einige Menschen letztlich ihr Gefallen an bestimmten Erfahrungen verlieren und wie die Variabilität sich auf ihr Gedächtnis auswirkt.
4. Investition
In der letzten Phase des Hakenmodells muss der Konsument ein bisschen arbeiten. Die Investitionsphase erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er in Zukunft erneut den Hakenzyklus durchlaufen wird. Die Investition besteht darin, dass der Nutzer irgendetwas für das Produkt oder die Dienstleistung gibt, beispielsweise Zeit, Daten, Mühe, soziales Kapital oder Geld.
Bei der Investitionsphase geht es aber nicht darum, dass der Konsument sein Portemonnaie öffnet und anschließend zur Tagesordnung übergeht. Vielmehr impliziert die Investition eine Handlung, die den Service für die nächste Runde im Hakenzyklus verbessert: Freunde einladen, Vorlieben angeben, virtuelle Guthaben einrichten und das Kennenlernen der neuen Features sind alles Investitionen, die User vornehmen, um ihr Nutzungserlebnis zu verbessern. Diese Beteiligung kann genutzt werden, um bei jedem Durchlaufen des Hakenzyklus den Auslöser noch intensiver, die Handlung noch einfacher und die Belohnung noch aufregender zu machen. Kapitel 5 zeigt, wie Investitionen den Nutzer dazu anregen, aufeinanderfolgende Hakenzyklen zu durchlaufen.
Barbra macht es Spaß, endlos durch das Pinterest-Füllhorn zu scrollen, und sie entwickelt dabei den Wunsch, die Dinge aufzubewahren, die ihr Freude bereiten. Durch das Sammeln von Items gibt sie der Website Datenmaterial über ihre Vorlieben. In Kürze wird sie Favoriten markieren, eigene Beiträge einstellen und weitere Investitionen vornehmen – was ihre Bindung an die Seite erhöht und sie für weitere Hakenzyklen bereit macht.
Eine neue Supermacht
Gewohnheitsprägende Technologien gibt es bereits, und sie werden dazu eingesetzt, unser Leben zu gestalten. Die Tatsache, dass wir durch unsere verschiedenen Geräte – Smartphones und Tablets, Fernseher, Spielekonsolen und Wearable Technology – mehr Zugang zum Internet haben, eröffnet den Unternehmen deutlich mehr Möglichkeiten, unser Verhalten zu beeinflussen. Die Firmen kombinieren ihre erhöhte Konnektivität zu den Verbrauchern mit der Fähigkeit, Kundendaten schneller zu sammeln, auszuwerten und zu verarbeiten.
Wir sehen einer Zukunft entgegen, in der alles potenziell stärker gewohnheitsprägend sein wird. Wie der berühmte Silicon-Valley-Investor Paul Graham schreibt: »Wenn diese Formen des technologischen Fortschritts, die solche Dinge hervorgebracht haben, nicht anderen Gesetzen unterworfen sind als der technologische Fortschritt im Allgemeinen, wird die Welt in den kommenden 40 Jahren stärkeren Abhängigkeiten unterliegen als in den letzten 40 Jahren.«13 Kapitel 6 erforscht diese neue Realität und diskutiert den moralischen Aspekt der Manipulation. Kürzlich schrieb mir ein Blogleser per E-Mail: »Wenn es nicht für etwas Böses genutzt werden kann, ist es keine Supermacht.« Er hat recht. Und gemäß dieser Definition ist die Schaffung gewohnheitsprägender Produkte tatsächlich eine Supermacht. Bei verantwortungsloser Anwendung können schlechte Gewohnheiten sehr rasch zu gedankenlosen, zombieartigen Abhängigkeiten verkommen.
Haben Sie Barbra und ihren Bruder Johnny aus dem Beispiel erkannt? Die Fans von Zombiefilmen unter Ihnen bestimmt. Sie sind Figuren aus dem Horrorklassiker Night of the Living Dead, einem Film über Menschen unter dem Einfluss einer mysteriösen Macht, die jede ihrer Handlungen steuert.14 Bestimmt haben Sie das Wiederaufleben des Zombiegenres in den vergangenen Jahren bemerkt. Spiele wie Resident Evil, Fernsehsendungen wie The Walking Dead und Filme wie World War Z sprechen für den zunehmenden Reiz dieser Kreaturen. Doch was macht Zombies plötzlich so faszinierend? Vielleicht hat der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie – so verbreitet und überzeugend wie nie zuvor – die Angst in uns geschürt, dass wir ungewollt kontrolliert werden.
Wenngleich diese Angst spürbar ist, sind wir wie die Helden in jedem Zombiefilm – unter Bedrohung, aber sehr viel mächtiger. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass gewohnheitsprägende Produkte weitaus mehr nutzen als schaden können. Die »Entscheidungsarchitektur«, wie sie von den bekannten Akademikern Thaler, Sunstein und Balz beschrieben wird, bietet Techniken zur Beeinflussung von Entscheidungen und Verhaltensweisen. Letztendlich sollte diese Vorgehensweise genutzt werden, »um Menschen einen Anstoß zu geben, bessere Entscheidungen zu treffen (wie sie selbst finden)«.15 Dementsprechend hilft dieses Buch Innovatoren bei der Entwicklung von Produkten, die Menschen dabei helfen, diejenigen Dinge zu tun, die sie ohnehin tun wollen, aber in Ermangelung einer Lösung nicht tun.
Hooked will die enorme neue Macht entfesseln, die Innovatoren und Unternehmer besitzen, um das tägliche Leben von Milliarden von Menschen zu beeinflussen. Ich glaube, der Dreiklang von Zugangsmöglichkeiten, Datenmaterial und Geschwindigkeit bietet beispiellose Chancen, um positive Gewohnheiten zu prägen. Mit den richtigen Voraussetzungen kann die Technologie das Leben durch heilsame Gewohnheiten bereichern, die unsere Beziehungen verbessern, uns klüger machen und unsere Produktivität erhöhen.
Das Hakenmodell erklärt die logischen Hintergründe der Gestaltung vieler erfolgreicher gewohnheitsprägender Produkte und Dienstleistungen, die wir tagtäglich nutzen. Angesichts der riesigen Menge an verfügbarer wissenschaftlicher Literatur ist das Modell nicht erschöpfend, doch es soll Unternehmern und Innovatoren als praktisches (statt theoretisches) Werkzeug dienen, die sich die Nutzung von Gewohnheiten für positive Zwecke auf die Fahnen geschrieben haben. In diesem Buch habe ich die wichtigsten Forschungsergebnisse zusammengetragen, gebe praktisch umsetzbare Erkenntnisse weiter und biete ein praktisches Handlungsgerüst, das die Erfolgsaussichten von Innovatoren erhöhen soll.
Haken verbinden ein Kundenproblem mit einer Unternehmenslösung, und zwar häufig genug, um eine Gewohnheit auszubilden. Mein Ziel ist es, Ihnen ein besseres Verständnis dessen zu bieten, wie bestimmte Produkte unser Handeln verändern und damit, wer wir sind.
Wie Sie dieses Buch nutzen
Am Ende jedes Abschnitts finden Sie ein paar stichpunktartige Erkenntnisse. Überarbeiten Sie sie, schreiben Sie sie in Ihr Notizbuch oder teilen Sie sie in einem sozialen Netzwerk. Das ist eine wunderbare Methode, um innezuhalten, nachzudenken und das Gelesene zu vertiefen.
Arbeiten Sie selbst an einem gewohnheitsprägenden Produkt? Dann können Ihnen die Abschnitte »Was Sie jetzt tun sollten« am Ende der folgenden Kapitel dabei helfen, Ihre nächsten Schritte zu planen.
Zum Einprägen und Teilen
•Gewohnheiten lassen sich definieren als Verhaltensweisen, die wenig oder gar kein bewusstes Nachdenken erfordern.•Das Zusammenlaufen von Zugriffsmöglichkeiten, Datenmaterial und Geschwindigkeit macht unsere Welt zu einem zunehmend gewohnheitsprägenden Ort.•Unternehmen, die Kundengewohnheiten schaffen, erzielen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.•Das Hakenmodell beschreibt eine Erfahrung, die ein Konsumentenproblem häufig genug mit einer Lösung verknüpfen soll, sodass eine Gewohnheit daraus wird.•Das Hakenmodell hat vier Phasen: Auslöser, Handlung, variable Belohnung und Investition.161.Der Gewohnheitsbereich
Wenn ich jogge, schalte ich ab. Ich denke nicht darüber nach, was mein Körper tut, und für gewöhnlich schweifen meine Gedanken total ab. Ich finde das entspannend und erfrischend, und deshalb gehe ich etwa dreimal pro Woche morgens joggen. Neulich musste ich zu meiner gewohnten morgendlichen Laufzeit den Anruf eines Kunden aus Übersee entgegennehmen. »Kein Problem«, dachte ich. »Ich kann ja stattdessen abends joggen gehen.« Doch diese Zeitverschiebung erzeugte abends ein paar seltsame Verhaltensweisen.
Ich verließ das Haus in der Abenddämmerung, um joggen zu gehen, und kam an einer Frau vorbei, die gerade den Müll hinausbrachte. Sie sah mich an und lächelte. Ich grüßte sie höflich: »Guten Morgen!« – dann bemerkte ich meinen Irrtum. »Ich meine, guten Abend! Entschuldigung!«, korrigierte ich mich, als ich erkannte, dass ich ungefähr zehn Stunden zu spät war. Sie runzelte die Stirn und lächelte nervös. Leicht beschämt bemerkte ich, wie blind meine Gedanken gegenüber der Tageszeit gewesen waren. Ich wies mich selbst zurecht, das nicht noch einmal zu machen, doch schon nach wenigen Minuten begegnete ich einem anderen Jogger, und abermals – als wäre ich besessen – brach es aus mir heraus: »Guten Morgen!« Was war denn da bloß los?
Zu Hause, während ich wie gewöhnlich nach dem Joggen unter der Dusche stand, begannen meine Gedanken umherzuschweifen, wie sie das im Bad häufig tun. Mein Gehirn schaltete auf Autopilot und ich fuhr mit meiner täglichen Routine fort, ohne auf mein Tun zu achten. Erst als ich mich an der Rasierklinge schnitt, bemerkte ich, dass ich mein Gesicht eingeschäumt und mich zu rasieren begonnen hatte. Obwohl dies etwas ist, was ich jeden Morgen tue, ist eine Rasur am Abend vollkommen unnötig. Und doch hatte ich es unbewusst getan. Die Abendversion meines Morgenlaufs hatte ein Verhaltensmuster ausgelöst, das meinen Körper anwies, automatisch die üblichen, mit dem Joggen verbundenen Aktivitäten durchzuführen. So ist das mit festen Gewohnheiten – Verhaltensweisen mit nur wenig oder ganz ohne bewusstes Nachdenken –, die nach manchen Schätzungen fast die Hälfte unserer täglichen Handlungen bestimmen.17
Gewohnheiten gehören zu den Methoden, mit denen das Gehirn komplexe Verhaltensweisen erlernt. Neurowissenschaftler glauben, dass Gewohnheiten uns in die Lage versetzen, unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten, indem wir automatische Reaktionen in den Basalganglien abspeichern, einem Bereich des Gehirns, der für unwillentliche Handlungen zuständig ist.18 Gewohnheiten bilden sich, wenn das Gehirn die Abkürzung nimmt und nicht mehr aktiv darüber entscheidet, was als Nächstes zu tun ist.19 Das Gehirn lernt rasch, Verhaltensweisen festzuschreiben, die eine Lösung bieten, egal mit welcher Situation es konfrontiert wird.
Nägelkauen ist beispielsweise eine häufige Verhaltensweise, die mit wenig oder ganz ohne bewusstes Nachdenken einhergeht. Ursprünglich beginnt der Nägelkauer womöglich aus einem bestimmten Grund an seinen Nägeln zu knabbern – zum Beispiel um einen unansehnlichen Niednagel zu entfernen. Wenn das Verhalten jedoch ohne bewussten Zweck auftaucht, also lediglich als automatische Reaktion auf einen Auslösereiz, hat die Gewohnheit die Kontrolle übernommen. Für viele hartnäckige Nägelkauer ist der unbewusste Auslöser das unangenehme Gefühl von Stress. Je stärker der Nägelkauer den Vorgang des Nagelbeißens mit der damit einhergehenden vorübergehenden Entlastung verknüpft, desto schwieriger wird es, diese konditionierte Reaktion zu ändern.
Genau wie das Nägelkauen werden viele unserer täglichen Entscheidungen einfach nur deshalb getroffen, weil wir auf diese Weise schon in der Vergangenheit eine Lösung gefunden haben. Das Gehirn folgert automatisch: Wenn diese Entscheidung gestern gut war, ist sie auch heute eine sichere Angelegenheit. Und so wird die Handlung zur Routine. Beim Joggen hatte mein Gehirn den Blickkontakt mit einer anderen Person während des Laufens mit dem Standardgruß »Guten Morgen!« verknüpft, deshalb sprach ich automatisch diese Worte, egal wie wenig sie zur Tageszeit passen mochten.
Warum Gewohnheiten gut fürs Geschäft sind
Wenn unsere einprogrammierten Verhaltensweisen einen so großen Einfluss auf unsere täglichen Handlungen haben, kann es sicherlich ein Segen für die Wirtschaft sein, diese Macht der Gewohnheit zu nutzen. Tatsächlich können Gewohnheiten sehr gut für das Geschäftsergebnis sein, wenn man in der Lage ist, sie auf effektive Art und Weise zu formen. Gewohnheitsprägende Produkte verändern das Konsumentenverhalten und erzeugen unaufgeforderte Kundenbindung. Ziel ist es, den Kunden zu beeinflussen, damit er Ihr Produkt aus eigenem Antrieb verwendet, wieder und wieder, ohne dafür offenkundige Handlungsappelle wie Anzeigen oder Werbekampagnen zu benötigen. Ist eine Gewohnheit erst einmal entstanden, wird der Nutzer automatisch angeregt, das Produkt bei Alltagsereignissen zu benutzen, zum Beispiel wenn er Zeit totschlagen will, während er in einer Warteschlange steht.
Die in diesem Buch vorgestellten Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen sind jedoch nicht universell einsetzbar und passen nicht zu jedem Unternehmen und jeder Branche. Unternehmer sollten einschätzen, wie Nutzergewohnheiten sich auf ihr spezielles Geschäftsmodell und ihre Zielsetzungen auswirken. Die Brauchbarkeit einiger Produkte beruht auf der Ausbildung von Gewohnheiten, doch das ist nicht immer der Fall. Zum Beispiel brauchen Unternehmen, die selten gekaufte oder genutzte Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, keine Gewohnheitsnutzer – zumindest nicht im Sinne täglicher Nutzung. Lebensversicherungsunternehmen beispielsweise arbeiten mit Vertretern, Anzeigenwerbung, Mundpropaganda und Empfehlungen, um Kunden zum Kauf von Versicherungen zu veranlassen. Ist die Police erst einmal gekauft, bleibt für den Kunden nichts weiter zu tun.
In Hooked beziehe ich mich daher auf Produkte im Kontext von Unternehmen, die eine fortgesetzte, unaufgeforderte Kundenbindung benötigen und deshalb Konsumentengewohnheiten schaffen müssen. Ich schließe Unternehmen aus, die Kunden mit anderen Mitteln zum Handeln auffordern.
Bevor wir uns mit der Technik zur Erzeugung von Gewohnheiten beschäftigen, müssen wir zunächst ihre allgemeine Bedeutsamkeit sowie die Wettbewerbsvorteile für Unternehmen begreifen. Gewohnheiten zu prägen ist für das Geschäft auf verschiedene Weise nützlich.
Erhöhung des Customer-Lifetime-Value
Betriebswirten wird beigebracht, dass der Wert eines Unternehmens aus der Summe seiner zukünftigen Gewinne besteht. Mit dieser Benchmark berechnen Investoren den angemessenen Preis eines Unternehmensanteils. CEOs und ihre Führungsteams werden nach ihrer Fähigkeit bewertet, den Wert ihrer Aktien zu erhöhen – und kümmern sich daher intensiv um die Fähigkeit ihrer Unternehmen, Free Cashflow zu erzeugen. Nach Ansicht der Shareholder besteht die Aufgabe des Managements darin, Strategien für die künftige Gewinnsteigerung anzuwenden, indem Umsätze erhöht oder Ausgaben gekürzt werden.
Die Prägung von Kundengewohnheiten ist eine effektive Methode, um den Unternehmenswert zu steigern, indem ein höherer Customer-Lifetime-Value (CLTV) erzeugt wird. Der CLTV ist jener Umsatz, den ein Kunde generiert, ehe er zu einem Wettbewerber wechselt, die Produktnutzung einstellt oder stirbt. Konsumentengewohnheiten erhöhen die Produktnutzungsdauer und -häufigkeit eines Kunden und führen daher zu einem höheren CLTV. Manche Produkte haben einen sehr hohen CLTV. So sind beispielsweise Kreditkartenkunden in der Regel sehr lange treu – und daher viel wert. Deshalb sind Kreditkartenunternehmen bereit, beträchtliche Summen zu investieren, um neue Kunden zu gewinnen. Das erklärt, warum Sie so viele Werbeangebote erhalten, die von Gratisprämien bis zu Bonusmeilen reichen und Sie dazu verführen sollen, eine weitere Kreditkarte anzufordern oder für die bereits bestehende ein Upgrade vorzunehmen. Ihr potenzieller CLTV rechtfertigt die Marketinginvestition des Kreditkartenunternehmens.
Preisbildungsflexibilität
Warren Buffett, der bekannte Investor und CEO von Berkshire Hathaway, sagte einmal: »Die Stärke eines Unternehmens im Laufe der Zeit erkennt man an der Heftigkeit der Qualen, die es bei der Erhöhung seiner Preise erleidet.«20 Buffett und sein Partner Charlie Munger erkannten, dass Kunden von einem Produkt abhängig werden, wenn sie es erst einmal in ihre Alltagsroutine eingebaut haben, und daher weniger preissensibel sind. Die beiden verwiesen auf die Kundenpsychologie als logischen Beweggrund für ihre bekannten Investitionen in Firmen wie See’s Candies und Coca-Cola.21 Buffett und Munger wissen, dass Gewohnheiten einem Unternehmen mehr Spielraum für Preiserhöhungen geben.
So ist es beispielsweise bei kostenlosen Videospielen eine gängige Praxis der Spielentwickler, die Nutzer erst dann zum Geldeinsatz aufzufordern, wenn sie bereits kontinuierlich und gewohnheitsmäßig spielen. Besteht erst einmal der Anreiz zum Spielen und wird der Wunsch größer, innerhalb des Spiels schneller im Level zu steigen, ist es viel leichter, die bisherigen Gratisnutzer in zahlende Kunden zu verwandeln. Mit dem Verkauf virtueller Gegenstände, zusätzlicher Leben und Power-ups wird richtig Geld verdient. Bis Dezember 2013 hatten sich zum Beispiel über 500 Millionen Menschen Candy Crush Saga heruntergeladen, ein Spiel, das hauptsächlich auf Mobilgeräten gespielt wird. Das »Freemium«-Modell dieses Spiels verwandelt einige dieser Nutzer in zahlende Kunden und bringt seinen Entwicklern fast eine Million Dollar täglich ein.22
Dieses Muster lässt sich auch auf andere Dienstleistungen übertragen. Nehmen Sie zum Beispiel Evernote, die beliebte Notiz- und Archivierungssoftware. Sie ist kostenlos verfügbar, aber das Unternehmen bietet weitergehende Features wie Offline-Zugriff und Werkzeuge für die Zusammenarbeit an – zu einem Preis, den viele treu ergebene Kunden bereitwillig zahlen. Der CEO von Evernote, Phil Libin, gab einige erhellende Erkenntnisse darüber preis, wie seine Firma Gratisnutzer in solche verwandelt, die Umsatz bringen.23