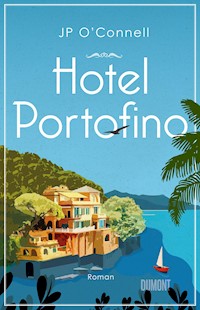
14,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hotel Portofino
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr … Die Hotel-Portofino-Reihe: Hotel Portofino Sommer im Hotel Portofino Alle Bände sind eigenständige Romane und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Sammlungen
Ähnliche
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr …
›Hotel Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
JP O’Connell hat viele Jahre als Journalist gearbeitet, u.a. für The Guardian, The Times und Daily Telegraph. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, zuletzt erschien ›Bowies Bücher‹ (2020). Er lebt in London. Eva Kemper studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen. Zu ihren Übersetzungen zählen Werke von Junoz Díaz, Jarett Kobek, Emma Stonex und Cathy Park Hong.
JP O’Connell
HOTELPORTOFINO
Roman
Aus dem Englischenvon Eva Kemper
Emily Dickinson ›Dass es nie wiederkehrt [1] wurde zitiert nach: Emily Dickinson ›Sämtliche Gedichte. Zweisprachig‹.
Übersetzt von Gunhild Kübler. Hanser Verlag, München 2015.
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel ›Hotel Portofino‹ bei Simon & Schuster, London.
Copyright © THE WRITERS ROOM 2022
Published by Arrangement with SIMON & SCHUSTER UK LTD., LONDON WC1X 8HB, United Kingdom.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
eBook 2022
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Eva Kemper
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Stefanie Naumann
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8242-7
www.dumont-buchverlag.de
EINS
Es war wirklich befriedigend, dachte Bella, die Zimmer für die Gäste herzurichten. Nach einiger Diskussion mit Cecil hatte sie entschieden, die Drummond-Wards in der Epsom Suite unterzubringen. Die Zimmer boten nicht nur einen schönen Meeresblick, sie waren auch hell und luftig, mit einem Bett aus solidem Mahagoni und Tapeten mit einem zarten, unaufdringlichen Blütenmuster.
Von zu geschäftigen Mustern hielt sie nichts. Man war leicht versucht, innezuhalten und sie ausgiebig zu betrachten, um ihr Zusammenspiel aus Linien und Formen zu verstehen. Aber manchmal war es – im Leben ebenso wie beim Interieur – besser, Muster blieben unbemerkt.
Bella hatte ohnehin keine Zeit innezuhalten. Sie war viel zu beschäftigt.
Sie ging hinüber zu Francesco und Billy, die sich abmühten, eine Matratze zu wenden.
»Du bist doch ein starker Bursche«, sagte sie zu Billy. Er hatte einen hochroten Kopf und ächzte. »Versuch es noch mal.«
»Aber es ist so schwer, MrsAinsworth!«
»Das ist Pferdehaar«, erklärte Bella. »Deshalb schläft man so bequem darauf.«
»Da ist auch Metall drin. Das fühle ich.«
»Das sind Federn, Billy.«
Während Billy noch ungläubig den Kopf schüttelte, eilte Paola mit einem Stapel frisch gebügelter Bettwäsche herein. Die Laken waren aus London gekommen – von niemand Geringerem als Heal’s aus der Tottenham Court Road. Sicher, der British Store in Bordighera verkaufte neben typischen Produkten wie Gordon’s Gin und Keksen von Huntley & Palmer auch Bettwäsche. Viele Briten vor Ort kauften gern dort ein.
Aber für das Hotel Portofino war nur das Beste gut genug.
Und das bedeutete weiche, mit dickem Faden gewebte Baumwolle. Bettlaken, die schnackten, wenn man sie von der Wäscheleine zog.
Als die Matratze ordnungsgemäß gewendet war, trollte Billy sich in die Küche, um seiner Mutter zu helfen. Paola bezog das Bett, und Francesco stellte eine Vase mit violett schimmernden Iris auf einen Beistelltisch.
Die Bäder bestückte Bella gern selbst. Im Hotel Portofino gehörte zu den besseren Suiten ein eigenes Bad. Sie und Cecil hatten in moderne Warmwassertechnik investiert. Heutzutage erwarteten die Leute, ein Bad nehmen zu können – ohne Dienerschaft in der Nähe, die umständlich immer wieder Holz in den Ofen legen musste. Auch bargen die alten Anlagen zum Teil echte Gefahren. Jeder kannte die Geschichte von dem explodierten Badeofen im Castello Brown. Ein unseliger englischer Tourist hatte ihn im falschen Moment ausgestellt, und – nun ja – drei Monate später wurde immer noch renoviert.
Mit leisen Schritten überquerte Bella die glänzenden Mosaikfliesen, legte ein frisches weißes Handtuch neben das Waschbecken und stellte eine Duftkerze auf einen Sims neben der großen Badewanne mit den Klauenfüßen. Die letzten Bewohner der Suite – ein älteres Paar aus Guildford, furchtbare Nörgler alle beide – hatten einen unangenehmen Geruch beklagt. Bella hatte nichts feststellen können, aber bei den Drummond-Wards wollte sie kein Risiko eingehen.
Als sie das Bad verließ, stand Paola neben dem fertig bezogenen Bett und wartete auf Bellas Urteil. Paola war eine Kriegswitwe aus dem Dorf. Sie hatte große dunkle Augen und rabenschwarze schimmernde Haare, die sich zurückgebunden im Nacken lockten. Sie war ebenso hübsch wie verlässlich. In letzter Zeit war Bella allerdings eine Veränderung aufgefallen. Eine ungewohnte Wachsamkeit kombiniert mit etwas eher Urwüchsigem, etwas, das ahnen ließ, dass sie ein Geheimnis hatte. Es war schwer zu beschreiben, aber Paola kam Bella vor wie eine Katze, die wusste, dass ein Schälchen Sahne auf sie wartete.
Die Tagesdecke musste nur eine Winzigkeit zurechtgezupft werden. Bella trat einen Schritt zurück, begutachtete die Arbeit des Zimmermädchens und nickte anerkennend.
»Eccellente«, sagte sie lächelnd. Paola erwiderte das Lächeln, wich dem durchdringenden Blick ihrer Arbeitgeberin aber aus.
Warum mache ich mir Sorgen?, fragte Bella sich. Warum kann ich nicht einfach entspannt sein?
Die Antwort lag auf der Hand, wenn sie darüber nachdachte. In diesem Sommer stand viel auf dem Spiel. Nicht nur die Zukunft des Hotels, sondern auch Lucians Zukunft und – es fiel ihr schwer, es zuzugeben, aber es blieb ihr nichts anderes übrig – ihre Ehe mit Cecil. Manchmal erschien es Bella, als würde sie am seidenen Faden hängen. Wenigstens mit ihren Angestellten hatte sie Glück.
Betty, ihre Köchin, und ihr Sohn Billy waren schon in London und davor in Yorkshire bei ihnen gewesen. Sie waren wie Familie, und Bella vertraute ihnen blind, aber in dieser neuen, fremden Welt mussten sie sich weiß Gott erst noch zurechtfinden. Was Constance betraf, Lotties neue Nanny, die Betty empfohlen hatte, hegte Bella große Hoffnungen.
Paola war dagegen immer noch eine unbekannte Größe. Nach einer Stunde mit ihr fragte Bella sich, ob sie die Italiener jemals verstehen würde. Dabei wollte sie es doch so gern.
Italien hatte Bella schon als Kind fasziniert. Im Internat hatte sie Kopien berühmter italienischer Gemälde über ihr Bett gehängt und musste ihre Wut mühsam unterdrücken, als sie auf Geheiß der Nonnen, die die Schule leiteten, Botticellis Die Geburt der Venus wegen Obszönität abnehmen musste. Für Bella verkörperte Italien alles Wahre, Schöne und Gute. Wie ein Leuchtfeuer auf einer hohen Landzunge sandte es strahlendes mediterranes Licht aus, das die Düsternis des feuchtkalten, nebeligen Londons durchdrang.
Cecil mochte Italien auch. Zumindest sagte er das. Aber es war Bellas Idee gewesen, ihre Flitterwochen in Portofino zu verbringen.
Jetzt seufzte sie, als sie an diese sorglose Zeit zurückdachte. Kaum zu glauben, dass die Tochter, die sie in diesem Urlaub gezeugt hatten, jetzt Witwe war und ihr Sohn ein verwundeter Veteran nach dem schlimmsten Krieg seit Menschengedenken. Noch unglaublicher, dass es 1926 war und sie achtundvierzig Jahre alt.
Die Zeit war wie ein Schatten vorbeigehuscht.
Und das war nicht alles, was sie verloren hatte. Aber diesen Gedanken schob sie von sich, so weit sie konnte.
Beinahe unvorstellbar erschien ihr, dass Cecil und sie einmal jung und verliebt gewesen waren, aber es stimmte; sie hatten milde, verführerische Nächte lang aufs glitzernde Wasser gestarrt, bevor sie nackt bei Paraggi in der Bucht geschwommen waren, während über den Bergen die Sonne aufging.
Bei dieser ersten Reise nach Portofino hatten sie sich in stillen mondbeschienenen Gassen innig geküsst, so viel Neues gespürt, so viel Neues geschmeckt – salzigen, kräftigen Prosciutto zum Beispiel und Feigen, so frisch, dass sie auf der Zunge zerplatzten.
Wenn Cecil im Hotel Tennis spielte, zog Bella allein los und folgte alten Maultierpfaden zu Bergbauernhöfen und Olivenhainen. Sie spähte durch verschlossene Tore in Gärten voll üppiger Blumen und fragte sich, wer dort wohnen mochte – und ob sie selbst jemals so wohnen würde. Sie sah den Spitzenklöpplerinnen auf dem Marktplatz zu, danach legte sie sich auf die warmen Felsen und tankte Sonne, während Eidechsen über ihre nackten Beine flitzten.
Damals waren die Sitten noch strenger, eine Frau allein unterwegs erntete Gegrummel und missbilligende Blicke. Aber davon ließ Bella sich nicht aufhalten. Warum sollte sie auch? Sie war eine dieser neuen Frauen, von denen sie in Romanen las, und sie konnte eine neue Wirklichkeit erahnen.
Einmal stieg sie die Anhöhe neben dem Hafen hinauf zur Kirche San Martino, deren gestreifte Fassade sie gelockt hatte. Abgesehen von einer alten Frau in Schwarz mit einem gehäkelten Kopftuch war sie allein dort. Als ihr der Weihrauchduft in die Nase stieg, sie die Finger ins Weihwasser tauchte und sich bekreuzigte – obwohl sie nicht katholisch war, erschien es ihr richtig –, kam es ihr vor, als würde sie eine Rolle spielen und gleichzeitig Teil von etwas sein. Es war wie eine Erleuchtung, eine Erfahrung, die sie abspeichern und von der sie später zehren konnte.
Im Leben hing so vieles von Ritualen und dem richtigen Auftritt ab, vor allem jetzt, da sie ein Hotel leitete und die Direktorin und die Concierge gleichzeitig spielte. Es wäre ihr lächerlich erschienen, ihre Arbeit als Berufung zu bezeichnen, aber sie empfand sie als zutiefst sinnvoll. Und sie war gut, das wusste sie. Umso mehr schmerzte die Erinnerung, wie skeptisch Cecil anfangs auf ihre Idee reagiert hatte.
»Ein Hotel eröffnen? An der italienischen Riviera?« Sie waren im Wohnzimmer ihres hohen, schmalen Hauses in Kensington gewesen, Cecil hatte sich gerade Single Malt nachgeschenkt. »Was in aller Welt sollte uns dazu treiben?«
Er wusste genau, wie er ihr den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Aber in diesem Fall hatte sie nicht klein beigegeben.
»Es wäre ein Abenteuer«, sagte sie munter. »Ein Neuanfang. Eine Möglichkeit, den Krieg und all das Schreckliche, das er unserer Familie angetan hat, zu vergessen.«
»Ein Hotel zu führen ist Plackerei. Überleg nur mal, um wie viel unsinniges Zeug man sich kümmern muss. Die richtigen Stühle für die Terrasse kaufen. Ausflüge in Museen organisieren. Das ist so …«
»Mittelklasse? Gewöhnlich?«
»Na ja, schon. Ganz zu schweigen von …«, Cecil verzog die Lippen, als er nach dem mot juste suchte, »prosaisch. Was nicht schlimm wäre, aber du, Bellakins, bist niemals prosaisch. Deshalb habe ich dich geheiratet. Nun ja, unter anderem deshalb.« Seufzend ließ er sich in seinen Lieblingssessel sinken. »Außerdem gibt es heutzutage zu viel Konkurrenz. Jedenfalls, wenn du Touristen der besseren Sorte anlocken willst.«
Das konnte sie nicht abstreiten. Jedes Jahr im November trat die britische Oberschicht ihre Wanderung in wärmere Gefilde an, wo sie bis zum Ende des Winters blieb. Einige bevorzugten Cannes, andere schworen auf den Lido di Venezia oder die gesundheitlichen Vorzüge von Baden-Baden. Wenn die Hitze an der französischen Riviera unerträglich wurde, galt Biarritz als herrlicher Zufluchtsort.
Die italienische Riviera war dagegen noch relativ unentdeckt. Natürlich gab es hier eine britische Kolonie – wo auf der Welt nicht? –, und die größeren Hotels lockten sogar mit Tennisplätzen und Swimmingpools.
Aber auf dieses Publikum setzte Bella nicht ihre Hoffnungen.
»Ich stelle es mir als Sommerhotel vor«, sagte sie. »Nicht als Sammelpunkt für die Zugvögel der besseren Gesellschaft.«
Cecil gab sich entsetzt. »Aber, aber! Umgekehrter Snobismus ist auch kein feiner Zug.«
»Ich bin kein Snob, weder umgekehrt noch sonst wie.« Bella bemühte sich, nicht wütend zu klingen. »Ich möchte nur, dass es interessante Menschen anspricht. Menschen, mit denen ich mich gern unterhalten würde.«
»Künstler zum Beispiel.«
»Ja.«
»Und Schriftsteller.«
»Das hoffe ich doch.«
»Menschen mit radikalen Ansichten.« Cecils spöttischer Ton war nicht zu überhören.
»Nicht unbedingt.«
»Menschen, die nicht so vornehm tun wie ich.«
Jetzt riss Bella der Geduldsfaden. »Werde nicht albern.«
»Oder so arm sind wie ich. Und finanziert wird das Projekt von deinem Vater, vermute ich.«
»Er hilft uns bestimmt mit Freude aus.«
Cecil hob spöttisch sein Glas. »Dann ein Toast – auf seine großzügige Majestät.«
Mit den Jahren hatte Bella sich angewöhnt, Cecils Sarkasmus zu ignorieren, weil sie wusste, dass er damit seine Unsicherheit überspielte. Es war zermürbend. Daher band sie ihn jetzt ganz bewusst mit ein und animierte ihn dazu, in Zeitungen und Zeitschriften nach Immobilienannoncen Ausschau zu halten, während sie stapelweise Maklerbroschüren durchging. Das sollte ihm das Gefühl geben, er sei Teil des Plans. Außerdem konnte er erstaunlich einfallsreich und sogar findig sein, wenn er nur wollte.
An der Riviera wurden zahlreiche Häuser angeboten, trotzdem fand sich in den Broschüren nichts Passendes. Die Immobilien waren entweder zu groß oder zu klein oder in den bekannteren, aber zu stark erschlossenen Urlaubsorten wie Santa Margherita und Rapallo, während Bellas Herz an Portofino mit seiner intimeren Atmosphäre hing.
Sie suchten bereits seit Monaten und waren kurz davor aufzugeben, als Cecil an einem Winterabend beiläufig die aktuelle Times unter seinem Arm hervorzog und Bella auf eine Annonce hinwies, die er in seiner geliebten burgunderroten Tinte eingekreist hatte:
Historische Villa in Portofino, elegantes Anwesen mit reizvollem Meeresblick. Strand- und stadtnah. Hervorragend als »pensione« geeignet. Nur ernsthafte Anfragen an: 12Grosvenor Square, Mayfair.
Drei Tage später fanden sie sich in Italien wieder, ganz aufgekratzt, aber auch nervös aus Sorge, nach all den Mühen – Seekrankheit und verpasste Anschlüsse hatten die Reise zu einem Albtraum gemacht – könnte das Haus sie enttäuschen. Vielleicht würde es in Wirklichkeit nicht so aussehen wie auf den Fotos, die der Verkäufer, ein älterer viktorianischer Herr, der durchdringend nach Talkumpuder roch, ihnen beim Tee gezeigt hatte.
Eine geschotterte Zufahrt gesäumt von Palmen führte zu einer großen blassgelben Villa mit einem gedrungenen Turm wie bei einem Bauernhaus aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Ein unerwarteter Hauch von Toskana, bemerkte Cecil. Es war schön, so wunderschön! Erleichterung durchströmte Bellas Körper wie Opium. Sie würde nie die eindrucksvolle Stille vergessen, als die schwere Eichentür aufschwang und sie zum ersten Mal die kühle marmorne Eingangshalle betraten.
Vi piacerà, vedrete, hatte der Agent behauptet. Es wird Ihnen gefallen.
Und jetzt waren sie hier!
Bella hörte, wie eine Tür zum Flur geöffnet wurde und ein Mann sich räusperte. Lucians Freund Nish, kurz für Anish. Er war schon seit ein paar Wochen hier – eine sanfte, gelehrte Seele, die nach dem Krieg Lucians Leben gerettet hatte, kein Zweifel.
Als Bella die Treppe hinunterging, drangen andere Geräusche zu ihr: laute Frauenstimmen, wütend oder zumindest verstimmt. Alice stürmte aus der Küche und stieß am Fuß der Treppe fast mit ihrer Mutter zusammen. Sie wirkte aufgewühlt.
»Betty schon wieder«, rief sie. »Sie regt sich furchtbar auf. Hilfst du mir, sie zu beruhigen?«
Die beiden Frauen gingen in die Küche, wo eine Fülle von Kupfertöpfen im Sonnenlicht schimmerte, das durch die offene Hoftür strömte. Der Duft des Brots im Backofen stieg Bella verführerisch in die Nase. An diesem Morgen war sie zu sehr in Gedanken gewesen, um zu frühstücken.
Betty stand am Herd, das gerötete Gesicht zu einer Grimasse verzogen. Bella ging zu ihr und fragte: »Was ist los, was haben Sie?«
»Nichts, MrsAinsworth. Ich schaffe das schon.«
»Was schaffen Sie schon?«
Ohne sich umzudrehen, deutete Betty auf das große Stück Rindfleisch, das hinter ihr auf dem Tisch lag. »So ein Stück habe ich noch nie gebraten.«
»Es ist doch Rindfleisch, oder?« Bella winkte Alice heran. Beide begutachteten das Fleischstück näher.
»Ja, sicher. Italienisches Rindfleisch.«
»Und mit italienischem Rindfleisch stimmt etwas nicht?«
»Es hat kein Fett«, sagte Betty nüchtern.
Alice schaltete sich ein. »Und das … ist nicht gut?«
Betty starrte sie an, als wäre Alice verrückt. »Da habe ich keinen Bratensaft! Für den Yorkshire Pudding! Oder die Kartoffeln! Wo wir gerade dabei sind, solche haben Sie noch nie gesehen.« Mit spitzen Fingern nahm sie eine Kartoffel aus einem Kochtopf und hielt sie hoch. »Wächserne kleine Knubbel. Gar keine richtigen Knollen.«
»Sie bekommen sie bestimmt wunderbar hin«, sagte Alice. »Das machen Sie doch immer, Betty.«
»Ich gebe mein Bestes, MrsMays-Smith.«
Alice ließ Bella mit Betty allein. Nicht zum ersten Mal bemerkte Bella, dass die ältere Frau überfordert war, und spürte dabei ihr schlechtes Gewissen. Es war nicht einfach gewesen, Betty davon zu überzeugen, in London ihre Zelte abzubrechen und den Ainsworths nach Italien zu folgen, vor allem weil sie erst ein paar Jahre zuvor aus Yorkshire dorthin gezogen war. Betty war davor nie ins Ausland gereist, und selbst London hielt sie für gefährliches fremdes Pflaster.
In ihrem ganzen Leben war sie noch nie ein so großes, kühnes Wagnis eingegangen wie diesen Umzug, und Bella hatte Betty dafür mit Lob überschüttet. Manchmal sorgte sie sich allerdings, dass sie mit ihren Ermutigungen Druck aufbaute. Und das wollte sie nicht. Sie wollte liebenswürdig sein, vor allem jemandem wie Betty gegenüber.
Wie so viele Menschen hatte Betty immer noch nicht den Krieg verwunden. Sie hatte zwei Söhne an der Westfront verloren. Zwei Söhne! Billy war ihr geblieben, aber wie musste es für sie sein, wenn ihr Blick auf Lucian fiel? Jeden Tag musste es sich anfühlen, als würde ein Glassplitter in ihrem Fuß stecken.
Ihr den Reiz Italiens zu beschreiben war schwierig gewesen, auch wenn er für Bella offensichtlich war. Sie zeigte Betty Postkarten, die sie von ihrer Hochzeitsreise mitgebracht hatte. Von Hand teilkoloriert, voller Erinnerungen an Sonne und Glück. Die Strategie schien zu funktionieren – sie beruhigte Betty, dass Italien ein zivilisiertes Land war, ein sicherer Ort für sie und ihren vaterlosen Sohn, auch wenn die Nachrichten manchmal ein anderes Bild zeichneten.
»Wie sieht es mit dem Essen aus?«, hatte Betty misstrauisch gefragt.
Bella hatte aus ihrer Tasche ein Buch hervorgeholt. Mit ihrer molligen Hand hatte Betty über den weichen grünen Stoffeinband gestrichen und dann mit zusammengekniffenen Augen den Titel gelesen: »Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens von Pellegrino Artusi.«
»Darin steht alles, was Sie wissen müssen«, hatte Bella gesagt. »Niemand schreibt besser über italienisches Essen als dieser Mann.«
Betty hatte gelächelt. Sie war zurecht stolz darauf, lesen zu können. »Ich werde mich jeden Abend damit hinsetzen.«
Bettys erste Versuche konnte man nicht als kulinarische Glanzleistungen bezeichnen. Besonders denkwürdig war ihre Version einer Minestrone, allerdings aus ganz falschen Gründen.
»Was in aller Welt ist das?«, fragte Cecil und rührte in dem matschigen Gemüse.
Vorsichtig kostete Bella die Suppe. Die Minestrone war so scharf, dass Bella sich überrascht die Serviette vorhielt, um ein Husten zu unterdrücken. »Ich glaube, sie hat Bärlauch genommen. Eine ganze Menge. Na ja. Das ist nicht schlimm.« Sie legte ihren Löffel beiseite. »Wir müssen sie ermutigen, Cecil. Außerdem wird sie nicht jeden Tag italienisch kochen. Viele unserer Gäste essen sicher lieber Pasteten mit Rindfleisch und Nieren.«
Schon nach ein paar Wochen hatte sich viel verändert. Betty war eine fleißige und fähige Köchin. Und ihr Sohn Billy war zu einem beeindruckenden, vertrauenswürdigen jungen Mann herangewachsen, der einen hervorragenden Hoteldiener abgeben würde. Bald wollte Bella ihm das Kellnern beibringen – die hohe Kunst des aufmerksamen Belauerns.
Jetzt drückte Bella sanft Bettys Schulter. »Sie machen das wunderbar. Das Essen, das Sie zaubern. Es ist himmlisch.«
Betty errötete vor Freude. »Das ist sehr nett von Ihnen, MrsAinsworth.«
»Und Billy hilft Ihnen, oder?«
Betty nickte. »Ich habe ihn losgeschickt, um Sahne für den Zitronenpudding zu holen.«
»Das ist gut. Und vergessen Sie nicht, dass Sie bald auch Constance hier haben. Sie wird Ihnen in der Küche zur Hand gehen können, wenn sie nicht auf Lottie aufpasst.«
Als sie das hörte, drehte Betty sich zu Bella um und erstarrte. »Welchen Tag haben wir heute?«
»Donnerstag.«
»O nein …« Die Köchin schlug sich eine Hand vor den Mund.
»Was ist los, Betty?«
»Es ist heute. Constance kommt heute an. Mit dem Zug aus Genua.«
»Das ist doch der Zug, den Lucian abpassen will. Der Zug mit den Drummond-Wards.«
»Oh, MrsAinsworth.« Betty wirkte den Tränen nah. »Und Sie haben mir vertraut, dass ich alles vorbereite. Weil Constance eine Freundin der Familie ist …«
»Keine Panik, Betty. Vielleicht ist Lucian noch nicht losgefahren. Dann kann er Constance gleich mitbringen.«
Sie bemühte sich, zuversichtlich und munter zu klingen. Allerdings war die Situation alles andere als ideal. Nach dem, was Bella über Julia Drummond-Ward gehört hatte, würde sie es nicht gut annehmen, wenn sie die Kutsche mit einer Bediensteten teilen musste. Außerdem war Lucian mit ziemlicher Sicherheit längst unterwegs zum Bahnhof Mezzago. Bella hatte mit ihm gesprochen, als er darauf gewartet hatte, dass Francesco die Pferde einspannte.
Eilig lief Bella ins Foyer und rief Lucians Namen, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Ihre Stimme hallte noch von den Wänden wider, als Nish aus der Bibliothek kam.
»Er ist nicht hier, MrsAinsworth. Er ist vor einer Stunde aufgebrochen. Er wollte auf keinen Fall zu spät kommen, um Rose abzuholen.«
»Und ihre Mutter«, erinnerte Bella ihn.
»Natürlich. Sie auch.« Nish lächelte. »Kann ich bei irgendetwas helfen?«
»Nein, nein«, winkte Bella ab. »Entspannen Sie sich, ruhen Sie sich aus. Sie sind unser Gast hier.«
»Aber diese Woche ist wichtig für das Hotel. Und für Sie.«
Das ließ sich nicht abstreiten. Montag waren die ersten Gäste eingetroffen – erst Lady Latchmere und ihre Großnichte Melissa, dann Graf Albani und sein Sohn Roberto. Am Wochenende würde das Hotel voll belegt sein.
Über die Buchung des Grafen hatte Bella sich besonders gefreut. Damit hatte er der breiten Öffentlichkeit signalisiert, dass auch Italiener das Hotel Portofino besuchten. Cecil jedoch war nicht überzeugt davon, dass sie dieses Signal ausstrahlen sollten.
Wo in aller Welt war er jetzt? In letzter Zeit flog er immer öfter und ohne Ankündigung aus. Würde er zurückkommen, bevor die Drummond-Wards eintrafen? Bei ihrer ersten Begegnung mit Julia wollte Bella nicht allein sein. Sie kannte Julias und Cecils Vorgeschichte. Und sie empfand dieser Frau gegenüber starke, komplizierte Gefühle. Neugier, Neid – sogar Angst. Wofür war ein Ehemann gut, wenn er ihr in einer solchen Situation keinen Rückhalt bot?
»Geht es Ihnen gut, MrsAinsworth?« Nish riss Bella aus ihren Gedanken.
»Ich mache mir nur Sorgen wegen Constance«, sagte sie. »Dem neuen Kindermädchen. Sie kommt offenbar mit dem Zug der Drummond-Wards. Aber jetzt können wir nichts mehr ausrichten. Sie muss allein hierherfinden.«
»Das schafft sie bestimmt«, sagte Nish. »Als ich in Mezzago ankam, hat es vor eifrigen Taxifahrern nur so gewimmelt.«
Bella lachte. »Warum beruhigt mich das jetzt nicht?«
Mit aufgepflanztem Bajonett stellte Lucian einen Fuß fest auf den Schützenauftritt, den anderen auf die wackelige Leiter an der Grabenwand. Er lehnte den Kopf gegen die oberste Sprosse, schloss die Augen und flüsterte ein Gebet.
Hörte Gott zu? Er sah nicht viel, was dafür sprach.
Die Dämmerung zog schwer heran, sie verschmolz Himmel und Erde zu einer formlosen grauen Masse. Eiskalter Regen traf Lucians Gesicht wie Nadelstiche. Seine Hände und Füße waren verfroren, aber an seinem Rücken lief trotzdem Schweiß herab. Um ihn herum donnerten die Waffen. Wann hatte es zum letzten Mal eine Pause von diesem Getöse gegeben? Lucian hielt es nicht mehr nach. Er hatte sich an diese Welt der kalten, beklemmenden Angst gewöhnt.
Vielleicht war ein Teil von ihm schon seit Langem daran gewöhnt. In der Schule hatte Lucian eine Bewältigungsstrategie für die Momente perfektioniert, wenn er wieder einmal für irgendein banales Vergehen Schläge mit dem Rohrstock bekam. Er hatte sich so tief in sich zurückgezogen, dass er die Schmerzen nicht mehr gespürt hatte.
Jetzt versuchte er es mit derselben Taktik, er konzentrierte sich auf seine Atmung und den Puls, der in seinen Ohren pochte. Aber das ferne Dröhnen der Haubitzen, das Heulen und die Einschläge der Granaten konnte er nicht ignorieren. Jede verstreichende Sekunde erschien wie eine Ewigkeit.
Und dann kam es – das geisterhafte Pfeifen die Reihe entlang. Der barsche Befehl, sich bereitzuhalten. Lucian stützte sich an der lehmigen Grabenwand ab. Vollkommen durchgefroren. Wenn eine Granate explodierte, flogen winzige Stückchen hart wie Mauersplitter herum.
Plötzlich gellte ein Pfeifen in sein linkes Ohr. Es war klar, was das bedeutete. Er war an der Reihe. An der Reihe, seine Pflicht zu tun und aus dem Graben zu klettern …
Lucian riss die Augen auf, der Anblick war unerwartet: ein untersetzter Mann mit Schnurrbart, roter Schirmmütze und langem Mantel mit Messingknöpfen. Er beugte sich zu Lucian vor und rief auf Italienisch: »Signore! Il treno da Nervi sta arrivando!« Dann trat er behutsam zurück.
Mit hämmerndem Herzen setzte Lucian sich auf.
Es war wieder passiert. Er musste eingeschlafen sein. Wie so oft hatte er von Cambrai geträumt. Furchtbare Träume, die ihn zurück an die Front versetzten.
Wieder ertönte dieses Geräusch, Lucian zuckte zusammen und klammerte sich an seinen Stuhl. Wo war er? Sein Blick huschte nervös umher, aber er beruhigte sich, als er die Terrakottafliesen sah, die bunten Plakate und die Sonne, die durch die Fenster strömte.
Natürlich.
Der Warteraum am Bahnhof Mezzago. Die Panik ebbte ab.
Der wuchtige Bahnhofsvorsteher füllte den Türrahmen aus. Er nahm die Pfeife aus dem Mund, blickte zu Lucian hinüber und deutete mit dem Daumen auf den stehenden Zug. Lucian stand auf und folgte ihm auf den Bahnsteig. Es war unheimlich, wie sehr dieser Mann Lucians früherem Sergeant-Major ähnelte. Andererseits schienen diese Geister überall aufzutauchen.
Mit einem Schritt in die Hitze zu treten war ein wunderbares, belebendes Gefühl. Er atmete tief ein und roch Jasmin und heißen Asphalt. Auf dem Bahnsteig herrschte ein Durcheinander von Fahrgästen und Gepäckträgern, Dampf und Stimmen. Lucian schlängelte sich durch die Menge bis zum Abteil der ersten Klasse.
Er sollte Julia Drummond-Ward, eine alte Freundin seines Vaters, und ihre Tochter abholen. Alte Freundin … Lucian wusste, was das bedeutete, auch wenn darüber offiziell nicht gesprochen wurde.
»Habe ich MrsDrummond-Ward schon einmal gesehen?«, hatte er seine Mutter gefragt.
»Nur ein Mal, als du klein warst.«
»Wie soll ich sie dann erkennen?«
Sie hatte hintergründig gelächelt. »Ich vermute, dass es wenig Gelegenheit für eine Verwechslung geben wird. Aber wenn es dich beruhigt, hat dein Vater sicher noch irgendwo ein altes Foto verwahrt.«
So schmal hatte Lucian den Bahnsteig nicht in Erinnerung gehabt. Eine große Gruppe drängte näher und versperrte ihm die Sicht. Es dauerte einen Moment, bis die Menge sich lichtete, aber dann entdeckte Lucian ein Stück entfernt eine stattliche Frau, die er sofort und ohne Frage erkannte.
MrsJulia Drummond-Ward.
Sie war auf den Bahnsteig heruntergestiegen, klammerte sich an einen Sonnenschirm und bemühte sich um ein gefasstes Auftreten. »Scusi!«
Mit schnellen Schritten eilte Lucian zu ihr und streckte ihr die Hand entgegen. Sie ergriff sie nicht. Stattdessen ließ sie ihren Blick von seinem gebräunten Gesicht zu seinem kragenlosen weißen Hemd und den aufgekrempelten Ärmeln gleiten.
»Meine Tochter«, sagte sie mit einer Geste Richtung Zug.
Und dann sah Lucian zum ersten Mal Rose: An der Tür des Abteils schickte sie sich an auszusteigen. Sie trug ein langärmliges Spitzenkleid mit einem Taillenband, das ihre schmale Mitte betonte. Ein breitkrempiger Strohhut hatte Mühe, ihre kastanienbraunen Locken zu bändigen. Wenn sie von der Reise ein wenig erschöpft wirkte, tat das ihrer außergewöhnlichen natürlichen Schönheit keinen Abbruch. Es unterstrich sie sogar – ließ sie noch natürlicher wirken, falls das überhaupt möglich war.
Rose bemerkte Lucians Blick und erwiderte sein Lächeln. Ihm wurden die Knie weich. Er fühlte sich schüchtern und – ganz untypisch für ihn – unzulänglich.
Die ältere Frau hatte ihn nicht aus den Augen gelassen. Sie sagte abrupt: »Nostri bagagli«, und zeigte auf den Gepäckwagen. Dann sagte sie genauso laut, aber langsamer, als würde sie mit einem Kind sprechen: »Unser Gepäck. Es sind acht Koffer.« Sie hielt sechs Finger und zwei Daumen hoch. »Otto.«
Lucian hielt ein Lachen zurück, als ihm die Wahrheit dämmerte. MrsDrummond-Ward hatte keine Ahnung, wer er war. Verständlich, mit seiner Arbeiterbräune und den pechschwarzen Haaren wirkte er wirklich südländisch, wie sie es wahrscheinlich genannt hätte.
Wenn sie ihn also für einen Italiener hielt, würde er den Italiener geben. Er verbeugte sich leicht. »Signora.«
»Und verlieren Sie nichts!«
Er neigte den Kopf. »Nein, Signora.«
Lucian machte auf dem Absatz kehrt und marschierte zum Gepäckabteil. Erleichtert sah er, dass die Koffer der Damen schon auf dem Bahnsteig aufgestapelt waren, und überwachte, wie sie auf einen Gepäckwagen geladen wurden. Er blieb dicht bei dem Gepäckträger, als sie durch den Bahnhof und hinaus auf die Piazzetta gingen.
Mehrere Mietdroschker buhlten um Fahrgäste. Nachdem Lucian einen annehmbaren Preis vereinbart hatte, lud er die meisten Koffer der Damen in die vertrauenerweckendste der leichten Kutschen. Das restliche Gepäck würde mit den Drummond-Wards im Gefährt des Hotels Portofino reisen, das Lucian selbst instand gesetzt und in seiner inoffiziellen Rolle als Hotelkutscher nach Mezzago gelenkt hatte.
Lucian kehrte zu den wartenden Frauen zurück. Er merkte, dass er ein wenig anders ging als sonst – ungefähr so, wie er es sich bei einem italienischen Bauern vorstellte. Sorglos und stolz, so gut er es mit seinem zerschundenen Körper hinbekam.
Sie hatten unter einer Markise Schatten gefunden. Trotzdem machte MrsDrummond-Ward ein finsteres Gesicht und fächelte sich Luft zu. Ihr Wollkleid war für dieses Wetter viel zu warm. Rose schien es weniger auszumachen. Sie bestaunte ihre neue Umgebung. Große Güte, war sie schön. Eine Frau wie sie hatte Lucian noch nie gesehen – nicht von Nahem und leibhaftig. Sie sah aus wie ein Filmstar aus einer Zeitschrift.
Lucian hätte zu gern etwas gesagt – er wollte das alberne Spiel beenden, das er begonnen hatte. Nur wusste er nicht recht, wie er es anstellen sollte, ohne die Frauen zu brüskieren. Außerdem musste er zugeben, dass es amüsant wäre zu sehen, ob er das Spiel durchhalten und vielleicht sogar gewinnen konnte, denn es war zweifellos ein Wettstreit. Nicht zwischen Lucian und Rose – nichts konnte gegen sie bestehen –, aber zwischen ihm und ihrer stolzen, mürrischen Mutter.
Fünf Minuten später hatte Lucian das Paar in die Kutsche verfrachtet. MrsDrummond-Ward hatte der harten Sitze wegen ein ziemliches Aufheben gemacht, aber bald beruhigte sie sich, und nachdem sie es sich bequem gemacht hatte, redete sie in einem fort.
Über Kopfsteinpflaster fuhren sie zur Küstenstraße. Lucian war auf seinem Platz vorn ständig versucht, sich umzudrehen und mit seinen Fahrgästen zu plaudern, wie es ein örtlicher Fahrer tun würde. Ecco la famosa chiesa! Attenta al vestito, per favore … Dabei könnte er auch einen Blick auf die himmlische Rose erhaschen. Aber er sprach nur rudimentär Italienisch, und MrsDrummond-Ward ließ sich ohnehin nicht ablenken.
Sie redete und redete. Trat in dem hochnäsigen Geschwätz doch einmal eine Pause auf, und Rose warf nicht schnell genug etwas ein, sagte ihre Mutter: »Hör mir doch zu!«, und Rose antwortete: »Ja, Mama«, so tonlos, dass es beinahe aufsässig wirkte.
Nach mehreren Haarnadelkurven folgte ein gerades Stück Straße, und Lucians Gedanken schweiften ab. Als sich das Gespräch seiner eigenen Familie zuwandte, spitzte er wieder die Ohren.
»Sie gehören zu den ältesten Familien im Land«, sagte MrsDrummond-Ward. »Ich kannte Cecil schon als Kind.«
»Und was ist mit MrsAinsworth?« Eine unschuldige Frage, ohne Hintergedanken.
»Meine Güte, nein. Sie ist von ganz anderem Schlag.«
»Von anderem Schlag?«
»Sei nicht so begriffsstutzig, Rose. Du weißt genau, was ich meine.«
»Ich glaube nicht, Mama.«
»Sie ist die Art Frau, die es nicht seltsam findet, ein Hotel zu eröffnen.« Sie senkte die Stimme. »Ihr Vater ist der Besitzer einer Lederfabrik. Und es stört ihn nicht, dass alle Welt das weiß!«
Den richtigen Trick für den Umgang mit ihrer Mutter hatte Rose vor Langem herausgefunden: Man durfte nicht anbeißen, wenn sie provozierte. Tat man es doch, erntete man Wut, bald gefolgt von Schmollen. Es war viel besser, gelassen und sanftmütig zu bleiben. Was nicht dasselbe war, wie passiv zu sein, nicht wenn man sich bewusst so gab. Aber es überraschte Rose, wie sehr sie die Bemerkungen ihrer Mutter immer noch trafen, obwohl sie über zwanzig und damit erwachsen war.
Bald – hoffentlich bald! – würde sie verheiratet sein. Warum also konnte sie über Mamas Kränkungen und Erniedrigungen nicht einfach hinweggehen?
Vorhin im Zug war es zu einer beispielhaften Situation gekommen. Bei der Einfahrt in den Bahnhof hatte Rose sich aus dem Fenster gelehnt, um den entzückenden kleinen Bahnsteig und das emsige Treiben besser betrachten zu können. Aber Mama hatte das sehr missbilligt. Sie hatte Rose ihren scheußlichen Sonnenschirm in die Seite gestoßen – ja, richtig gestoßen! »Komm vom Fenster weg, Rose! Du machst dir das Kleid schmutzig.«
Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als zu gehorchen.
Hätte Rose doch nur allein nach Italien reisen können. Es wäre ganz wunderbar gewesen! Aber das kam natürlich gar nicht infrage. So etwas kam nie infrage. Eine junge Dame brauchte eine Anstandsdame. Und diese Anstandsdame … musste Mama sein.
Aber warum? Mama verabscheute »das Ausland«, wie sie immer sagte. Ihr Enthusiasmus für diese Reise hatte früh nachgelassen, schon als sie ihre erste Station Rom erreichten.
Rose und sie hatten ein paar Tage in einer achtbaren Pension nahe der Spanischen Treppe verbracht. Rose war zum ersten Mal in Italien, und vor Aufregung ganz kribbelig, freute sie sich darauf, Spaghetti zu essen und ihr Italienisch auszuprobieren, das sie mühsam mit einem alten Grammatikbuch in ihrer Bibliothek gelernt hatte. Ihre Mutter war dagegen bei den wenigen Besichtigungstouren, zu denen sie Rose begleitete, noch unwirscher und unbeeindruckter als normalerweise. Mit der Zeit war Rose so frustriert, dass sie beschloss, ihrer Enttäuschung ausnahmsweise Ausdruck zu verleihen.
Natürlich nahm Mama sich nichts von den Klagen an, die Rose ihr nervös und scheu vortrug. »Du lässt dich zu leicht zu einem verklärten Blick verleiten. Als junges Mädchen habe ich eine Grand Tour unternommen, daher kenne ich Italien gut – vielleicht sogar zu gut. Vergiss nie, dass in diesem Land vor allem ungebildete Bauern leben.«
»Dante war Italiener«, wandte Rose ein. Was hoffentlich stimmte. Zumindest klang es, als würde es stimmen.
Mama lachte schroff. »Was weißt du schon von Dante? So oder so, es wird dir nicht helfen, einen passenden Ehemann zu finden.«
Rose fühlte sich, als würde sich ein schwerer Umhang um sie schlingen. Sie konnte sich nicht bewegen und nicht atmen. Sie sehnte sich danach, ihn abzustreifen und … sie selbst zu sein. Wer auch immer »sie selbst« war. Vielleicht konnte und würde ihr das im Hotel Portofino gelingen.
Bald mussten sie dort sein. Während Mama zu ihrer Rechten über die Grauen von Sozialsiedlungen schwadronierte – »So etwas gibt es hier immerhin nicht, wie du siehst. In Italien sind die Armen arm und zufrieden damit« –, genoss Rose den ungewohnten Anblick der Dörfer auf ihrem Weg. Braun gebrannte Mädchen streckten die Köpfe aus den Fenstern der oberen Etagen, vor den Häusern saßen alte Damen und strickten, während zu ihren Füßen Kinder spielten. Alles war ungemein charmant. Will man Italien begreifen, muss man die Menschen dort ebenso betrachten wie die Kunst. Wo hatte sie das gelesen? Sie wusste es nicht mehr. Ihr Gedächtnis war furchtbar! Mama beschwerte sich ständig darüber.
Besonders faszinierend fand Rose den Hinterkopf des Kutschers. Schwarze Locken ringelten sich über seinen Nacken. Seine breiten Schultern waren nicht zu übersehen, die Muskeln zeichneten sich deutlich unter seinem kragenlosen weißen Hemd ab, das in der Mitte des Rückens schweißnass war.
Rose drängte ihn in Gedanken dazu, sich umzudrehen, aber natürlich tat er es nicht, er konnte es nicht. Er musste auf die Straße achten, die kaum eine Straße war, eher eine furchige, in den Hang geschlagene Spur.
Trotzdem, dachte sie. Trotzdem. Es wäre doch schön, sein Gesicht zu sehen.
Sie erreichten Portofino, als die größte Hitze des Tages schwand. Die Kutsche folgte dem gewundenen Weg voll Staub und lockerer Steinchen den Hügel hinauf.
Zur Linken wuchsen in einem Orangenhain chinotti, die bitteren kleinen Orangen, die dem Campari, einem von Lucians Lieblingsgetränken, seinen Geschmack verliehen.
Lucian hatte sie schon bei seiner ersten Reise nach Ligurien bestaunt, sie hatten seinen Eindruck untermauert, dass alles in diesem sonnendurchfluteten Italien das Gegenteil von Krieg bedeutete. In Frankreich hatte ihm ein anderer Offizier im schrecklichen Winter 1917 zwei zusammengefrorene Orangen gezeigt. »Sieh dir die Dinger an! Hart wie Cricketbälle!«
Hier gab es ganz sicher keine gefrorenen Orangen.
Nachdem das Genesungsheim Lucian entlassen und er sich so weit auskuriert hatte, dass er sich länger als zehn Minuten am Stück konzentrieren konnte, lieh er sich von seiner Mutter ihren uralten Baedeker-Reiseführer für Italien. Er liebte die Abbildungen und Landkarten darin, die gesalzenen, vernichtenden Kritiken von diesem Restaurant und jenem Hotel.
Er beschloss, irgendwann aufs Festland zu gehen und wie sein großes Vorbild David Bomberg zu malen. Denn das war er, ein Maler – da konnte sein Vater sich auf den Kopf stellen! Lucian würde sich keine Belehrungen gefallen lassen von einem Mann, der in seinem Leben noch keinen Tag richtig gearbeitet hatte.
All seine Freunde planten ihre Flucht aus einem England, das ihnen schäbig und geschwächt erschien. Die besten Autoren und Künstler hatten schon ihre Zelte abgebrochen, vor allem wenn sie im Krieg gekämpft hatten. Was sollte sie dort auch halten? Das beständige patriotische Gepolter mit dem Unterton völliger Ignoranz darüber, was tatsächlich auf den Schlachtfeldern Frankreichs und Belgiens geschehen war?
»England ist ein Land der Philister«, sagte Nish immer, »aber das ist den Menschen dort nicht klar. Dieses Land besitzt keinerlei kulturellen Einfluss. Deshalb ist das Empire auch dem Untergang geweiht.«
Guter alter Nish. Bei ihm wusste man immer, woran man war.
Jetzt hielt Lucian die Kutsche vor dem letzten abschüssigen Wegstück an, um den Pferden eine Pause zu gönnen und seinen Fahrgästen die Gelegenheit, den Ausblick zu bewundern: die hohen pastellfarbenen Häuser, die sich an die Bucht schmiegten, und die Boote, die sanft auf dem herrlichen azurblauen Wasser schaukelten. Er nahm an, das würde ihnen gefallen – dieser Anblick wäre für sie ebenso eindrucksvoll wie für ihn beim ersten Mal. Doch während es Rose hörbar den Atem verschlug, war MrsDrummond-Ward nur verdutzt.
»Warum hat er angehalten?«, hörte Lucian sie fragen.
»Ich weiß nicht. Damit wir die Aussicht genießen können, vermute ich.«
»Aber ich will hier nicht stehen bleiben.« Sie tippte Lucian auf die Schulter. »Weiter, bitte.« An Rose gewandt: »Wie sagt man: ›Fahren Sie zum Hotel?‹«
»Ich versuche, mich zu erinnern.«
»Dann sag es. Sag es dem Fahrer.«
»Vai in albergo?« Rose hielt die Luft an …
»Certo«, antwortete Lucian. Zum ersten Mal seit ihrer Abfahrt vom Bahnhof wandte er sich um und fing Rose’ Blick auf. Als sie sich kurz anlächelten, wurde ihm leicht ums Herz. Sie hat gemerkt, wer ich bin, dachte er. Oder zumindest vermutet sie es stark.
Lucian drehte sich grinsend nach vorn und trieb die Pferde weiter, den Hügel hinunter zum Hotel.
ZWEI
Billy lief eilig durch das Foyer und zerrte dabei an seiner Jacke, die glänzenden schwarzen Schuhe klackerten auf dem Marmorboden. »Wann kommen sie an, MrsAinsworth?«
Bella wartete an der Tür auf ihn. »Jeden Moment, Billy. Kommst du mit der Uniform nicht zurecht?« Sie senkte die Stimme, falls ihm die Frage peinlich war.
»Nur mit dem Kragen nicht.« Er zwängte einen Finger unter die gestärkte Baumwolle. »Ich bekomme es nicht hin, dass er richtig sitzt.«
»Warte, ich helfe dir.« Bella beugte sich vor und richtete seinen Kragen. Bei der Gelegenheit steckte sie auch seine Hemdzipfel in die Hose und rückte ihm die Krawatte zurecht. Seit er klein war, verspürte sie diesen seltsamen Drang, ihn zu bemuttern. Sie warf sich in Positur und sagte: »Vergiss nicht, Billy. Der erste Eindruck zählt.«
Er grinste breit. »Der erste Eindruck. Ja, Ma’am!«
Die Kutsche wurde vom Knirschen der Räder auf dem Kies angekündigt, dann hielt sie vor der mit Säulen eingefassten Tür. Billy eilte nach draußen, um Francesco mit dem Gepäck zu helfen. Bella hatte sich entschlossen, die Drummond-Wards an der Eingangstreppe statt hinter der Rezeption willkommen zu heißen. Sie sah, wie Julia ihr Portemonnaie öffnete und ein paar Münzen in Lucians Hand fallen ließ.
»Grazie«, sagte sie. »Für Ihre Hilfe.« Eine äußerst seltsame Geste, wie Bella fand. Sie nahm sich vor, Lucian bei erster Gelegenheit danach zu fragen.
Jetzt allerdings rief die Pflicht.
Sie trat vor. »MrsDrummond-Ward. Rose. Willkommen!«
«MrsAinsworth?« Julia streckte ihr eine behandschuhte Hand entgegen, die Bella herzlich schüttelte.
»Bitte«, sagte sie, »nennen Sie mich Bella. Ich hoffe, ich darf Sie Julia nennen?«
Julia nickte knapp.
»Wie war Ihre Reise?«
»Lang«, antwortete Julia tonlos. »Und überaus ermüdend.«
»Nun, dann wollen wir unser Bestes geben, damit es sich gelohnt hat.« Sie deutete auf die Fassade der Villa, die im hellen Sonnenlicht strahlte. »Willkommen im Hotel Portofino!«
Im Gegensatz zu ihrer Mutter schien Rose von dem Gebäude hingerissen zu sein. Sie strahlte vor Freude, als sie den Kopf in den Nacken legte und ihre neue Umgebung betrachtete. »Wie durch und durch bezaubernd.«
Bella übernahm die Initiative und hakte sich bei Rose unter. »Ich hoffe, Lucian hat Ihnen auf dem Weg vom Bahnhof hierher einen ersten Überblick verschafft.«
»Lucian?«
»Ja.«
Julia schloss zu ihnen auf. »Unser Fahrer war Lucian?«
»Ja, sicher.«
»Aber ich dachte … Wir dachten …«
»Was?« Bella sah sich nach Lucian um in der Hoffnung, er könne ihr zur Rettung eilen. Aber er war nirgends zu sehen.
Im Wohnzimmer der Ascot Suite legte Melissa ihr Buch beiseite, um die Ankunft der Drummond-Wards vom Fenster aus zu beobachten. Sie boten einen reizenden Anblick, ganz elegant und prunkvoll. All die Gerüchte stimmten, das Mädchen war bildhübsch.
Melissa schwelgte in Spekulationen. Wie viele Kleider hatten die Drummond-Wards mitgebracht? Würden sie den ganzen Sommer über bleiben?
Aber dann rief ihre Großtante aus dem angrenzenden Schlafzimmer: »Melissa! Woher kommt dieser scheußliche Lärm?«
»Ich glaube, es sind neue Gäste gekommen.«
»Wirklich? Meine Güte. Ich wusste es, wir hätten eine Villa mieten sollen.«
Dieses Lamento gab sie nicht zum ersten Male von sich. Melissa ließ den Blick durch das geräumige, exquisit eingerichtete Zimmer schweifen. »Ich bezweifle sehr, dass es so komfortabel gewesen wäre«, sagte sie.
Lady Latchmere stand plötzlich in der Tür, als wäre sie durch eine versteckte Falltür erschienen. »Aber vielleicht mit ein wenig mehr Privatsphäre, oder?«
Welch eigenartige Frau sie war. Die – erst ganz leicht – grau melierten Haare trug sie hoch aufgetürmt, ihre eindrucksvolle Gestalt war in ein schwarzes Samtkleid mit Rüschenkragen gehüllt. Melissa hatte keine Ahnung, wie alt ihre Großtante war, und keine einfache Möglichkeit, es herauszufinden: Die Menschen, die es möglicherweise wussten, hätten auf eine solch unverfrorene Frage nicht gut reagiert. Sie fand es in jedem Falle bemerkenswert, dass Lady Latchmeres träges Gebaren so wenig zu ihrer offensichtlich robusten körperlichen Verfassung passte, genauso wenig wie ihre altmodische Kleidung, die offen gesagt in einen Kostümladen gehört hätte, zu ihrer glatten, faltenfreien Haut.
Allerdings bestand Melissas Aufgabe hier in Italien darin, Lady Latchmeres Marotten zu ertragen, nicht darin, sie zu hinterfragen. Sie setzte ein strahlendes Lächeln auf. »Wie fühlst du dich heute, Tante?«
»Ganz furchtbar!«
»Soll ich Bescheid sagen, dass du nicht am Dinner teilnimmst?«
»Wo denkst du hin, meine Liebe? Ich muss bei Kräften bleiben.« Lady Latchmere kam langsam näher und stützte sich dabei auf einen Stock, gegen den Melissa den Argwohn hegte, er könne bloße Requisite sein. »Also gut, sag es mir.« Sie spähte aus dem Fenster. »Welchen Eindruck hast du von dem Drummond-Ward-Mädchen?«
Melissa zuckte zusammen. Sie konnte es nicht ausstehen, wenn man sie derart in Verlegenheit brachte. »Ich weiß nicht, Tante.«
»Nun, heraus damit. Du wirst dir doch eine Meinung gebildet haben.«
»Über ihr Aussehen, ja.«
»Dann lass sie hören!«
Melissa wählte ihre Worte mit Bedacht. »Na ja, sie hat sehr schöne Haare. Und sie geht eindeutig mit der neuesten Mode.«
»Glaubst du, der junge Lucian wird sie mögen?«
»Keine Ahnung«, sagte Melissa. »Warum fragst du?«
Lady Latchmere seufzte. »Also wirklich, Melissa. Du musst besser aufpassen.« Sie beugte sich vor und flüsterte theatralisch: »Ihre Eltern wollen, dass sie heiraten!«
Sie wohnten in der Epsom Suite.
Die liebenswürdige Bella, die sie so freundlich willkommen geheißen hatte, sagte, ihr Mann – Mamas besonderer Freund in ihrer Jugend – sei auf die Idee gekommen, jede Suite nach einer berühmten Pferderennbahn zu benennen. Diese hier bestand aus zwei Zimmern mit französischen Balkonen mit Blick aufs Meer.
Die Aussicht war beeindruckend. Allerdings langweilte sie Rose auch ein wenig, wenn sie ehrlich war. Immerhin machte das Meer nicht viel. Es war einfach … das Meer. Überall auf der Welt sah es gleich aus.
Rose und ihre Mutter ruhten sich eine Weile von der beschwerlichen Reise aus. Dann schlüpfte Rose nach einer Katzenwäsche mit einem Schwamm in ihr neues Kleid – ein seidenes Modell von Chanel mit Metallic-Spitze und reihenweise überlappenden Pailletten –, während Julia sich im Bad zurechtmachte.
Eine Stunde später war sie immer noch nicht hervorgekommen.
Also wirklich, dachte Rose. Wen will sie denn beeindrucken?
Sie verfolgte diesen Gedanken nicht weiter, sondern gab sich ihrem Entdeckergeist hin, sah sich in der Suite um, öffnete eine Schublade und fand ein Beutelchen aus Musselin mit getrocknetem Lavendel. Diese kleinen aufmerksamen Details waren wirklich entzückend! Im Vergleich wirkte die alte Pension in Rom nun regelrecht trist, obwohl sie Rose noch vor wenigen Tagen so bezaubernd erschienen war.
»Mama!«, rief sie.
»Was ist?«
»Sieh mal, wie hübsch und reizend alles ist. Glaubst du, MrsAinsworth sorgt selbst dafür?«
Die Stimme ihrer Mutter drang aus dem Bad zu ihr. »Sie macht sich sicher gern die Hände schmutzig. Das liegt in der Familie.« Julia erschien in der offenen Tür. »Bist du so weit?«
»Seit einer Ewigkeit.«
Julia rauschte zu Rose hinüber. »Lass dich mal ansehen.«
Rose stand geduldig da, während ihre Mutter ihr am Kleid herumzupfte, die Brüste zurechtrückte und in die Wangen kniff, damit sie Farbe bekam. Nach endlosem Gewese verkündete sie, so könne Rose sich blicken lassen. Sie drehte das Mädchen zu dem hohen vergoldeten Spiegel um, und sie begutachteten zusammen das Spiegelbild – Rose wusste nicht recht, worauf sie achten sollte, ihrer Mutter war es umso klarer. Julia straffte die Schultern und bedeutete Rose, sie solle es ihr nachtun.
»Haltung«, sagte sie, »die Haltung ist das Wichtigste. Vergiss nicht, was deine alte Tanzlehrerin immer gesagt hat.«
Lange schwiegen sie, nur das Gelächter von Männern im Zimmer unter ihnen war zu hören.
Dann fragte Rose beiläufig: »Glaubst du, dass Lucian zum Dinner kommt?«
»Wer weiß? Ich muss schon sagen, ich fand sein Verhalten heute Nachmittag sehr ungewöhnlich.«
Rose beschloss, es auf eine Diskussion ankommen zu lassen. »Immerhin hast du ihn für einen Italiener gehalten. Du hast ihn angesprochen, als wäre er Italiener.« Bei der Erinnerung musste sie lächeln.
»Und er hatte reichlich Gelegenheit, mich zu korrigieren. Aber aus irgendeinem Grund hat er es nicht getan. Er hat offensichtlich viel von seinem Vater.« Julia runzelte die Stirn. »Wo ist Cecil eigentlich?«
Ach, das ist es also, dachte Rose. Deshalb bist du noch übellauniger als sonst.
Stilvoll und gemessenen Schrittes stiegen sie die Treppe hinab.
»Ich werde nicht viel essen«, flüsterte Julia, »und ich rate dir dasselbe.«
»Aber ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen.«
»Hunger ist nicht so wichtig, wie deine Figur zu behalten.«
Bella begrüßte sie am Eingang des Speisesaals. Der Raum war nur halb besetzt, trotzdem spürte Rose die Blicke der anderen Gäste auf sich, als sie ihrer Mutter unter leisem Gemurmel zu einem Tisch vor den offenen Terrassentüren folgte.
Die Aufmerksamkeit verwandelte die stechende Leere in ihrem Magen in ein warmes Glimmen.
Ein Windhauch fuhr durch den Raum und ließ den Kronleuchter zittern. Bella stand daneben und passte auf, als ein Dienstmädchen – dunkle Haut, Italienerin – ihnen Schaumwein einschenkte. Rose’ Mutter hatte im Vorfeld der Reise nicht erwähnt, wie bezaubernd Bella aussah. Sie war auf eine natürliche, schlichte Art schön. Ihre kastanienbraunen Haare fielen ihr in weichen Locken auf die Schultern. Rose glaubte, in ihren großen grau-blauen Augen Traurigkeit zu erkennen.
»Champagner«, bemerkte Julia. »Wie reizend.«
Es war das erste Positive, das Rose seit der Ankunft von ihrer Mutter hörte. Sie blickte zu Bella auf, um zu sehen, ob es ihr auch aufgefallen war.
Bella nahm das Kompliment mit einem Lächeln zur Kenntnis. »Es ist Prosecco, Julia. Leichter und fruchtiger. Von einem Weinberg in der Nähe.«
Julia nippte und ließ den Geschmack einen Moment auf ihrer Zunge wirken. »Recht süß. Aber nicht gänzlich unangenehm.«
Die Beleidigung schien Bella nicht zu bemerken – oder sie war eine gute Schauspielerin. »Es freut mich, dass Sie es so sehen. Wie gefallen Ihnen Ihre Zimmer?«
»Sie sind etwas kleiner, als wir es gewohnt sind.«
Rose schaltete sich ein. »Aber so bezaubernd eingerichtet. Wir haben uns gefragt, ob Sie alles selbst gemacht haben. Nicht wahr, Mama?«
»Liebste Rose.« Ein Lächeln legte sich auf Bellas Gesicht. »Ich hoffe, all meine Gäste sind so freundlich und aufmerksam wie Sie.«
»Gehören wir zu Ihren ersten Gästen?« Julia schaffte es, der Frage einen vorwurfsvollen Unterton zu verleihen.
Bella antwortete, ohne zu zögern. »Wir haben seit Ostern offen. Aber erst seit etwa einem Monat läuft es richtig.«
Auf der anderen Seite des Raums kam plötzlich Aufruhr auf. Eine altmodisch gekleidete Frau schimpfte mit einer italienischen Serviererin, die offenbar versucht hatte, ihr ein Glas Prosecco einzuschenken. Bella entschuldigte sich und ging zu dem Tisch, an dem eine andere Frau – Lucians Schwester? – versuchte zu schlichten.
Im Saal breitete sich gespannte Stille aus.
»Gibt es ein Problem, Lady Latchmere?«, hörte Rose Bella fragen.
»Ich rühre Alkohol grundsätzlich nicht an«, antwortete die Frau. »Wie oft muss ich das noch wiederholen?«
Die Schwester – sie hieß Alice, erinnerte Rose sich – bedeutete der Serviererin, das Glas abzuräumen. »Es tut mir sehr leid, Lady Latchmere«, sagte sie. »Ich verspreche, das wird nicht wieder vorkommen.«
Rose beobachtete die Szene interessiert, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit der Tür zu. Zwei Italiener betraten den Saal – ein Mann in mittleren Jahren mit recht hoheitsvollem Auftreten, der andere weniger formell gekleidet und deutlich jünger, näher an Rose mit ihren dreiundzwanzig Jahren. Sie sahen einander so ähnlich, dass man in ihnen Vater und Sohn vermutete.
Rose tippte den Arm ihrer Mutter an. »Wer ist das?«
Julia hatte die Männer auch bemerkt und sah ihnen nach, als sie den Saal durchquerten. »Das weiß ich nicht«, sagte sie. »Fragen wir mal.« Sie winkte Bella heran. »Und das ist?«
Ihre Gastgeberin warf einen Blick hinüber. »Graf Albani.«
»Und sein Sohn?«
»Ja. Er heißt Roberto.«
Julia runzelte die Stirn. »Meiner Kenntnis nach sollten alle Gäste hier Engländer sein. So stand es ausdrücklich in Ihrer Anzeige. ›Ein durch und durch englisches Hotel an der italienischen Riviera‹.«
»Englisch oder englischsprachig«, stellte Bella richtig. »Graf Albani hat in Oxford studiert.«
Julia deutete auf einen dunkelhäutigen jungen Mann, der in der Ecke gegenüber allein an einem Tisch saß. Er las ein Buch. »Was ist mit ihm?«
Rose zuckte zusammen. Manchmal war Mama wirklich ungehobelt.
»MrSengupta ist ein Freund meines Sohnes«, erklärte Bella.
»Verstehe«, sagte Julia skeptisch.
In diesem Moment tauchte Lucian in der Tür auf. Er hatte sich seit dem Nachmittag in Schale geworfen, allerdings hatte er auf Rose nicht zuletzt durch seine zerzausten Haare und die zerknittert-nachlässige Künstleraura so attraktiv gewirkt. Sie spürte, wie sie errötete, und senkte den Blick. Sie war solche Gefühle nicht gewohnt und hatte noch nicht gelernt, sie unter Kontrolle zu halten.
Als sie Lucian sah, wurde Bella munterer. »Wenn man vom Teufel spricht, Lucian! Komm her und leiste Wiedergutmachung. Erzähl Julia und Rose alles über Portofino.«
Lucian hatte auf Nish zugehalten, schwenkte aber ab, als er die Stimme seiner Mutter hörte.
»Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden.« Bella richtete sich auf und ging.
Auf dem Weg zu ihrem Tisch hielt Lucian die Serviererin an, die gerade mit einem Tablett vorbeikam, und schnappte sich ein Glas Prosecco. Er zwinkerte der Frau zu, was Rose reizend fand – allerdings hoffte sie, dass ihre Mutter es nicht bemerkt hatte.
»Nun«, sagte er, als er sich an ihren Tisch setzte, »ich weiß kaum, wo ich anfangen soll.«
»Mit einer Entschuldigung?«, schlug Julia vor.
Lucian grinste entwaffnend wie ein Schuljunge. »Es tut mir leid«, sagte er, »es war albern von mir. Es hat einen völlig falschen Eindruck davon vermittelt, was für ein Mensch ich bin.«
»Und was für ein Mensch sind Sie?«
Die Frage schien Lucian zu überrumpeln. Erst nach einer spürbaren Pause antwortete er. »Ein ernsthafter. Ich bin ein ernsthafter Mensch. Mit ernsthaften Ambitionen.« Er sah Rose an, als wollte er sie mit seinem Blick beschwören, ihm zu glauben.
»Was zu werden?«
»Ein Künstler.«
»Meine Güte.« Julia zog die Augenbrauen hoch. »Ist das überhaupt ein Beruf?«
»Erzählen Sie doch der Reihe nach«, versuchte Rose, das Gespräch in angenehmere Gefilde zu lenken. »Was bringt eine englische Familie wie Ihre überhaupt hierher?«
Lucian trank einen großen Schluck Prosecco. »Das war einfach. Mama hat sich in diesen Ort verliebt. In ihren Flitterwochen.«
Bildete Rose es sich nur ein, oder war ihre Mutter bei dem Wort Flitterwochen ein wenig blass geworden?
»Das kann man verstehen. Aber was hat sie dazu bewegt, hier leben zu wollen?«
»Sie fand, wir bräuchten einen Neuanfang.« Bei Lucian klang das so einfach. »Ein schönes Abenteuer nach dem Krieg. Sie, Alice, Lottie, ich. Sogar Vater.«
Julia unterbrach. »Und wird Ihr Vater uns heute Abend mit seiner Anwesenheit beehren?«
Um Himmels willen, dachte Rose. Warum musste sie immer so direkt sein?
»Ich fürchte, er lässt sich entschuldigen.« Lucian stieg die Röte ins Gesicht. »Er wurde in Genua aufgehalten, es war nicht zu vermeiden.«
Paola stellte ein Tablett voller Crostini mitten auf den Tisch. Zu hungrig, um zu warten, nahm Rose eines und steckte es sich in den Mund. »Köstlich!«
Sie rechnete damit, dass ihre Mutter sie rügen würde. Aber Julia hatte es scheinbar nicht bemerkt.
Um zehn Uhr hatten alle Gäste die Mahlzeit beendet und verließen den Speisesaal, um sich anderweitig Unterhaltung zu suchen. Einige setzten sich auf die Terrasse und rauchten. Eine kleine Gruppe angeführt von Lady Latchmere spielte in der Bibliothek Bridge. Nish hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen, um zu lesen.
Bella nutzte die Atempause, um sich im Speisesaal kurz hinzusetzen, während Alice die Tische fürs Frühstück eindeckte. Der Abend war vorüber, und Bella merkte, dass sie sich wochenlang für das Eintreffen von Rose und Julia gewappnet hatte. Jetzt waren sie endlich da.
Julia war recht unterkühlt; das hatte Bella schon erwartet. Rose war wirklich bildhübsch, wenn auch ein wenig dünn. Würde Lucian sich für sie interessieren? Daran hatte Bella ihre Zweifel.
Einzelne Momente des Tages erschienen vor ihrem inneren Auge wie Bilder einer Laterna magica. Cecil, der neben ihr im Bett lag und von dem sie nur den Hinterkopf sah. Die streunende Katze mit dem verletzten Ohr, zusammengerollt vor dem Küchenherd. Julias baumelnde Ohrringe, ganz ähnlich dem Paar, das Cecil ihr selbst einmal geschenkt hatte.
Bettys Sorgen zum Trotz war das Essen hervorragend geworden. Sie hatte das italienische Rindfleisch mit Kräutern in lieblichem Wein gekocht – höchstwahrscheinlich eine Idee aus Artusis Buch, aber Bella hatte auch gesehen, dass Betty sich mit dem Metzger im Ort unterhalten hatte, der ein wenig Englisch sprach. Es hatte, in Graf Albanis Worten, »einfach himmlisch« geschmeckt.
Julia hatte der Prosecco geschmeckt. Lucian ebenso – vielleicht zu sehr. Irgendwann hatte er Francesco gewinkt, er solle Nachschub bringen, eine ganze Flasche. Francesco hatte Bella fragend angesehen, und sie hatte den Kopf geschüttelt. Zum einen war es ein teurer Tropfen. Nichts, was die Familie allzu oft trank. Und zum anderen wusste sie zu gut, was Alkohol anrichten konnte, wie manche Männer sich durch ihn benahmen.
Sie betete jeden Abend dafür, dass Lucian nicht die Schwäche seines Vaters geerbt hatte.
Alice faltete die Servietten zu Fächern. Es war eine langweilige Arbeit, und Bella versuchte, Alice aufzumuntern.
»Ich finde, es ist heute den Umständen entsprechend gut gelaufen«, sagte sie.
»Das Dinner?« Alice blickte auf.
»Ja. Und die erste Begegnung mit Rose.«
Alice antwortete nicht.
»Sie ist ausgesprochen hübsch«, merkte Bella an.
»Ich schätze schon. Auch wenn es nicht wichtig ist.«
»Du hast recht. Der Charakter zählt.«
Jetzt lachte Alice abfällig auf. »Ach, Mama. Was zählt, sind die zweieinhalbtausend Hektar Ackerland ihres Vaters.«
Bella erschrak darüber, wie sehr sie diese Spitze traf. Vielleicht zu Unrecht? Möglicherweise sprach Alice nur aus, was sie selbst nicht zu sagen wagte. »Sei nicht so zynisch, Alice. Das steht dir nicht gut zu Gesicht.«
Aber Alice ließ sich nicht zurückhalten. »Es stimmt doch! Sie könnte aussehen wie die Kehrseite eines Omnibusses, und Vater wäre immer noch ganz wild darauf, dass Lucian sie heiratet.«
»Alice!«
»Er würde nicht einmal ein Zehntel so viel Energie aufwenden, um mir einen neuen Mann zu suchen.«
Bella fehlte die Energie, um zu widersprechen. Außerdem hatte das, was Alice gesagt hatte, einen wahren Kern. Stumm deckten sie die restlichen Tische, dann ging Bella nach unten in die Küche, wo Betty gerade ihre Schürze aufknotete.
»Sind Sie immer noch hier, Betty?«
»Ich wollte gerade gehen, MrsAinsworth.« Sie zögerte. »Möchten Sie etwas, Ma’am?«
»Ich könnte eine Tasse Pfefferminztee vertragen.«
Erschöpft zog Betty ihre Schürze wieder an.
»Nein, nicht.« Das wollte Bella auf keinen Fall. »Bitte. Ich schaffe das schon.« Sie ging zu dem Wasserkrug, in dem ein Bündel frische Minze stand, und zupfte eine Handvoll duftender Blätter ab. »Danke übrigens. Für das Dinner.«
Betty antwortete immer noch nicht.
»Graf Albani lässt sein Kompliment ausrichten.«
Ein müdes Lächeln huschte über Bettys Gesicht. »Wirklich?«
»Besonders für das Rindfleisch.«
»Ach, du liebes bisschen.« Sie sah aus, als würde sie gleich vor Freude schweben.
Betty schleppte sich nach oben ins Bett. Bella nahm den Wasserkessel vom Regal über dem Herd und ging zur Spüle, um ihn zu füllen. Als sie den Wasserhahn aufdrehen wollte, bemerkte sie hinter einigen Flaschen Olivenöl eine offene Flasche Weißwein. Sie zögerte nur kurz, bevor sie sich am Ende dieses langen, beschwerlichen Tages mit einem Gläschen belohnte.
Sie holte die Geldkassette aus ihrem Büro und aus der Vorratskammer ein Brötchen und ein Glas Tapenade. Eine kleine Stärkung würde ihr guttun, bevor sie sich an die Buchführung setzte – sie bemühte sich, das jeden Abend zu erledigen, denn wer sollte es sonst machen? Cecil?
Sie setzte sich an den leeren Küchentisch. Aber als sie gerade das Geschäftsbuch aufgeschlagen hatte, klopfte jemand an die hintere Küchentür.
Wer in aller Welt konnte das sein?
Bella schloss die Tür auf, deren Scharniere beim Öffnen laut ächzten. Auf der Schwelle stand eine schlanke junge Frau, etwa zwanzig Jahre alt, mit großen Augen, die goldbraunen Haare unter einer Kreissäge aus Stroh zusammengebunden. Sie trug einen kleinen Koffer bei sich, schien vor Müdigkeit kaum noch Herrin ihrer Sinne und sah Bella flehentlich an.
Bella musterte die junge Frau mit ihren abgewetzten Schuhen und dem groben Leinenkleid. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Bitte, Ma’am. Ich bin Constance. Das neue Kindermädchen.«
Seit Jahren – seit vielen Jahren – war Constance nicht mehr so erschöpft gewesen wie jetzt. Der Weg hatte größtenteils bergab geführt, aber die letzte Meile war die reinste Qual gewesen. Sie hatte Blasen und wunde Stellen an den Füßen, und ihr Kleid war verschwitzt.
Constance besaß überhaupt nur zwei Kleider. Dieses grobe, schwere Kleid, vom vielen Waschen eingelaufen, war das eine. Das andere war ihr gutes Sonntagskleid, das sie auf der Reise natürlich nicht getragen hatte aus Sorge, es könnte einen Riss bekommen oder schmutzig werden. Sie träumte davon, ihren Lohn zu sparen, bis sie sich neue Kleider leisten konnte. Dabei wusste sie, dass diese Hoffnung vergebens war. Sie hatte versprochen, den Großteil ihres Verdienstes hier in Italien ihrer Mutter und dem Baby zu Hause zu schicken.
Vielleicht kannte Betty ja ein Geschäft in der Nähe, das nicht zu teuer war. In Portofino wurde doch Spitze angefertigt, oder? War Spitze hier also billig? Oder teuer? Sie hätte es gern gewusst, sie wünschte sich, ihre mangelnde Bildung würde sich nicht immer so deutlich zeigen.
Es war von Betty sehr freundlich gewesen, sie für diese Stelle zu empfehlen. Constance war fest entschlossen, sie nicht zu enttäuschen oder irgendwem zur Last zu fallen. Deshalb war es gut, dass sie Mezzago pünktlich auf die Minute erreicht hatte.
Sie hatte auf dem staubigen Bahnsteig gewartet und das geschäftige Treiben der desinteressierten Fremden beobachtet und der Kofferträger, die Wagen voller Gepäck herumschoben. In rostfarbenen Tontöpfen wuchsen üppige leuchtend rote Blumen. Ein junger Mann eilte vorüber – ein sehr attraktiver junger Mann. Offensichtlich holte er wichtige Menschen ab. In Genua hatte sie gesehen, wie eine gut gekleidete englische Dame und ihre Tochter unter ständigem Zanken in einen Wagen der ersten Klasse gestiegen waren. Vielleicht, dachte Constance träge, suchte er die beiden.
Dann lichtete sich die Menge zusehends, bis Constance als letzte Reisende zurückblieb.
Kein Grund zur Sorge, dachte sie. Vielleicht wartete derjenige, den das Hotel geschickt hatte, ja draußen? Betty hatte gesagt, der Sohn der Besitzer, Lucian, würde sie abholen. Sie faltete den Brief auseinander und las ihn noch einmal.
Warte auf dem Bahnsteig. Lucian kann man nicht übersehen. Er ist groß und gut aussehend und hat dunkle Haare.





























