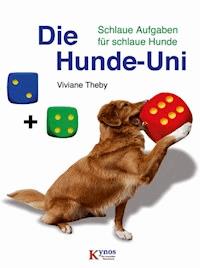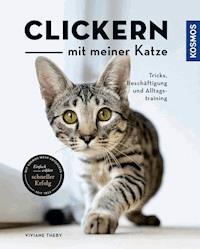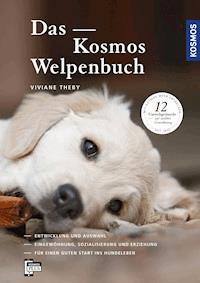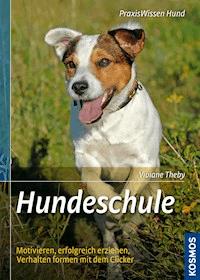
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kosmos
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Hundeerziehung mit viel Begeisterung und Motivation, ganz ohne Stress und Zwang, dafür steht Viviane Theby. In ihrer Hundeschule erklärt sie anschaulich und verständlich, wie Hunde lernen, welche Signale im Alltag wichtig sind und wie das Training in kleinen Schritten aufgebaut werden kann. Von SITZ, PLATZ und FUSS bis hin zu kleinen Tricks, die allen Spaß machen. -Zielgerichteter Trainingsaufbau – in Etappen zum Erfolg. -Hör- und Sichtzeichen, die für den Alltag wichtig sind. -Wie Hunde Signale verstehen lernen. -EXTRA: Clickertraining.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Inhalt
Theorie des Lernens
Wege der Hundeausbildung
Gesetze des Lernens
Klassische Konditionierung
Konditionieren auf den Clicker
NEIN (I)
Instrumentelle Konditionierung
Auf einen Blick – Konditionierungsformen
Assoziatives Lernen
Abläufe im Gehirn
Rückruf (I)
Der Kontext
Assoziationszeit
Clickerspiel
Ballspiel mit Hund (I)
Signalverknüpfung
Auf einen Blick – Wie Hunde lernen
Motivation
Das Erreichen von Zielen
Lob und Strafe
Das Schwanzwackelspiel
Rückruf (II)
Rückruf (III)
Das Premack-Prinzip
Lernen und Motivation
NEIN (II)
Abwechslung im Training
Denksport für Hunde
Auf einen Blick – Mit Motivation zu mehr Kreativität
Formen von Verhalten
Bestärken von Verhalten
Freies Formen
Targetstick (I)
Formen durch Hilfestellung
SITZ und PLATZ (I)
Auf einen Blick – Möglichkeiten des Lernens
Einmal Rolle rum
Signale in der Hundeausbildung
Was Hunde verstehen
Targetstick (II)
Signal und Hilfestellung
SITZ und PLATZ (II)
Freizeichen
Das Falsch-Signal
Nichtbeachten von Signalen
Auf einen Blick – Signale richtig eingeführt
NEIN (III)
BEI FUSS (I)
Belohnungsmodelle
Verhaltensweisen belohnen
Ballspiel mit Hund (II)
Verhaltensdauer belohnen
SITZ BLEIB (I)
Rückruf (IV)
Der Jackpot
Belohnung einer alternativen Verhaltensweise
VORAUS
Differenziertes Belohnen
Auf einen Blick – Variabel belohnen
Verhaltensketten
Aufbau einer Verhaltenskette
Belohnen einer Verhaltenskette
Auf einen Blick – Regeln zur Verhaltenskette
Zeitung holen
Laufsteg
Strafe in der Hundeausbildung?
Eine Methode mit langer Tradition
Verhalten belohnen – Unangenehmes entfernen
Negative Verstärkung – Unangenehmes zufügen
An-der-Leine-Ziehen
Anspringen
Negative Verstärkung – Entzug von Angenehmem
Auszeit
Kleinstmögliche Belohnung
Unerwünschtes Verhalten ändern
Auf einen Blick – Die Schwierigkeit beim Strafen
Rückruf (V)
SITZ BLEIB (II)
Einflüsse auf das Lernen
Dominanz
Intelligenz
Lernen in Bezug auf unterschiedliche Rassen
Lernen findet immer statt
Lernen und Alter
Stress
Signal zum Entspannen
Auf einen Blick – Was Lernen beeinflusst
Krankheiten
BEI FUSS (II)
Abwechslung im Hundeleben
Service
Nützliche Adressen
Zum Weiterlesen
Theorie des Lernens
Theorie des Lernens
Wege der Hundeausbildung
Warum soll man sich als Hundehalter mit der Lerntheorie beschäftigen?
Eine Frage, auf die es sicher mehrere Antworten gibt. Erst kürzlich sah ich bei einem Sachkundenachweis ein für mich sehr unschönes Bild: Der Halter hatte seine Staffordshire-Hündin hervorragend im Griff. Aber jedes Mal, wenn er BEI FUSS sagte, zuckte sie zusammen, wie von einer Peitsche getroffen. Meist folgte dann noch der Ruck an der Leine, denn der Halter wollte natürlich, dass sein Hund in dieser Situation besonders gut folgt. Ich glaube nicht, dass dieser Mann seiner Hündin mit Absicht solche Schmerzen zugefügt hat, denn er mochte sie sehr gern. Er hatte es einfach nicht anders gelernt. Leider wird noch in den meisten Hundeschulen mit dieser „Leinenruck-Methode“ gearbeitet, sodass es für viele Hundehalter den Anschein hat, es müsste so sein. Ein von B. F. Skinner veröffentlichter Text zeigt, dass dem nicht so ist:
„Es heißt oft, die Erziehung (eines Hundes) sei eine Kunst, wir haben aber immer mehr Grund anzunehmen, dass es eines Tages eine Wissenschaft wird. Bis jetzt haben wir schon genug über die Natur des Lernens entdeckt, um Trainingsmethoden zu empfehlen, die effektiver sind und verlässlichere Ergebnisse erzielen als die Daumen-drauf-Methoden der Vergangenheit. An Tieren ausprobiert, erwiesen sich diese Techniken um einiges besser als die traditionellen Methoden professioneller Trainer; sie erzielten bemerkenswertere Ergebnisse mit viel weniger Aufwand ...“
Obwohl dieser Text sehr modern klingt, stammt er bereits aus dem Jahr 1951. Aber bis heute hat sich das leider kaum herumgesprochen. Immer noch werden allerorts auf den Hundeübungsplätzen die Tiere angeschrien, es wird an der Leine geruckt und es werden gar nicht selten sogar tierschutzwidrige Utensilien wie Stachelhalsband oder Elektroschock-Halsband in der Ausbildung verwendet. Und den Hundehaltern wird das dann so verkauft, als müsste es so sein. Diejenigen, die etwas sensibel für die Belange ihres Hundes sind, spüren jedoch, dass es das nicht sein kann. Mangels einer Alternative lassen sie die Ausbildung ihres Hundes lieber ganz sein, nach dem Motto: Wozu brauche ich auch einen ausgebildeten Hund? Das ist heutzutage jedoch keine Lösung mehr, wo das Ansehen des Hundes so sehr in der Öffentlichkeit steht. Gerade heute gilt es, wirklich gut erzogene Hunde zu haben. Leider sind Hunde auch nicht von Haus aus so wohlerzogen und wissen, was richtig und falsch ist, wie es uns Lassie oder Kommissar Rex vielleicht vortäuschen. In Wirklichkeit können wir von einem Hund nur das erwarten, was wir ihm auch beigebracht haben. Und es kann so viel Spaß machen, einen Hund auszubilden; nämlich dann, wenn man sieht, dass auch der vierbeinige Freund mit Spaß bei der Sache ist und die nächste Unterrichtsstunde gar nicht abwarten kann. Sie glauben, das gibt es nicht? Und ob!
Hintergrundwissen ist für jedes Training sinnvoll.
Lernen mit dem Clicker
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Hund mit Freude erziehen. Es gehört etwas an theoretischem Hintergrundwissen dazu, aber auch die Praxis wird nicht zu kurz kommen. Ich hoffe, Ihnen damit auch einiges an Argumentationspunkten in die Hand zu geben, um die traditionellen Hundeausbilder endlich zu überzeugen, dass es viel bessere Wege gibt, einen Hund auszubilden.
Um bestimmte Dinge deutlich zu machen, werden wir den Clicker in den praktischen Übungen verwenden. (Für die, die es noch nicht wissen: Der Clicker ist ein Ding, das ein Geräusch macht ähnlich dem Knackfrosch der Kinder.) Für mich ist das nicht eine neue Methode der Ausbildung. Vielmehr ist die Ausbildung mit dem Clicker auch nur so gut oder so schlecht wie die Theorie, die dahintersteckt. Aber durch den Clicker kann ich viele Sachen besser verdeutlichen und Ihnen hoffentlich auch verständlicher machen. Haben Sie diese Theorie erst einmal gelernt, wollen Sie den Clicker eventuell gar nicht mehr verwenden. Das ist dann auch in Ordnung. Vielleicht haben Sie bis dahin aber auch festgestellt, dass er einiges vereinfacht, und benutzen ihn gerne weiter. Auch das ist in Ordnung.
Erfolg garantiert
Ein sehr erfolgreicher amerikanischer Tiertrainer hatte uns Teilnehmern auf einem Seminar einmal erzählt, dass er nicht etwa die Tiere über positive Verstärkung (d.h. über Belohnung) ausbildet, weil er so tierfreundlich ist, sondern weil das die einzige Möglichkeit ist, die dauerhaft zum Erfolg führt. Gewalt und Zwang können Aggression auslösen, was man sich bei einem Killerwal einfach nicht leisten kann. Außerdem sind diese Tiere viel zu teuer, als dass man von Zeit zu Zeit einen neuen anschaffen könnte, weil der alte aggressiv geworden ist, wie es leider im Hundetraining noch oft der Fall ist. So werden z.B. in den USA jährlich 1% der Hunde eingeschläfert, weil es Verhaltensprobleme gibt.
Diese Aussage des Trainers fand ich sehr beeindruckend, weil er ja wirklich Tiere trainiert, die funktionieren müssen. Das ist nicht nur ein Hobby, und im Beruf ist Zeit Geld. Und dennoch werden positive Ausbildungsmethoden benutzt. Wie viel wichtiger ist das dann, wenn es „nur“ um ein Hobby geht!
Die praktischen Übungen in diesem Buch sind in einzelne Übungsschritte unterteilt, die Sie ganz einfach nachvollziehen können. Wenn Sie die Übungen zusammen mit Ihrem Hund durcharbeiten, lernt Ihr vierbeiniger Freund mit Ihnen spielerisch die wichtigsten Signale, und auch einige Tricks sind dabei. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Hund viel Spaß und viel Erfolg!
Eine gute Ausbildung erfolgt spielerisch.
Am besten ist es, wenn der Hund dabei gar nicht merkt, dass er trainiert wird.
Gesetze des Lernens
Das Lernen unterliegt gewissen Gesetzen, genau wie z.B. die Schwerkraft. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Wissenschaftler mit den Vorgängen des Lernens. Unzählige Versuchstiere mussten Labyrinthe durchlaufen oder andere Aufgaben lösen. Es wird nun Zeit, dass das, was mit ihrer Hilfe herausgefunden wurde, Einzug in das Bewusstsein der Ausbilder findet. Ausbilder ist dabei jeder, der einen Hund oder ein anderes Tier hat und ihm etwas beibringen möchte.
Wir werden uns im Folgenden mit der Lerntheorie genauer beschäftigen, die alles andere als trockener, langweiliger Stoff ist. Eine meiner Ausbilderinnen hat die Lerntheorie immer mit dem Klavierspiel verglichen. Ich werde Ihnen also die einzelnen Akkorde beibringen, damit Sie diese zu Melodien zusammensetzen können.
Der Anfang wird vielleicht etwas theoretisch. Aber die Theorie ist wichtig, um später in der Praxis damit spielen zu können.
Hat der Mensch das nötige Hintergrundwissen, kann Hundeschule richtig Spaß machen ...
... und zwar Mensch und Hund.
Klassische Konditionierung
Lernen von Zusammenhängen
Die klassische Konditionierung ist eine Form des Lernens, die – eigentlich so ganz nebenbei – Anfang des 20. Jahrhunderts von dem russischen Wissenschaftler Iwan Pawlow entdeckt wurde. Für seine Forschungen untersuchte er das Verdauungssystem der Hunde. Durch eine Operation legte er den Ausführungsgang der Speicheldrüsen bei einigen Hunden nach außen, um den Speichel aufzufangen und untersuchen zu können. Dabei stellte er fest, dass die Tiere nicht nur speichelten, wenn sie das Futter vorgesetzt bekamen, sondern nach einigen Malen auch schon, wenn der Versuchsassistent, von dem sie das Futter normalerweise bekamen, durchs Zimmer ging.
Glücklicherweise erahnte Pawlow die Bedeutung dieses Phänomens und war flexibel genug, seine Forschungen in diese Richtung zu lenken. Er präsentierte den Tieren, nachdem er für sie eine weitgehend reizfreie Umgebung geschaffen hatte, unterschiedliche Reize unmittelbar vor der Fütterung. Einer davon war ein Metronom. Ein Metronom hat normalerweise keinerlei Bedeutung im Leben eines Hundes. Aber nach einiger Zeit speichelten die Tiere, wenn sie das Metronom hörten.
Was ist passiert?
Das Futter ist ein sogenannter unkonditionierter Stimulus (US) (oder unbedingter Reiz), der als unkonditionierte Reaktion (UR) (oder unbedingte Reaktion) das Speicheln hervorruft. Dieser Vorgang ist angeboren, der Hund braucht das nicht zu lernen und kann es auch nicht beeinflussen. Unkonditioniert heißt so viel wie nicht erlernt.
Wird nun das Futter einige Male direkt nach dem Metronom gegeben, welches normalerweise keinerlei Bedeutung für den Hund hat, wird es zum konditionierten Stimulus (CS) (oder bedingten Reiz). Der Hund hat gelernt, dass das Metronom das Erscheinen des Futters ankündigt. Er fängt also bereits an zu speicheln, wenn er das Ticken des Metronoms hört. Dieses Speicheln nennt man jetzt die konditionierte Reaktion (CR) (oder bedingte Reaktion).
Nach etlichen Jahren der Forschung auf dem Gebiet der klassischen Konditionierung hat sich herausgestellt, dass Pawlow eigentlich nur einen Spezialfall dieses Vorgangs entdeckt hat. Heute weiß man, dass die klassische Konditionierung viel mehr als nur das ist. Mit ihr lernen Lebewesen etwas über die Zusammenhänge bestimmter Ereignisse in ihrer Umgebung.
Bob Bailey, einer meiner Ausbilder, sagte immer: „Pawlow is always sitting on your shoulders.“ (Pawlow sitzt immer auf deinen Schultern.) Damit wollte er uns ermahnen, die klassische Konditionierung, die in jedem Training eine Rolle spielt, immer zu beachten.
Wir werden später sehen, wie wir uns die klassische Konditionierung in der Hundeausbildung zunutze machen können.
Info Pawlows Entdeckung
Ein ehemals unbedeutender Reiz (hier Metronom) bekommt durch die Verknüpfung mit einem für den Hund bedeutsamen Reiz (Futter) selbst eine Bedeutung.
Löschen einer Reaktion
Ein weiteres Phänomen in der klassischen Konditionierung ist das Löschen. Folgt dem Clicker einige Male kein Futter, wird die konditionierte Reaktion gelöscht. Der Clicker wird für den Hund wieder bedeutungslos. Deshalb ist es wichtig, dass jedem Click ein Leckerchen folgt. Wichtig im Zusammenhang mit dem Löschen ist, dass ein Verhalten, bevor es gelöscht wird, erst noch besonders stark auftritt. Nehmen wir als Beispiel das Betteln bei Tisch. Sie möchten das Betteln am Tisch löschen, indem Sie Ihrem Hund nie mehr etwas Fressbares vom Tisch geben. Er wird sich daraufhin erst einmal besonders ins Zeug legen, um wieder etwas zu bekommen. Darauf müssen Sie gefasst sein, und dem müssen Sie widerstehen und dürfen ja nicht nachgeben! Ihr Hund wird irgendwann aufgeben. Ähnlich verhalten Sie sich z.B., wenn Sie einen Euro in einen Getränkeautomaten geworfen haben und es kommt nicht wie gewohnt eine Flasche heraus. Bevor Sie das so einfach hinnehmen, werfen Sie je nach Temperament vielleicht noch einmal einen Euro ein, vielleicht rütteln Sie auch kräftig am Automaten, ehe Sie es endgültig aufgeben.
Die spontane Erholung
Ist eine Reaktion gelöscht, wird sie nach einiger Zeit erneut spontan auftreten. Beispiel: Sie wollen Ihrem Hund abgewöhnen, zu bellen, wenn die Türglocke läutet. Die konditionierte, also erlernte Reaktion auf das Läuten ist Bellen. Diese Reaktion kann man löschen, indem das Läuten als konditionierter Stimulus nicht mehr von einem unkonditionierten Stimulus, nämlich dem Besuch, gefolgt wird. Sie müssen jemanden bitten, ganz oft bei Ihnen zu klingeln, ohne dass daraufhin irgendetwas passiert, d.h., Sie reagieren nicht darauf und gehen nicht zur Tür. Geschieht dies oft genug, wird das Verhalten des Hundes (das Bellen) gelöscht. Am nächsten Tag wird er aber wieder bellen, wenn die Türglocke läutet. Das nennt man die spontane Erholung. Allerdings geht es dieses Mal viel schneller, bis das Verhalten gelöscht ist, vorausgesetzt, die Türklingel bedeutet auch weiterhin nicht, dass jemand vor der Tür steht. Zurück zu unserem Beispiel mit dem Getränkeautomaten: Am nächsten Tag sind Sie ganz in Gedanken versunken und gehen wie immer zum Automaten, um sich ein Getränk zu ziehen. Auch Ihr Verhalten hat sich spontan erholt.
Einfluss auf das Training
Dieses Phänomen können wir uns in der Ausbildung zunutze machen, wenn der Hund einmal einen schlechten Tag hat und eine Übung, die sonst immer klappt, aus irgendwelchen Gründen nicht gelingt. Bevor Sie nun darauf herumreiten und sich und den Hund unnötig frustrieren, überschlafen Sie die Sache. Sie haben gute Chancen, dass es zu einer spontanen Erholung kommt, und am nächsten Tag ist alles vergessen. Wenn nicht, kann man dann immer noch weitersehen. Sie sehen, so langsam bekommt die ganze Theorie einen Sinn. Wir können dadurch bestimmte Verhaltensweisen des Hundes erklären und voraussagen. Ein nächstes Phänomen ist die konditionierte Hemmung. Ein Reiz, der dem Hund zeigt, dass der unkonditionierte Stimulus mit Sicherheit nicht (!) folgt, ist ein konditionierter Hemmer. Für uns wäre es der Zettel mit der Aufschrift „Außer Betrieb“ auf dem Automaten.
Konditionierung zweiter Ordnung
Ist ein bestimmter Reiz erst einmal gut konditioniert, kann er als unkonditionierter Stimulus für einen anderen Reiz dienen. Dazu ein Beispiel: Der Hund hat eine schlechte Erfahrung in der Tierarztpraxis gemacht. Den Tierarzt in seinem weißen Kittel hat er mit Schmerz verknüpft. Die konditionierte Reaktion ist Angst und Meideverhalten. Das kann sich bis ins Wartezimmer fortsetzen. Dieses wird zum konditionierten Stimulus zweiter Ordnung. Fährt der Hund außer zum Tierarzt sonst nie mit dem Auto, kann das Auto zum konditionierten Stimulus dritter Ordnung werden. Auch hier wird er dann also Angst und Meideverhalten zeigen, obwohl von dem eigentlichen Angstauslöser, nämlich dem Tierarzt, noch weit und breit nichts zu sehen ist. Die Konditionierung zweiter Ordnung spielt eine große Rolle im Verhalten der Hunde. Für uns oft unverständliche Reaktionen lassen sich mit ihrer Hilfe erklären.
Gegenkonditionieren
Außer dem Löschen entdeckte Pawlow noch eine andere Vorgehensweise, eine konditionierte Reaktion zu eliminieren, nämlich das Gegenkonditionieren. Pawlow zeigte das damals auch an seinen Hunden. Der unkonditionierte Stimulus war ein leichter Schock, der eine Fluchtreaktion auslöste. Diesen Stimulus paarte er mit Futter. Ein Hund kann nicht gleichzeitig fliehen und fressen. Wenn also dieser milde Schock (US) auftrat, orientierten sich die Hunde nach dem Futter und fingen an zu speicheln. Sie zeigten keinerlei Fluchtverhalten. Gegenkonditionieren heißt also, ein Verhalten durch ein anderes zu ersetzen, wobei das eine Verhalten das andere ausschließt. Es ist eine Vorgehensweise, die man gut in der Ausbildung eines Hundes einsetzen kann. Einem Hund, der stürmisch jeden Besuch begrüßt, kann man beibringen, dass das Läuten der Türglocke heißt, er soll sich auf seinen Platz legen. Ein Hund kann nicht gleichzeitig die Leute anspringen und auf seinem Platz liegen.
Generalisieren
Pawlow entdeckte außerdem, dass die Hunde nicht nur auf einen bestimmten Reiz reagierten, sondern auch auf ähnliche. Zum Beispiel paarte er Töne unterschiedlicher Höhe mit Futter, nachdem die Hunde auf einen bestimmten Ton konditioniert waren. Die Hunde reagierten dann auch in derselben Art und Weise auf ähnliche Töne. Dieses Phänomen nennt man Generalisieren.
Generalisieren bzw. Verallgemeinern muss der Hund auch die Signale, die wir ihm beibringen. Zuerst heißt SITZ nämlich nur SITZ im Wohnzimmer bzw. wo wir es zuerst mit dem Hund üben. Er muss dann noch lernen, dass SITZ auch draußen auf der Wiese, auf der Straße usw. SITZ bedeutet, und dass es egal ist, ob Sie stehen, sich bewegen und nah oder weit von Ihrem Hund entfernt sind, wenn Sie das Signal geben.
Ein SITZ, wenn Frauchen auch sitzt und etwas Leckeres in der Hand hat, ist anders, als wenn der Hund vor dem stehenden Frauchen sitzt.
Unterscheidung
In der Natur ist es wichtig, dass man nicht alles verallgemeinert. Deswegen wollte Pawlow herausfinden, inwieweit seine Hunde in der Lage waren, ähnliche Stimuli zu unterscheiden. Aber auch ein ständiges Wiederholen ein und derselben Tonhöhe gepaart mit Futter führte nicht dazu, dass die Hunde auf ähnliche Töne anders reagierten. Das gelang nur mit einem Unterscheidungstraining. Auf das Ertönen eines Tones einer bestimmten Höhe folgte Futter, auf einen ähnlichen Ton folgte kein Futter. Während die Hunde am Anfang des Experiments noch auf beide Töne reagierten, lernten sie, diese mit der Zeit zu unterscheiden, und reagierten nur noch auf den Ton, dem auch Futter folgte.
Beim Betteln am Tisch lernen die Hunde auch ganz schnell zu unterscheiden, bei wem sie Erfolg haben und bei wem nicht. Beim Obedience-Training, einer Hundesportart, besteht eine Aufgabe darin, einen bestimmten Gegenstand aus mehreren gleichen Gegenständen herauszufinden. Auch da macht man sich das Unterscheidungstraining zunutze.
Eine Kollegin von mir lehrte ihren Hund, zwischen Anheben der linken und der rechten Augenbraue zu unterscheiden.
Hunde können verschiedene Sichtzeichen unterscheiden lernen.
Das Blockieren
Dies ist eine Eigenschaft beim klassischen Konditionieren, die erst in den Siebzigerjahren entdeckt wurde. Es besagt Folgendes: Wenn ein Reiz konditioniert wird und daraufhin eine Bedeutung für das Tier bekommt und anschließend genau dieser Reiz in Kombination mit einem anderen noch einmal konditioniert wird, wird die Konditionierung dieses zweiten Reizes blockiert. Ein Beispiel dafür ist folgendes Phänomen: Wir haben dem Hund ein Verhalten beigebracht, das wir jetzt unter ein Wortsignal bringen wollen. Das Handzeichen für dieses Verhalten kennt der Hund bereits. Es bringt jetzt nichts, das Wortsignal zusammen mit dem Handzeichen zu geben. Das Wort wird in diesem Fall blockiert. Wenn nämlich unsere Körpersprache bereits ein Hinweis für das erwünschte Verhalten ist, braucht man als Hund nicht nach weiteren Hinweisen zu suchen. Die Natur ist in dieser Hinsicht auf Energiesparen eingestellt. Das bedeutet, dass das Wortsignal in dem Fall einfach überhört wird. Diesen Zustand findet man bei Hunden relativ oft. Das Signal allein reicht meistens nicht aus, ein von uns gewünschtes Verhalten auszuführen. Die Hunde brauchen immer noch ein, wenn auch noch so kleines Körpersignal. Oft ist es uns gar nicht bewusst, dass wir zusätzlich ein solches Signal geben. Das fällt eher Beobachtern auf.
Wie kann man dem Hund aber dennoch das Wortsignal beibringen? Überlegen Sie einmal. Genau! Das Signal muss kurz vor (!) dem Handzeichen kommen, eine Art Konditionierung zweiter Ordnung.
Das Überschatten
Ein ähnliches Phänomen ist das Überschatten. Es tritt auf, wenn zwei Zeichen gleichzeitig gegeben werden. In diesem Fall überschattet das für den Hund wichtige Zeichen das unwichtige. Das tritt oft in der herkömmlichen Ausbildung auf. Der Hund lernt ein bestimmtes Signal, z.B. SITZ. Außer dem Wort erhält er immer auch andere Zeichen, sei es nun ein Ruck am Halsband oder ein leichtes Vornüberbeugen des Hundehalters. In jedem Fall sind diese anderen Zeichen für den Hund wichtiger, weil ihm die Sprache nicht so viel bedeutet wie unsere Körpersignale. Das Lernen des Wortsignals wird dadurch mehr oder weniger stark überschattet. Das können Sie leicht testen, indem Sie Ihrem Hund das Signal SITZ geben (sofern er es schon kennt) und dabei mit dem Rücken zu ihm stehen, er also die gewohnten anderen Zeichen nicht bekommt. Die allermeisten Hunde verstehen in diesem Fall nicht, was von ihnen gefordert wird, und sie können es aus oben genanntem Grund auch gar nicht verstehen. Ärgern Sie sich darum nicht über Ihren „dummen“ Hund. Sie können sicher sein, dass bei diesem Experiment die meisten Hunde versagen werden, sofern sie nicht so trainiert wurden, dass das Überschatten nicht passieren konnte.
Praxis – Konditionieren auf den Clicker
Praxis – NEIN (I)
Praxis – NEIN (I)
Das Signal NEIN soll für den Hund bedeuten, dass er mit dem, was er gerade tut, aufhören und stattdessen zu seinem Halter zurückkommen soll.
Schritt 1
Machen Sie es sich mit Leckerchen bewaffnet in Ihrem Sessel bequem. Jede Hand wird mit einem Leckerchen „geladen“ und der Hund darf sie sich von der flachen Hand nehmen. Dann sagen Sie NEIN und schließen augenblicklich die Hand, von der Ihr Hund das Leckerchen nehmen will. Sollte Ihr Hund das Wort NEIN schon kennen, lassen Sie sich einfach ein neues Signal einfallen, wie z.B. NA DENKSTE.