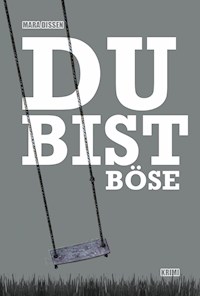Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Weglaufen, weit weglaufen, um somit eine Rückkehr an diesen grauenvollen Ort, ihren Arbeitsplatz, unmöglich zu machen..." Susanne Rüter, Ärztin im Maßregelvollzug, hasst sich und ihre Arbeit in der Anstalt. Von der Gesellschaft weggeschlossen, nutzen psychisch kranke Straftäter die desolaten Zustände hinter den Gittern, um ihre Gewaltphantasien weiter ausleben zu können, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Anfeindungen und brutale Ausschweifungen sind unter den Insassen an der Tagesordnung. Im Schweigen sind sie jedoch wieder vereint. Diese Mauer des Schweigens erschwert Kommissar Bode die Aufklärung eines Mordes an dem Ort, der sich Maßregelvollzug nennt und doch nur weitere Schwerverbrechen hervorbringt. Als noch ein zweiter Mord folgt, gerät der Ermittler an seine Grenzen, denn auch Frau Rüter trägt ein Geheimnis mit sich, welches sie vor den Insassen und Mitarbeitern gehütet glaubt. Doch sie täuscht sich gewaltig..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mara Dissen
IM SCHATTEN
DER GITTER
Thriller
Impressum
© 2015 creaticon by SCHMÖKERbar
Lektorat: Mara Dissen
Umschlaggestaltung: creaticon by SCHMÖKERbar,
Kreativagentur, Berlin
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-3506-9
Printed in Germany
Inhalt
Januar 2014
15. Januar 200506.00 Uhr
18. Januar 200506.30 Uhr
18. Januar 200508.30 Uhr
18. Januar 200512.50 Uhr
18. Januar 200513.15 Uhr
18. Januar 200522.00Uhr
18. Januar 200523.25 Uhr
19. Januar 200507.00Uhr
19. Januar 200510.30 Uhr
20. Januar 200506.50 Uhr
20. Januar 200508.05 Uhr
20. Januar 200508.09 Uhr
20. Januar 200511.20 Uhr
20. Januar 200512.00Uhr
20. Januar 200512.45 Uhr
20. Januar 200514.10 Uhr
20. Januar 200523.10 Uhr
21. Januar 200508.30 Uhr
21. Januar 200510.30 Uhr
21. Januar 200510.30 Uhr
21. Januar 200513.30 Uhr
21. Januar 200514.50 Uhr
21. Januar 200515.10 Uhr
21. Januar 200516.00 Uhr
21. Januar 200517.00 Uhr
21. Januar 200518.30 Uhr
21. Januar 200520.30 Uhr
21. Januar 200521.00 Uhr
21. Januar 200521.10 Uhr
21. Januar 200521.25 Uhr
21. Januar 200523.00 Uhr
22. Januar 200508.00 Uhr
22. Januar 200508.30 Uhr
22. Januar 200511.00 Uhr
22. Januar 200511.00 Uhr
22. Januar 200511.10 Uhr
22. Januar 200512.15 Uhr
22. Januar 200513.00 Uhr
22. Januar 200513.30 Uhr
Januar 2014
Januar 2014
Mit raumgreifenden Schritten, die Umgebung scheinbar nicht wahrnehmend, nähert sie sich dem imposanten Anwesen. Nur noch spärlich gesetzte Rhododendronbüsche trennen sie von der herrschaftlich anmutenden Auffahrt, als sie abrupt stehen bleibt. Wie von einem Peitschenhieb getroffen, wird sie von der Vergangenheit eingeholt, lässt sie taumeln, zweifeln an ihrem Vorhaben. Sie ermahnt sich, Ruhe zu bewahren, sich an ihre Überlebensstrategien zu erinnern. Nur mühsam gelingt es ihr, einen gleichmäßigen Atem-rhythmus aufzubauen. Mit jedem Atemzug wird sie sich ihrer Umgebung bewusster, nimmt Einzelheiten wahr, die doch schon so lange verschüttet waren.
Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände zu Fäusten geballt und an die Oberschenkel gepresst, starrt sie auf das nur schwach erleuchtete Gebäude. Die hohen vergitterten Fenster waren ihr nie bedrohlich erschienen, sondern standen für Sicherheit innerhalb der massiven Wände. Heute sendet jeder Eisenstab eine Bedrohung aus, die von innen nach außen zu strahlen scheint.
Ihr Blick schweift weiter zu der riesigen Eichentür, gesichert mit schweren Eisenbeschlägen. Vergeblich versucht sie, die Kratzspuren auszumachen, entstanden durch die vielen Befreiungsversuche der Bewohner und ihrer hilflosen Rückkehr nach gescheitertem Dasein in vermeintlicher Freiheit. Sie redet sich ein, dass die Entfernung zu groß, die Spuren zu gering seien, um sich ihr zu zeigen. Sie wehrt sich dagegen, dass die Sachbeschädigungen nur in ihrer Vorstellung existieren sollten. Zu vernichtend hatten die Qualen der Menschen, eingesperrt hinter dicken Mauern, von ihr Besitz ergriffen, sie fast selber an den Rand des Wahnsinns getrieben. Sie klammert sich an objektiv Messbarem, sucht Beweise für ihre Empfindungen, um so dem Drang, ihrem Leben ein Ende zu setzen, zu entgehen. Die Kratzspuren würde sie später, bei näherer Betrachtung als real wiedererkennen, redet sie sich ein und verspürt wohltuend die wiederkehrende Sicherheit, die ihr für ihr Vorhaben so wichtig erscheint.
Langsam entkrampfen sich ihre Hände. Die gerade noch zu Fäusten geballten Finger fangen an, die Oberschenkel abzutasten, fahren fort an ihrem Gesäß, landen an ihrer Hüfte und ballen sich erneut zu Fäusten. Es hatte sich nichts verändert. Noch immer ist sie unförmig und fett.
Unfähig sich zu bewegen, starrt sie auf das Gebäude, das ihr einst so vertraut gewesen war. Nur noch schemenhaft kann sie die Giebelfenster ausmachen, die auch heute noch eine trügerische Ruhe und Geborgenheit ausstrahlen. Sie verbietet es sich, an Stunden voller ekstatischer sexueller Hingabe zu denken, unter wohlbehüteten Betttüchern, mit einem Partner, der scheinbar bereit gewesen war, ihr gemeinsames Geheimnis zu bewahren und sie doch nur missbraucht hatte.
Zusehends ruhiger betrachtet sie ihre Umgebung. Nur wenige Häuser stehen verstreut in der weitläufigen Landschaft. Ein jedes hätte ohne weiteres als herrschaftliches Anwesen bezeichnet werden können. Imposante Gartenanlagen, geprägt von Rosenstöcken, Azaleen, Akazien und kunstvoll gestutzten Lebensbäumen umrahmen Gebäude, die viel über ihre Bewohner aussagen.
Lichtdurchflutet, nur wenige Räume der Neugier der Mitmenschen entzogen, spiegeln sich riesige Glasflächen in künstlich angelegten Teichen.
Trutzburg ähnlich scheinen sich andere wiederum dem Interesse der Mitmenschen entziehen zu wollen. Ihre Häuser verfügen über dicke Mauern, die Fenster gleichen Schießscharten.
Eines haben jedoch alle gemeinsam: Ihre Bewohner wollen Abstand, Abstand von der alles dominierenden Anstalt, wie das vor ihr liegende Gebäude genannt wird. Es sind nicht nur die Anstaltsbewohner, die in allen Nachbarhäusern Beklemmung hervorrufen und die Grundstückspreise in den Keller ziehen, sondern auch die Menschen, die vorgeben, den psychisch erkrankten Kreaturen im offenen Klinikbereich zu helfen, behaupten, auch die Schwerverbrecher im hinteren Bereich des Gebäudes, der Anstalt des Maßregelvollzugs, sicher weggeschlossen zu haben. Das Misstrauen macht keinen Unterschied zwischen Ärzten, Pflegern und sonstigen Mitarbeitern. Zu oft musste die Polizei die Anstalt aufsuchen, um grauenvolle Verbrechen aufzuklären.
Die Kälte kriecht unter ihren hochgeschlagenen Mantelkragen, läuft den Rücken hinunter, erreicht ihr Gesäß. Zitternd bearbeitet sie mit den Fäusten ihre Oberschenkel, schaltet die Vorstellung aus, wie sich ihr Fett bei jedem Schlag schwabbelnd um eine Faust legt.
Es ist ihr nicht bewusst, wie lange sie in der anbrechenden Dunkelheit verharrt hat. Wut steigt in ihr auf. Sie will sich nicht durch Erinnerungen von ihrem Plan abbringen lassen. Sein Wagen, ein auffälliges, nicht zu übersehendes Statussymbol, hätte wie immer provozierend vor dem Eingang stehen müssen. Die Auffahrt ist verlassen.
Verunsichert und doch entschlossen nähert sie sich Schritt für Schritt der schweren Eichentür. Er soll für jede Minute Leid das er ihr zugefügt hat bezahlen, unsagbaren Schmerz verspüren, Schmerz der ihren bei weitem übersteigt. Erbarmungslos will sie sich in seiner Pein laben. Seinen Tod würde sie langsam und fachgerecht einleiten. Sie ist sich bewusst, dass sie die Mittel als seine langjährige Assistenzärztin dazu besitzt.
15. Januar 200506.00 Uhr
Die Küche am Ende des langen Ganges war zu einem Ort geworden an dem man sich traf und die letzten Neuigkeiten austauschte.
<Hier menschelt es>, hatte vor nicht allzu langer Zeit der Azubi euphorisch aber naiv seinen Empfindungen freien Lauf gelassen.
Die Arbeitsbelastungen in der Privatklinik „Mitten im Leben“ waren hoch. Die Verdichtung der Arbeit war die Folge eines massiven Personalabbaus. Die Sparmaßnahmen erfassten jedoch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Mitarbeiter. Die Ausbildung des Pflegepersonals entsprach in vielen Fällen nicht den Anforderungen, die die hochgradig schwierige Klientel stellte. Fortbildung und Weiterbildung galten als Fremdwörter. Therapeuten mussten Behandlungsmethoden anbieten, für die sie nicht ausgebildet waren. Ärzte mit adäquater Fachausbildung waren Mangelware. Burnout hatte um sich gegriffen. Oft wurden erforderliche Arbeiten bewusst übersehen, Vermeidungsstrategien angewandt.
Es gelang, dem imposanten Gebäude äußerlich einen erhabenen Eindruck zu verleihen. Innerhalb der Anlage war der langsame Verfall jedoch nicht mehr zu verbergen. Immer wieder mussten von den Behörden aufgezeigte Hygiene- und Sicherheitsmängel beseitigt werden. Die angespannte Atmosphäre unter der Belegschaft nahm die Luft zum Atmen.
Das Fehlen niedergelassener Ärzte und daraus schlussfolgernd zunehmende Zwangseinweisungen hatten bei den wenigen anderen psychiatrischen privaten Kliniken und Anstalten des Maßregelvollzugs zu Gewinn, verbunden mit langen Aufnahmezeiten geführt. Der von der Leitung ‚Mitten im Leben‘ propagierte Wettbewerb mit vergleichbaren Einrichtungen verfehlte aufgrund von Misswirtschaft seine Wirkung. So lag auch der erhoffte Erfolg gegenüber dem üblicherweise staatlichen Maßregelvollzug in weiter Ferne. Die eigenen Mitarbeiter, eine Entlassung fürchtend, sich gegenseitig belauernd, Fehler anderer aufzeigend, um somit der eigenen Arbeitslosigkeit zu entgehen, machten die wenigen innovativen Bestrebungen zunichte. Ein Kampf um Existenzsicherung war entbrannt. Die Betreuung der Patienten wurde vom reinen Zeitfaktor beherrscht und nicht mehr von deren Bedürfnissen. Der Sicherheitsaspekt im Bereich des Maßregelvollzugs wurde vernachlässigt.
Nur wenige Mitarbeiter gestanden sich ein, dass die Küche für sie ein Zufluchtsort war, in dem sie die Schrecken und Grauen nach langen, nicht enden wollenden Dienstzeiten vermeintlich vergessen konnten. Kaum ein Angestellter verließ die Klinik nach einem anstrengenden Arbeitstag, ohne in der Küche zumindest vorbeigeschaut zu haben. Es schien, als würden hier die gegenseitigen Anfeindungen und Intrigen zum Stillstand gelangen. Erschöpft lehnte man sich an die Wand oder ließ sich auf einen der wenigen Stühle sinken. Bruchstückhaft flogen Wortfetzen wie: <Total durchgeknallt>, <hochgefährlich, niemals alleine rein>, <arme, irre Sau>, <möchte dem nicht draußen begegnen>, vom einen zum anderen Ende der Großraumküche.
Martin Okram beherrschte sein Metier. Töpfe und Pfannen wurden rasant schnell, kaum nachvollziehbar für Außenstehende, auf den Herdplatten hin und her geschoben, ihr Inhalt mit diversen, teils exotischen Gewürzen verfeinert. Mit einer scheinbar schwebenden Leichtigkeit wechselten die Kochutensilien von einer Hand in die andere, um das jeweilige Mahl genau auf den Punkt zu bringen. Er besaß das Talent, immer wieder neue, schmackhafte, ausgefallene Gerichte zu kreieren.
Anders als anderen Abteilungen, war Okrams Budget nicht dem Rotstift anheim gefallen, was er jedoch wohlweislich für sich behielt. Er war sich bewusst, dass ihm unausgesprochen die Aufgabe zufiel, durch seine verlockenden Köstlichkeiten, die Belegschaft zumindest einmal am Tag bei Laune zu halten.
Niemand konnte nachvollziehen, was Okram mit seinen Fähigkeiten als Koch in einer psychiatrischen Anstalt hielt. Mitarbeiter, aber auch einige wenige Insassen, sahen seinen Arbeitsplatz in einem Nobelrestaurant, wo sein Talent wohl eher geschätzt werden würde, als in einer Anstalt, in der verirrte Seelen wie Schwerverbrecher, paranoide Persönlichkeiten, Suizidgefährdete, mehr von der Einnahme ihrer Medikamente, als von einem ausgezeichneten Mittagsmahl abhängig waren.
Die meisten Insassen hatten zeitlebens von einfacher, billiger Kost gelebt und konnten Okrams fantasievollen Gerichten nur wenig abgewinnen. Nicht selten kam es zu lauthalsen Protesten und dem Schrei nach Fast Food. Verhaltensoriginellen Patienten fiel auch schon hin und wieder eine äußerst zweckentfremdete Verwendung des ihnen kredenzten Mahls ein.
Viele Mitarbeiter führten die Anziehungskraft der Küche auf Okrams Kochkünste und die appetitanregenden Düfte zurück. Nur wenige gestanden sich allerdings ein, dass es Okram selbst war, der sie magisch anzog.
Groß, muskulös, stets braun gebrannt, stand er aufrecht vor den Arbeitsplatten oder schritt eilig von einem Bereich zum anderen. Seine Bewegungen wirkten nie überhastet, strahlten immer Zielgerichtetheit aus, übermittelten Verlässlichkeit, die außerhalb der Küche in der Anstalt so selten anzutreffen war. Seine Anweisungen an das Küchenpersonal umfassten nur wenige Worte, gerade laut genug, um die Geräusche der eilig hantierenden Mitarbeiter zu übertönen. Das Team war ohne Zweifel eingespielt, Okram das unangefochtene Leittier.
Am Ende eines jeden Arbeitstages lehnte sich Okram an einen der breiten, hohen Schränke. Die kräftigen Arme im weißen, kurzärmligen Shirt vor der Brust verschränkt, betrachtete er voller Stolz und Genugtuung sein Reich. Er wusste um seine charismatische Ausstrahlung und verstand es hervorragend, sie nicht in Arroganz umkippen zu lassen. Geduldig wartete er auf das allabendliche Ritual. Langsam wurde von außen vorsichtig die Küchentür geöffnet.
„Ich bin jetzt fertig“, flüsterte eine Männerstimme stets nur diesen einen Satz. Gemeinsam verließen sie die Küche.
18. Januar 200506.30 Uhr
Die frühe Morgensonne schien nur matt durch die hohen vergitterten Fenster, deren Eisenstäbe Schattenspiele auf den Boden warfen. Der lange Flur war in ein unwirkliches Licht gehüllt. Die Türen, hinter denen sich Therapie- und Behandlungszimmer befanden, waren geschlossen. In der Küche hatten Okram und sein Küchenteam die Arbeit noch nicht aufgenommen.
Der Gang, der in der Mitte des langen Flures abzweigte, lag verlassen da. Schwere geschlossene Eichentüren, eine jede wie in einem Hotel mit einer Nummer versehen, vermittelten den Eindruck von einstigem Reichtum und Erhabenheit und ließen scheinbar vergessen, dass sich hinter jeder Tür Wohnraum für Elend und Leid verbarg. Die Patienten in diesem Bereich der Klinik waren freiwillig gekommen: Zwangserkrankte, Suizidgefährdete, Depressive, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatten, am Leben der Gesellschaft teilhaben zu können.
Nur der geschulte Beobachter konnte am Ende des Ganges eine leicht geöffnete Wohnungstür mit der Nummer 7 wahrnehmen und den Spalt als einen Schrei nach Hilfe deuten, Hilfe, die für so viele Klinikinsassen in weiter Ferne lag.
Der Speisesaal auf der gegenüber liegenden Seite sollte zum Verweilen auffordern, hatte jedoch zu so früher Morgenstunde sein Ziel noch nicht erreicht.
Energisch wurde von innen die Tür des Personalbereichs geöffnet, und es offenbarte sich eine gähnende Leere. Die Klinikinsassen schienen sich selbst überlassen zu sein.
Susanne Rüter blieb unschlüssig im Türrahmen stehen, entschied sich, den Tag doch nicht so schwungvoll fortzusetzen, wie sie ihn mit dem Aufreißen der Tür begonnen hatte. Es lohnte sich nicht, nicht hier. Als sie die leicht angelehnte Wohnraumtür Nummer 7 sah, stöhnte sie innerlich auf, ignorierte sie.
<Nicht schon wieder>, schoss es ihr durch den Kopf. Sollten sich doch die anderen darum kümmern. Die anderen, die ihre Nachtschicht unten im behaglich eingerichteten Kellerraum verbrachten, weit genug entfernt vom nächtlichen Wimmern und Phantasieren der ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen.
Jede Nacht losten sie eine Aufsicht aus, die im extremen Notfall, und nur dann, Alarm schlagen sollte. Diese hatte heute ihren Platz im Bereitschaftsraum schon vor einiger Zeit verlassen. Vermeidungshandeln, fälschlicherweise gedeutet als Arbeitsverweigerung, stand jedoch für Überforderung und prägte jede Nacht.
Wie eine Marionette stakste Susanne den Gang entlang, versuchte die Geräusche, die aus den Wohnräumen drangen, auszuschalten. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Ihre Schicht hatte noch nicht begonnen. Susanne war wie immer viel zu früh.
Für ihr Pflichtbewusstsein wurde sie belächelt.
Niemals hatte sie sich während ihrer Nachtschichten zu den Mitarbeitern in den Keller gesellt. Wie jeden Morgen warteten sie in den Tiefen des Gebäudes auf ihre in Kürze stattfindende Schichtablösung, ließen sich aber Zeit, in der Patientenetage, ihrem eigentlichen Arbeitsplatz, zu erscheinen.
Susanne wusste, dass man davon ausging, dass sie wie immer zu früh ihren Dienst antreten und die Probleme auf der Station schon regeln würde.
Heute täuschte man sich. Susanne hatte keine Lust. Man täuschte sich überhaupt gewaltig in Susanne, wenn man sie nur für die dicke, plumpe Person hielt, an der das Leben schändlich vorbeilief. Flachbusig mit allerdings ausladendem Hintern und enormen Oberschenkeln, unter ihrem weißen Kittel stets unvorteilhaft und bieder gekleidet, galt sie nicht nur als hässlich, sondern auch als ausgesprochen humorlos. Kollegen und Patienten begegnete sie verschlossen und unnahbar. Man hielt sich jedoch auch von ihr fern. Zu gegensätzlich waren ihr unvorteilhaftes Aussehen, gepaart mit Unnahbarkeit und rätselhafter Ausstrahlung von Begierde und dem Wunsch geliebt zu werden.
Als sie den sonnendurchfluteten Gang erreicht hatte, blieb sie abrupt stehen, betrachtete nachdenklich die geworfenen Schatten der Fenstergitter und schaute in den hinteren Teil des Gebäudes. Martialisch anmutende Eisenstäbe, Verankerungen in Boden und Wänden zogen eine Trennlinie durch das Gebäude, könnten als Verbindung zu den so unterschiedlichen und doch oft seelenverwandten Bewohnern im hinteren Teil des Gebäudes gedacht sein, wäre an den Gitterstäben nicht die schwere Kette befestigt gewesen. Zögernd wandte sich Susanne in die entgegengesetzte Richtung und betrat ihr Behandlungszimmer.
Als Assistenzärztin war sie zuständig für Neuaufnahmen, Neuaufnahmen ausschließlich für den vorderen Teil des Gebäudes. Einmal am Tag musste sie jedoch den Bereich hinter den Eisenstäben, dem Bereich des Maßregelvollzugs, zu den obligatorischen Teambesprechungen betreten. Dies tat sie stets durch den Haupteingang, da ihr ausschließlich die Zugangskarte zu den Zellen ausgehändigt worden war. Das Recht auf eine weitere Zugangskarte für die Außentore hatte sie sich noch nicht erarbeitet. Susanne kannte jedoch einfachere Wege.
In einer Stunde würde sie sich in ihrem Büro wieder mit einer verlorenen Seele befassen müssen, die ihre ganze Hoffnung in die Klinik „Mitten im Leben“ legte. Diese Aussicht erleichterte ihr den obligatorischen Weg in den hinteren, von Schwerverbrechern bewohnten Bereich, deren Lebensweg bei vielen von einer blutdurchtränkten Vergangenheit geprägt war.
Als sie ihre Zimmertür schließen wollte, kam sie ins Straucheln. Mischa hatte sich zwischen ihren Füßen hindurch Zutritt zu ihrem Raum verschafft. Im gleichen Moment hörte sie die schwere Eingangstür zuschlagen und wusste, dass Rudi Selter, der Pflegedienstleiter, zum Dienstantritt erschienen war. Sein Hund Mischa stand nun schwanzwedelnd vor Susanne. Sein dichtes, schwarz weiß geflecktes Fell, das immer leicht verwuschelt aussah, glänzte in den Sonnenstrahlen. Mischa war nicht groß, sodass er seinen Kopf leicht schräg nach oben strecken musste, um Susanne ansehen zu können. Hierbei fielen ihm einige Fellsträhnen über seine braunen Augen, was ihm einen frechen, aber auch liebenswerten Ausdruck verlieh. Mischa forderte von Susanne seine Streicheleinheiten ein, indem er zart seine Pfote auf ihren Unterschenkel legte. Lächelnd, was bei Susanne nur äußerst selten vorkam, fuhr sie Mischa über den Kopf, kraulte ihn hinter den Ohren. Sie mochte diesen kleinen Kerl und Mischa spürte, dass er wieder ein Herz erweicht hatte. Auf der Suche nach weiteren Streicheleinheiten trabte er aus Susannes Zimmer.
Susanne ging zu ihrem Schreibtisch, griff nach der neuen Patientenakte, vertiefte sich darin. Wieder würde sie sich wahrscheinlich eine Biografie anhören müssen, deren Verlauf sie aus langjähriger Praxiserfahrung selbstständig vervollständigen könnte. Nur selten erfuhr sie neue, unerwartete Begebenheiten, von denen man auch nicht immer sagen konnte, ob sie der Wahrheit entsprachen. Interessant wurde es mitunter, wenn Susanne ihre Diagnose erstellt hatte und gemeinsam mit den Patienten den Behandlungsplan besprach. Die Reaktionen der Patienten waren häufig sehr originell und reichten von Ablehnung bis hin zu gekünstelter Euphorie.
Auch die erwartete Neuaufnahme schien nach Aktenlage keinen für Susanne neuen, unerwarteten spannenden Lebensabschnitt vorweisen zu können. Wieder einmal war nur Routine gefragt.
Irritiert zuckte sie zusammen. Es gab keinen Zweifel. Mischa, der Hund, der Bellen nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählte, kläffte und jaulte erbärmlich.
Susanne stürzte auf den Flur. Mischa lief am Ende des Ganges vor den riesigen Eisengittern aufgeregt hin und her. Vergeblich versuchte er sich durch die engstehenden Gitterstäbe zu zwängen. Susanne erreichte Mischa gleichzeitig mit Rudi, der seinen Hund von den Stäben fern halten wollte.
Susanne starrte in den dunklen Teil hinter den Gittern. Was hatte Mischa gehört, gesehen? Fensterlos, ohne künstliches Licht lag der Teil ungenutzt vor ihr. In wenigen Metern Entfernung befand sich eine geschlossene Wand mit einer stählernen Verbindungstür, einer Tür mit Sicherheitsverriegelung, die nur mit der Zugangskarte für Außentore zu öffnen war.
Psychisch Kranke und Rechtsbrecher mit schweren Verhaltensstörungen, sowie alkohol-, medikamenten-, drogenabhängige Kriminelle waren auf diese Weise von in Freiheit lebenden Menschen getrennt aber auch von den Patienten im vorderen Klinikteil. Die meisten Patienten aus dem vorderen Teil hielten sich von der Vergitterung fern. Man konnte ja nie wissen.
Rudi lachte über den Mut seines kleinen Hundes, sprach beruhigend auf ihn ein, verpasste ihm einen kleinen Klaps und beobachtete wie sein Hund, nun wieder zusehends ruhiger, in andere Richtung auf neue Entdeckungstour davonlief. Nur langsam entfernte sich Susanne von der Absperrung. Nachdenklich ging sie an Rudi vorbei, sah nicht die Angst in seinen Augen.
18. Januar 200508.30 Uhr
„Lassen Sie mich los, verdammt noch mal“, kreischte eine hohe Frauenstimme sich fast überschlagend. „Ich muss da jetzt hin, das wissen Sie doch. Ich hab's getan und muss das in Ordnung bringen“, steigerte sich die Lautstärke und schmerzte in den Ohren.
„Sie können jetzt nicht weg. Schon gar nicht in diesem Aufzug. Es ist sehr kalt draußen“, war Rudi, deutlich um eigene Ruhigstellung bemüht, zu vernehmen.
Susanne saß noch immer hinter ihrem Schreibtisch. Das Gespräch mit der Neuaufnahme war um eine Stunde nach hinten verschoben worden. Vielleicht würde es auch überhaupt nicht stattfinden. Nicht selten machten Patienten vor der Kliniktür kehrt, wurden sich erneut bewusst, dass auch vorherige Therapien nur kurzfristig Erfolg erzielt hatten.
Susanne hatte also Zeit, die sie sich jedoch nicht nahm, um in das Geschehen einzugreifen. Den Anfall von Frau Schulte aus Zimmer 7 hatte sie schon erwartet seit sie deren angelehnte Wohnungstür wahrgenommen hatte. Susanne war allerdings erstaunt, dass er so lange auf sich hatte warten lassen. Wäre er vorher eingetreten und das Aufnahmegespräch pünktlich zustande gekommen, hätte sie nicht eingreifen können. Warum sollte sie es jetzt tun? Rudi war erprobt und würde mit der Situation schon fertig werden. Sie musste noch früh genug mit Frau Schulte in Verbindung treten, um aufzuarbeiten, was gerade vor ihrer Tür ablief.
„Ich muss hier raus. Gestern Abend im Park, ich habe ihn schwer verletzt. Halten Sie mich gefälligst nicht fest. Soll ich ihn etwa sterben lassen? Ich habe Angst, entsetzliche Angst, muss alles wieder richten.“
Die Stimme war zu einem Flüstern zusammengefallen. Panik gab ihr nicht mehr die Kraft, sich gegenüber Rudis kräftiger Stimmlage durchzusetzen. Lautlos fielen einzelne Tropfen zwischen ihren Füßen auf den Boden, trafen ihre Turnschuhe. Die Hosenbeine waren dunkel, von Urin durchtränkt, konnten keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Frau Schulte schien es nicht zu bemerken. Die Panik hatte über sie gesiegt.
„Ich gehe jetzt da vorne aus der Tür und sie werden mich nicht daran hindern“, krächzte Frau Schulte langsam und schwerfällig.
„Oh doch, das werde ich“, antwortete Rudi bestimmt.
„Gehen Sie, Frau Schulte, schauen sie nach und kommen Sie dann wieder rein. Aber denken Sie daran, nicht zu lange. Es ist sehr kalt.“
Susanne zuckte zusammen. Der Chefarzt Dr. Rolf Brandt hatte sich eingeschaltet.
„Danke, danke“, hörte sie Frau Schulte hauchen, bevor eilige Schritte sich in Richtung Ausgangstür entfernten. Susanne stützte sich auf der Schreibtischplatte ab, schraubte sich förmlich aus ihrem Sessel, steuerte unschlüssig den Flur an. Brandt stand Rudi gegenüber und schüttelte leicht verärgert den Kopf.
„Sie wissen doch, dass man die Frau nicht von ihren abwegigen Vorhaben abhalten darf und kann. Die kommt schon gleich wieder. Lassen Sie sie zukünftig einfach laufen und beobachten Sie nur ihre ‚Ausflüge‘, um notfalls eingreifen zu können. Ist das klar?“
Rudi schien sichtlich beleidigt. Ohne eine Erwiderung wollte er sich umdrehen, als er Susanne wahrnahm. Brandt folgte seinem Blick und griente Susanne unverschämt lässig an. Als sie neben ihm stand berührte seine Hand fast unmerklich ihr ausladendes Hinterteil. Es war nicht auszumachen, ob Rudi diese Intimität mitbekommen hatte.
„Ich habe Herrn Selter über sein zukünftiges Verhalten aufgeklärt. Vielleicht nimmst du dir die Zeit, ihm klarzumachen, wie Zwangserkrankte ticken“, wandte er sich an Susanne, ohne sein unverschämtes Grinsen abzustellen.
Susanne kam nicht dazu, eine Antwort zu geben. An der Eingangstür wurde gekratzt, geschlagen, getreten. Frau Schulte schrie. Ihre Worte waren nicht zu verstehen, aber es stand außer Frage, dass sie eingelassen werden wollte.
„Das ist jetzt ihre Aufgabe, Rudi Selter. Vielleicht legen Sie sie erst einmal trocken.“ Mit einem meckernden Lachen verschwand er in seinem Behandlungszimmer.
„Einen Dreck werde ich machen“, grummelte Rudi und verschwand im Seitengang.
Susanne beeilte sich, Frau Schulte die Tür zu öffnen. Mit abgebrochenen Fingernägeln, blutigen Fingerkuppen, Holzsplitter im Handgelenk wankte sie an Susanne vorbei. Blutspuren zierten die schwere, von langjähriger Gewalteinwirkung gezeichnete Tür.
„Machen Sie sich sauber. Ziehen Sie sich warme Kleidung an. Nach dem Frühstück unterhalten wir uns in meinem Zimmer. Bis dann.“
Mit hängendem Kopf schlich Frau Schulte in ihren Wohnbereich.
Susanne freute sich nicht auf das Gespräch. Aufarbeitungen mit Frau Schulte waren Endlosschleifen. Susanne konnte ihnen als Ärztin keine Erfolgserlebnisse abringen.
Bedächtig, nahezu resignierend, betrat sie ihr Zimmer.
Eine neu eingetroffene Mail teilte ihr mit, dass es zu keiner Neuaufnahme kommen würde, so wie sie es vermutet, eigentlich gehofft hatte. Langsam, den Blick starr an die Decke geheftet, drehte sie den Schlüssel herum. In letzter Zeit kam es öfter vor, dass sie sich einschloss, der Realität entzog. Erschöpft sank ihr Kopf auf die Schreibtischplatte, suchte nach klaren Antworten, konnte sie auf der kalten, glatten Glasplatte nicht finden. Das Piepen ihres Handys schreckte sie auf.
„Na?, heute Abend um 22.00Uhr? Sag nichts, ich weiß, dass du wild drauf bist.“
Ohne eine Antwort abzuwarten hatte Dr. Rolf Brandt, von sich selbst stets überzeugt, schon wieder aufgelegt.
„Ich hasse dich“, schrie sie laut auf, nicht wissend, ob es Brandt oder sie persönlich betraf. Sie würde seiner Aufforderung wie immer folgen.
Vorsichtig fuhr ihre Hand an ihrem Schenkel entlang, spürte das harte Metall unter ihrem Kittel, brachte ihr die ersehnte Erleichterung. Der unförmige Schlüssel befand sich an seinem vorgesehenen Platz. Sie trug ihn immer bei sich, vergewisserte sich jedoch regelmäßig, obwohl sie ihn hart auf ihrem Schenkel spürte.
„Du bist wie Frau Schulte und all die anderen Zwangserkrankten und paranoiden Persönlichkeiten. Die Adaptation hat längst stattgefunden“, schimpfte sie teils verärgert, teils verängstigt laut vor sich hin. Nur widerwillig schloss sie wieder auf.
Das Klopfen an Susannes Tür erfolgte so leise und zaghaft, dass es kaum zu vernehmen war. Vorsichtig, wie in Zeitlupe, wurde die Tür Zentimeter um Zentimeter geöffnet.
„Kommen sie einfach rein, Frau Schulte. Wir kennen uns doch schon so lange.“
Frau Schulte wurde mutiger, sogar sehr mutig. Die letzten Zentimeter stieß sie die Tür förmlich auf, gab ihr einen Stoß, sodass sie hinter ihr wieder ins Schloss fiel und steuerte mit energischen Schritten den Stuhl in der Sitzecke an, auf dem sie schon so oft gesessen hatte.
„Geht es Ihnen wieder besser? Erzählen Sie mal“, eröffnete Susanne die Sitzung.
„Sie wollen mir ja wohl nicht sagen, dass Sie glauben, mir ginge es gut. Beschissen, auf ganzer Linie beschissen geht es mir. Diese stereotypen Gedanken, Impulse. Ich habe Angst davor. Warum muss ich ständig denken, jemanden fast zu Tode verletzt zu haben. Immer wieder dieses Zwangshandeln und sinnlose durch die Gegend rennen, Verletzte, Tote suchen. Mit dem Auto habe ich sie angefahren, habe sie grausam verstümmelt. Das ist alles so abstoßend.“
Erschöpft sank Frau Schulte in sich zusammen, bohrte ihre Fäuste in die Augenhöhlen, eine Gebärde, die sie in Phasen größter Qual oft vollzog. Ein markerschütternder Aufschrei ließ ihren Körper beben. Die Augenhöhlen wirkten wie ausgetrocknet. Tränen hatte Frau Schulte schon lange nicht mehr hervorgebracht.
„Ich empfinde das als widerlich und es bedroht mich. Aber so bin ich nun mal. Ich kann nicht anders. Das bin ich, verdammt. Wenn ich festgehalten werde bekomme ich Panik, unbeschreibliche Angst. Sie wissen das doch. Sagen Sie das doch endlich mal allen“, flüsterte sie mit einer brüchigen Stimme.
„Haben Sie Ihre Medikamente genommen, Frau Schulte?“