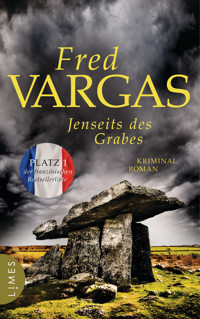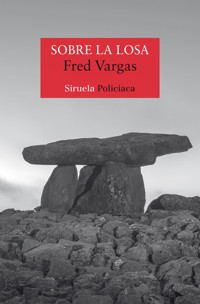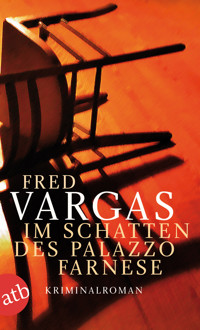
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Zutaten: Drei etwas exzentrische französische Studenten in Rom, die sich die Namen römischer Kaiser gegeben haben: Claudius, Tiberius, Nero. Eine wundervolle Italienerin Anfang 40, Laura, der in dieser Geschichte nahezu alle Männer verfallen. Claudius' Vater, ein namhafter Pariser Kunsthistoriker. Lorenzo Vitelli, ein feinsinniger italienischer Bischof, zuständig für die Vatikanbibliothek, Mentor der drei Studenten. Richard Valence, Sonderbeauftragter der französischen Regierung - kultiviert, sehr gut aussehend, Sakko und geschlossener Hemdkragen selbst bei dieser römischen Hitze. Sein erklärter Gegenspieler, Inspektor Ruggieri, immer in Hemdsärmeln, Typ Columbo. Der Fall: Auf dem europäischen Kunstmarkt taucht aus obskurer Quelle eine unbekannte Michelangelo-Zeichnung auf. Wurde sie aus den Archiven des Vatikans gestohlen? Überstürzt reist Claudius' Vater nach Rom. Bei einer nächtlichen Gala vor dem Palazzo Farnese wird er kurz nach seiner Ankunft durch einen Becher Schierling umgebracht. Wer aber war in der Lage, diesen antiken Gifttrank zu bereiten? "Fred Vargas schreibt Kriminalromane, die irrsinnig sind. Vor allem: irrsinnig gut. Schräge Typen gilt es darin zu entdecken, furiose Gedanken, abgedrehte Dialoge. Humor, Hintersinn, Psychologie und Phantasie: jeder Vargas-Krimi strotzt davon" Frankfurter Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über Fred Vargas
Fred Vargas, geb. 1957 und von Haus aus Archäologin. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin und eine Schriftstellerin von Weltrang. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis. Ihre Werke sind in über 40 Sprachen übersetzt und liegen sämtlich bei Aufbau in Übersetzung vor:
Im Schatten des Palazzo Farnese
Die schöne Diva von Saint-Jacques
Der untröstliche Witwer von Montparnasse
Das Orakel von Port-Nicolas
Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
Bei Einbruch der Nacht
Fliehe weit und schnell
Der vierzehnte Stein
Die dritte Jungfrau
Die schwarzen Wasser der Seine
Das Zeichen des Widders
Der verbotene Ort
Die Tote im Pelzmantel
Die Nacht des Zorns (Frühjahr 2012)
Informationen zum Buch
Die Zutaten: Drei etwas exzentrische französische Studenten in Rom, die sich die Namen römischer Kaiser gegeben haben: Claudius, Tiberius, Nero. Eine wundervolle Italienerin Anfang 40, Laura, der in dieser Geschichte nahezu alle Männer verfallen. Claudius' Vater, ein namhafter Pariser Kunsthistoriker. Lorenzo Vitelli, ein feinsinniger italienischer Bischof, zuständig für die Vatikanbibliothek, Mentor der drei Studenten. Richard Valence, Sonderbeauftragter der französischen Regierung - kultiviert, sehr gut aussehend, Sakko und geschlossener Hemdkragen selbst bei dieser römischen Hitze. Sein erklärter Gegenspieler, Inspektor Ruggieri, immer in Hemdsärmeln, Typ Columbo. Der Fall: Auf dem europäischen Kunstmarkt taucht aus obskurer Quelle eine unbekannte Michelangelo-Zeichnung auf. Wurde sie aus den Archiven des Vatikans gestohlen? Überstürzt reist Claudius' Vater nach Rom. Bei einer nächtlichen Gala vor dem Palazzo Farnese wird er kurz nach seiner Ankunft durch einen Becher Schierling umgebracht. Wer aber war in der Lage, diesen antiken Gifttrank zu bereiten?
»Fred Vargas schreibt Kriminalromane, die irrsinnig sind. Vor allem: irrsinnig gut. Schräge Typen gilt es darin zu entdecken, furiose Gedanken, abgedrehte Dialoge. Humor, Hintersinn, Psychologie und Phantasie: jeder Vargas-Krimi strotzt davon.«
Frankfurter Rundschau
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fred Vargas
Im Schatten des Palazzo Farnese
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Inhaltsübersicht
Über Fred Vargas
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Impressum
1
Die beiden jungen Männer warteten im Hauptbahnhof von Rom.
»Wann kommt ihr Zug?« fragte Nero.
»In einer Stunde und zwanzig Minuten«, erwiderte Tiberius.
»Willst du lange da so liegen bleiben? Willst du die ganze Zeit hier so rumhängen und auf diese Frau warten, ohne dich zu rühren?«
»Ja.«
Nero seufzte. Der Bahnhof war leer, es war acht Uhr morgens, und er wartete auf diesen verdammten Palatino aus Paris. Er betrachtete Tiberius, der sich auf einer Bank ausgestreckt und die Augen geschlossen hatte. Eigentlich konnte er sich leise davonmachen, nach Hause gehen und sich wieder schlafen legen.
»Bleib da, Nero«, sagte Tiberius, ohne die Augen zu öffnen.«
»Du brauchst mich nicht.«
»Ich will, daß du sie siehst.«
»Gut.«
Schwerfällig setzte sich Nero.
»Wie alt ist sie?«
Tiberius rechnete. Er wußte nicht genau, wie alt Laura sein mochte. Er war dreizehn gewesen und Claudius zwölf, als sie sich in der Schule kennenlernten, und schon damals war es eine ganze Weile her, daß Claudius’ Vater zum zweiten Mal geheiratet und Laura zur Frau genommen hatte. Das bedeutete, daß sie fast zwanzig Jahre älter als sie beide war. Lange Zeit hatte er geglaubt, sie sei Claudius’ Mutter.
»Dreiundvierzig«, sagte er.
»Gut.«
Nero schwieg einen Augenblick. Er hatte eine Feile in seiner Tasche gefunden und war jetzt damit beschäftigt, sich die Fingernägel zu feilen.
»Ich bin Claudius’ Vater schon mal begegnet«, bemerkte er. »Er hat nichts Besonderes. Erklär mir, warum diese Laura einen Kerl geheiratet hat, der nichts Besonderes an sich hat.«
Tiberius zuckte mit den Schultern.
»So was kann man nicht erklären. Ich vermute, sie liebt Henri trotzdem, man weiß nur nicht warum.«
Tatsächlich hatte Tiberius sich das auch schon oft gefragt. Was tat die einzigartige, herrliche Laura in den Armen dieses so grundsoliden und steifen Typen? Man konnte es nicht erklären. Man hatte nicht mal den Eindruck, daß Henri Valhubert sich bewußt war, wie einzigartig und herrlich seine Frau war. Hätte Tiberius mit Henri leben müssen, er wäre augenblicklich an Langeweile gestorben, Laura aber machte nicht den Eindruck, als würde sie daran sterben. Auch Claudius fand es unglaublich, daß es seinem Vater gelungen war, eine Frau wie Laura zu heiraten. »Es ist bestimmt ein Wunder, profitieren wir davon«, pflegte er zu sagen. Es war ein Problem, über das Claudius und er schon lange nicht mehr nachdachten und dessen Erörterung sie immer mit der Bemerkung »So was kann man nicht erklären« abbrachen.
»So was kann man nicht erklären«, wiederholte Tiberius. »Was machst du da mit der Nagelfeile?«
»Ich nutze unser Warten, um meinem Erscheinungsbild den letzten Schliff zu geben. Solltest du Interesse daran haben«, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu, »ich besitze noch eine.«
Tiberius fragte sich, ob es wirklich eine so gute Idee war, Laura Nero vorzustellen. Laura hatte sehr empfindliche Seiten.
2
Henri Valhubert mochte solche Störungen nicht.
Er öffnete die Hand und ließ sie seufzend auf den Tisch fallen.
»Ja, es ist einer«, erklärte er.
»Sind Sie sicher?« fragte sein Besucher.
Valhubert zog eine Augenbraue hoch.
»Entschuldigen Sie«, sagte der Mann. »Wenn Sie das sagen.«
»Es ist ein Gekritzel von Michelangelo«, fuhr Valhubert fort, »ein Stück von einem Torso und ein Schenkel, die aus heiterem Himmel hier in Paris auftauchen.«
»Ein Gekritzel?«
»Ganz richtig. Irgendein abendliches Gekrakel, das aber Millionen wert ist, weil es aus keiner bekannten privaten oder öffentlichen Sammlung stammt. Etwas Unveröffentlichtes, das noch keiner gesehen hat. Ein hingekritzelter Schenkel, der hier mitten in Paris auftaucht. Kaufen Sie ihn, und Sie machen ein phantastisches Geschäft. Es sei denn natürlich, er wäre gestohlen.«
»Man kann heutzutage keinen Michelangelo mehr stehlen. So was liegt ja nicht unbemerkt herum.«
»Doch, in der Vaticana … In den Tiefen der unermeßlichen Archive der Biblioteca Vaticana … Dieses Papier riecht nach Vaticana.«
»Es riecht?«
»Ja, es riecht.«
Das war idiotisch. Henri Valhubert wußte sehr wohl, daß jedes beliebige alte Papier gleich roch. Verärgert schob er es von sich. Und? Warum berührte ihn die Sache so? Es war jetzt nicht der Augenblick, an Rom zu denken. Bloß nicht. Früher, in der Vaticana, wenn er auf der fieberhaften Suche nach barocken Bildern war und in der Stille der Bibliothek raschelnd Papiere hin und her schob, war es immer sehr heiß gewesen. War er auch heute noch so fieberhaft tätig? Nicht im geringsten. Er leitete vier Kunsteditionen, ging mit einem Haufen Kohle um, man lief ihm hinterher, um seinen Rat einzuholen, entschuldigte sich, bevor man ihn ansprach, sein Sohn wich ihm aus, und sogar seine Frau Laura zögerte, ihn zu unterbrechen. Dabei war es ihr, als er sie kennenlernte, herzlich egal gewesen, ob sie ihn unterbrach oder nicht. Damals in Rom kam sie abends und wartete auf ihn unter den Fenstern des Palazzo Farnese – in einem großen weißen Hemd ihres Vaters, das sie mit einem Gürtel zusammenschnürte. Er erzählte ihr, was er in den Stunden zuvor aus der Hitze der alten Vaticana zutage gefördert hatte, und Laura, das scharf gezeichnete Profil gesenkt, hörte ihm ernst zu. Dann plötzlich war es ihr herzlich egal, und sie unterbrach ihn.
Heute nicht mehr. Heute war das achtzehn Jahre her, und sogar Michelangelo machte ihn melancholisch. Henri Valhubert mochte solche Erinnerungen nicht. Warum kam der Kerl und hielt ihm dieses stinkende Papier unter die Nase? Und warum war er selbst noch immer Snob genug, Vergnügen daran zu finden, daß er »die Vaticana« sagte, als spräche er lässig von einer alten Freundin, anstatt respektvoll »die Biblioteca Vaticana«, wie alle anderen auch? Und warum fuhr Laura fast jeden Monat nach Rom? Machten ihre Eltern, die fern der großen Stadt ihr kümmerliches Dasein fristeten, derart viele Reisen erforderlich?
Er hatte nicht einmal Lust, dem Kerl seine Entdeckung wegzuschnappen, was ihm ein leichtes gewesen wäre. Der Kerl konnte seinen Michelangelo-Schenkel gern behalten, es war ihm gleichgültig.
»Schließlich kann das Blatt auch ganz legal aus irgendeiner kleinen italienischen Sammlung stammen«, sagte er, um das Gespräch wiederaufzunehmen. »Was waren die zwei, die es Ihnen angeboten haben, für Typen?«
»Sie waren kein bestimmter Typ. Sie sagten, sie hätten die Zeichnung von einem Privatmann in Turin erworben.«
Valhubert antwortete nicht.
»Was soll ich also tun?« fragte der Mann.
»Ich hab’s Ihnen doch gesagt, kaufen Sie das Blatt! Es ist geschenkt. Und seien Sie so nett, schicken Sie mir ein Foto davon – und geben Sie mir Bescheid, wenn weitere auftauchen. Man kann nie wissen.«
Kaum war er allein, öffnete Henri Valhubert weit das Fenster seines Büros, um die Luft der Rue de Seine zu atmen und den Geruch von altem Papier und Vaticana zu vertreiben. Laura müßte jetzt gerade in Roma Termini ankommen. Und dieser verrückte junge Tiberius würde vermutlich auf sie warten, um ihr das Gepäck zu tragen. Wie immer.
3
Der Palatino war eingefahren. Nach und nach stiegen die Reisenden aus. Tiberius zeigte Nero von weitem Laura.
»Tiberius …«, sagte Laura. »Du bist nicht bei der Arbeit? Stehst du schon lange hier?«
»Ich verdorre hier seit dem Morgengrauen. Du warst gerade über die Grenze und hast noch geschlafen, da war ich schon auf dem Bahnhof. Dort in der Ecke. Wie geht es dir? Hast du schlafen können in deinem Liegewagen? Gib mir deine Tasche.«
»Ich bin nicht müde«, erklärte Laura.
»Aber klar. Du weißt genau, daß Reisen müde macht. Übrigens, Laura, hier stelle ich dir unseren Freund Nero vor, die dritte satanische Spitze des teuflischen Dreiecks, das die Stadt Rom mit Feuer und Schwert verwüstet … Lucius Domitius Nero Claudius, sechster Cäsar … Tritt vor, Nero! Bei dem mußt du gut aufpassen, Laura … Er ist komplett und definitiv verrückt. Es ist der kompletteste Verrückte, den Rom seit langer Zeit in seinen Mauern beherbergt hat … Aber Rom weiß es noch nicht. Das ist das Problem.«
»Sie also sind Nero? Claudius erzählt mir seit Jahren von Ihnen«, bemerkte Laura.
»Ausgezeichnet«, erwiderte Nero. »Ich bin ein unerschöpfliches Thema.«
»Und vor allem ein sehr schlechtes Thema«, fügte Tiberius hinzu. »Eruptive und für die Zukunft der Nationen verhängnisvolle Intelligenz. Jetzt gib mir doch die Tasche, Laura! Ich möchte nicht, daß du Taschen trägst. Sie ist schwer, und außerdem sieht es häßlich aus.«
Nero ging neben ihnen. Tiberius hatte die Frau schlecht beschrieben, mit hochtrabenden Worten, die alles und nichts besagten. Nero warf ihr rasche Blicke von der Seite zu, aus der Distanz, mit einer respektvollen Ehrerbietung, die ziemlich ungewöhnlich bei ihm war. Laura war recht groß und schwankte beim Gehen kaum merklich. Warum hatte Tiberius diese Sache mit dem Profil so ungenau beschrieben? Er hatte von einem scharfgeschnittenen Profil gesprochen, von einem etwas verächtlichen Mund, von knapp schulterlangen Haaren.
Aber er hatte nicht gesagt, wie sehr einen das Gesamtbild in Erstaunen versetzte, sobald man sie betrachtete. Gerade im Augenblick hörte sie Tiberius zu, wie er erzählte, und nagte dabei an den Lippen. Nero war gespannt auf die Melodie ihrer Stimme.
»Nein, zu essen habe ich nichts bei mir, Großer!« erwiderte Laura; sie lief raschen Schrittes und hielt die Arme vor dem Bauch verschränkt.
»Und was wird aus mir?«
»Kauf dir irgendwas auf dem Weg. Schließlich mußt du etwas essen. Arbeitet Claudius inzwischen wieder? Konzentriert er sich?«
»Natürlich, Laura. Claudius arbeitet viel.«
»Du lügst, Tiberius. Tagsüber schläft er, und nachts zieht er umher. Mein kleiner Claudius ist so flatterhaft. Sag, Tiberius, warum ist er nicht mitgekommen?«
Sie wischte ihre Worte mit einer Handbewegung weg.
»Wegen Livia«, erwiderte Tiberius. »Weißt du noch nichts von der letzten großen Entdeckung deines Claudius’?«
»Das letzte Mal hat er mir von einer gewissen Piera erzählt.«
»Nicht doch. Piera, das ist mindestens zwanzig Tage her, das ist schon Geschichte, das zerfällt schon zu Staub. Nein, die entzückende Livia sagt dir nichts?«
»Aber nein. Jedenfalls glaube ich nicht. Ich sehe so viele Leute, weißt du.«
»Sehr gut, ich werde sie dir diese Woche zeigen. Vorausgesetzt natürlich, daß Claudius’ Leidenschaft bis dahin anhält.«
»Ich bleibe diesmal nur kurz, mein Großer. Morgen abend fahre ich nach Paris zurück.«
Tiberius blieb abrupt stehen.
»So schnell fährst du wieder?«
»Ja«, sagte Laura lächelnd. »In anderthalb Monaten komme ich wieder.«
»Ist dir klar, Laura, was du da sagst? Weißt du eigentlich, daß Claudius und ich, seitdem wir hier im römischen Exil leben, täglich, hörst du, täglich ein bißchen deinetwegen heulen? Ein kleines bißchen vor dem Mittagessen und dann noch ein kleines bißchen vor dem Abendessen. Und was machst du? Du verläßt uns für anderthalb Monate! Glaubst du, daß diese Pieras und Livias uns zerstreuen könnten?«
»Ja, das glaube ich«, erwiderte Laura weiter lächelnd.
Nero würdigte dieses Lächeln.
»Ich dagegen bin ein Engel«, erklärte Tiberius.
»Genau, mein Großer. Geh jetzt, ich nehme mir ein Taxi.«
»Können wir nicht mitkommen? Im Hotel ein Glas zusammen trinken?«
»Lieber nicht. Ich habe haufenweise Verabredungen.«
»Gut. Wenn du Henri wiedersiehst, dann grüß ihn von mir und von Claudius. Sag ihm, daß ich das Foto für sein Buch habe, um das er mich gebeten hat. Also … dann gebe ich dir deine Tasche zurück? Kaum bist du angekommen, verläßt du uns wieder? Und nicht früher als in anderthalb Monaten?«
Laura zuckte mit den Schultern.
»Ist schon gut«, fuhr er fort. »Ich werde mich in meine Studien vertiefen. Und du, Nero?«
»Ich werde mich im Blut der Familie ertränken«, erklärte Nero lächelnd.
»Er meint die kaiserliche Familie«, flüsterte Tiberius. »Das julisch-claudische Kaiserhaus. Das ist seine Macke. Eine ziemlich ernste. Und Nero, der Vatermörder, war der Schlimmste von allen. Er hat Rom in Brand gesteckt.«
»Was nicht erwiesen ist«, wandte Nero ein.
»Ich weiß«, sagte Laura. »Und er hat sich töten lassen und dabei gesagt: ›Welch ein Künstler stirbt mit mir!‹, oder so ähnlich.«
Tiberius hielt seine Wange hin, und Laura küßte ihn. Nero gab ihr die Hand.
Die beiden jungen Männer sahen ihr nach, wie sie sich, in ihren schwarzen Mantel gehüllt, die Schultern ein wenig gebeugt, als ob sie fröstele, mit großen Schritten entfernte. Sie drehte sich um und winkte ihnen noch einmal zu. Nero kniff die Augen zusammen. Nero war kurzsichtig: Er zog mit den Fingern an den Lidrändern seiner grünen Augen, um »die Schärfe einzustellen«, denn er weigerte sich strikt, eine Brille zu tragen. Ein römischer Kaiser kann sich nicht erlauben, eine Brille zu tragen, erklärte er. Vor allem nicht, wenn er grüne Augen hat, die sehr heikel sind. Das wäre unschicklich und grotesk. Nero trug eine antike Frisur, kurz, mit ein paar blonden, regelmäßigen Locken auf der Stirn, die er jeden Morgen mit Pomade andrückte.
Tiberius schüttelte ihn leicht.
»Du kannst aufhören, an deinen Augen zu ziehen«, sagte er. »Sie ist schon um die Ecke gebogen.«
»Du kannst keine Frauen beschreiben«, sagte Nero seufzend. »Und Männer auch nicht.«
»Halt die Klappe«, erwiderte Tiberius. »Komm, laß uns einen Kaffee trinken.«
Tiberius war erleichtert. Es wäre furchtbar für ihn gewesen, wenn sein lieber Nero Laura nicht gemocht hätte. Natürlich kannte er die exaltierte Begeisterungsfähigkeit seines Freundes, aber es bestand doch immer ein Risiko. Zum Beispiel hätte Nero einfach unentschieden sein können. Er hätte rein gar nichts verstehen und sagen können, ja, hübsch sei sie, aber nicht mehr jung, und es gebe so manches kleine Detail an ihr auszusetzen, sie sei alles andere als vollkommen – oder etwas in der Art. Aus diesem Grunde hatten Tiberius und Claudius so lange gezögert, bevor sie ihm Laura zeigten. Aber Nero verstand zu erkennen, was auf Erden etwas wert war.
»Nein, du kannst keine Frauen beschreiben«, erklärte Nero erneut, während er in seinem Kaffee rührte.
»Trink deinen Kaffee. Du nervst mich, wenn du so darin rumrührst.«
»Natürlich, du bist sie gewohnt. Du kennst sie, seit du klein warst.«
»Seit ich dreizehn war. Aber man gewöhnt sich nicht an sie.«
»Wie war sie früher? Schöner?«
»Meiner Meinung nach weniger schön. Sie hat eines von diesen Gesichtern, denen Erschöpfung gut steht.«
»Sie ist also Italienerin?«
»Nicht ganz, ihr Vater ist Franzose. Sie ist in Italien geboren und hat hier ihre gesamte, wohl ziemlich bescheuerte Jugend verbracht. Sie spricht fast nie darüber. Ganz offensichtlich waren ihre Eltern völlig verarmt, sie war so die Art Mädchen, die barfuß durch die Straßen von Rom laufen.«
»Kann ich mir vorstellen«, bemerkte Nero versonnen.
»In Rom ist sie auch Henri Valhubert begegnet, als er herkam, um an der École Française zu arbeiten. Sehr reich, verwitwet, mit einem kleinen Jungen, aber kein schöner Mann. Nein, Henri ist nicht schön. Sie hat ihn geheiratet und Rom verlassen, um in Paris zu leben. So was kann man nicht erklären. Es sind jetzt fast zwanzig Jahre her. Sie kommt ständig nach Rom, um ihre Familie zu besuchen, und auch andere Leute. Manchmal bleibt sie einen Tag, manchmal ein bißchen länger. Es ist schwer, sie lange am Stück für sich zu haben.«
»Du hattest gesagt, du magst Henri Valhubert?«
»Natürlich. Weil ich ihn gewohnt bin. Claudius gegenüber war er immer sehr streng. Seine Anfälle von Zärtlichkeit haben wir in einem Heft notiert, denn von Zeit zu Zeit hatte er welche, vor allem morgens. Laura steckte uns hinter seinem Rücken Geld zu und log für uns. Denn Henri Valhubert war gegen jegliche Art von unnützen Ausgaben. Hart ackern und leiden. Das Ergebnis: Claudius ist ein Faulpelz, und das macht seinen Vater vor Wut verrückt. Er ist kein einfacher Mann. Ich glaube, Laura fürchtet ihn. Eines Abends ist Claudius auf seinem Bett eingeschlafen, und ich mußte durch das große Arbeitszimmer, um nach Hause zu gehen. Da sah ich Laura, wie sie in einem Sessel saß und weinte. Es war das erste Mal, daß ich sie weinen sah, und ich war wie versteinert, da war ich fünfzehn, verstehst du. Zugleich war es ein außerordentlicher Anblick. Sie hielt ihr schwarzes Haar mit dem Handgelenk zurück und weinte lautlos, ihre Nasenflügel bebten, ein göttliches Bild. Es war das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.«
Tiberius runzelte die Stirn.
»Es war mein erster Schritt in Richtung Erkenntnis«, fügte er hinzu. »Davor war ich dumm.«
»Warum weinte sie?«
»Ich habe es nie erfahren. Und Claudius auch nicht.«
4
Claudius klopfte kurz an Tiberius’ Zimmertür und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Du nervst«, erklärte Tiberius, ohne sich von seinem Schreibtisch abzuwenden.
»Ich vermute, du arbeitest?«
Tiberius antwortete nicht, und Claudius seufzte.
»Was bringt dir das?«
»Verschwinde, Claudius. Ich sehe dich beim Abendessen.«
»Sag, Tiberius, als du Laura vor zwei Wochen am Bahnhof gesehen hast, habt ihr da über mich gesprochen?«
»Ja. Also, nein. Wir haben von Livia gesprochen. Wir haben uns ja nicht lange gesehen, weißt du.«
»Wieso von Livia? Übrigens habe ich vor zwei Tagen mit ihr Schluß gemacht.«
»Du bist anstrengend. Was war denn an diesem Mädchen nun wieder falsch?«
»Sie war so bemüht.«
»Wenn sie verliebt sind, hast du Angst, wenn sie es nicht sind, bist du beleidigt, und wenn sie es nur ein wenig sind, langweilst du dich. Was suchst du eigentlich genau?«
»Sag, Tiberius, hast du mit Laura über mich gesprochen? Oder über meinen Vater?«
»Nicht einmal über Henri.«
»Dreh dich um, wenn du mit mir redest!« rief Claudius. »Ich kann nicht sehen, ob du lügst.«
»Du ermüdest mich, mein Freund«, bemerkte Tiberius und gehorchte. »Ich mag es nicht, wenn du so erregt bist. Was gibt es noch?«