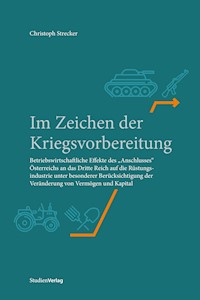
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Mit dem "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich erhofften sich weite Teile der österreichischen Industrie, vom wirtschaftlichen Aufschwung des Dritten Reiches durch dessen Aufrüstung am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu profitieren. Ob und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen dies gelang, ist Thema des vorliegenden Buches, das sich mit den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des "Anschlusses" auf die österreichische Rüstungsindustrie befasst und so eine Forschungslücke schließt. Im Fokus stehen dabei nicht nur die mit der Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich verbundenen politischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Maßnahmen im Allgemeinen. In ausgewählten Fallbeispielen werden zudem die finanzielle Entwicklung und Investitionstätigkeit von zwölf österreichischen Unternehmen der Rüstungsindustrie untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Strecker
Im Zeichen der Kriegsvorbereitung
© 2022 by Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Internet: www.studienverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7065-6287-4
Buchinnengestaltung nach Entwürfen von himmel. Studio für Design und Kommunikation, Innsbruck/Scheffau – www.himmel.co.at
Satz und Umschlag: Studienverlag/Maria Strobl – www.gestro.at
Umschlagabbildung: AdobeStock/Balthus, AdobeStock/RainLedy und AdobeStock/ylivdesign unter Bearbeitung von Maria Strobl
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.studienverlag.at
Danksagung
Viele Menschen haben mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt, ihnen möchte ich an dieser Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen.
Allen voran danke ich meiner wunderbaren Frau Eva, die mir die notwendige Zeit gegeben und viel Toleranz entgegengebracht hat. Sie hat mich zum Schreiben dieser Arbeit ermuntert und immer daran geglaubt, dass ich sie auch abschließen werde. Zudem danke ich meiner kleinen Tochter Valerie, die mich mit ihren Zeichnungen auf meinen Arbeitsunterlagen zwischendurch zum Lachen gebracht hat.
Ebenso danke ich meinen Eltern Ursula und Franz, Herrn Dipl.-Ing. Karl Plich, Frau Mag.a Charmian Lechner und Herrn Mag. Matthias Ley, MBA für ihre Unterstützung.
Stellvertretend für alle Archivarinnen und Archivare, die mir bei meinen Archivrecherchen so freundlich geholfen haben, danke ich Frau Dr.in Ulrike Zimmerl vom Bank Austria Archiv.
Und ich bedanke mich bei Herrn a.o. Univ.-Prof. Dr. Peter Eigner, der mit viel Geduld und hilfreichen Anmerkungen meine Gedanken und Ansätze in die richtige Richtung gelenkt hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Inhaltsüberblick
1.2. Forschungsstand
1.3. Hypothese und Forschungsfragen
1.4. Methode
1.5. Quellen und Archive
2. Österreichs Industrie zwischen Habsburgerreich und „Anschluss“
2.1. Die Industrie gegen Ende des Habsburgerreiches
2.1.1. Die Industrie vor dem Ersten Weltkrieg
2.1.2. Die Rüstungsindustrie im Ersten Weltkrieg
2.2. Die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zusammenbruch des Habsburgerreichs
2.2.1. Die Phase der Umstellung
2.2.2. Die Wirtschaft in der Krise und im Austrofaschismus
2.3. Wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Österreich und dem Deutschen Reich
2.3.1. Österreichs Rolle bei den deutschen Expansionsbestrebungen
2.3.2. Österreichs Außenhandel mit dem nationalsozialistischen Deutschen Reich
2.3.3. Deutsches Interesse an Österreichs Industrie
3. Die Eingliederung ins Dritte Reich
3.1. Wirtschaftliche Auswirkungen des „Anschlusses“
3.2. Aufteilung und „Bereinigung“ der Industrie
3.3. Exkurs: Wirtschaftliche Auswirkungen deutscher Besetzung in europäischen Ländern
3.4. Rationalisierung, Modernisierung und Rüstungsplanung
3.5. Auswirkungen des Kriegsbeginns auf die Rüstungsproduktion
4. Empirische Untersuchung betriebswirtschaftlicher Effekte des „Anschlusses“ auf Vermögen und Kapital von Rüstungsunternehmen
4.1. Die Jahresabschlussanalyse – Theorie
4.2. Die Jahresabschlussanalyse – angewandte Methode, Daten und Quellenkritik
4.3. Empirische Analyse einzelner Rüstungsunternehmen
4.3.1. Maschinenfabrik Heid AG
4.3.2. Martin Miller AG
4.3.3. Vereinigte Wiener Metallwerke AG
4.3.4. Steyr-Daimler-Puch AG
4.3.5. Enzesfelder Metallwerke AG
4.3.6. Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG
4.3.7. AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft
4.3.8. Felten & Guilleaume, Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- und Kupferwerke AG
4.3.9. Carbidwerk Deutsch-Matrei AG
4.3.10. Sprengstoff-Werke Blumau AG
4.3.11. Veitscher Magnesitwerke AG
4.3.12. Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG
4.4. Vergleichende Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerung
5. Schlussbetrachtung
6. Anhang
6.1. Jahresabschlüsse Maschinenfabrik Heid AG
6.2. Jahresabschlüsse Martin Miller AG
6.3. Jahresabschlüsse Vereinigte Wiener Metallwerke AG
6.4. Jahresabschlüsse Steyr-Daimler-Puch AG
6.5. Jahresabschlüsse Enzesfelder Metallwerke AG
6.6. Jahresabschlüsse Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG
6.7. Jahresabschlüsse AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft
6.8. Jahresabschlüsse Felten & Guilleaume, Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- und Kupferwerke AG
6.9. Jahresabschlüsse Carbidwerk Deutsch-Matrei AG
6.10. Jahresabschlüsse Sprengstoff-Werke Blumau AG
6.11. Jahresabschlüsse Veitscher Magnesitwerke AG
6.12. Jahresabschlüsse Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG
7. Literaturverzeichnis
7.1. Archivquellen
7.1.1. Archiv des Instituts für Zeitgeschichte Wien
7.1.2. Bank Austria Archiv
7.1.3. Bundesarchiv Deutschland
7.1.4. Hirtenberger Patronenfabrik Museum
7.1.5. Österreichische Gesellschaft für Zeitgeschichte Archiv
7.1.6. Österreichisches Staatsarchiv
7.1.7. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Deutschland
7.1.8. Tiroler Landesarchiv
7.2. Gedruckte Quellen
7.3. Online-Quellen
7.4. Fachliteratur
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Anteil der Wirtschaftszweige am BNP des Habsburgerreichs 1913
Abbildung 2: Geschützte Unternehmen in Zisleithanien im Okt. 1915
Abbildung 3: Fördervolumen in Bergbau und Hüttenwesen Zisleithanien 1913–1917
Abbildung 4: Streiks in Zisleithanien 1911–1917
Abbildung 5: Produktion von Rohstahl im Habsburgerreich 1914–1918
Abbildung 6: Produktion von Kriegsgerät im Habsburgerreich (in Stück) 1914–1918
Abbildung 7: Arbeitslosenrate in Österreich 1919–1929
Abbildung 8: Inflation in Österreich 1918–1924
Abbildung 9: Veränderung Bruttonationalprodukt Österreich 1921–1933
Abbildung 10: Entwicklung BNP in Österreich nach Wirtschaftsbereichen real 1920–1933
Abbildung 11: Veränderung der Industrieproduktion in Österreich 1920–1937
Abbildung 12: Veränderung Belegschaftsstand nach Unternehmensgröße in Österreich 1929–1934
Abbildung 13: Arbeitslosenrate in Österreich 1929–1937
Abbildung 14: Internationale relative industrielle Produktionsentwicklung 1929–1936
Abbildung 15: Außenhandelspartner Österreichs nach Ländern 1919 und 1922
Abbildung 16: Anteil Südosteuropas am deutschen Außenhandel
Abbildung 17: Anteil Deutsches Reich am Außenhandel Südosteuropas
Abbildung 18: Anteil Österreichs am Außenhandel Südosteuropas
Abbildung 19: Österreichs Export nach ausgewählten Ländern 1933 bis 1937
Abbildung 20: Verteilung Österreichs Export nach Ländern 1933 bis 1937
Abbildung 21: Österreichs Import aus ausgewählten Ländern 1933 bis 1937
Abbildung 22: Verteilung Österreichs Import aus Ländern 1933 bis 1937
Abbildung 23: Kohleimport Österreichs 1937
Abbildung 24: Verteilung des Außenhandels Österreichs nach Ländern 2015 bis 2017
Abbildung 25: Vergleich Österreichs Exportverteilung 1937 und 2017
Abbildung 26: Vergleich Österreichs Importverteilung 1937 und 2017
Abbildung 27: Export an Rüstungsgütern Österreich 1933 bis 1937
Abbildung 28: Import an Rüstungsgütern Österreich 1933 bis 1937
Abbildung 29: Österreichs Außenhandel mit Rüstungsgütern
Abbildung 30: Ausgewählte Kapitalbeteiligungen an Industrieunternehmen vor dem „Anschluss“
Abbildung 31: Für das Deutsche Reich wichtige österreichische Rüstungsunternehmen 1938
Abbildung 32: Zur Vermittlung vorgemerkte Arbeitslose in Österreich Dezember 1937
Abbildung 33: Arbeitslosenrate Österreich 1936–1941
Abbildung 34: Beschäftigte in der Kriegsindustrie 1939
Abbildung 35: Veränderung Außenhandel Österreich 1937 zu 1938
Abbildung 36: Veränderung Bruttonationalprodukt Österreich 1937–1941
Abbildung 37: Beispiele für Entlassungen aus Führungspositionen österreichischer Unternehmen
Abbildung 38: Kriegsgeräteproduktion Deutsches Reich 1940
Abbildung 39: Industrielle Investitionen im Deutschen Reich
Abbildung 40: Kriterien zur Auswahl von Unternehmen für die empirische Untersuchung
Abbildung 41: Hauptsitze und Niederlassungen/Werke der untersuchten Unternehmen innerhalb Österreichs
Abbildung 42: Maschinenfabrik Heid AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 43: Maschinenfabrik Heid AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 44: Maschinenfabrik Heid AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 45: Martin Miller AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 46: Martin Miller AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 47: Martin Miller AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 48: Vereinigte Wiener Metallwerke AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 49: Vereinigte Wiener Metallwerke AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 50: Vereinigte Wiener Metallwerke AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 51: Steyr Daimler Puch AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 52: Steyr Daimler Puch AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 53: Steyr Daimler Puch AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 54: Enzesfelder Metallwerke AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 55: Enzesfelder Metallwerke AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 56: Enzesfelder Metallwerke AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 57: Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 58: Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 59: Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 60: AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft – Bilanzentwicklung
Abbildung 61: AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft – Bilanzkennzahlen
Abbildung 62: AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft – Kennzahlen der GuV
Abbildung 63: Felten & Guilleaume, Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- und Kupferwerke AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 64: Felten & Guilleaume, Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- und Kupferwerke AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 65: Felten & Guilleaume, Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- und Kupferwerke AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 66: Carbidwerk Deutsch-Matrei AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 67: Carbidwerk Deutsch-Matrei AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 68: Carbidwerk Deutsch-Matrei AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 69: Sprengstoff-Werke Blumau AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 70: Sprengstoff-Werke Blumau AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 71: Sprengstoff-Werke Blumau AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 72: Veitscher Magnesitwerke AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 73: Veitscher Magnesitwerke AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 74: Veitscher Magnesitwerke AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 75: Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG – Bilanzentwicklung
Abbildung 76: Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG – Bilanzkennzahlen
Abbildung 77: Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG – Kennzahlen der GuV
Abbildung 78: Entwicklung Eigenkapitalquote und Anlagenintensität der untersuchten Unternehmen 1936 auf 1940
Abbildung 79: Veränderung Umsatz und Anlagevermögen der Unternehmen 1936–1940
Abbildung 80: Gewinnveränderung der untersuchten Unternehmen 1936–1940
Abbildung 81: Vergleich durchschn. Dividendenzahlung und durchschn. Eigenkapitalrentabilität der untersuchten Unternehmen 1936–1940
Abbildung 82: Kennzahlenvergleich untersuchte Unternehmen und jeweilige Industriebereiche 1936 zu 1939
Abbildung 83: Eigenkapitalquote und Anlagenintensität Maschinen- und Metallindustrie 1939
Abbildung 84: Eigenkapitalquote und Anlagenintensität verschiedener Gruppen 1939
Abbildung 85: Zusammensetzung Unternehmenskapital Maschinen- und Metallindustrie 1940
Abbildung 86: Strategische PartnerInnen der untersuchten Unternehmen
1. Einleitung
1.1. Inhaltsüberblick
Nicht nur Krieg selbst, sondern bereits die Vorbereitung auf diesen kann durch erhöhte Anforderungen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation eines Landes und seiner Unternehmen haben. Wenn damit auch noch eine Gleichstellung zweier unterschiedlicher Wirtschaftsräume verbunden ist, stellt dies die betroffenen Unternehmen womöglich vor große Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Produktionsumstellungen und Investitionsvorhaben mit entsprechenden Folgen für deren Vermögen und Kapital. Die vorliegende Arbeit hat somit zum Ziel, die Auswirkungen, die sich durch den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 ergaben, auf Unternehmensebene der Rüstungsindustrie zu untersuchen. Dabei werden betriebswirtschaftliche Veränderungen und insbesondere Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel aufgezeigt und die dahinterliegenden Zwecke, vor allem hinsichtlich der Kriegsvorbereitung, abgeleitet.
Der zeitliche Rahmen wird beginnend mit dem Ersten Weltkrieg bis vor dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 gesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Jahren 1936‒1940, um allein die Auswirkungen des „Anschlusses“ auf die Industrie ohne Einfluss wesentlicher wirtschaftlicher Einschnitte, wie der Weltwirtschaftskrise mit ihrer langen Stagnationsphase, in Österreich zu erfassen.
Eingeschränkt wird der Begriff Rüstungsindustrie auf jene Bereiche, die unmittelbare rüstungstechnische Relevanz für die Kriegsvorbereitung und -durchführung haben, vor allem die eisenerzeugende Industrie, metallverarbeitende Industrie, chemische Industrie und Elektroindustrie. Nicht untersucht werden etwa die Bereiche Textil- und Nahrungsmittelindustrie oder die Elektrizitäts- und Bauwirtschaft. Es werden sowohl jene Unternehmen betrachtet, welche bereits vor dem „Anschluss“ zu den klassischen Rüstungsbetrieben zählten, etwa Waffen- und Munitionshersteller, als auch jene, welche sich erst im Rahmen der nationalsozialistischen Kriegsvorbereitungen zu Produzenten oder Zulieferfirmen von Rüstungsgütern entwickelten.
Der inhaltliche Aufbau jedes Kapitels sieht eine Betrachtung auf volkswirtschaftlicher, industrieller und Unternehmensebene vor. Die empirische Untersuchung ist rein auf die Analyse von Unternehmen ausgerichtet.
In Kapitel zwei wird die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs vor dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich thematisiert. Der Fokus liegt hierbei auf der österreichischen Industrie und ihren Herausforderungen. Dabei werden die Auswirkungen von historischen Ereignissen sowohl auf volkswirtschaftlicher Ebene als auch auf Branchen- und Unternehmensebene beleuchtet. Beginnend mit ihrer Situation seit dem Ende des Habsburgerreichs wird die Rolle der Industrie bis zum Ende des Ersten Weltkrieges erörtert. Dabei werden die erhöhte Nachfrage nach Rüstungsgütern, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kriegswirtschaft und die Ressourcen- und Arbeitsmarktproblematik im Ersten Weltkrieg betrachtet. Anschließend werden zunächst die Folgen des Zusammenbruchs des Habsburgerreichs, wie Kapazitätsüberschüsse, unterbrochene Handelsverbindungen und Inflation, danach der Aufschwung in den 1920er Jahren mit der Genfer Sanierung, Währungsstabilität und Konsolidierungswelle und die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sowie die Entwicklung während des Austrofaschismus mit der Stabilisierung der Wirtschaft und einer mangelnden Wirtschaftspolitik aufgezeigt. Abschließend werden die Annäherung an das Deutsche Reich, alternative Bündnismöglichkeiten, die deutsche Südostpolitik und beginnende Vorbereitungsmaßnahmen für den „Anschluss“ behandelt. Zudem wird die deutsche Einschätzung des österreichischen wirtschaftlichen Potenzials dargestellt.
Kapitel drei behandelt den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich und seine wirtschaftlichen Folgen. Zunächst werden die wichtigsten Maßnahmen, welche mit dem „Anschluss“ gesetzt wurden, die die österreichische Wirtschaft ankurbeln und dem Niveau im Altreich näherbringen sollten, betrachtet. Hierbei geht es unter anderem um gesetzliche Änderungen, die Implementierung des Vierjahresplans in Österreich und den hohen Arbeitskräftebedarf. Dem folgen die unmittelbaren Auswirkungen auf die Industrieunternehmen, etwa im Rahmen der „Arisierung“ und „Germanisierung“. Im Fokus stehen hierbei zwangsweise EigentümerInnenwechsel oder eine nationalsozialistische Neuausrichtung der Unternehmen. Ebenfalls enthalten ist ein Exkurs zu den Auswirkungen deutscher Eroberungen und Besetzungen in anderen europäischen Ländern auf deren Industrie. Der Schwerpunkt verlagert sich danach auf die von der Industrie geforderten Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, um die Produktion von Rüstungsgütern zu erhöhen und deren Prozesse effizienter zu gestalten. Dabei werden Aspekte wie Investitionen, Arbeitsproduktivität, Zuliefernetzwerk und Outsourcing genauso wie Finanzierungs- und Fördermaßnahmen des Reichs und individuelle Handlungsspielräume berücksichtigt. Das Kapitel schließt mit der Betrachtung von gestiegenen Anforderungen an die Rüstungsproduktion infolge des Kriegsbeginns, den damit verbundenen Problemen, wie unzureichende Rohstofflieferungen oder Verzögerungen bei der Lieferung von Maschinen, und dem beginnenden Einsatz von Kriegsgefangenen in der Produktion.
Das vierte Kapitel bildet den Kern dieser Arbeit. In einer empirischen Analyse werden 12 Rüstungsunternehmen aus den Industriebereichen „Elektrotechnische Unternehmungen“, „Chemische Industrie“, „Berg- und Hüttenwerke“ und „Maschinen- und Metallindustrie“ hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Effekte des „Anschlusses“ untersucht. Es werden aus den jeweiligen Bilanzen Kennzahlen abgeleitet, welche Aufschluss über die Vermögens- und Kapitalentwicklung und die wirtschaftliche Situation geben. Dadurch wird ersichtlich, inwiefern der „Anschluss“ zu einer Veränderung in der Zusammensetzung und der Höhe des Anlage- und Umlaufvermögens bzw. Eigen- und Fremdkapitals geführt hat. Daraus abgeleitet werden die Mittelverwendung etwa für getätigte Investitionen und erweiterte Auftragsabwicklung einerseits und die Mittelherkunft im Sinne der dafür herangezogenen Finanzierungsquellen innerhalb oder außerhalb des jeweiligen Unternehmens. Eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Ergebnisse spielt die mit dem „Anschluss“ geforderte Umstellung aller Bilanzposten von Schilling auf Reichsmark-Werte im Rahmen der verpflichteten Erstellung einer Reichsmarkeröffnungsbilanz.
Im letzten Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse anhand der Beantwortung der Forschungsfragen, welche weiter unten gestellt werden, zusammengefasst und die Hypothese auf ihre Gültigkeit überprüft.
1.2. Forschungsstand
Der Ausgangspunkt für die vorliegende Forschungsarbeit ist die Publikation „Rüstung in Österreich 1938–1945“ von Norbert Schausberger aus dem Jahr 1970. Darin stellte er die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs in der Zeit des Nationalsozialismus dar und verband diese mit den politischen Ereignissen und der Kriegsvorbereitung bzw. -durchführung. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der österreichischen Rüstungsindustrie, die mit der beginnenden Aufrüstung im Deutschen Reich ebenfalls einen Aufschwung erfuhr und einer zunehmenden wirtschaftlichen Durchdringung durch deutsches Kapital unterlag. Für ihn waren umfangreiche wirtschaftliche, nicht ausgenützte Kapazitäten, Rohstoffe, Gold, Devisen und Arbeitskräfte die ausschlaggebenden Gründe für das deutsche Interesse, wobei Österreich in den Folgejahren als eine Art Kolonie behandelt wurde.1 Norbert Schausberger erwähnte auch umfangreiche Rationalisierungsmaßnahmen und Investitionen in der Rüstungsindustrie, die zunächst vom deutschen Privatkapital finanziert wurden.2 Für ihn standen sich die Interessen der deutschen Unternehmen, welche die österreichischen Unternehmen als ihre „Beute“ ansahen, die Interessen des Staates, allen voran zur Erfüllung der Vierjahresplanvorgaben, und jene vieler Nationalsozialisten, die sich durch die Belebung der österreichischen Wirtschaft profilieren wollten, als auch die wehrwirtschaftlichen Interessen konträr gegenüber.3 Die wirtschaftliche, vor allem die industrielle Entwicklung sah er an eine Blitzkriegsstrategie gekoppelt, nach welcher die Rüstungsproduktion nur kurzfristig entsprechend den militärischen Eroberungsplänen ausgelegt und neben einer weiterhin funktionierenden Zivilgüterproduktion laufen sollte.4 Norbert Schausberger versuchte die politischen und militärischen Ereignisse in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Wirtschaftspotenzial zu stellen5 und nannte in seinen Ausführungen immer wieder Beispiele von Rüstungsunternehmen und ihre Beiträge zur Rüstungsproduktion. Er stützte sich dabei vorwiegend auf Kriegstagebücher und Berichte öffentlicher Stellen des Archivs des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien.
Ebenfalls mit den wirtschaftlichen Veränderungen infolge des „Anschlusses“ Österreichs an das Deutsche Reich beschäftigte sich 1970 Liselotte Wittek-Saltzberg in ihrer Dissertation. Sie hatte ihre Arbeit auf Unterlagen von Reichs- und Parteistellen, etwa des Reichswirtschaftsministeriums, der Reichskanzlei oder des Oberkommandos der Wehrmacht gestützt, welche ebenfalls im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien zu finden sind. Im Fokus ihrer Arbeit standen die Übernahmen österreichischer Vermögenswerte durch das Deutsche Reich und die Umstrukturierung der österreichischen Wirtschaft.6 Ihren Erkenntnissen nach sollte die österreichische Wirtschaft nicht um ihrer selbst willen aufgebaut werden, sondern um die Erreichung deutscher Ziele zu unterstützen. Die österreichischen Unternehmen dienten vorwiegend in der Zulieferung den deutschen Großunternehmen und wehrwirtschaftlichen Interessen zulasten der Konsumgüterindustrie. Dennoch attestierte Liselotte Wittek-Saltzberg der österreichischen Wirtschaft insgesamt einen durch die Rüstungsproduktion induzierten Aufschwung, jedoch zum Preis ausbleibender Ersatzinvestitionen, Geldschöpfungsmaßnahmen zur Verhinderung einer Inflation, einer Stärkung der Rüstungsproduktion und der Abgabe staatlicher Souveränität.7
Stefan Karner hat sich ebenfalls bereits früh mit der österreichischen Wirtschaft im Nationalsozialismus beschäftigt. In einer Arbeit aus 1976 untersuchte er die Kärntner Wirtschaft und ging dabei auf die Organisation und die Entwicklung der Wehr- und Rüstungswirtschaft näher ein. Er hob die Bedeutung der Kärntner Rüstungsindustrie und insbesondere die erzielten Produktionssteigerungen hervor. Er bezog sich dabei auf Produktions-, Beschäftigungs- und Umsatzzahlen, verglich diese miteinander im Zeitablauf und stellte die Entwicklung auf Unternehmensebene dar.8 In einer 1986 erschienenen Publikation konzentrierte sich Stefan Karner dann auf Wirtschaft und Rüstung in der Steiermark. Dabei hielt er die Ausrichtung der Wirtschaft auf die Ziele der Nationalsozialisten und auf den Krieg mit einer Stärkung der Rüstungsindustrie fest. Zudem beschrieb er die unmittelbaren Auswirkungen des „Anschlusses“ in der Steiermark, wie die Umstellung der wichtigsten steirischen Unternehmen auf die Rüstungsproduktion und die Auswirkungen durch das Kriegsgeschehen. Dazu nannte er einige Beispiele für Produktionswerte, Kostenaufstellungen und Produktivitätsmessungen.9
1995 verfasste Josef Moser ein Werk, in dem er „Oberösterreichs Wirtschaft 1938 bis 1945“ untersuchte. Ausgehend von den Vorgaben des Vierjahresplans, ihren Bedeutungen für die Umstellung der österreichischen Wirtschaft und den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen ging er auf die Veränderungen in der oberösterreichischen Wirtschaft näher ein. Dabei beschrieb er Infrastrukturmaßnahmen genauso wie die Ausweitung der Nutzung der vorhandenen Ressourcen und die Anhebung des Rüstungspotenzials anhand von bestehenden Unternehmen oder der Neugründung von Rüstungsunternehmen.10 Zudem zeigte er Probleme bei der wirtschaftlichen Umstellung und den angeordneten Rationalisierungsmaßnahmen auf und nannte unter anderem einen Engpass bei Maschinenlieferungen, eine Unmenge an Bestimmungen, eine unzulängliche Rohstoffverteilung und auch Schwierigkeiten im Rechnungswesen. Josef Moser ging auch auf einige Unternehmen als Beispiele für die Ausweitung der Rüstungsproduktion ein.11 Weiters erwähnte er Anreizsysteme für Unternehmen zur Erhöhung der Investitionstätigkeit, etwa durch eine Senkung der Kreditzinsen, die gezielte Vergabe von Rüstungsaufträgen in benachteiligte Regionen und Bürgschaften des Reichs, aber auch die eher geringere Bedeutung der Banken bei der Finanzierung von Investitionen oder Rationalisierungsmaßnahmen.12
Otto Lackinger untersuchte 2007 in seiner Arbeit „Die Linzer Industrie im 20. Jahrhundert“ ein Beispiel für die wirtschaftliche Umstellung im Zuge des „Anschlusses“ auf lokaler Ebene. Anhand der Stadt Linz, welche rüstungstechnisch bis dahin eher unbedeutend war, zeigt er die für den Neubau einer Rüstungsproduktion wichtigen Standortfaktoren, vor allem die Verkehrslage, und den Impuls, den die Unternehmen, allen voran die Reichswerke Hermann Göring, der wirtschaftlichen und insbesondere industriellen Entwicklung der Stadt verliehen, auf.13 Otto Lackinger spricht auch von einer anfänglich kriegsorientierten Friedenswirtschaft und der Bereitschaft vieler Unternehmen, ihre Produktion auf die vielversprechende Rüstungsproduktion umzulenken. Dabei merkte er auch an, dass die Linzer Industrie zu einem Großteil von Arisierung und Germanisierung betroffen war und es nur zu wenigen Neugründungen kam. Mit dem Aufschwung infolge des „Anschlusses“ konnte die Linzer Industrie wieder an ihr Niveau von 1929 anschließen, bevor es im Krieg zu einer friedensähnlichen Kriegswirtschaft kam und sie gänzlich auf die Anforderungen der Kriegsführung ausgerichtet wurde.14
Karl-Heinz Rauscher beschäftigte sich 2004 mit der Entwicklung im Nationalsozialismus auf Unternehmensebene am Beispiel von Steyr-Daimler-Puch, im Speziellen mit den Auswirkungen der Rüstungsanforderungen auf die wirtschaftliche Situation. Dabei untersuchte er nicht nur die Produktionsumstellung und -erweiterung, sondern auch Veränderungen anhand der Unternehmensbilanzen. Damit konnte er direkte betriebswirtschaftliche Effekte durch den Vergleich von Kennzahlen ablesen. Er ging in seiner Arbeit auch auf die Finanzierungspolitik des Unternehmens ein und strich die Bedeutung sowohl von Eigenkapital als auch von Fremdkapital, etwa in Form von Bankfinanzierung, Anleihen oder Subventionen, für die Finanzierung von Investitionen heraus.15
Mark Spoerer beschäftigte sich in seiner Arbeit „Von Scheingewinnen zum Rüstungsboom“ ausführlich mit der Eigenkapitalrentabilität von deutschen Industrieaktiengesellschaften in der Zwischenkriegszeit und während des Zweiten Weltkrieges. Er untersuchte darin die Gewinnentwicklung von Unternehmen der Rüstungsindustrie anhand von Steuerbilanzen und stellte unter anderem die Frage, ob diese in der Zeit des Nationalsozialismus höher ausfielen.16 Er legte dar, dass die Eigenkapitalrendite der untersuchten Unternehmen zwischen 1936 und 1940 deutlich über jenen Werten aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise lag.17 Zudem stellte Mark Spoerer fest, dass es bei den untersuchten deutschen Unternehmen einen Anstieg der stillen Reserven in den 1930er Jahren gab. Dies wurde vom nationalsozialistischen Regime gefördert und sollte den Unternehmen einen höheren Grad der Selbstfinanzierung verschaffen. Nachdem das Regime selber einen hohen Kapitalbedarf hatte, erschwerte es den Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt. Sowohl die Kapitalnachfrage der Unternehmen wurde beeinflusst als auch das Kapitalangebot, etwa durch die Begrenzung von Dividendenzahlungen oder der zeitweiligen Emissionssperre, reduziert. Anstatt aber alternativ auf Bankkredite zurückzugreifen, konnten die Unternehmen aufgrund steigender (staatlicher) Nachfrage und staatlicher Preisfestsetzungen ihre Liquidität selbst erhöhen und sogar bestehende Kredite zurückzahlen.18
Jonas Scherner setzte sich 2008 in seiner Arbeit „Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich“ mit der Frage nach einer staatlichen Förderung in Bezug auf Investitionen in die Autarkie- und Rüstungsbranchen, den entsprechenden Vertragsgestaltungen und der Risikoabschätzung der Unternehmen auseinander.19 Er kam zu dem Schluss, dass die Investitionen wesentlich vom Gewinnmaximierungsbestreben der Unternehmen beeinflusst waren, der Staat ein Kostenbewusstsein darlegte und viele Verträge zu Festpreisen vereinbart wurden.20 In einer weiteren Arbeit stellte Jonas Scherner gemeinsam mit Christoph Buchheim 2006 fest, dass die Finanzierung von Investitionen, zumindest im Altreich, oftmals mithilfe von Eigenmitteln erfolgte. Die Unternehmen erwirtschafteten durch hohe Gewinne und Abschreibungen genügend Eigenmittel, um ihre Produktion und die eigenen Investitionen selbst zu finanzieren, ohne auf den Kapitalmarkt zurückgreifen zu müssen.21
1.3. Hypothese und Forschungsfragen
Die Finanzierung von Investitionen, Rationalisierungsmaßnahmen und Produktionsumstellungen in Österreich und ihre Herkunft wurden bislang zu wenig detailliert betrachtet. Eine empirische Analyse der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmensebene mit einer Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital anhand der Untersuchung und eines Vergleichs von Bilanzen wurde bislang noch nicht durchgeführt. Dies soll in der vorliegenden Arbeit nachgeholt und dabei die folgende, auf dem bisherigen Forschungsstand aufgesetzte Hypothese auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden:
Die österreichische Rüstungsindustrie war zwischen der Weltwirtschaftskrise und dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im Vergleich mit der deutschen Rüstungsindustrie aus wehrwirtschaftlicher Sicht rückständig, jedoch mit umfangreichen, nicht ausgenützten Kapazitäten ausgestattet. Der Eingliederungsprozess der Rüstungsunternehmen ins Deutsche Reich war daher geprägt von umfangreichen Finanzmitteln, welche hauptsächlich von deutschen Rüstungsunternehmen für den Erwerb österreichischer Rüstungsunternehmen, die Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie die Umsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen bereitgestellt wurden.
Damit einhergehend sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden, die in der bisherigen Literatur nicht oder nur teilweise zufriedenstellend beantwortet wurden:
• Welchen Stellenwert hatte Österreichs Wirtschaft und insbesondere seine Industrie bei den Expansionsbestrebungen des Deutschen Reichs und in welchem Ausmaß gab es Verbindungen zwischen der deutschen und der österreichischen Rüstungsindustrie vor dem „Anschluss“?
• Wie veränderte sich die betriebswirtschaftliche Lage der österreichischen Rüstungsindustrie durch den „Anschluss“?
• Welche Faktoren erschwerten die Eingliederung in das deutsche Wirtschaftssystem?
• Welchen Handlungsspielraum hatten österreichische Rüstungsunternehmen in ihrer betriebswirtschaftlichen Umstellung?
• Wie wurde die Umstellung der Rüstungsindustrie nach dem „Anschluss“ finanziert und wer trug das wirtschaftliche Risiko?
• Welchem Zweck diente die Eingliederung der österreichischen Rüstungsindustrie?
1.4. Methode
Zur empirischen Untersuchung der ausgewählten Rüstungsunternehmen wurde als Methode die Jahresabschlussanalyse gewählt. Der Jahresabschluss setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und muss von einem bilanzierungspflichtigen Unternehmen am Geschäftsjahresende vorgelegt werden.22 Die Bilanz gibt das Verhältnis zwischen seinem Vermögen und seinem Kapital wider und setzt sich somit aus der Aktiva (dem Vermögen des Unternehmens) und der Passiva (dem Kapital des Unternehmens) zusammen. Das Vermögen wiederum unterteilt sich in Anlage- und Umlaufvermögen, das Kapital in Eigen- und Fremdkapital. Die Aktiva informiert über die Mittelverwendung (z.B. Investitionen), die Passiva über die Mittelherkunft (z.B. Kreditfinanzierung).23 Das Anlagevermögen dient dem Geschäftsbetrieb langfristig und ist somit zum Gebrauch bestimmt, Umlaufvermögen hingegen steht nur kurzfristig zur Verfügung und ist somit zum Verbrauch vorgesehen. Das Eigenkapital wird von den EigentümerInnen zur dauerhaften Verwendung eingebracht.24 Das Fremdkapital stellt die Schuldverhältnisse des Unternehmens dar. Es beinhaltet in der Regel Rückstellungen und Verbindlichkeiten (z.B. gegenüber LieferantInnen oder Banken). Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) hingegen beinhaltet eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen des Unternehmens innerhalb der betrachteten Periode. Sie gibt somit Aufschluss über Umsatz, Kosten und den erwirtschafteten Gewinn oder Verlust.25
Bei der Mittelherkunft wird zudem die Finanzierungsart unterschieden nach Eigen- und Fremdfinanzierung bzw. Innen- und Außenfinanzierung. Bei der Eigenfinanzierung wird das Kapital von den EigentümerInnen aufgebracht, steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung und übernimmt eine Haftungsfunktion. Bei der Fremdfinanzierung besteht keine Haftung und die Mittel stehen je nach Bedarf kurz-, mittel- oder langfristig zur Verfügung. Bei der Innenfinanzierung wird das Kapital vom Unternehmen selbst (von „innen“) aufgebracht, etwa durch Einbehaltung des erwirtschafteten Gewinns. Die Außenfinanzierung umfasst hauptsächlich die Beteiligungs- und Einlagenfinanzierung bestehender und neuer EigentümerInnen und die Kreditfinanzierung. Es werden somit Finanzmittel von außen dem Unternehmen zugeführt.26 Mit dieser Aufschlüsselung werden die Finanzierungsquellen und die damit verbundene Risikoaufteilung übersichtlich dargestellt.
Bei der Jahresabschlussanalyse werden Unternehmensinformationen mithilfe von Kennzahlen so aufbereitet, dass daraus Rückschlüsse auf die Vermögens-, Kapital- und Ertragslage eines Unternehmens möglich sind. Dazu werden die Informationen zunächst verdichtet und umstrukturiert und anschließend in Relation zueinander oder zu Vergleichswerten (auch im Zeitablauf) gesetzt. In Verbindung mit zusätzlichen Informationen (z.B. Beschreibungen zu getätigten Investitionen) aus dem Jahresabschluss soll somit die Unternehmenslage aufgezeigt und eine wirtschaftliche Entwicklung mit bestimmten Einflussfaktoren abgeleitet werden.27 Der Fokus liegt auf einer finanzwirtschaftlichen Analyse, wobei hauptsächlich die Posten der Bilanz in Hinblick auf Investitionen und Finanzierung betrachtet werden. Damit wird Aufschluss über die Vermögens- und Finanzierungsstruktur und die damit verbundenen Vorteile und Risiken gegeben. Für die Analyse wurden folgende Kennzahlen gewählt28:
• Eigenkapitalquote
• Fremdkapitalquote
• Verschuldungsgrad
• Anlagenintensität
• Arbeitsintensität
• Anlagendeckung
• Umsatzrentabilität
• Eigenkapitalrentabilität
Eine detailliertere Beschreibung zur Bilanz, der angewendeten Jahresabschlussanalyse und den relevanten Kennzahlen ist in den Kapiteln 4.1 und 4.2 zu finden.
Für die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs im untersuchten Zeitraum wurden die Daten, etwa zum Außenhandel, dem Bruttoinlandsprodukt oder der Arbeitslosenquote, sowohl aus Quellen statistischer Veröffentlichungen als auch aus einschlägiger Fachliteratur herangezogen. Es ist mitunter möglich, dass hier nicht immer die aktuellen Veröffentlichungen herangezogen wurden, da weniger die exakten Werte, jedoch vielmehr die Gewichtung und die Trendrichtung einer Entwicklung relevant waren.
1.5. Quellen und Archive
Für die empirische Untersuchung wurden die Jahresabschlüsse aus drei Hauptquellen bezogen:
• Geschäftsberichte: Diese wurden von den Unternehmen nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht und enthielten neben Bilanz und GuV oftmals auch einen Bericht des Vorstandes.
• Wirtschaftsprüfberichte: Diese wurden von unabhängigen Wirtschaftsprüfkanzleien im Auftrag der EigentümerInnen nach Vorlage des offiziellen Jahresabschlusses angefertigt und enthielten neben Bilanz und GuV auch Feststellungen der PrüferInnen über die Richtigkeit des durch das Unternehmen offengelegten Jahresabschlusses.
• Compass-Finanzielles Jahrbuch: Darin wurden jährlich wesentliche Unternehmensinformationen, in vielen Fällen inklusive Bilanz und GuV, in kurzer Darstellung veröffentlicht.
Eine große Zahl an Geschäftsberichten und Wirtschaftsprüfberichten liegt im Bank Austria Archiv in Wien auf. Nachdem die Bank Austria Nachfolgerin der Creditanstalt ist, hat sie auch deren Archiv übernommen. Die Creditanstalt besaß sowohl als Eigentümerin als auch als Fremdkapitalgeberin vieler Industrieunternehmen umfangreiche Unterlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung dieser Unternehmen.
Viele Wirtschaftsprüfberichte sind zudem im Bundesarchiv Deutschland in Berlin-Lichterfelde einsehbar. Diese beziehen sich vorwiegend auf jene Unternehmen, die Teil eines deutschen Konzerns, etwa der Reichswerke Hermann Göring oder der IG-Farben, waren oder direkt dem Deutschen Reich gehörten.
Die Reihe Compass-Finanzielles Jahrbuch liegt einerseits physisch vor, etwa in der Bibliothek der Wirtschaftskammer Wien, wurde aber andererseits mittlerweile vollständig digitalisiert und ist unter https://portal.zedhia.at/abrufbar.
Zusätzliche Informationen, welche der grundsätzlichen Unternehmensdarstellung, seiner wirtschaftlichen Situation und Entwicklung und der Jahresabschlussanalyse im Speziellen hilfreich waren, wurden folgenden Quellen entnommen:
Unternehmensunterlagen wie Protokolle von EigentümerInnenversammlungen, Produktionsaufträge und Korrespondenzen. Diese enthalten detaillierte Informationen u.a. über Anlagevermögen, Eigen- und Fremdkapital, Umsatzzusammensetzung, Personal- und sonstige Aufwendungen, Gewinneinbehaltung und -ausschüttung, Auftragslage, Leitungsorgane und EigentümerInnenstruktur.
Belege für Finanzierungsmethoden, wie z.B. Darlehensverträge, Kreditvergaben, Förderungs- und Zuschussverträge, LieferantInnenkredite, Banküberweisungen, EigentümerInneneinlagen und Wehrmachtsverpflichtungsscheine
Unterlagen zu verwaltungstechnischen Anweisungen, wirtschaftslenkende Maßnahmen, öffentliche Rüstungsaufträge (z.B. Gauleiterakten, Anweisungen der Reichskanzlei, Akten des Wehrwirtschaftsamtes, Kriegstagebücher)
Einige dieser Quellen sind in den bereits oben genannten Archiven zu finden, vor allem jene, die direkten Unternehmensbezug haben. Andere, etwa betreffend die industriellen Verbindungen zwischen österreichischen und deutschen Unternehmen vor dem „Anschluss“, befinden sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Gauleiterakten oder andere behördenbezogene Quellen sind vorwiegend im Österreichischen Staatsarchiv vorhanden. Die informativen Kriegstagebücher können im Institut für Zeitgeschichte in Wien auf Mikrofilm eingesehen werden.
Gerade die Quellen der deutschen Archive wurden in diesem Umfang und Detaillierungsgrad bislang noch nicht für die Analyse österreichischer Unternehmen herangezogen.
Werner Plumpe folgend, muss eine Untersuchung von Unternehmen und ihrer Entwicklung einem komplexen, multidisziplinären Ansatz folgen. Dabei sollen vor allem die Betriebswirtschaft inklusive Managementlehre, Organisationslehre und betrieblicher Kostenlehre, zudem die Soziologie inklusive Arbeits-, Industrie- und Organisationssoziologie und auch die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte miteinbezogen werden. Relevant sind hierbei auch die Reaktionsmöglichkeiten von Unternehmen auf exogene Einflüsse auf ihre Entwicklung. Damit können die Auswirkungen formaler Organisationskriterien auf die Unternehmensentwicklung relativiert, der Einfluss von UnternehmerInnen auf die Steuerbarkeit der Entwicklung hinterfragt und die Abhängigkeit des Unternehmens von seiner Umgebung betrachtet werden. Es stellt sich somit die Frage nach der Lern- bzw. Anpassungsfähigkeit von Unternehmen vor allem bei Entwicklungsumbrüchen.29 Die vorliegende Arbeit soll in diesem Sinne mit ihrem multidisziplinären Ansatz einen kleinen Beitrag zur Unternehmensgeschichte leisten.
1 Schausberger 1970: Rüstung in Österreich 1938–1945, S. 23–28.
2 Schausberger 1970: Rüstung in Österreich 1938–1945, S. 32–33.
3 Schausberger 1970: Rüstung in Österreich 1938–1945, S. 37.
4 Schausberger 1970: Rüstung in Österreich 1938–1945, S. 43.
5 Schausberger 1970: Rüstung in Österreich 1938–1945, S. 175.
6 Wittek-Saltzberg 1970: Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Okkupation Österreichs, I–II.
7 Wittek-Saltzberg 1970: Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Okkupation Österreichs, S. 240–243.
8 Karner 1976: Kärntens Wirtschaft 1938–1945 unter besonderer Berücksichtigung der Rüstungsindustrie, S. 5–14.
9 Karner 1986: Die Steiermark im Dritten Reich 1938–1945, S. 235–240.
10 Moser 1995: Oberösterreichs Wirtschaft 1938 bis 1945, S. 23–35.
11 Moser 1995: Oberösterreichs Wirtschaft 1938 bis 1945, S. 115–120.
12 Moser 1995: Oberösterreichs Wirtschaft 1938 bis 1945, S. 135–136.
13 Lackinger 2007: Die Linzer Industrie im 20. Jahrhundert, S. 101–102.
14 Lackinger 2007: Die Linzer Industrie im 20. Jahrhundert, 114, 124.
15 Rauscher 2004: Steyr im Nationalsozialismus: Industrielle Strukturen, S. 193–204.
16 Spoerer 1996: Von Scheingewinnen zum Rüstungsboom, S. 19.
17 Spoerer 1996: Von Scheingewinnen zum Rüstungsboom, S. 152–153.
18 Spoerer 1996: Von Scheingewinnen zum Rüstungsboom, S. 113–115.
19 Scherner 2008: Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich, S. 21.
20 Scherner 2008: Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich, S. 298–299.
21 Buchheim und Scherner 2006: The Role of Private Property in the Nazi Economy: The Case of Industry, S. 396–397.
22 Deutsches Handelsgesetzbuch, § 242.
23 Urnik und Schuschnig 2015: Investitionsmanagement, Finanzmanagement, Bilanzanalyse, S. 6.
24 Hirschler 2012: Bilanzwissen für Führungskräfte, S. 19, 25.
25 Thommen, Achleitner, Gilbert, Hachmeister und Kaiser 2017: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 448–449.
26 Urnik und Schuschnig 2015: Investitionsmanagement, Finanzmanagement, Bilanzanalyse, 18–23, 202.
27 Küting, Weber und Boecker 2009: Die Bilanzanalyse, S. 1–3.
28 Urnik und Schuschnig 2015: Investitionsmanagement, Finanzmanagement, Bilanzanalyse, 16–17, 25, 216–217, 229–232, 236, 262–263.
29 Plumpe 1992: Statt einer Einleitung: Stichworte zur Unternehmensgeschichtsschreibung, S. 10–11.
2. Österreichs Industrie zwischen Habsburgerreich und „Anschluss“
2.1. Die Industrie gegen Ende des Habsburgerreiches
In den folgenden beiden Abschnitten werden die Entwicklung der Industrie am Vorabend des Ersten Weltkrieges und die Anforderungen an diese während des Krieges, jeweils mit Schwerpunkt auf dem Gebiet des heutigen Österreichs, genauer betrachtet.
2.1.1. Die Industrie vor dem Ersten Weltkrieg
Erste Anzeichen einer Industrialisierung im Habsburgerreich gab es bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wobei sich die Ansiedelung von Unternehmen auf die wirtschaftlich weiterentwickelten Gebiete des Reiches konzentrierte. Zu diesen zählte neben Böhmen und Mähren auch das Gebiet des heutigen Österreichs. Hier erfolgte die Industrialisierung zunächst insbesondere in Wien und dem Wiener Becken, unter anderem mit der Niederlassung von Metallwaren- und Maschinenbauunternehmen, als auch in der Obersteiermark im Bereich der Eisenproduktion und -verarbeitung.30 Die Industrialisierung Österreichs war von mehreren Faktoren abhängig. Hierzu zählten die Etablierung von neuen Produktionsmethoden, ausreichende Energieversorgung, verkehrstechnische Anbindungen und technischer bzw. technologischer Fortschritt. Österreich kam mit diesen Faktoren unterschiedlich zurecht. Arbeitsteilung und Rationalisierung stellten sich in den Branchen ungleichmäßig schnell ein, die notwendige Infrastruktur bildete sich vorwiegend in Ballungszentren aus und der Zugang zu Energiequellen war oft standortentscheidend. Erst mit dem Ausbau des Schienennetzes, dem technischen Fortschritt bei Produktionsanlagen und Energieerzeugung und der Verbesserung von Produktionsprozessen konnte die Industrie Anschluss an das internationale Entwicklungsniveau finden.31 Mitte des 19. Jahrhunderts setzte in ganz Österreich eine zunehmende Industrialisierung ein. Zwar gab es auch schon zuvor in mehreren kleineren Regionen einzelne Industrieunternehmen, jedoch bedingten technischer Fortschritt, Umstellungen der Produktionsprozesse und Steigerungen des Produktionsvolumens umfangreiche strukturelle Änderungen und Konzentrationsprozesse innerhalb von Regionen oder Branchen.32 Die industrielle Bedeutung Wiens mit dem Wiener Becken nahm dabei kontinuierlich zu. Die bereits vorhandenen Wirtschaftsstrukturen erleichterten die Gründung und Ansiedelung von Industrieunternehmen, welche einen immer größer werdenden Teil der arbeitenden Bevölkerung beschäftigte. In einzelnen Teilen dieser Region waren bis zu 40% der Erwerbstätigen in der Industrie tätig. Dabei war Wien das wirtschaftliche Zentrum, welches Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie der Maschinen-, Elektro-, Nahrungs-, Papier- und Textilindustrie die notwendige Infrastruktur bot. Außerhalb Wiens war zunächst die Textilindustrie federführend, später nahmen noch die Metallindustrie und die chemische Industrie eine wichtige Rolle ein. Diese ließen sich vorwiegend im Raum Mödling-Baden-Wiener Neustadt nieder, etwa in Berndorf, Hirtenberg, Enzesfeld, Traiskirchen und Wöllersdorf. In der Steiermark war es zunächst der Raum Mürzzuschlag-Leoben, welchem umfangreiche industrielle Bedeutung zukam. Dieser war geprägt vom Berg- und Hüttenwesen und beschäftigte bis zu 20% der Bevölkerung. Später erhielten noch der Raum Fohnsdorf-Köflach-Voitsberg (ebenfalls Steiermark) mit seinem Kohlebergbau und der Raum Steyr-Waidhofen an der Ybbs (Oberösterreich) im Bereich der Eisen- und Metallindustrie wirtschaftliche Relevanz.33
Die Wirtschaft des Habsburgerreichs war von Klein- und Mittelunternehmen geprägt, wobei es in einigen Branchen auch bedeutende Großunternehmen gab. Durch die Wirtschaftskrise von 1873, gepaart mit restriktiven Steuergesetzen, waren Investitionen in Aktiengesellschaften wenig lukrativ. Der Anteil der Aktiengesellschaften an den Unternehmen innerhalb Österreichs lag bei nur 0,3%. Erst in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gewann diese Finanzierungsform wieder an Attraktivität, wodurch es zu einem Zuwachs an Großunternehmen kam.34 Bei den Unternehmensansiedlungen in der österreichischen Reichshälfte lag der Schwerpunkt vor allem auf Böhmen (1901 waren es rund 38% aller Ansiedelungen) und dem Gebiet des heutigen Österreichs (ca. 34%). Innerhalb Österreichs wiederum konnten Niederösterreich und die Steiermark die meisten Ansiedlungen vorweisen. Etwas verändert zeigt sich diese Verteilung bei der Zahl der Beschäftigten: 1902 entfielen auf Böhmen ca. 35% der Beschäftigten, auf Österreich ca. 36%. Dafür gab es aber in Böhmen mehr Beschäftigte in Großunternehmen als in Österreich. Dies ist unter anderem auf eine weniger konservative Einstellung zur Weiterentwicklung in der böhmischen Industrie zurückzuführen. Bei den Branchen hatten in der österreichischen Reichshälfte die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, die Steine-, Erden- und Glasindustrie und die holzverarbeitende Industrie die größten Beschäftigungsanteile aufzuweisen. Auf das Gebiet des heutigen Österreichs bezogen ergab sich ein leicht verändertes Bild: Neben der Bekleidungsindustrie waren die Metallverarbeitung und die Nahrungsmittelindustrie die Bereiche mit den meisten Beschäftigten.35
Das Habsburgerreich umfasste nach einer Volkszählung im Jahr 1910 eine Gesamtbevölkerung von etwa 51,4 Mio. EinwohnerInnen, wovon ungefähr 6,6 Mio. auf das Gebiet der heutigen Republik Österreich entfielen. Dies war nur ein geringer Anteil verglichen mit den ca. 13,5 Mio., die in den Grenzen der späteren Tschechoslowakischen Republik lebten, oder den ca. 8,2 Mio. im Gebiet der künftigen Republik Polen. Ungarn zählte, auf seinem heutigen Staatsgebiet, ca. 7,6 Mio. EinwohnerInnen.36 Von der österreichischen Bevölkerung waren 1869 ca. 2,8 Mio. Personen erwerbstätig, wovon ca. 0,7 Mio. (25%) in Bergbau, Industrie und Gewerbe tätig waren. 1900 waren es bereits ca. 3,2 Mio. bzw. rund 0,9 Mio. (28%) und 1910 ungefähr 3,5 Mio. bzw. 1 Mio. (31%) Personen.37 Der Anteil der Industrie an den Erwerbstätigen innerhalb der gesamten österreichischen Reichshälfte stieg von 15,3% im Jahr 1869 auf 20,1% im Jahr 1910. Der Großteil der Erwerbstätigen war zwar noch immer in der Landwirtschaft tätig, deren Anteil ging aber im gleichen Zeitraum von 66,6 auf 56,9% zurück.38 Hingegen spielte die Industrie in der ungarischen Reichshälfte noch eine geringere Rolle. Ihr Anteil stieg hier zwar von 8,6% im Jahr 1869 auf 16,2% im Jahr 1910, lag jedoch noch deutlich unter jenem der Landwirtschaft (80,0% bzw. 66,7%).39 Die Relevanz des Industrieanteils war in anderen industrialisierten Ländern wesentlich stärker zu spüren als im Habsburgerreich. Im Deutschen Reich etwa nahm der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten zwischen 1871 und 1910 von 49,3 auf 35,8% ab, während jener der Industrie von 27,5 auf 29,4% anstieg.40 Zwar war die Veränderung des industriellen Anteils nicht so stark ausgeprägt, jedoch unterschied sich das Ausgangsniveau im Deutschen Reich deutlich von jenem der Habsburgermonarchie, was einen Entwicklungsvorsprung von einigen Jahrzehnten widerspiegelt. Im Bereich der Industrieproduktion konnte das Habsburgerreich nicht mit den großen Industriemächten mithalten. Das Deutsche Reich steigerte seinen Anteil der weltweiten Produktion von 8,5% im Jahr 1880 auf 14,8% im Jahr 1913, in welchem es nur von den Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 32% übertroffen wurde, jedoch Großbritannien (13,6%) überholt hatte. Hingegen lag der Anteil des Habsburgerreichs an der weltweiten Produktion im Jahr 1880 nur bei 4,4%, stieg zwar auf 4,7% im Jahr 1900, fiel aber bis 1913 wieder auf 4,4% zurück. Es lag damit sogar hinter Russland, welches 1913 einen Anteil von 8,2% verzeichnen konnte.41 Bei der Entwicklung des gesamten Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von 1870 bis 1913 lag das Habsburgerreich mit einem Zuwachs von 1,1% unter jenem des Deutschen Reichs (1,7%) und Frankreichs (1,5%), jedoch noch über jenem Großbritanniens (1,0%) und Russlands (0,9%).42
Innerhalb des Habsburgerreichs war das industrielle Wachstum nicht einheitlich. Während die Industrie der österreichischen Reichshälfte von 1900 bis 1913 um jährlich maximal 4% wuchs, lag der Zuwachs jener des ungarischen Teils bei rund 7%.43 Die Industrie Zisleithaniens konnte ihre Produktion vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts erheblich steigern, von 1880 bis 1900 betrug die Wachstumsrate 127%. Diese Entwicklung setzte sich, wenn auch nicht mehr in demselben Ausmaß, bis 1913 fort. In diesem Zeitraum betrug das Wachstum aber immerhin noch 44%.44 Der wirtschaftliche Rückstand gegenüber den bereits hochindustrialisierten Ländern Europas in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg blieb weitgehend konstant, konnte teilweise sogar aufgeholt werden. Das reale Volkseinkommen stieg dabei zwischen 1901 und 1913 um ca. 49%.45 Wie aber bereits in den Jahrzehnten zuvor handelte es sich nicht um ein kontinuierliches Wachstum. Die Wirtschaft war immer wieder von Konjunkturzyklen geprägt, die vor allem ab der Jahrhundertwende auch von internationalen Konjunkturschwankungen beeinflusst waren. Der generelle wirtschaftliche Aufschwung des Habsburgerreichs ab der Jahrhundertwende wurde zwar zwischenzeitlich von Rezessions- und Depressionsphasen gebremst, jedoch konnte der relative Rückstand gegenüber anderen europäischen Industrienationen bis zum Ausbruch des Krieges verringert werden.46Abbildung 1 zeigt, dass im Jahr 1913 die Industrie mit 27% den größten Anteil am Bruttonationalprodukt (BNP) hatte. Dem folgten die Gewerbe (inkl. Baugewerbe) mit 21% und der Handel mit 14%. Die Agrarwirtschaft steuerte mit 11% nicht viel mehr als der Öffentliche Dienst mit 7% zum Bruttonationalprodukt bei.
Abbildung 1: Anteil der Wirtschaftszweige am BNP des Habsburgerreichs 1913
Quelle: Daten aus Monatsberichte des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (1965), S. 8, eigene Darstellung
Für das Wachstum der Industrie waren unterschiedliche Faktoren verantwortlich. Am ausgeprägtesten zeigten sich diese im Bereich des österreichischen Maschinenbaus. Die steigende Nachfrage nach Maschinen, sowohl durch andere Industriebereiche als auch durch die Landwirtschaft, ging einher mit der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, etwa bei der Stromerzeugung oder dem Verbrennungsmotor, und dem vereinfachten Handel mit Maschinen.47
Die ebenfalls für die Entwicklung wichtige Standortfrage der Unternehmen war zu einem Großteil mit Rohstoffvorkommen oder mit der Anbindung an das Eisenbahnnetz verknüpft. Gerade in Österreich mit seinen topographischen Gegebenheiten stellte das viele Traditionsunternehmen bei ihrer Entwicklung vor eine große Herausforderung. Dies betraf unter anderem die Eisen- und Stahlerzeugung, welche bislang ihren Bedarf an Erzen lokal decken und ihre Öfen mit Holz befeuern konnte. Die erweiterte Produktion erhöhte die Nachfrage sowohl nach dem Rohstoff Eisenerz als auch jene nach Koks und Steinkohle, mit welchen die technologisch weiterentwickelten Öfen nun betrieben wurden. Wollten sie ihre ursprünglichen Standorte beibehalten, waren sie mit hohen Transportkosten konfrontiert, wodurch sie aber mit ihren Preisen nicht mehr konkurrenzfähig waren. Die unzureichenden Transportwege innerhalb Österreichs waren ein generelles Problem, das auch den zunehmenden Import von günstigeren Rohstoffen erschwerte. Nicht nur, dass der Bau von Schienen in der österreichischen Berglandschaft teuer und teilweise überhaupt nicht möglich war, auch die Anbindung an den internationalen Rohstoffhandel erfolgte nur über weitreichende Transportwege zu den internationalen Häfen. Österreich stützte sich zwar lange Zeit auf den eigenen Hafen Triest, dieser war aber weit entfernt von den Industriestandorten und im internationalen Vergleich von eher geringer Bedeutung.48 Dadurch kam es sogar zur Abwanderung von Unternehmen, etwa in der Schwerindustrie, der Baumwollindustrie und der Zuckerindustrie, vorwiegend nach Mähren und Böhmen aufgrund der dort bereits vorhandenen ausgiebigen Steinkohlevorkommen und des tendenziell niedrigeren Lohnniveaus. Dieser Umzug ermöglichte kürzere Transportwege und erhöhte gleichzeitig die Produktivität.49 Grundsätzlich wurde aber die Infrastruktur innerhalb Österreichs zusehends ausgebaut und dabei auch industriellen Bedürfnissen angepasst. Zunächst hatte die Schifffahrt eine wichtige Bedeutung für den Transport. Hier war es vor allem die Donau, welche nach umfangreichen Regulierungs- und Stauwerksprojekten in einem größeren Ausmaß befahren werden konnte. Die Schifffahrt wurde jedoch bald durch die aufkommende Eisenbahn zurückgedrängt. Konnten sich beide Transportmöglichkeiten anfangs noch gut ergänzen – die Donauschifffahrt bediente die West-Ost-Richtung, während die Eisenbahn für den Transport auf der Nord-Süd-Strecke zuständig war –, so brachte der Ausbau des Schienennetzes dann aber die kostengünstigere Eisenbahn in direkte Konkurrenz zur teureren Schifffahrt. Angelegt wurde die Eisenbahn zunächst, um den Wirtschaftsraum Wien mit den Rohstoffvorkommen in Mähren und Schlesien zu verbinden. Dem folgte eine zunehmende Nachfrage in mehreren Regionen nicht nur als Transportmittel für Rohstoffe zu den Fabriken, sondern auch um Personen zu ihren Arbeitsplätzen und Fertigwaren zu ihren Märkten zu bringen. Damit kam es zu intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den bahnbetreibenden Gesellschaften und der Industrie, einer stärkeren Vernetzung von Wirtschaftsräumen und einem hohen Arbeitskräfteeinsatz beim Ausbau des Schienennetzes.50 Die Länge des Eisenbahnnetzes innerhalb des Habsburgerreichs nahm von 4.500 km im Jahr 1860 auf 36.300 km im Jahr 1900 deutlich zu und konnte bei der Netzdichte in Bezug auf die Einwohnerzahl zur Jahrhundertwende bereits mit dem Deutschen Reich mithalten.51 Zwar wurde auch in den Folgejahren das Schienennetz noch erweitert, jedoch entwickelte es sich recht heterogen und entsprach bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges keinesfalls den militärischen Anforderungen. Die Relation der Schienenlänge zur Fläche des Habsburgerreiches betrug 1913 rund 1:10, während jene des Deutschen Reiches bereits bei 1:2,5 lag.52 Der Ausbau des Schienennetzes in Europa ermöglichte aber generell eine Intensivierung des internationalen Handels. Im Außenhandel war die Monarchie vorwiegend vom Deutschen Reich abhängig. Während mehr als zwei Drittel der gesamten Importe aus dem Deutschen Reich kamen, gingen bis zu 50% der Exporte, der Großteil davon Rohstoffe, ebenfalls an dieses.53 Gemessen am gesamten realen Güter- und Leistungsvolumen der Monarchie 1913 hatte der Import einen Anteil von ca. 21%. Der Anteil des Exports am realen Bruttonationalprodukt belief sich auf etwas mehr als 24%. Die Zahlungsbilanz in diesem Jahr war bei einem Volumen von 1.600 Mio. Kronen jeweils für Import und Export ausgeglichen. Jedoch war der Zugang zu Märkten außerhalb der Monarchie weitgehend durch Zölle und andere Handelshemmnisse, aber auch durch einen hohen Wert der habsburgischen Krone erschwert, wodurch sich der Großteil des Handels innerhalb der Grenzen des Habsburgerreichs abspielte.54
Um dennoch konkurrenzfähig zu bleiben, fehlte aber in vielen Bereichen das nötige Kapital. Da in Österreich relativ niedrige Löhne gezahlt wurden, wurde von den ArbeiterInnen wenig Geld angespart, welches die Banken den Industrieunternehmen als Investitionskapital hätten zur Verfügung stellen können.55 Die grundsätzlich mangelnde Kapitalausstattung der Monarchie war für die wirtschaftliche Entwicklung erschwerend. Dieser Mangel war bedingt unter anderem durch einige umfangreiche und teure Kriege, welche die Monarchie im 19. Jahrhundert führte. Nicht nur, dass sie diese Kriege zumeist nicht gewinnen konnte und mit ihnen auch ertragreiche Gebiete wie das Königreich Lombardei-Venetien verlorengingen, aufgrund der hohen Kosten und der damit verbundenen Verschuldung kam es immer wieder zu einem spürbaren Anstieg der Inflation.56 Generell jedoch besaß Österreich, und hier insbesondere Wien, durch die hohe Bankenkonzentration und die zunehmende Bevölkerung in Bezug auf Kapital und Arbeitskräfte einen wesentlichen Vorteil gegenüber den anderen Gebieten des Reichs. Diese Ressourcen begünstigten auch die Entwicklung der österreichischen Industrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. So begannen die Banken ihre Investitionspolitik zu verändern und stellten der Industrie vermehrt Kapital zur Verfügung. Mit dem Aufkommen der Aktiengesellschaften gingen die Banken sogar Beteiligungen an Unternehmen ein. Dadurch wurde nicht nur die Gründung neuer Unternehmen erleichtert, sondern auch die Entwicklung von Großunternehmen gefördert. Die damit beginnende Verbindung von Banken und Industrieunternehmen sollte sich im Verlauf der folgenden Jahrzehnte noch verstärken und die weitere industrielle Entwicklung prägen.57 Dabei waren die Banken darauf bedacht, ihren Einfluss auf die Industrieunternehmen noch zu verstärken. Von öffentlicher Seite kam in der österreichischen Reichshälfte vorerst nur zögernd Interesse für die industrielle Entwicklung auf. Zwar ließ sie den Banken relativ freie Hand bei ihrer Investitionspolitik, teilweise erschwerte sie aber diese Entwicklung durch eine kontraproduktive Steuerpolitik. Hingegen wurde im ungarischen Reichsteil die Industrialisierung öffentlich unterstützt, was sogar zu einem spürbaren Kapitalfluss von Österreich nach Ungarn führte. Um ihren Einfluss auf die Industrie zu sichern und zu erweitern, unterstützten die Banken gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Formierung von industriellen Kartellen.58 Sie trachteten danach, den heimischen Markt zu kontrollieren und vor ausländischen Zugriffen zu schützen. Die Kartelle setzten Konzentrationsprozesse in Gang, hatten wesentlichen Anteil an der Schutzzollpolitik und gestalteten umfangreiche Maßnahmen zur Reglementierung des heimischen Absatzmarktes. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges umfassten diese Maßnahmen unter anderem Vereinbarungen zu Preisgestaltung, Marktaufteilung und Produktionsabstimmung. Die Zahl der Kartelle nahm von 18 im Jahr 1890 auf 120 im Jahr 1909 zu, wobei große Zunahmen in der Textil-, der chemischen und der Metallindustrie verzeichnet wurden. Die Textilindustrie stellte 1909 absolut gesehen mit 27 Kartellen den größten Anteil, gefolgt von der Metallindustrie mit gesamt 19. Bis Kriegsausbruch stieg die Gesamtzahl der Kartelle auf über 200 an.59 Eine dynamische Entwicklung der österreichischen Industrie und damit eine Verringerung des wirtschaftlichen Abstandes zu anderen großen europäischen Industrienationen wurde aber weiterhin durch den Mangel an Kapital erschwert, welches für die Erweiterung und Modernisierung der Produktionsanlagen benötigt wurde. Da von staatlicher Seite her die Gründung von Kapitalgesellschaften nicht unterstützt wurde, war die finanzielle Ausstattung vorwiegend von den Eigentümerpersonen abhängig. Erst in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges nahm die Zahl der Kapitalgesellschaften deutlich zu (von 61 im Jahr 1906 auf 2.638 im Jahr 1914), wobei 60% davon auf die Industrie entfielen.60 Der Kapitalmangel war jedoch nicht unbedingt dadurch begründet, dass zu wenige finanzielle Mittel vorhanden gewesen wären. Vielmehr lag es an dem für Unternehmen durch die Gesetzgebung infolge des Börsenkrachs von 1873 erschwerten Zugang zum Kapitalmarkt an der Börse und der mangelnden Risikobereitschaft vieler potenzieller KapitalgeberInnen, ihr Geld in Aktien oder Anleihen zu investieren. Das für den Aufschwung der Industrie notwendige Kapital wurde schließlich zum Großteil von einheimischen Banken zur Verfügung gestellt. Diese reagierten anfangs vorsichtig, da sie einem gewissen Sicherheitsdenken unterlagen.61 Dieses hat seinen Ursprung in problematischen Geschäften während der vorangegangenen Jahrzehnte, vorwiegend aufgrund der Auswirkungen des Börsenkrachs. Da die Banken selber mit Umsatzrückgängen und einer zunehmenden Konkurrenz konfrontiert waren, waren sie bereit, der sich nun rasch entwickelnden Industrie Kapital zuzuführen. Neue, junge und unvoreingenommene Bankvorstände übernahmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts sukzessive die Leitung der Banken und erkannten das große Geschäftspotenzial, welches ein Aufschwung der Industrie zu bieten hatte. Sie versicherten sich sogar der Unterstützung industrieller KonsulentInnen und begannen damit, jeweils verschiedene Branchen von sich abhängig zu machen und mit diesen enge Vernetzungen einzugehen.62 Vor allem im Bereich der Investitionsgüter- und Waffenindustrie hatten Banken Einfluss auf alle Aktienunternehmen nicht nur durch Kapital, sondern verbreitet auch in personeller Form durch die Stellung von AufsichtsrätInnen oder DirektorInnen. Das Interesse einer direkten Unternehmensbeteiligung ging aber nicht nur von den Banken aus. Da der Staat Steuern auf Fremdkapitalzinsen erhob, gehörte es verbreitet zur Firmenpolitik, eher das Grundkapital zu erweitern, als zusätzliche Ausgaben durch die Aufnahme von Darlehen zu generieren. Nachteil dieser Beteiligungspolitik war das wirtschaftliche Erfolgsrisiko, das die Banken nun mitzutragen hatten. Dieses versuchten sie zu kontrollieren, indem sie in den Wettbewerb der Unternehmen eingriffen: Sie fusionierten Firmen, forcierten die Kartellbildung und erschwerten neuen Unternehmen den Eintritt in gewisse Branchen. Um sich zusätzlich abzusichern, gingen die Banken auch untereinander weitgehende Beteiligungen ein.63 Die Kartelle wurden zuweilen zentral gesteuert, in einigen Fällen übernahm sogar die Österreichische Kontrollbank den Außenauftritt der im Kartell vertretenen Unternehmen. Diese wurde 1914 von den Banken gegründet, um ihren Einfluss auf die Wirtschaft generell und die Industrie im Speziellen besser untereinander abstimmen zu können. Die Relevanz der Banken für die Wirtschaft nahm in den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges noch erheblich zu. So stiegen von 1900/1901 bis 1913 die Bilanzsummen der Banken in der Monarchie um 107%, die Zahl der Bankinstitute verdoppelte sich und das Aktienkapital am Beispiel der Wiener Banken stieg um ca. 97%. Damit einhergehend erfreute sich die Finanzierung mittels Kreditaufnahme wachsender Beliebtheit, sowohl bei KapitalgeberInnen in Form von längerfristigen Sparmöglichkeiten als auch bei der Industrie durch einen einfacheren Zugang zu Finanzmitteln für ihre Investitionstätigkeiten.64
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs war die industrielle Entwicklung im Habsburgerreich, wie in vielen anderen europäischen Ländern, noch immer von Energie in Form von Kohle abhängig. Lag der Verbrauch an Kohle im Jahr 1861 noch bei etwas mehr als 3 Mio. t, so wuchs dieser auf über 46 Mio. t im Jahr 1913. Auch wenn sich in dieser Steigerung ein umfangreiches Industriewachstum widerspiegelt, im europäischen Vergleich fiel der Kohlebedarf eher bescheiden aus. So stieg der Bedarf etwa im Deutschen Reich im selben Zeitraum von ca. 14 Mio. t auf 187 Mio. t und in Frankreich von über 15 Mio. t auf ca. 65 Mio. t.65 Während der Verbrauch von Kohle an Volumen zunahm, reduzierte sich die Anzahl der im Kohlebergbau tätigen Unternehmen von 731 im Jahr 1872 auf 307 im Jahr 1913. Durch technischen Fortschritt und Konsolidierungen wurden immer mehr Unternehmen eingestellt oder in große Unternehmen integriert.66 Das Habsburgerreich konnte ein großes Kohlepotenzial vorweisen, welches bei der Braunkohle international sogar mit großen Produzenten wie den USA, dem Deutschen Reich oder Großbritannien mithalten und vor allem den Eigenbedarf für eine lange Zeit sicherstellen konnte. Steinkohle wurde zwar ebenfalls abgebaut, die Produktion konnte aber den steigenden Bedarf nicht decken, die Kohle musste somit vermehrt importiert werden. Während innerhalb des Habsburgerreichs einige Regionen, wie etwa Westböhmen, das untere Schlesien und Nordmähren reichhaltige Kohlevorkommen besaßen, war Österreich nicht mit umfangreichen Ressourcen an Bodenschätzen ausgestattet. Hier lag der Schwerpunkt im Bergbau, gemessen am Produktionswert, vor Beginn des Ersten Weltkriegs bei der Produktion von Braunkohle und, wenn auch mit einem deutlich geringeren Volumen, beim Abbau von Eisenerzen. In kleinerem Rahmen wurden Blei-, Zink- und Kupfererze abgebaut. Aufgrund der teilweise schwer erschließbaren Lagerstätten waren eine Produktion und die Weiterverarbeitung mit höheren Kosten verbunden. Dies führte zur bereits erwähnten Konsolidierung von Unternehmen innerhalb der Bergbaubranche und zur Stilllegung einzelner Abbaugebiete. Damit einhergehend kam es auch zu Rationalisierungen und Modernisierungen im Abbauprozess, wodurch ein geringerer Beschäftigungszuwachs benötigt wurde, um ein deutlich höheres Produktionsvolumen zu erreichen. Trotz dieser Veränderungen konnten die österreichischen Bergbauunternehmen nur schwer mit der Konkurrenz aus Böhmen, Mähren oder Schlesien mithalten, wodurch sich der Absatzmarkt nur auf die unmittelbar angrenzenden Regionen erstreckte.67 Beim Abbau von Graphit und Magnesit gehörte das Habsburgerreich jedoch zu den WeltmarktführerInnen. Während der Großteil des Graphits in Südböhmen abgebaut wurde, waren die Lagerstätten für Magnesit hauptsächlich im südlichen Niederösterreich und der Steiermark zu finden. Ein wesentlicher Teil der Abbaumenge beider Rohstoffe wurde in Länder wie das Deutsche Reich, Großbritannien und Frankreich exportiert.68 Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Industrie spielte aber gerade der Abbau von Eisenerzen. Hier konnte zwar ein großer Teil der Nachfrage durch umfangreiche Vorkommen in der Steiermark, wie dem Erzberg, und, wenn auch in geringerem Ausmaß, in Böhmen gedeckt werden. Insgesamt jedoch reichte das heimische Angebot nicht aus und die Industrie war von zusätzlichen Importen abhängig. Auch beim Abbau und der Verarbeitung von Eisenerzen kam es zu Unternehmenszusammenschlüssen und Unternehmensschließungen. Aufgrund des Kostendrucks wurde zudem der Personalstand abgebaut, obwohl das Produktionsvolumen von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg signifikant zunahm.69 1913 waren mehr als 6.000 Personen in 23 Bergbau-Unternehmen beschäftigt, welche mehr als 3 Mio. t Erze förderten. Das Fördervolumen hatte sich allein seit 1896 mehr als verdoppelt, und zwei Drittel des Volumens kamen vom Erzberg. Der Importanteil betrug im selben Jahr mehr als 31%.70
Zwar konnte Österreich mit den umfangreichen Kohlevorkommen in Schlesien und Nordmähren nicht mithalten, jedoch ermöglichte die Eisenbahn den Anschluss an diese Regionen, wodurch der steigende Energiebedarf österreichischer Unternehmen gedeckt werden konnte. Die Abhängigkeit von Kohle als Energiespender hielt sich trotz der aufkommenden Elektrifizierung bis in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg.71 Die industrielle Entwicklung Österreichs seit Ende des 19. Jahrhunderts war dennoch eng mit der sich verbreitenden Elektrifizierung verbunden. Ihr Einzug in die Fabriken bot der österreichischen Wirtschaft neue Möglichkeiten der Entwicklung. Nicht nur, dass Unternehmen unabhängiger und flexibler agieren konnten, aufgrund der Umstellung auf Fließbandarbeit wurden auch ihre Produktionsabläufe rationalisiert. Dabei entstand mit der Elektroindustrie eine neue Branche, die sich vor allem im Osten Österreichs, insbesondere in Wien, ansiedelte. Diese schuf nicht nur zahlreiche neue Arbeitsplätze, sondern zog auch ausländisches Kapital an. Zudem wurde die Elektrizitätswirtschaft auf die in Österreich vorhandene Wasserkraft aufmerksam. Diese einzubeziehen, gelang ihr aber nur sehr dezentral und in den Großstädten konnte sie sich zunächst noch nicht gegen die günstiger produzierenden Gasgesellschaften durchsetzen. Zudem war die Nachfrage nach Kohle noch ungleich größer. Das gesamte Investitionsvolumen für die Elektroindustrie und die Umstellung anderer Branchen auf elektrisch betriebene Produktionsanlagen betrug bis 1912 rund 600 Mio. Kronen.72 Es waren zunächst kleinere Unternehmen, welche die günstigeren Elektromotoren in ihre Produktionsanlagen einbauten, große Unternehmen folgten angesichts des noch relativ hohen Strompreises zögerlich. Dies lag vor allem daran, dass der Strom selber vorwiegend mithilfe von Kohle und noch nicht durch Wasserkraft erzeugt wurde. Eine diesbezügliche Umstellung erfolgte erst nach dem Ersten Weltkrieg.73 Mit der zunehmenden Elektrifizierung entwickelte sich die Elektroindustrie zu einer eigenen Branche. Neben der direkten Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten, Telegraphen, Beleuchtungen und Elektromotoren kam es auch zur Einbindung von unzähligen Zulieferunternehmen wie den Elektrizitätswerken oder bei der Herstellung von Schaltanlagen und Glühbirnen. Der überwiegende Teil der Branche war in Wien angesiedelt und befand sich in ausländischen, insbesondere deutschen Händen. Wichtige Unternehmen der Branche waren die Vereinigte Elektrizitäts- und Maschinenfabriks-AG, Brown Boveri, Siemens, AEG, die Elin AG, die Vereinigte Telephon- und Telegraphenfabrik Czeija, Nissl & Co und Felten & Guilleaume.74
Eine bereits früh etablierte und von Rohstoffen stark abhängige Branche war die metallerzeugende Industrie. Bis zur Umstellung auf eine Produktion mit Hilfe des effizienten Kokshochofens im 19. Jahrhundert waren die bislang kleinen Unternehmen auf den regionalen Bezug von Holz zur Befeuerung ihrer Hütten angewiesen. Um die Nachfrage des Marktes mit seinen steigenden Ansprüchen ausreichend abdecken und die Möglichkeiten neuer Verfahren umsetzen zu können, hätte es auch hier eines Konsolidierungsprozesses bedurft. Dazu waren aber viele bestehende Unternehmen nicht bereit, wodurch die gesamte Industrie nicht mit der internationalen Entwicklung mithalten konnte. Zudem entstanden innerhalb der österreichischen Reichshälfte auch in anderen Regionen Unternehmen, welche die modernen Verfahren bereits umsetzten und somit in Konkurrenz zu den bestehenden Unternehmen traten und diese weiter unter Druck setzten. Vor allem die Konkurrenz außerhalb des Reiches mit ihren günstigeren Angeboten veranlasste die österreichische Metallindustrie, sich letztendlich doch in Kartellen zusammenzuschließen und mit Hilfe von Zöllen die Importe zugunsten der eigenen Produktion zu drosseln.75 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zu einigen notwendigen Unternehmenszusammenschlüssen. Der umfangreichste und für Österreich bedeutungsvollste Zusammenschluss erfolgte 1881 aus Kärntner und steirischen Eisen- und Hüttenwerken zur Österreichischen Alpine Montangesellschaft. Sie hatte einen schweren Start, da eine ihrer GroßaktionärInnen, die Bank Société de l’Union Générale, kurz nach Erwerb der Anteile in Konkurs ging. Um ihre Anteile zu übernehmen, musste die Alpine Montan einen Großteil ihrer Grundstücke verkaufen und umfangreiche Kredite bei der Länderbank aufnehmen. Dennoch gelang ihr die Umstellung auf Koks als Energiequelle und die Errichtung von Großanlagen. Einen weiteren Entwicklungsschub erhielt das Unternehmen durch den Einstieg des Industriellen Karl Wittgenstein 1897. Er brachte Rationalisierung und technologische Erneuerungen und verringerte die Schuldenlast. Ein anderes Beispiel eines erfolgreichen Unternehmenszusammenschlusses der metallerzeugenden Industrie sind die Böhlerwerke. Von ihrer Gründung 1870 an übernahm das Unternehmen verschiedene Hütten u.a. in Kapfenberg, Ybbstal und Hainfeld, kaufte aber auch größere Unternehmen wie die St. Eygyder Eisen- und Stahlindustrie Gesellschaft oder das Frischstahlwerk Kleinreifling.76Böhler konnte seine Produktion zusehends erweitern. Aufgrund umfangreicher ausländischer Munitionsaufträge im Rahmen der japanisch-russischen Auseinandersetzungen 1905 etwa wurde ein weiteres Werk im Wiener Becken errichtet. Zur Produktpalette zählte neben Stahl für Munition und Waffen auch die Erzeugung von Spezialwerkzeugen.77 Der Bedarf an Roheisen nahm generell im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg zu. Allein in der österreichischen Reichshälfte stieg die Produktion von 1904 bis 1912 um ca. 80%, demgegenüber stand eine Nachfragesteigerung von 96%. Somit musste die heimische Produktion durch Importe ergänzt werden.78 Im Bereich der Stahlerzeugung konnte im Habsburgerreich die Produktionsmenge von 1891 bis 1911 um 378% erhöht werden. Im selben Zeitraum nahm die Stahlerzeugung des Deutschen Reichs mit 470% deutlich mehr zu, während jene Großbritanniens nur um 108% zunahm. Absolut gesehen gab es jedoch noch enorme Produktionsunterschiede. Das Habsburgerreich konnte 1911 rund 2,3 Mio. t Stahl erzeugen, hingegen lag die Erzeugung in Großbritannien bei 6,6 Mio. t. Das Deutsche Reich brachte es sogar auf 14,6 Mio. t, wodurch es zum mit Abstand größten Stahlerzeuger Europas aufstieg. Ähnlich verlief die Entwicklung beim Verbrauch von Roheisen. Zwar steigerte die Habsburgermonarchie ihren Verbrauch von 1881 bis 1911 um 313%, erreichte aber 1911 mit 2,1 Mio. t nur etwa 14% des Verbrauchs des Deutschen Reichs.79 Generell erlebte die metallerzeugende Industrie um die Jahrhundertwende einen starken Auftrieb, welcher mit der Expansion der metallverarbeitenden Industrie einherging.
Die metallverarbeitende Industrie spielte in der österreichischen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Im Vergleich mit anderen Ländern der Monarchie war dieser Industriezweig in Österreich überrepräsentiert. Er hatte großes Produktionspotenzial und gut ausgebildete Arbeitskräfte, jedoch war er mit hohen Preisen für Eisen und einem verhältnismäßig kleinen Absatzmarkt konfrontiert. Dabei entwickelten sich Großunternehmen, welche sich auf die Produktion von großen Anlagen spezialisierten. Bedeutende Nachfrage entstand hier beispielsweise durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes und die steigende Nutzung des Automobils.80 Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erfolgte auch eine weitläufige Umstellung der Produktion von kleineren Gütern wie Nadeln, Messern und Sensen zu größeren Anlagen für den Maschinenbau, die Elektrotechnik und die Rüstungsproduktion. Dabei war die Branche lange Zeit nicht nur von einigen großen Unternehmen geprägt, sondern auch von vielen kleinen spezialisierten Unternehmen, zumindest bis nach dem Börsenkrach von 1873 ein gewisser Konsolidierungsprozess einsetzte. So schlossen sich etwa die Traditionsunternehmen Urban aus Wien und Brevillier aus Neunkirchen zusammen und produzierten zusammen Nägel, Schrauben, Muttern, Nieten und Maschinenteile. Ein bereits etabliertes Unternehmen, das auch nach der Krise seine Produktion erweitern konnte, war die Berndorfer Metallwaren AG. Sie stieg mit Hilfe ihres Eigentümers Arthur Krupp zu einem führenden Hersteller von Essbesteck auf und hatte Kapazitäten für die Produktion weiterer Metallwaren, die später auch für die Rüstung relevant waren.81 Wesentliche Nachteile des Habsburgerreichs gegenüber Ländern wie Großbritannien und dem Deutschen Reich waren die erst spät und teilweise überhaupt nicht erfolgte Umstellung der Produktion auf maschinelle Erzeugung und fehlende Rationalisierungsmaßnahmen. Hatte dieser Industriezweig Mitte des 19. Jahrhunderts noch internationale Bedeutung, so fiel er in der zweiten Jahrhunderthälfte hinter die ausländische Konkurrenz zurück und musste selbst am heimischen Markt zeitweise Einbußen hinnehmen.82
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm aber der Bedarf an größeren Maschinen erheblich zu, wodurch das Habsburgerreich zu einem der weltweit größten Maschinenproduzenten wurde. Die Unternehmen waren innerhalb Österreichs vorwiegend auf Niederösterreich, Wien und Graz konzentriert und hatten den Hauptanteil an der Gesamtproduktion des Reichs in diesem Bereich. Sie beschäftigten einen Großteil der Industriearbeitskräfte in der jeweiligen Region und stellten hauptsächlich Lokomotiven, Waggons und Dampfmaschinen her. Große Produzenten dieser Güter waren unter anderem die Grazer Waggon- & Maschinen-Fabriks-Aktiengesellschaft, die Wiener Lokomotivfabrik AG, die Andritz AG, die J.M. Voith AG und die Firma Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth. In der Produktion von Motoren war es die Automobilindustrie mit Unternehmen wie der Daimler-Motoren AG, der Puchwerke AG und der Österreichischen Automobil Fabriks-AG, welche um die Jahrhundertwende von einer steigenden Nachfrage profitierten.83 Im Maschinenbau fanden 1906 mehr als 60.000 Personen in annähernd 600 Unternehmen eine Anstellung.84 Die Metallverarbeitung profitierte vor allem aufgrund der expandierenden Stahlproduktion und konnte allein in der österreichischen Reichshälfte im Zeitraum 1880 bis 1913 um mehr als 800% wachsen. Der Bereich Maschinenbau konnte in derselben Zeitspanne sein Produktionsvolumen nahezu verzehnfachen.85
Die chemische Industrie konnte in der Monarchie zwar größenmäßig nicht mit anderen Industrien mithalten, lieferte jedoch wertvolle Vorprodukte für verschiedene Branchen. So wurden Chemikalien für die Herstellung von Seifen, Kerzen, Glas, Textilien oder Papier erzeugt. Bedeutenderen Umfang hatten die Zündholzherstellung und die Kautschukproduktion für die Herstellung von Gummi. Auch die Rüstungsindustrie war auf diese Vorleistungen angewiesen, etwa in Form von Schwefel- und Salpetersäure für die Munitionsproduktion. Die chemische Industrie war geprägt von mehreren kleineren Unternehmen, die sich in Österreich hauptsächlich in Wien und Niederösterreich ansiedelten. Einige größere Unternehmen fanden sich in der Kautschukproduktion, etwa die Vereinigten Gummiwarenfabriken Hamburg-Wien, die Österreichische Amerikanische Gummifabriken AG oder die Semperit Gummiwerke GmbH.86





























