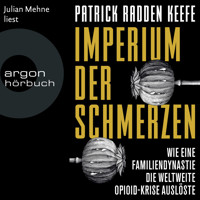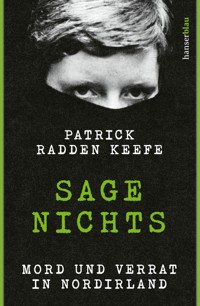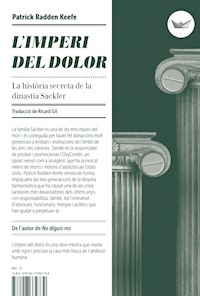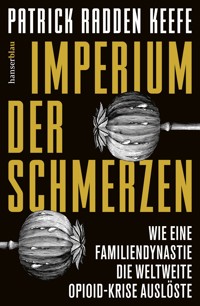
30,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 30,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
„Ein Buch, das wütend und fassungslos macht und dabei so meisterhaft erzählt ist, dass man es nicht aus der Hand legen mag.“ ARD ttt
Das große, verstörende Porträt der Sackler-Familie, die sich als Philantropen feiern lassen, deren Vermögen durch Valium entstand und die mit der Erfindung des Medikaments OxyContin die Opioidkrise in den USA auslöste. Und Millionen Menschen weltweit in die Abhängigkeit stürzte.
Der preisgekrönte Autor Patrick Radden Keefe zeichnet das Sittengemälde einer Industriellenfamilie, die die Welt prägt. Die Geschichte der Sackler-Dynastie birst vor Dramen – barocke Privatleben, erbitterte Verteilungsschlachten, machiavellistische Manöver in Gerichtssälen und der kalkulierte Einsatz von Geld, um sich als Kunstmäzene Zugang zur Elite zu kaufen und die weniger Mächtigen zu brechen. Ein narratives Meisterwerk, umfassend recherchiert und erschreckend zwingend argumentiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1016
Ähnliche
Über das Buch
»Du fühlst dich fast schuldig, wie sehr du dieses Buch genießt.« (The Times) Das große, verstörende Porträt der Sackler-Familie, die sich als Philantropen feiern lassen, deren Vermögen durch Valium entstand und die mit der Erfindung des Medikaments OxyContin die Opioidkrise in den USA auslöste. Und Millionen Menschen weltweit in die Abhängigkeit stürzte.Der preisgekrönte Autor Patrick Radden Keefe zeichnet das Sittengemälde einer Industriellenfamilie, die die Welt prägt. Die Geschichte der Sackler-Dynastie birst vor Dramen — barocke Privatleben, erbitterte Verteilungsschlachten, machiavellistische Manöver in Gerichtssälen und der kalkulierte Einsatz von Geld, um sich als Kunstmäzene Zugang zur Elite zu kaufen und die weniger Mächtigen zu brechen. Ein narratives Meisterwerk, umfassend recherchiert und erschreckend zwingend argumentiert.
Patrick Radden Keefe
Imperium der Schmerzen
Wie eine Familiendynastie die weltweite Opioid-Krise auslöste
Aus dem amerikanischen Englisch von Benjamin Dittmann-Bieber, Gregor Runge und Kattrin Stier
hanserblau
Für Beatrice und Tristram
und für alle, die jemanden durch diese Krise verloren haben
Wie oft haben wir über den Aberglauben und die Feigheit der mittelalterlichen Barone gespottet, die glaubten, indem sie die Kirche mit Ländereien beschenkten, könnten sie ihre Überfälle und Plünderungen vergessen machen. Die Kapitalisten nun hängen offenbar demselben Glauben an — mit dem einen, durchaus nicht geringen Unterschied: dass sich die Erinnerung an die Raubzüge der Kapitalisten tatsächlich als ausgelöscht erweist.
G. K. Chesterton (1909)
Doctor, please, some more of these.
Rolling Stones (1966)
Prolog
Die Wurzel allen Übels
Der New Yorker Firmensitz der internationalen Anwaltskanzlei Debevoise & Plimpton erstreckt sich über zehn Stockwerke eines eleganten, schwarzen Wolkenkratzers mitten im Hochhausdschungel des Finanzviertels von Manhattan. Die Firma wurde 1931 von zwei Anwälten aus der New Yorker Oberschicht gegründet, die zuvor für eine namhafte Kanzlei an der Wall Street gearbeitet hatten. Debevoise & Plimpton machte sich bald einen eigenen Namen und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem global agierenden Konzern mit achthundert Anwälten, einer Reihe imposanter Klienten und einem Jahresumsatz von gut einer Milliarde Dollar.1 In ihren Büros im Finanzdistrikt zeugt heute nichts mehr von der ursprünglich durch Eiche und Leder geprägten Ästhetik der Firma. Stattdessen sind sie so gewöhnlich eingerichtet wie alle Konzernbüros der Gegenwart: Teppichflure, verglaste Konferenzräume, Stehtische. Im 20. Jahrhundert zeigte sich Macht ganz offen. Im 21. Jahrhundert bevorzugt Macht die Sprache des Understatements.
An einem klaren und kalten Frühlingsmorgen des Jahres 2019 — Wolken zogen über das schwarz verspiegelte Glas der Fassade — betrat Mary Jo White das Gebäude, nahm den Fahrstuhl in die Geschäftsräume von Debevoise & Plimpton und brachte sich in einem Konferenzraum in Stellung, in dem die Luft vor Spannung knisterte.2 Mit ihren einundsiebzig Jahren verkörperte White das Prinzip von Macht als Understatement. Sie war klein — kaum einen Meter fünfzig groß, kurze braune Haare, Krähenfüße um die Augen — und bediente sich einer direkten und nüchternen Sprache. Aber als Anwältin war sie gefürchtet. White scherzte gelegentlich, ihre Spezialität sei das Geschäft mit den »ganz großen Sauereien«3. Sie war teuer, aber wer so richtig in der Klemme steckte und nebenbei über sehr viel Geld verfügte, für den war sie die Anwältin der Wahl.
Fast zehn Jahre lang war White US-Bundesstaatsanwältin für den Southern District von New York. Sie führte Anklage gegen die Männer, die 1993 das Bombenattentat auf das World Trade Center verübt hatten. Barack Obama ernannte sie zur Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht. Zwischen ihren verschiedenen Beamtenposten kehrte sie jedoch immer wieder zu Debevoise & Plimpton zurück. Sie war als junge Anwältin in die Firma gekommen und hatte es als zweite Frau zur Teilhaberin gebracht. Sie vertrat die ganz großen Player: Verizon, JP Morgan, General Electric, die National Football League.4
Der Konferenzraum war voller Anwälte, nicht nur von Debevoise & Plimpton, sondern auch von anderen Kanzleien, über zwanzig waren es, ausgestattet mit Notizbüchern, Laptops und berstenden Aktenordnern, aus denen die Post-its quollen. Auf dem Tisch stand eine Konferenztelefonanlage, über die weitere zwanzig Anwälte aus dem ganzen Land zugeschaltet waren. Der Anlass für den Aufmarsch dieser juristischen Armee war die Aussage einer langjährigen Klientin von Mary Jo White, einer öffentlichkeitsscheuen Milliardärin, die sich im Zentrum eines Ansturms von Klagen befand, die anführten, sie habe ebenjenes Milliardenvermögen auf Kosten Hunderttausender Menschenleben angehäuft.
White hat einmal bemerkt, ihr Job als Staatsanwältin sei simpel gewesen: »Du tust das Richtige. Du ermittelst gegen Kriminelle. Jeden Tag dienst du der Gesellschaft.«5 Inzwischen war ihr Job verzwickter. Hochkarätige Wirtschaftsanwältinnen wie White sind gewiefte Fachleute, die sich zwar eines gewissen gesellschaftlichen Ansehens erfreuen, letztendlich jedoch bestimmt ihre Kundschaft das Geschäft. Diese Dynamik ist vielen Staatsanwälten vertraut, die Studiengebühren und Häuser abbezahlen müssen: Die erste Hälfte des Berufslebens verbringt man damit, gegen Kriminelle vorzugehen, in der zweiten vertritt man sie.
Der Anwalt, der an diesem Morgen die Fragen stellen würde, ging auf die siebzig zu und hieß Paul Hanly. Er unterschied sich von seinen Kollegen. Hanly war Vertreter der Sammelklage. Er mochte maßgeschneiderte Anzüge in kräftigen Farben und Maßhemden mit steifem abgesetzten Kragen. Seine stahlgrauen Haare trug er glatt zurückgekämmt, eine Hornbrille betonte seinen stechenden Blick. So wie White eine Meisterin der unterschwelligen Macht war, stand Hanley für das Gegenteil: Er sah aus, als wäre er einem Dick Tracy-Cartoon entsprungen. Doch sein Kampfgeist war dem Whites ebenbürtig, und er hegte eine tief sitzende Verachtung für die höfliche Fassade, die Personen wie White in Momenten wie diesen an den Tag legten. Machen wir uns nichts vor, dachte Hanly. In seinen Augen waren Whites Klienten nichts als »arrogante Arschlöcher«6.
Die Milliardärin, die an diesem Morgen unter Eid aussagen sollte, war eine siebzigjährige Medizinerin, die ihren Beruf nie praktiziert hatte. Sie war blond mit breitem Gesicht, hoher Stirn und weit auseinanderliegenden Augen. Sie wirkte schroff. Ihre Anwälte hatten dafür gekämpft, die Anhörung zu verhindern, und es widerstrebte ihr, daran teilnehmen zu müssen. Sie strahlte die lässige Ungeduld einer Person aus, die sich beim Boarding eines Flugzeugs niemals hinten anstellen muss, so dachte einer der anwesenden Anwälte bei sich.
»Sie sind Kathe Sackler?«, fragte Hanly.
»Ja«, erwiderte sie.
Kathe gehört zur Familie Sackler, einer prominenten New Yorker Dynastie von Mäzenen. Wenige Jahre zuvor hatte Forbes die Sacklers unter den zwanzig reichsten Familien der Vereinigten Staaten aufgelistet; mit einem geschätzten Vermögen von etwa 14 Milliarden Dollar hätten sie »so legendäre Familien wie die Buschs, die Mellons und die Rockefellers hinter sich gelassen«.7 Der Name »Sackler« prangte an Museen, Universitäten und Krankenhäusern auf der ganzen Welt. Nur wenige Gehminuten von diesem Konferenzraum entfernt lagen das Sackler-Graduierteninstitut für Biomedizin der Medizinischen Fakultät der NYU, das Sackler-Zentrum für Biomedizin und Ernährungsforschung der Rockefeller University das Sackler-Zentrum für Kunsterziehung am Guggenheim Museum und der Sackler-Flügel des Metropolitan Museum of Art.
Kathe Sacklers Familie hatte in den letzten sechzig Jahren ihre Spuren in New York City hinterlassen, so wie vor ihr bereits die Vanderbilts und die Carnegies. Allerdings waren die Sacklers inzwischen reicher als diese Familien, deren Vermögen zurückgingen auf das Goldene Zeitalter der amerikanischen Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Institutionen, die aus den Schenkungen der Sacklers hervorgegangen waren, fanden sich bis weit über die Grenzen von New York hinaus: das Sackler-Museum in Harvard, das Sackler-Graduiertenkolleg für Biomedizin an der Tufts University in Massachusetts, die Sackler-Bibliothek in Oxford, der Sackler-Flügel im Pariser Louvre, die Sackler-Medizinfakultät an der Universität Tel Aviv und das Sackler Kunst- und Archäologiemuseum in Peking. »Ich bin damit aufgewachsen«, sagte Kathe Sackler zu Hanly, »dass meine Eltern Stiftungen hatten.« Sie hätten sich »sozial engagiert«.
Die Sacklers hatten buchstäblich Hunderte Millionen Dollar verschenkt, seit Jahrzehnten stand ihr Name in der öffentlichen Wahrnehmung für großzügiges Mäzenatentum. Ein Museumsdirektor verglich die Sacklers mit den Medicis, dem florentinischen Adelsgeschlecht, das im 15. Jahrhundert die Kunst der Renaissance finanziell beflügelt hatte. Die Medicis hatten ihr Vermögen mit Bankgeschäften gemacht, wie aber die Sacklers zu ihrem Wohlstand gekommen waren, blieb lange im Verborgenen. Geradezu manisch verlieh die Familie ihren Namen an Kunst- und Bildungsinstitutionen. Er wurde in Marmor gemeißelt, prangte auf Messingtafeln und wurde sogar in Buntglas geschrieben. Es gab Sackler-Lehrstühle, Sackler-Stipendien, Sackler-Vortragsreihen und Sackler-Preise. Für den flüchtigen Betrachter war es jedoch kaum möglich, den Namen der Familie mit einem konkreten Geschäft in Verbindung zu bringen, das all diesen Wohlstand hervorgebracht haben könnte.8 Die Mitglieder der Familie wurden bei Galadiners und Wohltätigkeitsveranstaltungen in den Hamptons, auf einer Jacht in der Karibik oder beim Skifahren in den Schweizer Alpen gesehen, und man staunte — oder tuschelte — darüber, wie sie wohl zu ihrem Geld gekommen sein mochten. Zumal der Großteil des sacklerschen Vermögens nicht im späten 19. Jahrhundert der Großbanken und Räuberbarone angehäuft worden war, sondern im Laufe der letzten paar Jahrzehnte.
»Sie haben 1980 an der New York University einen Bachelor-Abschluss gemacht«, fragte Hanly. »Richtig?«
»Richtig«, sagte Kathe Sackler.
»Und 1984 haben Sie dort Ihr Medizinstudium abgeschlossen?«
»Ja.«
Ob es stimme, fragte Hanly, dass sie nach zwei Jahren chirurgischer Facharztausbildung angefangen habe, für die Purdue Frederick Company zu arbeiten?
Purdue Frederick war ein Arzneimittelhersteller, der später unter dem Namen Purdue Pharma bekannt wurde. Diese Firma mit Sitz in Connecticut hatte den Löwenanteil des sacklerschen Reichtums erwirtschaftet. Während die Sacklers mit raffinierten »Namensnennungsklauseln« dafür sorgten, dass alle Galerien und Forschungseinrichtungen, die Nutznießer ihrer großzügigen Spenden wurden, den Namen der Familie an prominenter Stelle anbringen mussten, war ihr Familienunternehmen nicht nach den Sacklers benannt. Tatsächlich konnte man die Website von Purdue Pharma durchforsten, ohne je auf den Namen Sackler zu stoßen — obwohl sich das Unternehmen vollständig im Privatbesitz von Kathe Sackler und anderen Mitgliedern der Familie befand. Im Jahr 1996 hatte Purdue Pharma ein bahnbrechendes Medikament auf den Markt gebracht, ein Opiumderivat namens OxyContin, ein hochwirksames Schmerzmittel, das als revolutionär für die Behandlung chronischer Schmerzen angepriesen wurde. Es entwickelte sich zu einem der größten Bestseller in der Geschichte der Pharmaindustrie und generierte Einnahmen in Höhe von rund 35 Milliarden Dollar.9
Es führte jedoch auch massenweise zu Abhängigkeit und Missbrauch. Zu dem Zeitpunkt, als Kathe Sackler ihre Aussage machte, wurden die Vereinigten Staaten von einer verheerenden Opioidkrise heimgesucht, in deren Folge Amerikanerinnen und Amerikaner im ganzen Land von diesen starken Medikamenten abhängig waren. Viele Menschen, die mit dem Missbrauch von OxyContin angefangen hatten, gingen schließlich zu Straßendrogen wie Heroin oder Fentanyl über. Die Zahlen waren erschütternd.10 Laut den Centers for Disease Control and Prevention (die CDC ist eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums) starben in den fünfundzwanzig Jahren nach der Markteinführung von OxyContin etwa 450.000 Amerikanerinnen und Amerikaner an einer Opioid-induzierten Überdosis. Inzwischen stellten solche Überdosen die häufigste unnatürliche Todesursache dar und forderten mehr Opfer als Autounfälle — sogar mehr Opfer als die uramerikanischste aller Sterbearten die durch Schussverletzungen. Tatsächlich haben mehr Amerikanerinnen und Amerikaner ihr Leben durch Opioid-Überdosen verloren als in allen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen.
*
Was Mary Jo White an ihrer Arbeit als Juristin gefiel, war die Notwendigkeit, »die Dinge aufs Wesentliche zu reduzieren«11. Die Opioidkrise war zwar hochkomplex und betraf das gesamte Gesundheitssystem. Doch als Paul Hanly, der Vertreter der Sammelklage, Kathe Sackler befragte, versuchte er, diese riesige menschliche Tragödie auf die grundlegende Ursache zu reduzieren. Vor der Einführung von OxyContin gab es in Amerika keine Opioidkrise. Nach der Einführung von OxyContin schon. Die Sacklers und ihre Firma sahen sich jetzt mit über zweihundertfünfzig Klagen konfrontiert, die von Städten, Bundesstaaten, Stämmen amerikanischer Ureinwohner, Krankenhäusern, Schuldistrikten und einer Vielzahl weiterer Parteien angestrengt wurden. Alle Einzelklagen waren zu einer gewaltigen Zivilsammelklage gebündelt worden, in deren Rahmen Staatsanwaltschaften und die Vertreter privater Kläger versuchten, Pharmakonzerne zur Verantwortung zu ziehen für ihre Rolle in der Vermarktung von Opioiden und dafür, dass sie die Öffentlichkeit über das Suchtpotenzial getäuscht hatten. Ähnlich war es bereits Zigarettenfirmen ergangen, die dazu gezwungen wurden zu erklären, warum sie die gesundheitlichen Risiken des Rauchens heruntergespielt hatten. Führende Manager wurden vor den Kongress zitiert, und 1998 stimmte die Tabakindustrie schließlich einer beispiellosen Vergleichszahlung von 206 Milliarden Dollar zu.12
Mary Jo Whites Job bestand nun darin, den Sacklers und Purdue Pharma eine solche Abrechnung zu ersparen. In der Klageschrift gegen Purdue Pharma führte die Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York Kathe und sieben weitere Sacklers als Angeklagte auf und bezeichnete OxyContin als »die Wurzel allen Übels der Opioidkrise«13. Diese Schmerztablette hatte den Stein ins Rollen gebracht und die Verschreibungspraxis amerikanischer Ärztinnen und Ärzte bei Schmerzmitteln grundlegend verändert — mit verheerenden Folgen. Auch die Generalstaatsanwaltschaft von Massachusetts klagte gegen die Sacklers mit der Begründung, »eine einzige Familie habe jene Entscheidungen getroffen, die maßgeblich für die Opioidkrise verantwortlich waren«14.
Mary Jo White sah das anders.15 All diese Klagen gegen die Sacklers verdrehten die Fakten und machten ihre Klienten zu Sündenböcken, führte sie an. Worin bitte bestand ihr Vergehen? Sie hatten doch lediglich ein völlig legales Produkt verkauft, ein von der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA freigegebenes Medikament. In den Augen von White war es eine Schmierenkomödie, die inszenierte Suche nach einem Prügelknaben. Sie beharrte darauf, die Opioidkrise sei »weder das Werk meiner Klienten noch das von Purdue Pharma«.
Während dieser Befragung aber hielt sie sich zurück. Nachdem sie sich kurz als »Mary Jo White, Debevoise & Plimpton, ich vertrete Dr. Sackler«, vorgestellt hatte, setzte sie sich und hörte zu. Sie überließ es ihren Kollegen, Paul Hanly mit Einsprüchen zu unterbrechen. Lautes Säbelrasseln gehörte nicht zu ihrer Rolle, heute sollte sie nur als im Holster steckende Waffe still, aber sichtbar an Kathe Sacklers Seite in Erscheinung treten. Sie und ihr Team hatten ihre Klientin gut vorbereitet. Denn was auch immer Mary Jo White über »die Reduktion auf das Wesentliche« gesagt haben mochte, wenn die eigene Klientin auf dem heißen Stuhl saß, ging es in erster Linie darum, das Wesentliche zu vermeiden.
»Dr. Sackler, trägt Purdue eine Verantwortung für die Opioidkrise?«, fragte Paul Hanly.
»Einspruch!«, unterbrach einer der Anwälte. »Einspruch!«, sekundierte ein zweiter.
»Ich glaube nicht, dass Purdue eine Verantwortung im juristischen Sinne trägt«, erwiderte Kathe Sackler.
»Das war nicht die Frage«, stellte Hanly klar. »Ich will wissen, ob das Vorgehen von Purdue eine Ursache für die Opiodkrise war.«
»Einspruch!«
»Ich glaube, es handelt sich um ein sehr komplexes Geflecht vielfältiger Faktoren, von gesellschaftlichen Problemen, medizinischen Details und regulatorischen Lücken in vielen amerikanischen Bundesstaaten«, antwortete sie. »Ich denke, das alles ist es sehr, sehr, sehr komplex.«
Doch dann tat Kathe Sackler etwas Überraschendes. Angesichts der dunklen Vergangenheit von OxyContin wäre zu erwarten gewesen, dass sie sich von diesem Medikament distanzieren würde. Doch während der Befragung durch Hanly weigerte sie sich, auch nur die Prämisse seiner Befragung zu akzeptieren. Die Sacklers hätten keinerlei Grund, sich für irgendetwas zu schämen oder sich zu entschuldigen, stellte sie klar — es sei rein gar nichts an OxyContin auszusetzen. »Es ist ein sehr gutes Medikament, ein äußerst wirkungsvolles und sicheres Medikament«, sagte sie. Von einer Konzernchefin, die in einem milliardenschweren Verfahren vorgeladen wird, war ein gewisses Maß an Widerstand zu erwarten. Das aber war etwas anderes: Stolz. In Wahrheit schulde man ihr, Kathe Sackler, die Anerkennung für »die Idee« von OxyContin. Während OxyContin für die versammelte Anklägerschaft die Wurzel allen Übels einer totbringenden Krise historischen Ausmaßes für das Gesundheitssystem war, präsentierte sich Kathe Sackler voller Stolz selbst als ebenjene Wurzel von OxyContin.
»Ist Ihnen bewusst, dass Hunderttausende Amerikanerinnen und Amerikaner von OxyContin abhängig geworden sind?«, fragte Hanly.
»Einspruch!«, warfen zwei Anwälte ein. Kathe Sackler zögerte.
»Eine einfache Frage«, bemerkte Hanly. »Ja oder nein?«
»Das kann ich nicht beantworten«, sagte sie.
*
Später in seiner Befragung kam Paul Hanly auf ein bestimmtes Gebäude an der East Sixty-Second Street zu sprechen, nicht weit von ihrem Konferenzraum entfernt. Es seien eigentlich zwei Gebäude, korrigierte ihn Kathe Sackler. »Von außen haben sie zwei separate Eingänge, aber im Inneren sind sie miteinander verbunden«, erklärte sie. »Sie bilden eine Einheit.« Schmucke New Yorker Stadthäuser mit Kalksteinfassade in einer exklusiven Gegend am Central Park. Zeitlos elegante Gebäude, die neben Immobilienneid auch Erinnerungen an eine frühere Zeit heraufbeschwören. »Es ist das Büro« — sie unterbrach sich — »war … das Büro meines Vaters und meines Onkels.«
Denn ursprünglich waren es drei Sackler-Brüder gewesen, erläuterte sie. Arthur, Mortimer und Raymond. Mortimer war ihr Vater. Alle drei Brüder waren Ärzte, aber zugleich »sehr geschäftstüchtig«, fuhr sie fort. Die Sage der drei Brüder und der Dynastie, die sie begründeten, erzählte zugleich die Geschichte von einem Jahrhundert des amerikanischen Kapitalismus. In den 1950er-Jahren hatten die drei Brüder die Firma Purdue Frederick aufgekauft. »Es war damals eine ziemlich kleine Firma«, sagte Kathe Sackler. »Ein kleines Familienunternehmen.«
Buch I
Der Patriarch
Kapitel 1
Ein guter Name
Als Arthur Sackler im Sommer 1913 in Brooklyn zur Welt kam1, ließen die massiven Wellen europäischer Zuwanderung den Stadtteil rasant wachsen. An jeder Straßenecke sah man täglich neue Gesichter, hörte die Klänge fremder Sprachen, links und rechts wuchsen Häuser empor, schufen Arbeit und Wohnraum für die Neuankömmlinge, allerorten pulsierte die übermütige und vorwärtsdrängende Stimmung eines Neuanfangs. Als Erstgeborener von Migranten teilte Arthur die Träume und den Ehrgeiz dieser neuen Generation Amerikas, ihren Tatendrang und ihren Hunger. Nahezu von Geburt an bebte er vor Energie. Als Abraham geboren legte er diesen altertümlichen Namen zugunsten des amerikanischer anmutenden Namens Arthur ab.2 Ein Foto aus dem Jahr 1915 oder 1916 zeigt ihn als Kleinkind, aufrecht im Gras sitzend, hinter ihm ruht seine Mutter wie eine Löwin.3 Sophie Greenberg ist dunkelhaarig, dunkeläugig und Ehrfurcht gebietend. Arthur schaut direkt in die Kamera, ein Engelchen in kurzen Hosen, mit abstehenden Ohren und einem ruhigen, ungewöhnlich ernsten Blick, als wüsste er schon ganz genau Bescheid.
Sophie Greenberg war erst ein paar Jahre zuvor aus Polen eingewandert.4 Sie war noch ein Teenager, als sie 1906 nach Brooklyn kam und hier einen sanftmütigen, fast zwanzig Jahre älteren Mann namens Isaac Sackler kennenlernte. Auch Isaac war Einwanderer, er kam aus Galizien, das damals noch zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte; mit seinen Eltern und Geschwistern war er 1904 auf einem Schiff nach New York gekommen.5 Isaac war ein stolzer Mann.6 Er entstammte einer Familie von Rabbinern, die vor der Inquisition aus Spanien nach Mitteleuropa geflohen waren7, und nun würden er und seine junge Braut sich in New York etwas Neues aufbauen. Zusammen mit seinem Bruder eröffnete Isaac ein kleines Gemüsegeschäft in der Montrose Avenue 83 in Williamsburg. Sie nannten es Sackler Bros.8 Die Familie bewohnte ein Apartment im gleichen Haus. Drei Jahre nach Arthurs Geburt bekamen Isaac und Sophie einen zweiten Jungen, Mortimer, und vier Jahre danach einen dritten, Raymond. Arthur war seinen jüngeren Brüdern treu zugetan und beschützte sie hingebungsvoll. Als sie noch klein waren, teilten sich die drei Brüder eine Zeit lang sogar ein Bett.9
Isaacs Gemüseladen lief gut genug, sodass die Familie schon bald nach Flatbush umziehen konnte.10 Flatbush war eine belebte Gegend, die sich wie das Herz des Stadtteils anfühlte und als Mittelklasse11, wenn nicht gar obere Mittelklasse galt, zumal im Vergleich mit den weiter entfernten Migrantenvierteln Brooklyns wie Brownsville oder Carnasie. In New York waren Immobilien schon damals die alles entscheidende Messlatte und ihre neue Adresse zeigte, dass Isaac Sackler es in der Neuen Welt zu etwas gebracht und ein gewisses Maß an Stabilität erreicht hatte. In Flatbush gab es baumgesäumte Straßen und gute, geräumige Wohnungen, es war ein Aufsteigerviertel. Ein Zeitgenosse Arthurs ging so weit zu sagen, dass es damals auf die anderen Juden in Brooklyn so wirken konnte, als seien die Juden in Flatbush »praktisch Nichtjuden«12. Die Einnahmen aus dem Gemüsegeschäft investierte Isaac in Immobilien, er kaufte Mehrfamilienhäuser und vermietete Wohnungen.13 Aber Isaac und Sophie hegten Träume für Arthur und seine Brüder, die weit über Flatbush und wohl auch über Brooklyn hinausgingen. Und darin lag etwas von Vorsehung. Sie wollten, dass die Gebrüder Sackler die Welt verändern.
*
Wenn es später so schien, als hätte Arthur tatsächlich mehr Leben gelebt, als je ein anderer hätte in eine einzige Lebenszeit hineinquetschen können, dann war es sicherlich hilfreich, dass er schon früh damit angefangen hat. Er arbeitete schon als kleiner Junge als Aushilfe im Laden seines Vaters.14 Bereits in diesem jungen Alter legte er einige jener Qualitäten an den Tag, die ihn sein Leben lang antreiben und prägen würden — seine einzigartige Vitalität, eine umfassende Intelligenz und ein unerschöpflicher Ehrgeiz. Sophie war klug, aber ungebildet. Mit siebzehn arbeitete sie in einer Textilfabrik, nie würde sie perfektes Schriftenglisch beherrschen.15 Zu Hause sprachen Isaac und Sophie Jiddisch16, aber sie hielten ihre Söhne dazu an, sich stärker zu assimilieren. Sie aßen koscher, gingen aber nur selten in die Synagoge.17 Sophies Eltern lebten mit der Familie zusammen18, und es galt das in Einwandererkreisen nicht unübliche Prinzip, dass alle Hoffnungen und Wünsche der älteren Generationen sich auf die in Amerika geborenen Kinder richteten. Vor allem Arthur fühlte das Gewicht dieser Erwartungen: Er war der Pionier, der erstgeborene Amerikaner, und alle Träume hingen nun an ihm.19
Das Mittel zum Realisieren dieser Träume würde Bildung sein. An einem Herbsttag des Jahres 1925 kam Artie Sackler (man nannte ihn inzwischen Artie) an die Erasmus Hall High School an der Flatbush Avenue.20 Er war der Jüngste in seiner Klasse — kaum zwölf Jahre alt — weil er die Aufnahmeprüfung für ein Begabtenförderprogramm bestanden hatte.21 Artie war nicht gerade schüchtern, aber Erasmus war eine Respekt einflößende Institution.22 Ursprünglich bestand die Schule nur aus einem zweistöckigen Holzhaus, das die holländischen Siedler im 18. Jahrhundert erbaut hatten. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Schule stetig vergrößert: Um das alte Schulhaus herum entstand ein viereckiger Innenhof im Stil der Oxford University, mit efeuberankten, burgähnlichen neogotischen Bauten, auf denen sogar Wasserspeier hockten. Diese Erweiterungsbauten waren vor allem für die vielen frisch zugewanderten Kinder Brooklyns gedacht. Sowohl das Kollegium an der Erasmus als auch ihre Schülerinnen und Schüler nahmen die Ideale von sozialem Aufstieg und Integration sehr ernst, sie verstanden sich als Speerspitze des amerikanischen Experiments, der Unterricht dieser staatlichen Schule war erstklassig, es gab Latein und Griechisch und naturwissenschaftliche Labore23, einige Lehrkräfte trugen Doktortitel24.
Erasmus war allerdings auch riesig. Mit seinen gut achttausend Schülerinnen und Schülern war es eine der größten weiterführenden Schulen des Landes25, und die meisten Kinder waren wie Arthur Sackler — der begeisterte Nachwuchs neu eingewanderter Familien, Kinder der Roaring Twenties, mit glänzenden Augen und pomadisiertem Haar. Durch die Schulkorridore strömten die Jungs mit Anzug und roter Krawatte, die Mädchen in Kleidern und roten Haarbändern.26 Ein Mitschüler von Arthur erzählte, wenn alle sich in der Mittagspause unter dem hohen Bogen des Eingangstores trafen, dann sah es aus »wie bei einer Cocktailparty in Hollywood«27.
Arthur liebte die Schule.28 Im Geschichtsunterricht entdeckte er seine Begeisterung für die Gründerväter, in denen er Seelenverwandte sah, vor allem in Thomas Jefferson. Denn Arties Interessen waren ähnlich eklektisch wie die von Jefferson — Kunst, Naturwissenschaften, Geschichte, Sport, Wirtschaft; er wollte einfach alles machen — und bei Erasmus legte man sehr großen Wert auf Angebote jenseits des Lehrplans. Es gab damals an die hundert Clubs, für so ziemlich alles. Wenn an einem Nachmittag im Winter der Unterricht beendet war, die Dunkelheit hereinbrach und das Licht durch die Schulfenster in den Innenhof strahlte, konnte man in den Korridoren hören, wie der ein oder andere Club sich versammelte: »Herr Vorsitzender! Antrag zur Geschäftsordnung!«29
Wenn Arthur sich später an seine Zeit bei Erasmus erinnerte, sprach er auch über »den großen Traum«30. Erasmus war so etwas wie ein Hochaltar der amerikanischen Meritokratie, und die längste Zeit seines Lebens sah es für Arthur so aus, als könnte er jedes Hindernis überwinden und alle seine Ziele erreichen, sofern sein persönlicher Einsatz dafür reichen würde. Sophie Sackler spornte seinen schulischen Ehrgeiz an und fragte ihn jeden Tag: »Hast du heute wieder eine schlaue Frage gestellt?«31 Arthur war zu einem breitschultrigen blonden Schlacks herangewachsen mit markantem Gesicht und blauen, kurzsichtigen Augen. Er verfügte über eine beeindruckende Ausdauer, und die brauchte er auch. Zusätzlich zu seinen schulischen Verpflichtungen wurde er Redakteur der Schulzeitung und fand auch noch eine Stelle im Büro des schuleigenen Verlags, wo er für den Verkauf von Werbeanzeigen in den Publikationen der Schule zuständig war.32 Arthur lehnte ein reguläres Gehalt ab und schlug stattdessen eine kleine Provision für jede von ihm verkaufte Anzeige vor. Die Verwaltung schlug ein, und schon bald verdiente Arthur gut damit.
Diese frühe Lektion sollte sein Leben zutiefst prägen: Arthur Sackler setzte vor allem auf sich und suchte nach Möglichkeiten, dass der Einsatz seiner eigenen unglaublichen Energie sich rentierte.33 Mit nur einem Job gab er sich nicht zufrieden. Er gründete ein kleines Unternehmen, das die Fotografien für die Jahrbücher der Schule organisierte. Er verkaufte Anzeigen an die Drake Business Schools, einen großen Träger im Bereich der post-schulischen Ausbildung für Büroangestellte, und schlug dieser Firma anschließend vor, ihn — einen Highschool-Schüler — zu ihrem Werbechef zu machen.34 Und so kam es auch.
Sein unermüdlicher Eifer und seine rastlose Kreativität ließen immer neue Einfälle und Ideen aus ihm heraussprudeln. Zum Beispiel gab Erasmus für seine achttausend Schülerinnen und Schüler eigens »Programmhefte« und andere Publikationen für den alltäglichen Lehrplan heraus.35 Warum nicht Anzeigen auf den Rückseiten verkaufen? Wie wäre es damit, Lineale mit dem Logo der Drake Business School kostenlos in der Schule zu verteilen?36 Als Arthur fünfzehn wurde, verdiente er mit all diesen Geschäften genug Geld, um seine Familie finanziell unterstützen zu können.37 Er akkumulierte die neuen Jobs schneller, als er sie abarbeiten konnte, und trat einen Teil an seinen Bruder Morty ab.38 Eigentlich sollte Ray als der Jüngste gar nicht arbeiten müssen, meinte Arthur. »Lass den Jungen sich vergnügen«39, sagte er immer. Aber dann stieg auch Ray in das Geschäft ein. Arthur kümmerte sich darum, dass seine Brüder für The Dutchmen, das Schulmagazin von Erasmus, Anzeigen verkaufen konnten. Sie überredeten die Zigarettenmarke Chesterfield, spezielle Werbung für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu schalten, dafür gab es eine hübsche Provision.40
Trotz der zukunftsorientierten Ausrichtung blieb Erasmus stets der Geschichte verbunden. Einige der von Arthur Sackler so verehrten amerikanischen Gründerväter hatten seine Schule unterstützt: Alexander Hamilton, Aaron Burr und John Jay spendeten Erasmus Geld.41 Die Schule war nach dem niederländischen Gelehrten Desiderius Erasmus aus dem 15. Jahrhundert benannt, und ein Buntglasfenster in der Bibliothek zeigte Szenen seines Lebens.42 Das Fenster, das »dem großen Mann, dessen Namen wir seit hundertvierundzwanzig Jahren führen« gewidmet war, wurde erst ein Jahr vor Arthurs Schuleintritt eingesetzt. Arthurs Mitschülern wurde so täglich eingeschärft, dass auch sie womöglich eines Tages ihren Platz in der langen ungebrochenen Ahnenreihe großer Amerikaner, die bis auf die Staatsgründung zurückführte, einnehmen könnten. Dass sie jetzt noch in beengten Mietskasernen hausten, jeden Tag die gleichen abgetragenen Klamotten trugen oder ihre Eltern eine fremde Sprache sprachen, das war nicht ausschlaggebend. Dieses Land war für alle da und man konnte in seinem Leben wahrhaft Großes erreichen. Bei Erasmus war man stets umgeben von den in Stein gemeißelten Spuren, den Bildern und Namen der legendären großen Männer, die ihnen vorausgegangen waren.
Mitten im Innenhof stand noch immer das marode alte Schulhaus der Holländer, Zeugnis einer Zeit, als dieser Teil von Brooklyn noch Ackerland war. Wenn im Winter der Wind wehte und das Gebälk des alten Gebäudes ächzte, witzelten Arthur und die anderen Schulkinder, dass es wohl der Geist von Vergil wäre, der darüber stöhnte, wie seine schönen lateinischen Verse hier mit Brooklyner Akzent rezitiert wurden.43
*
Arthurs hyperaktive Produktivität dieser Jahre könnte auch von gewissen Ängsten angetrieben worden sein: Das Vermögen seines Vaters begann während seiner Zeit bei Erasmus zu schwinden.44 Einige Immobiliengeschäfte gingen schief, und die Sacklers mussten in eine günstigere Wohnung umziehen. Isaac kaufte ein Schuhgeschäft auf der Grand Street, aber es scheiterte und musste schließen. Um seine Immobiliengeschäfte zu finanzieren, hatte er seinen Gemüsehandel verkauft, und nun musste Isaac einen schlecht bezahlten Job hinter der Theke eines anderen Gemüseladens annehmen, um die Rechnungen zu bezahlen. Arthur erinnerte sich später, dass er in dieser Zeit oft fror, aber nie hungerte. Erasmus hatte eine eigene Jobvermittlung für seine Schülerinnen und Schüler, und um seine Familie unterstützen zu können, übernahm Arthur weitere Jobs. Er trug Zeitungen aus. Er lieferte Blumen.45 Er hatte keine Zeit für Freundinnen, Sommerferienlager oder Partys. Er arbeitete. Seinen ersten Urlaub machte er mit fünfundzwanzig, dieser Umstand machte ihn besonders stolz.46
Und trotzdem tat sich für Arthur bei seinen Streifzügen manchmal eine ganz andere Welt auf — Einblicke jenseits seiner Existenz in Brooklyn, ein anderes Leben, zum Greifen nah. Von Zeit zu Zeit unterbrach er sein frenetisches Treiben und schlenderte die Steintreppen zum Brooklyn Museum hoch, wandelte durch die ionischen Säulengänge hindurch in die riesigen Hallen und bestaunte die ausgestellten Kunstwerke.47 Seine Lieferjobs führten ihn zuweilen bis nach Manhattan, bis in die noblen Viertel mit den goldenen Palästen der Park Avenue. Vor Weihnachten lieferte er große Blumenbouquets aus, während er durch die breiten Straßen ging, sah er durch hell erleuchtete Fenster weihnachtlichen Glanz in den Apartments.48 Er liebte das Gefühl, ein großes Gebäude mit Portier zu betreten, die Arme voller Blumen, vom kalten Gehweg in die samtene Wärme der Lobby einzutauchen.49
Als 1929 die Große Depression einsetzte, verschlechterte sich auch Isaaac Sacklers Situation.50 Sein ganzes Geld hatte er in Mietwohnungen investiert und die waren nun wertlos: Er verlor das bisschen, was er hatte. In den Straßen von Flatbush reihten sich verzweifelte Menschen in die Schlangen vor den Essensausgaben ein. Die Arbeitsvermittlung von Erasmus betreute nicht nur Schüler, sondern auch deren Eltern.51 Eines Tages bat Isaac seine drei Söhne zu sich. In einem trotzigen Aufflammen des alten unbeugsamen Familienstolzes erklärte er, dass er nicht bankrottgehen werde. Seine knappen Ressourcen hatte er verantwortungsvoll verwaltet und konnte zumindest die Rechnungen begleichen. Darüber hinaus aber blieb nichts übrig. Isaac und Sophie wünschten sich nichts mehr, als dass ihre Kinder die Schullaufbahn fortsetzen könnten — aufs College zu gehen, sich weiter nach oben zu arbeiten, alles tun zu können, was ehrgeizigen jungen Menschen in Amerika offenstand. Aber dazu fehlte Isaac jetzt das Geld. Wenn die Gebrüder Sackler zur Schule gehen wollten, müssten sie es sich verdienen.
Das so aussprechen zu müssen, war sicher hart für Isaac. Aber immerhin hatte er seinen Kindern etwas mit auf den Weg gegeben. Etwas, das wichtiger war als Geld. »Ich habe euch das Kostbarste gegeben, was ein Vater seinen Kindern geben kann«, sagte er zu Arthur, Mortimer und Raymond, nämlich »einen guten Namen«.52
*
Wenn Sophie Sackler unsicher war, ob der kleine Arthur und seine Brüder krank waren, gab sie ihnen einen Kuss auf die Stirn, um ihre Temperatur zu prüfen.53 Sophie war energischer und durchsetzungsstärker als ihr Mann, und sie hatte schon immer eine sehr klare Vorstellung davon, was aus ihren Kindern mal werden sollte: nämlich Ärzte.
»Ich wusste schon mit vier, dass ich später Mediziner werde, erinnerte sich Arthur. »Es war die reinste Hirnwäsche meiner Eltern, dass ich Arzt werde.«54 Für Sophie und Isaac war die Medizin ein nobler Beruf.55 Bis ins 19. Jahrhundert galten Ärzte vielen nur als Quacksalber oder Hausierer mit Schlangenöltinkturen. Doch Arthur und seine Brüder wurden in das sogenannte Goldene Zeitalter der amerikanischen Medizin hineingeboren, Anfang des 20. Jahrhunderts verbesserten neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Ursachen und die gezielte Behandlung vieler Krankheiten die Wirksamkeit der Medizin ganz erheblich — und damit auch das Ansehen dieses Berufsstandes.56 Es war daher vor allem in jüdischen Einwandererfamilien nicht unüblich, sich ein Medizinstudium für die Kinder zu wünschen. Der Beruf des Arztes galt als integer, man diente damit dem Wohl der Gesellschaft, außerdem versprach er hohes Ansehen und finanzielle Sicherheit.
Im Jahr des großen Börsencrashs machte Arthur seinen Schulabschluss an der Erasmus und schrieb sich als Student an der New York University ein.57 Das College gefiel ihm. Aber er hatte kein Geld. Seine Bücher waren gebraucht oder geliehen, manche fielen schon auseinander.58 Er hielt sie mit Gummibändern zusammen, lebte sparsam und lernte fleißig.59 Er vertiefte sich auch in die Viten antiker Medizinphilosophen wie Alkmaion von Kroton, der das Gehirn als Sitz des menschlichen Geistes identifizierte, und Hippokrates, dem sogenannten Vater der Medizin, in dessen berühmtem Eid die Grundwerte ärztlicher Integrität verewigt wurden, vor allem »erstens nicht schaden«.
Neben seinem harten Studienpensum schaffte es Arthur, sich auch weiterhin mit anderen Dingen zu beschäftigen, und arbeitete für die Collegezeitung, das Satiremagazin und das Jahrbuch zugleich. Abends fand er noch Zeit, um im gemeinnützig orientierten Privatcollege Cooper Union Kunstkurse zu besuchen und sich in figürlichem Zeichnen und Bildhauen zu üben.60 In einem Artikel über derlei außerschulische Aktivitäten schrieb Arthur damals, dass »Studenten sich so einen erweiterten Blick auf das Leben und seine Herausforderungen erwerben, durch den sich die praktische Wirksamkeit und Anwendbarkeit ihrer Studieninhalte vervielfachen«61. Mittags kellnerte er im Campuscafé. Und in den wenigen freien Stunden zwischen dem Unterricht verkaufte er noch Limonade in einem Süßwarenladen.62
Das verdiente Geld schickte Arthur nach Brooklyn zu Sophie und Isaac. Seinen Brüdern brachte er bei, wie sie die Jobs, die er ihnen vermittelt hatte, auch behielten.63 Morty und Ray waren für Arthur immer seine »kleinen Brüder«64. Vielleicht lag es auch an den Umständen, denn die Nöte der Großen Depression hatten Arthur die Rolle des Versorgers in der Familie geradezu aufgezwängt, hinzu kam noch sein Status als Erstgeborener und seine dominante Persönlichkeit, aber in gewisser Weise fungierte er für Mortimer und Raymond nicht als großer Bruder, sondern eher als Elternteil.
Der Campus der New York University lag damals weit stadtaufwärts in der Bronx. Aber Arthur zog mit Lust hinaus in die große Metropole. Er besuchte Museen, seine Schritte hallten in den marmornen Galerien, die nach schwerreichen Industriellen benannt waren. Verabredungen führte er ins Theater, allerdings konnte er sich nur Stehplätze leisten, sodass sie den ganzen Abend auf den Füßen verbrachten. Sein liebstes günstiges Vergnügen für Dates war eine Fahrt mit der Staten Island Ferry rund um Lower Manhattan herum.65 Als Arthur 1933 seinen College-Abschluss machte, hatte er genug Geld verdient (in einer Ära mit Rekordarbeitslosigkeit), um seinen Eltern einen neuen Laden mit angrenzenden Wohnräumen kaufen zu können.66 Er wurde an der New York University Medical School angenommen und schrieb sich sofort ein, mit einem prallvollen Lehrplan und als Redakteur beim Studentenmagazin67. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt Arthur im Anzug, souverän, selbstbewusst, einen Stift in der Hand. Als wäre er mitten in einem Gedanken unterbrochen worden, dabei ist das Bild offensichtlich inszeniert.68 Er liebte die Medizin — ihre Rätselhaftigkeit und die Verheißung, sie würde dem gewissenhaften Forscher einst ihre »Geheimnisse offenbaren«69. Er meinte, »ein Arzt kann einfach alles erreichen«70. Für ihn war Medizin die »Fusion von Technik und menschlicher Erfahrung«.
Aber er wusste auch um die große Verantwortung in der Medizin, dass ein gutes oder ein schlechtes Urteil in diesem Beruf über Leben und Tod entscheiden konnte. Als Arthur als Assistent in der Chirurgie arbeitete, war der dortige Chefarzt ein sehr angesehener Chirurg, der aber zusehends alterte und an dem Arthur Anzeichen einsetzender Senilität zu bemerken glaubte. So schien der ältere Herr die Grundregeln medizinischer Hygiene vergessen zu haben, denn er schrubbte sich vor einer Operation die Hände und band sich dann die Schuhe zu. Weit besorgniserregender war die Beobachtung, dass auch seine Fähigkeiten mit dem Skalpell so sehr gelitten hatten, dass Menschen in seiner Obhut verstarben. Das passierte so regelmäßig, dass die Belegschaft ihn hinter seinem Rücken schon den »Todesengel« nannte.
An einem Dienstag begleitete Arthur den Chirurgen auf seiner Visite und sie kamen an das Bett einer jungen Frau in den Dreißigern, Magengeschwür mit Durchbruch. Arthur untersuchte die Patientin, deren Magengeschwür von einer Fistel umschlossen war, und stellte fest, dass keine akute Gefahr bestand. Der Chefarzt aber verkündete: »Ich operiere sie am Donnerstag.«
Nun war Arthur alarmiert, denn die völlig unnötige Operation stellte möglicherweise eine ernsthafte Gefahr für das Leben der Frau dar. Also riet er ihr, das Krankenhaus zu verlassen, mit ihr sei alles in bester Ordnung. Beschwor sie, ihre Kinder und ihr Mann würden sie sicher brauchen. Nur die wahren Gründe seiner Bedenken zu verraten, dazu fühlte Arthur sich nicht berechtigt; es wäre als schwerer Bruch des Protokolls durch einen Untergebenen angesehen worden. Die Frau wollte nicht gehen. Also sprach Arthur mit ihrem Mann. Aber auch der ließ sich nicht überzeugen, sie mit nach Hause zu nehmen. Menschen ohne eigene medizinischen Kenntnisse folgen oft dem ganz natürlichen Impuls, der Erfahrung und dem Urteil von Ärzten zu vertrauen und ihr Leben, und das ihrer Liebsten, in ihre Hände zu legen. »Der Professor wird operieren«, sagte der Ehemann zu Arthur.
Der Todesengel operierte die Frau am festgelegten Tag. Sein Skalpell durchstieß den ummantelten Abszess, und sie verstarb. War Arthur durch seine beruflichen Ambitionen blind gewesen für das, was hier auf dem Spiel stand? Hätte er den Gehorsam verweigert und sich dem Todesengel in den Weg gestellt, dann hätte er das Leben der Frau womöglich retten können. Die Operation nicht verhindert zu haben, konnte er sich nie verzeihen. Trotzdem bemerkte er mal: »Medizin ist hierarchisch, und vielleicht muss das so sein.«71
Außer der schweren Verantwortung, die eine medizinische Laufbahn mit sich brachte, bewegten Arthur auch andere hartnäckige Bedenken. Wäre für ihn ein Leben einzig als praktizierender Arzt wirklich erfüllend? Mediziner zu sein hatte immer finanzielle Sicherheit versprochen. Bis sich während der Großen Depression selbst manche Ärzte in Brooklyn nur mit dem Verkauf von Äpfeln über Wasser halten konnten.72 Vom materiellen Wohlstand einmal abgesehen, wie stand es um die Frage geistiger und intellektueller Stimulation. Arthur wollte kein Künstler werden, das war viel zu unrealistisch. Aber er hatte schon immer ein gutes unternehmerisches Gespür und ein leidenschaftliches Interesse fürs Geschäftliche, und daran konnte kein medizinischer Eid etwas ändern. Außerdem hatte er schon wieder einen interessanten Nebenjob an Land gezogen, dieses Mal als Werbetexter für das deutsche Pharmaunternehmen Schering. Arthur hatte entdeckt, das unter seinen vielen Talenten er eines am besten beherrschte: Leuten was verkaufen.
Kapitel 2
Die Anstalt
Marietta Lutze kam aus Deutschland nach New York und wurde das Gefühl nicht los, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen hatte. Menschen aus Deutschland wurden, gelinde gesagt, nicht gerade mit offenen Armen in den Vereinigten Staaten empfangen. Es waren erst ein paar Monate vergangen, seit Hitler sich in seinem Bunker erschossen hatte, während sowjetische Truppen Berlin einnahmen. Marietta war damals sechsundzwanzig Jahre alt, groß und schlank, eine aristokratische Erscheinung mit blonden Locken und fröhlich blitzenden Augen.1 Sie hatte noch während des Krieges in Deutschland ihren Abschluss in Medizin gemacht, aber um sich bei den New Yorker Ärztekammern um eine Approbation bewerben zu können, musste sie noch zwei praktische Jahre absolvieren.2 Sie fand eine Stelle in einem Krankenhaus in Far Rockaway in Queens. Der Wechsel fiel ihr nicht leicht. Die Leute blieben der Fremden mit dem schweren deutschen Akzent gegenüber skeptisch. Und eine Frau, die Ärztin sein wollte, fanden sie noch dubioser. Als Marietta in Far Rockaway anfing, nahm sie erst mal niemand ernst — weder ihre Patienten noch die Rettungssanitäter noch ihre eigenen Kollegen. Stattdessen wurde ihr im ganzen Krankenhaus hinterhergepfiffen.3
Aber sie legte sich ins Zeug. Sie fand die Arbeit anstrengend, aber auch stimulierend. Und sie schloss sogar neue Freundschaften — mit zwei jungen Assistenzärzten aus Brooklyn, Brüder namens Raymond und Mortimer Sackler.4 Mortimer war der Ältere der beiden, jovial und schwatzhaft mit verschwörerischem Lächeln, gelocktem Haar und stechenden dunklen Augen. Der jüngere Raymond hatte helleres Haar, das sich auf dem Kopf bereits lichtete, grüne Augen, weiche Züge und ein sanftes Wesen.5
Wie Marietta hatten die Brüder ihre medizinische Ausbildung außerhalb der USA absolviert. Nachdem sie die ersten Semester an der New York University erfolgreich abgeschlossen hatten, bewarben sich Mortimer und Raymond an der Medical School. Aber in den 1930ern hatten viele medizinische Studiengänge in Amerika Quoten für jüdische Bewerber eingeführt. Mitte der 30er-Jahre stammten über 60 Prozent der Bewerbungen an amerikanischen Medical Schools von jüdischen Menschen, und dieses gefühlte Ungleichgewicht führte zu scharfen Restriktionen.6 An manchen Medical Schools, in Yale etwa, wurden Bewerbungen von Studenten, die zufällig jüdisch waren, mit einem »H« für »hebräisch« versehen.7 Zuerst hatte sich Mortimer an einer Medical School beworben und schnell gemerkt, dass seine ethnische Herkunft sich auswirkte, als ob er auf einer Schwarzen Liste stehen würde. Er fand in den gesamten USA keine einzige Medical School, die ihn aufnehmen wollte. Also fuhr er 1937 im Zwischendeck eines Schiffs nach Schottland, um am Anderson College of Medicine in Glasgow weiterzustudieren.8 Raymond folgte ihm ein Jahr später.
Viele Amerikaner aus jüdischen Familien, die in ihrem eigenen Land vom Medizinstudium ausgeschlossen waren, studierten jetzt im Ausland. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass die Familie Sackler, die erst wenige Jahrzehnte zuvor Europa verlassen hatte, um in Amerika ihr Glück zu versuchen, schon eine Generation später gezwungen war, für adäquate Bildungschancen den Rückweg nach Europa anzutreten. Marietta erfuhr auch, dass Raymonds und Mortimers kurzer Trip nach Schottland von ihrem Bruder finanziert worden war. Die Kohlen waren damals rationiert, ihre Unterkunft war kalt und sie ernährten sich hauptsächlich von gebackenen Bohnen. Aber die Brüder schätzten die schottische Schläue und Herzlichkeit sehr.9 Trotzdem blieben sie nur kurz: Der deutsche Überfall auf Polen zwang die Brüder 1939 abermals dazu, ihr Studium abzubrechen. Sie landeten an der Middlesex University in Waltham, Massachusetts — einer nicht akkreditierten Medical School, die sich den Quoten für Menschen jüdischen Glaubens verweigerte und später der Brandeis University angegliedert wurde.10
Nach dem Krieg absolvierten Morty und Ray beide ihr praktisches Jahr im Krankenhaus von Far Rockaway. Sie waren intelligent und ehrgeizig. Marietta mochte sie. Der Klinikalltag konnte überwältigend sein, aber die Lebenslust der Gebrüder Sackler gefiel ihr. Die beiden unterschieden sich stark: Morty war ein überschäumender Hitzkopf mit ätzendem Spott, Ray ausgeglichen und rational. »Mortimer war ein Flammenwerfer«, erinnerte sich ein Bekannter der beiden, »Raymond ein Friedensstifter.«11 Abgesehen von ihrem unterschiedlichen Auftreten waren die Brüder sich so ähnlich, dass sie gelegentlich ihre Schichten tauschten, und der eine sich für den anderen ausgab.12
Eines Abends, nach einem besonders üblen Tag, beschlossen die Assistenzärzte der Klinik, ein leeres Zimmer im Krankenhaus für eine kleine Party umzufunktionieren.13 Sie hängten ihre weißen Kittel an den Haken, schafften Drinks herbei und warfen sich in Schale. Mariettas schwarzes Strickkleid ließ ihre blasse Haut durchscheinen. Die Assistenzärzte tranken und unterhielten sich, ab einem gewissen Punkt wurde auch gesungen. Marietta war üblicherweise eher schüchtern, aber sie sang gern. Also fasste sie sich ein Herz, stellte sich vor die Feiernden und stimmte ein Lied an, das sie oft in Berlin gesungen hatte. Es war der Chanson »Parlez-moi d’amour« — und ehe sie sich’s versah, versank sie in ihrer Rolle und schmachtete mit tiefer, erotischer Stimme, als stünde sie auf einer Cabaretbühne.14
Noch während sie sang, bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann im Publikum, der sehr ruhig dasaß und sie anschaute. Mit seinem aschblonden Haar und der randlosen Brille wirkte er wie ein Professor. Er ließ sie nicht aus den Augen. Marietta hatte eben geendet, da kam er schon auf sie zu und sagte, wie sehr ihm das Lied gefallen habe. Er hatte hellblaue Augen, eine sanfte Stimme und wirkte sehr selbstbewusst. Er sei auch Arzt. Sein Name sei Arthur Sackler.15 Mortys und Rays älterer Bruder. Drei Ärzte also; ihre Eltern hätten »drei von drei« bekommen, scherzte Arthur oft.16 Am nächsten Tag rief Arthur bei Marietta an und wollte mit ihr ausgehen.17 Aber sie lehnte ab.18 Ihre Arbeit war zu erdrückend, für Verabredungen hatte sie keine Zeit.
Danach hörte Marietta ein ganzes Jahr lang nichts mehr von Arthur Sackler, und sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Aber als sich ihr erstes praktisches Jahr in der Klinik dem Ende neigte, suchte sie nach der nächsten Stelle. Sie interessierte sich für das Creedmoor Hospital, eine staatliche psychiatrische Einrichtung in Queens. Sie erkundigte sich bei Ray Sackler nach Kontakten, ob er dort jemanden kenne? Und Ray kannte tatsächlich jemanden, der in Creedmoor arbeitete: seinen älteren Bruder Arthur. Also rief Marietta bei Arthur Sackler an und vereinbarte einen Termin.19
*
Das Creedmoor Psychiatric Center wurde 1912 als Armenhaus des Brooklyn State Hospitals gegründet. Es hatte sich seitdem immer weiter ausgedehnt und umfasste in den 40er-Jahren ein riesiges Klinikareal mit über siebzig Gebäuden auf über 120 Hektar.20 Historisch betrachtet gab es schon immer einen Kampf darum, wie mit psychisch kranken Menschen umzugehen sei. Manche Kulturen grenzten sie aus — oder verbrannten sie gar als »Hexen«. In anderen Kulturen wandte man sich an Menschen mit psychischen Leiden in der Hoffnung, sie besäßen kostbares und privilegiertes Wissen. In Amerika neigte das medizinische Establishment seit dem 19. Jahrhundert dazu, psychisch Kranke in einem immer weiter wuchernden Netzwerk riesiger Anstalten einzupferchen. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden etwa eine halbe Million Menschen in solchen Einrichtungen festgehalten — und zwar nicht vorübergehend stationär: Wer sich in einem Ort wie Creedmoor wiederfand, der verließ ihn im Allgemeinen nicht mehr. Oft fristeten die Leute jahrzehntelang ein Leben in Gefangenschaft. Deshalb war diese Einrichtung auch hoffnungslos überfüllt: Die Klinik war für maximal viertausend Menschen zugelassen, aber nun lebten dort sechstausend.21 Es war ein trostloser und schauriger Ort. Manche Patienten waren völlig apathisch, stumm, inkontinent, nicht ansprechbar.22 Andere neigten zu extremen Wutausbrüchen. Besucher sahen sie in ihren weißen Zwangsjacken über das Gelände irren wie die Vision einer Radierung von Goya.23
Arthur Sackler kam 1944 nach Creedmoor, nachdem er sein Studium an der New York University abgeschlossen und ein paar Jahre in einem Krankenhaus in der Bronx gearbeitet hatte. In seinem praktischen Jahr hatte er 36-Stunden-Schichten durchgestanden, Kinder entbunden, war in Rettungswagen mitgefahren, stets hatte er dazugelernt und Gefallen an der stimulierenden Vielfältigkeit immer neuer Diagnosen und Therapien gefunden.24 Aber sein besonderes Interesse galt inzwischen der Psychiatrie. Er arbeitete unter Johan van Ophuijsen, einem weißhaarigen Psychoanalytiker aus den Niederlanden25, über den Arthur stolz behauptete, er sei »Freuds Lieblingsschüler«26 gewesen. Arthur nannte ihn »Van O«27, er war ganz nach seinem Geschmack: ein Renaissancemensch — ein Arzt, der praktizierte und forschte, wissenschaftliche Artikel schrieb, mehrere Sprachen beherrschte und in seiner knappen Freizeit auch noch boxte und Orgel spielte. Arthur verehrte den älteren Van O und beschrieb ihn als »Mentor, Freund und Vater«28.
Die Psychiatrie war damals kein besonders hoch angesehenes Fachgebiet der Medizin. Vielmehr war es, einem damaligen Kollegen von Arthur Sackler zufolge, »eine eher abseitige Karriere«29. Die Psychiatrie versprach wenig Prestige, und sogar das Gehalt war niedriger als das von Chirurgen und Allgemeinmedizinern.30 Nach Abschluss seiner Ausbildung wollte Arthur in der Psychiatrie forschen, aber er hatte nie vor, eine eigene Praxis zu eröffnen und Patienten zu behandeln. Er verspürte weiterhin den Drang, seine Familie zu unterstützen — schließlich musste er noch das Medizinstudium seiner Brüder finanzieren. Also fand Arthur Sackler eine Stelle in der Pharmaindustrie, bei Schering, für die er schon als Student Werbetexte verfasst hatte.31 Für ein Jahresgehalt von 8.000 Dollar arbeitete Arthur in der medizinischen Forschung und in der Marketingabteilung zugleich.32 Bei Eintritt der USA in den Krieg bewahrte ihn seine Kurzsichtigkeit davor, eingezogen zu werden. Statt des Militärdienstes fing er also eine weitere Facharztausbildung an — im Creedmoor Psychiatric Center.33
Seit Jahrtausenden hatten Mediziner versucht, die Rätsel psychischer Erkrankungen zu entschlüsseln. Sie hatten unendlich viele Theorien aufgestellt, nicht wenige davon muten heute als plump und grotesk an: In der Antike glaubte man, der Wahnsinn werde durch ein Ungleichgewicht von »Körpersäften«, wie der schwarzen Galle, ausgelöst, und im Mittelalter hielt man psychisch Erkrankte für von Dämonen Besessene. Während die Medizin in fast allen Bereichen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts enorme Fortschritte feierte, waren die Funktionen und Dysfunktionen des menschlichen Geistes, zu dem Zeitpunkt als Arthur Sackler nach Creedmoor ging, auch für die amerikanische Ärzteschaft noch immer ein großes Mysterium. Eine Erkrankung wie Schizophrenie konnte man zwar diagnostizieren, aber über ihre Ursachen wusste man kaum etwas, geschweige denn über ihre Behandlung. Schon Virginia Woolf (die selbst unter psychischen Krankheiten litt) beklagte eine »Armut der Sprache« hinsichtlich bestimmter Erkrankungen. »Das kleinste Schulmädchen, wenn es sich verliebt, hat Shakespeare oder Keats, die ihm aus der Seele sprechen; aber ein Leidender versuche, den Schmerz in seinem Kopf dem Doktor zu beschreiben, und sogleich versiegt die Sprache.«34
Als Arthur seine ärztlichen Lehrjahre beendete, dominierten im Großen und Ganzen zwei gegensätzliche Theorien über die Entstehung psychischer Erkrankungen. Auf der einen Seite glaubte man, dass Schizophrenie — und andere Erkrankungen, wie Epilepsie oder kognitive Beeinträchtigungen — erblich bedingt sei. Mit solchen Leiden werde man geboren, sie seien naturgegeben, unveränderlich und unheilbar. Der beste Rat der medizinischen Fachwelt lautete, diese bedauernswerten Fälle vom Rest der Gesellschaft zu isolieren — und oftmals auch zu sterilisieren, damit sie ihre Gebrechen nicht auch noch weitervererbten.35
Am anderen Ende des Spektrums waren die Freudianer, die nicht glaubten, dass psychische Erkrankungen intrinsisch und angeboren wären, sondern vielmehr in frühkindlichen Erfahrungen gründeten. Freudianer wie Van O glaubten, man könne viele Krankheitsbilder mittels Therapie und Analyse behandeln. Aber die Gesprächstherapie war eine teure und individuelle Angelegenheit36 und kam schon deshalb für eine Einrichtung von industriellem Ausmaß wie Creedmoor nicht infrage.
In der Diagnostik psychischer Erkrankungen gab es historisch gesehen oft ein sehr klares Missverhältnis der Geschlechter: In Creedmore lebten fast doppelt so viele Frauen wie Männer.37 Arthur wurde dem Gebäude R zugeteilt, einer Abteilung für »gewalttätige Frauen«.38 Es konnte ein schrecklicher Ort sein. Manchmal musste Arthur seine Patientinnen mit körperlicher Gewalt bändigen. Aber auch er wurde angegriffen. Einmal ging eine Frau mit einem spitz geschliffenen Metalllöffel auf ihn los.39 Trotzdem empfand er Mitgefühl für seine Patientinnen. Was sagte es eigentlich über die amerikanische Gesellschaft, fragte er sich, dass empfindsame und leidende Menschen isoliert, hinter Mauern gesperrt und dort einem »Limbus der lebenden Toten«40 überlassen wurden, wie er es später nannte. Es war verrückt zu glauben, dass es damit getan wäre, die Menschen einzukerkern, und dass ihre Institutionalisierung die Gesellschaft im Allgemeinen (und die Ärzte im Besonderen) von ihrer Pflicht entbinden würde, das Leiden dieser Menschen zu lindern. »Es macht den Anschein, als habe sich die Gesellschaft betäubt oder sich der Illusion hingegeben, dass dieses unerhörte persönliche Leid und eine solche massenhafte Zerstörung menschlicher Talente und Fähigkeiten einfach nicht existiert — nur weil wir es hinter Krankenhausmauern versteckt haben«, meinte Arthur damals.41 Van O teilte die Verachtung für diese staatlichen Einrichtungen.42 Seiner Meinung nach wurden die Vereinigten Staaten von einer Epidemie der Geisteskrankheiten heimgesucht. Ihr damit zu begegnen, die Patientinnen und Patienten einzusperren — sie in einer psychiatrischen Klinik zu »begraben«43 —, käme einem Todesurteil gleich.
Arthur betrachtete die Situation mit seinem unerbittlich analytischen Verstand und erkannte das faktische Dilemma: Die Fallzahlen psychischer Erkrankungen nahmen deutlich schneller zu als die Fähigkeit der Behörden, solche Kliniken aufzubauen.44 Das bewies schon ein kurzer Rundgang durch die überfüllten Abteilungen von Creedmoor. Hierfür wollte Arthur unbedingt eine praktikable Lösung finden. Etwas, das funktionierte. Eine besondere Herausforderung lag indes im Nachweis der Wirksamkeit: Bei psychischen Krankheiten ließ sich das schwieriger abschätzen als bei chirurgischen Operationen, wo man oft sehr schnell sehen konnte, ob der Eingriff erfolgreich war oder nicht. Das Gehirn aber war komplexer. Und die Tatsache, dass Resultate so schwierig zu evaluieren waren, hatte zu recht bizarren Experimenten geführt. Nur wenige Jahrzehnte zuvor war der Leiter einer staatlichen Klinik in New Jersey davon überzeugt gewesen, dass er seine Patienten heilen könnte, indem er ihnen die Zähne entfernte.45 Als einige seiner Patientinnen nicht auf diese Behandlung anzusprechen schienen, machte der Chefarzt weiter und entfernte Mandeln, Dickdärme, Gallenblasen, Blinddärme, Eileiter, Gebärmütter, Eierstöcke und Gebärmutterhälse. Das Resultat seiner Experimente war zwar keine einzige Heilung, aber über hundert Tote.46
In Creedmoor war das damalige Mittel der Wahl ein weniger invasives Verfahren, aber auch das lehnte Arthur ab: Elektroschocks. Diese Therapie war die Erfindung eines italienischen Psychiaters, der die Idee nach einem Besuch im Schlachthaus entwickelt hatte.47 Er hatte zugesehen, wie Schweine kurz vor der Schlachtung mit einem Stromschlag betäubt wurden, und eine ähnliche Prozedur ersonnen, bei der Elektroden an den Schläfen einer Patientin befestigt wurden, um elektrische Ladungen durch ihren Temporallappen und andere Hirnregionen zu leiten, in denen das Gedächtnis entsteht. Die Patientin krampfte und wurde bewusstlos. Beim Erwachen war sie oft orientierungslos und klagte über Übelkeit. Manche Patientinnen verloren Teile ihres Gedächtnisses, andere waren zutiefst erschüttert und wussten nicht mehr, wer sie waren.48 Doch trotz ihrer rohen Gewalt schien die Elektroschocktherapie vielen Patientinnen Linderung zu verschaffen.49 Sie schien starke Depressionen zu mildern und Menschen mit psychotischen Episoden zu beruhigen; sie war zwar kein Heilmittel für Schizophrenie, aber sie konnte oft die Symptome dämpfen.50
Warum das Verfahren wirkte, konnte niemand so genau sagen, man wusste lediglich, dass es das tat. Und an einem Ort wie Creedmoor reichte das. Die Klinik setzte das Verfahren seit 1942 ein, vermutlich wurden Tausende Patientinnen und Patienten damit behandelt.51 Natürlich gab es Nebenwirkungen. Die während der Behandlung auftretenden Krampfanfälle, verursacht von den durch ihre Köpfe strömenden elektrischen Ladungen, waren für die Patientinnen schmerzhaft und extrem beängstigend. Die Dichterin Syliva Plath wurde damals in einer Klinik in Massachusetts einer Elektroschocktherapie unterzogen und beschrieb das Gefühl als »ein gewaltiger Ruck, bis ich glaubte, mir würden die Knochen brechen und das Mark würde mir herausgequetscht wie aus einer zerfasernden Pflanze«52. Der Sänger Lou Reed erhielt 1959 in Creedmoor Elektroschocks und war nach seinem Martyrium temporär völlig paralysiert, seine Schwester beschrieb ihn als »stumpf« und unfähig, selbstständig zu gehen.53
Trotzdem hatte die Elektroschocktherapie ihre Fürsprecher, und noch heute wird sie flächendeckend eingesetzt als Therapie bei starken Depressionen.54 Aber Arthur Sackler hasste es. Schon bald war jede Station in Creedmoor mit einem Elektroschockgerät ausgestattet.55 Arthur musste die Prozedur immer wieder durchführen. Manchmal ging es den Patienten danach besser, manchmal nicht. Vor allem wirkte die Prozedur sehr brutal — erst wurden die Personen fixiert, damit ihre krampfenden Gliedmaßen die Umstehenden nicht verletzen konnten, dann wurde die elektrische Ladung eingestellt wie bei irren Wissenschaftlern in Hollywoodfilmen — und nicht selten waren die Patienten danach traumatisiert.
Arthur hatte seine jüngeren Brüder immer dazu angehalten, ihm nachzufolgen — auf die Erasmus, in die vielen Nebenjobs, die er für sie organisiert hatte, schließlich in die Medizin. Nun rekrutierte er Mortimer und Raymond auch für Creedmoor, und schon bald verabreichten auch sie Elektroschocks. Die Brüder führten Tausende solcher Behandlungen durch, die sie als demoralisierend empfanden. Sie waren angewidert von den engen Grenzen ihres eigenen medizinischen Wissens, von der Vorstellung, dass sie keine humanere Therapie anbieten konnten.56
Und als ob die Elektroschocktherapie nicht schon schlimm genug war, kam nun ein weitaus härteres Verfahren in Mode: die Lobotomie. Bei dieser Prozedur wurden Hirnnerven durchtrennt, was dem Anschein nach die innere Unruhe linderte. Man knipste im Gehirn buchstäblich ein paar Lichter aus. Aber für hoffnungslos überfüllte Einrichtungen wie Creedmoor war das Verfahren verlockend, denn es war schnell und effizient. »Es ist nichts dabei«, erklärte es 1952 einer der Ärzte, »ich nehme eine Art medizinischen Eispickel, halte ihn so, durchstoße damit den Knochen über der Augenhöhle, drehe ihn hin und her und durchtrenne so die Hirnnerven — fertig. Der Patient kriegt davon nichts mit.«57 Die Prozedur war tatsächlich nicht sehr komplex. Oft wurden die Patienten bereits ein paar Stunden später nach Hause entlassen. Sie waren gut an ihren Hämatomen an den Augen zu erkennen.58 Vor allem Frauen wurden nicht nur bei Schizophrenie oder Psychosen lobotomiert, sondern auch bei Depressionen.59 Das Verfahren machte Menschen fügsam, indem es sie in Zombies verwandelte — und es war irreversibel.
Dieses Arsenal an therapeutischen Scheußlichkeiten überzeugte Arthur Sackler und seine Brüder davon, dass es noch andere Heilungsansätze für psychische Erkrankungen geben müsste. Den Glauben der Eugeniker, dass menschlicher Wahnsinn unveränderlich und unheilbar sei, teilte Arthur ohnehin nicht.60 Obgleich ausgebildeter Freudianer, war er der Meinung, dass nicht nur die gelebten Erfahrungen eines Menschen psychische Krankheiten hervorriefen, es musste auch eine biochemische Komponente geben und daher auch eine effektivere Behandlungsmethode als die freudsche Analyse möglich sein. Arthur machte sich an die Arbeit, eine Antwort zu finden, eine Art Schlüssel, der psychische Erkrankungen enträtseln und den Menschen ihre Freiheit zurückgeben konnte.61
Der damalige Chefarzt von Creedmoor war ein Mann namens Harry LaBurt, der kein besonders großer Freund neumodischer Ideen war.62 LaBurt liebte die Macht, die man ihm als Klinikleiter übertragen hatte. Er residierte in einem großen Haus auf dem Klinikgelände, das als Direktorenvilla bekannt war. Sein Büro im Verwaltungsgebäude war immer verschlossen: Wer ihn sehen wollte, musste durch einen Türsummer eingelassen werden.63 Auf manche wirkte LaBurt nicht wie ein Arzt, sondern eher wie ein Gefängnisdirektor. Ein damaliger Kollege von Arthur beschrieb die Klinik als »ein Gefängnis mit sechstausend Betten«.64 Für LaBurt zählte der Status quo, nicht die Entdeckung kreativer neuer Mittel zur Erlösungen der Menschen aus seinem steinernen Königreich. »Der Aufsichtsrat nimmt mit großer Befriedigung die positiven Auswirkungen zur Kenntnis, die das Fernsehen auf die Patienten ausübt«, wurde in einem Jahresbericht von Creedmoor verkündet.65 Einer so rastlosen und ehrgeizigen Persönlichkeit wie Arthur Sackler konnte diese Selbstgefälligkeit bloß Verdruss bereiten. Arthur und LaBurt hatten kein gutes Verhältnis.66
Im Austausch mit seinen Brüdern hingegen begann Arthur das Problem psychischer Erkrankungen weiter zu analysieren. War es möglich, dass die Eugeniker und die Freudianer beide falschlagen? Und dass die Antworten nicht nur in den Genen oder frühkindlichen Erlebnissen lagen — sondern in der Störung chemischer Prozesse im Gehirn?67
*
Am Ende benötigte Marietta Lutze doch keinen Job in Creedmoor, weil sie eine Stelle in einer anderen Klinik in Queens fand. Aber als sie sich mit Arthur Sackler traf, um sich über Creedmoor zu erkundigen, da nutzte er die Gelegenheit und bat sie erneut um eine Verabredung. Diesmal willigte sie ein. Zufälligerweise musste Arthur bald dringend zu einer medizinischen Fachtagung in Chicago, ob sie ihn vielleicht begleiten würde? Marietta war seit ihrer Ankunft in New York so in Arbeit versunken gewesen, dass sie noch nichts vom Land gesehen hatte. Also schlug sie ein. Kurz darauf machte sie sich in ihrem schwarzen Kleid und mit einem großen Hut auf den Weg zum verabredeten Treffpunkt Grand Central Station. Sie nahmen jedoch keinen Zug. Stattdessen erwartete Arthur sie draußen an der Straße — mit einem imposanten dunkelblauen Buick Roadmaster Cabrio.68
Auf der langen Fahrt nach Chicago erzählte sie ihm ihre Lebensgeschichte.69 Sie stammte aus einer wohlhabenden Familie, der das bekannte deutsche Pharmaunternehmen Dr. Kade gehörte. Während des Krieges hatte sie von den Gräueln um sie herum wenig mitbekommen, so beteuerte sie, obwohl sie in Berlin Medizin studiert hatte.70 Wenn Leute in Amerika erfuhren, dass sie aus Deutschland kam, reagierten sie oft feindselig und hinterfragten ihre persönliche Geschichte.71 Arthur jedoch tat dies nicht. Falls er ihre Darstellung des Krieges anzweifelte, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. Er hörte lieber genau zu.
Denn auch Marietta war vom Kriegsgeschehen nicht unberührt geblieben. Sie war bereits verheiratet gewesen — mit einem Marineoffizier namens Kurt. Sie lernten sich während des Krieges kennen, er war Chirurg und einige Jahre älter als sie. Nach der Hochzeit lebten sie nur einen Monat zusammen, dann wurde Kurt eingezogen. In Brest geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft und kam in ein Gefangenenlager. Eine Weile lang schrieb er ihr Briefe, kurze Notizen auf Zigarettenpapier, die er irgendwie aus dem Lager schmuggeln konnte. Am Ende aber blieb er so lange in Gefangenschaft, dass sie ihre Ehe lösten.72
Auf den amerikanischen Juden Arthur, der Antisemitismus am eigenen Leib erfahren und als Student gegen Hitler demonstriert hatte, dessen Familie die Deutschen ebenso leidenschaftlich verabscheute wie viele Amerikaner, eher noch mehr, konnte Mariettas Version der Geschichte nur einigermaßen befremdlich gewirkt haben. Andererseits hatte er selbst bis vor Kurzem für das deutsche Unternehmen Schering gearbeitet.73 Marietta mochte wohl auch etwas Exotisches an sich haben, diese teutonische Sexbombe, die aussah wie Ingrid Bergman in Casablanca und obendrein noch Ärztin war. Im Amerika der Nachkriegszeit war Ausländerfeindlichkeit weitverbreitet, aber einer von Arthurs grundlegendsten Charakterzügen war eine intensive Neugier auf für ihn radikal fremde Menschen und Kulturen. Marietta bemerkte, dass Arthur auf dieser Autofahrt nach Chicago nur wenig über sich sprach und vorzugsweise mit seiner ruhigen Stimme Fragen stellte. Was einen angenehmen Kontrast zu ihren bisherigen Erfahrungen mit amerikanischen Männern darstellte, die sie kaum je als Erwachsene ernst zu nehmen schienen, geschweige denn als Ärztin. Arthur hingegen hörte einfach nur zu. Dieses Ungleichgewicht hielt Marietta damals für unverstellte Neugier. Erst später erkannte sie in Arthurs Zurückhaltung auch eine gewisse Neigung zu Heimlichkeit.74
Nach dem Ausflug nach Chicago ging Marietta zurück an die Arbeit im Queens General Hospital, und auf ihrer Station tauchten auf einmal Sträuße voller Blumen auf. Übermäßig viele Blumen, Bouquets von geradezu beschämender