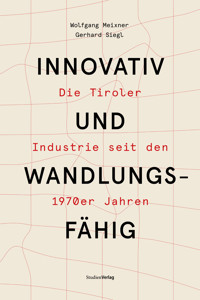
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Nach Jahrzehnten des nahezu kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums in der Nachkriegszeit kehrte ab den 1970er Jahren auch in Österreich und Tirol wieder die "ökonomische Normalität" mit Auf- und Abschwüngen von Konjunkturzyklen ein. Auf starke Konjunkturjahre folgten teils krisenartige Abschwünge (z.B. Ölpreiskrisen 1973 und 1979, Finanz- und Bankenkrise 2007/09, Coronakrise 2020/22), die Anpassungsprobleme nach sich zogen. Zudem setzte durch weltweite Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien ("Computerzeitalter") und die zunehmende Digitalisierung ein Wandel der Arbeits- und Lebenswelt ein, der in seinen Dimensionen nicht vorhersehbar war. Umso mehr war die Tiroler Industrie herausgefordert, mit Innovationen und Wandlungsfähigkeit in diesem turbulenten halben Jahrhundert zu bestehen. Dieses Buch folgt auf die 1992 erschienene "Geschichte der Tiroler Industrie" von Helmut Alexander und benennt die strukturellen Veränderungen in der Tiroler Industrie seit den 1970er Jahren. Die Autoren zeigen die dahinterliegenden treibenden Kräfte auf und beleuchten den Stellenwert der Tiroler Industrie, die wesentlich zum Wohlstand des Landes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner beiträgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Ähnliche
Wolfgang Meixner, Gerhard Siegl
Innovativ und wandlungsfähig
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Standortfaktoren
Rohstoffe
Energie
Verkehr
Umwelt
Politische und wirtschaftshistorische Rahmenbedingungen
Strukturelle Veränderungen
Branchen der Industrie
Textil- und Bekleidungsindustrie
Bauindustrie
Sägeindustrie
Holzindustrie
Chemische Industrie
Glasindustrie
Metallindustrie
Elektro- und Elektronikindustrie
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Stein- und keramische Industrie
Arbeitskräfte
Lehre
Arbeitskräftemangel
Arbeitslose
Einkommen
Export und Globalisierung
Tiroler Wirtschaftsräume
Bezirk Lienz
Bezirk Reutte
Bezirk Imst
Bezirk Landeck
Neue Wege der Tiroler Wirtschaftspolitik
Das Wirtschaftsleitbild als Bestandsaufnahme und Instrument der Politik
Innovation durch Forschungsförderung und Gründungsinitiativen
„ZukunftsRaumTirol“
Schluss
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abkürzungen
Autoren
Vorwort
Als Präsident der Industriellenvereinigung Tirol ist es mir eine besondere Freude, das Vorwort zu diesem Werk beisteuern zu dürfen, das sich mit der Geschichte der Industrie in unserem Bundesland Tirol befasst. Seit unter der Ägide des damaligen IV-Tirol-Präsidenten, Kommerzialrat Ing. Martin Huter, der Tiroler Historiker Dr. Helmut Alexander die Geschichte der Tiroler Industrie bis in die 1980er Jahre dokumentiert hat, ist einige Zeit vergangen. Es freut mich, dass nun unter meiner Präsidentschaft eine weiterführende historische Monografie zur Geschichte der Tiroler Industrie erscheint. Diese knüpft an die Arbeit von Helmut Alexander an und erweitert fundiert die Darstellung der Entwicklung bis in die heutige Zeit.
Das vorliegende Buch „Innovativ und wandlungsfähig. Die Tiroler Industrie seit den 1970er Jahren“ belegt die herausragende Bedeutung, die der industrielle Sektor für die Entwicklung Tirols hat.
Die Welt und damit auch die Bedingungen für die Tiroler Industrie haben sich seit den 1970ern wesentlich geändert. Gleich geblieben ist jedoch, dass die Tiroler Industrie mit ihrer Innovationskraft – deren Basis neben mutigem und visionärem Unternehmertum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tiroler Industrie sind – maßgebend zum Wohlstand und zur positiven Entwicklung unserer Heimat beigetragen hat.
Die Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion, die immer intensivere Zusammenarbeit im gemeinsamen Europa und die zunehmend global organisierte Marktwirtschaft haben viele Chancen geboten. Diese konnten von der Tiroler Industrie genutzt werden, weil sie damals hervorragend aufgestellt war und die Bedingungen am Wirtschaftsstandort Österreich dies begünstigt und zugelassen haben.
Die Tiroler Industrie hat durch die Schaffung und den Erhalt von Tausenden von sicheren und hochqualitativen Arbeitsplätzen und eine Vielzahl von Innovationen ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich unser Bundesland zu einer der wohlhabendsten und attraktivsten Regionen Europas entwickelt hat.
Ein Meilenstein für die Tiroler Industrie, der auch eine zentrale Rolle im vorliegenden historischen Werk spielt, war der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995. Die europäische Integration hat unseren Unternehmen neue Märkte eröffnet und Österreichs Position als zentraler Wirtschaftsraum im Herzen Europas gestärkt. Es liegt an uns als Mitgliedsland der Europäischen Union, diese so zu gestalten, dass uns auch zukünftig das Nutzen von Chancen und das erfolgreiche Meistern von Herausforderungen gelingen kann. Durch eine überbordende Bürokratie und die damit auferlegten Belastungen für unsere Unternehmen wird dies nicht nur behindert, es gefährdet zudem die Identifikation mit dem bisher so erfolgreichen und zukünftig umso wichtigeren europäischen Projekt.
Das vorliegende Buch zeichnet eindrucksvoll die Rolle der Industrie als tragende Säule des wirtschaftlichen Aufschwungs in Tirol nach. Die Wertschöpfung des produzierenden Sektors bildet gemeinsam mit dem Tourismus das Rückgrat der Tiroler Wirtschaft. Das Werk von Wolfgang Meixner und Gerhard Siegl unterstreicht durch historische Fakten nicht nur das positive Image der Tiroler Industrie als gestaltende Kraft, sondern erinnert auch daran, dass unser heutiger Wohlstand das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit, Fleiß und unternehmerischer Weitsicht ist. Der hohe Lebensstandard und die soziale Sicherheit, die wir in Tirol genießen, sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen jeden Tag aufs Neue erarbeitet und verteidigt werden – eine Lektion, die uns der Blick in die Vergangenheit lehrt. Wenn Anspruchsdenken das Leistungsdenken ersetzt, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass nachkommende Generationen die gleiche Lebensqualität erwarten dürfen, wie wir es heute tun. Das war den Menschen in der Tiroler Industrie, die die Geschichte in diesem Band gestalteten, mehr als bewusst und soll uns heute als Mahnung dafür dienen, dass eine starke Industrie und der Leistungswille ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft die Grundvoraussetzungen für das gute Leben in Tirol sind.
Ich danke allen Mitgliedern der Industriellenvereinigung Tirol, deren Unterstützung die Arbeit an diesem Buch erst möglich gemacht hat. Mein besonderer Dank gilt den beiden Autoren Wolfgang Meixner und Gerhard Siegl. Ihr Beitrag zur Geschichte der Tiroler Industrie ist von unschätzbarem Wert.
Mit diesem Buch hoffen wir nicht nur die Vergangenheit zu würdigen, sondern auch einen Wegweiser für die Zukunft zu bieten. Es zeigt, dass der Fortschritt der Tiroler Industrie ein Schlüssel für Wohlstand, sozialen Frieden und eine nachhaltige Zukunft ist.
Dr. Christoph Swarovski
Präsident der Industriellenvereinigung Tirol
Einleitung
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (EU), damals Europäische Gemeinschaft (EG), am 1. Jänner 1995 erfüllte sich ein Wunsch der Tiroler produzierenden Wirtschaft, der seit Anfang der 1960er Jahre zielstrebig verfolgt wurde.1 In den Beitrittsverhandlungen selbst spielte die Industrie in Bezug auf Tirol keine bedeutende Rolle. Die großen „Problembereiche“ Tirols waren eine Nachfolgelösung für das seit 1993 geltende Transitabkommen mit der EG/EU sowie die Zukunft der kleinund bergbäuerlich strukturierten Tiroler Landwirtschaft. Als dritter Tiroler Themenkreis wurde die Frage der Zweitwohnsitze verhandelt. Das seit 1993 in Tirol geltende Grundverkehrsgesetz sollte es Ausländer:innen und EU-Bürger:innen erschweren, in Tirol Grund bzw. Besitz zu erwerben.2 Zudem war es die Bestrebung Österreichs, dass ein möglichst großer Teil der Staatsfläche als Ziel-5b-Gebiet eingestuft wurde, um an entsprechenden Förderprogrammen für benachteiligte ländliche Gebiete teilnehmen zu können. Die Festlegung der Ziel-5b-Gebiete war allerdings nicht Gegenstand der Beitrittsverhandlungen, sondern fiel in die Kompetenz der Europäischen Kommission. Das Bundesland Tirol konnte als „traditionelle[s] Bergbauernland von einer großflächigen Einstufung als Ziel-5b-Gebiet profitieren“.3 Über 60 Prozent der Landesfläche (7.766 km²) mit einer Bevölkerung von rund 190.000 Personen (30,2 Prozent der Gesamtbevölkerung) wurden als Fördergebiet definiert, darunter Osttirol (Bezirk Lienz), das Oberland (Bezirke Imst und Landeck), fast das gesamte Außerfern (Bezirk Reutte) sowie Gebiete im Tiroler Unterland und im Wipptal. Diese erhielten in den ersten fünf Jahren nach dem EU-Beitritt Fördermaßnahmen finanziert, durch die eine „geordnete Entwicklung des ländlichen Raumes verwirklicht“ werden sollte.4 Rund zwanzig Prozent der Kosten wurden von der EU getragen.5 Die Fördermaßnahmen betrafen nicht nur die Erhaltung und die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, sondern auch die Schaffung und den Ausbau dauerhafter Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft oder die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe.6
Die Tiroler produzierende Wirtschaft, insbesondere die Industrie, brachte „beste Voraussetzungen“ mit, um im künftigen europäischen Wirtschaftsraum zu bestehen.7 Die Tiroler Industriestruktur war, im Gegensatz etwa zu den Bundesländern Steiermark, Niederösterreich und zum Teil auch Oberösterreich, kaum „durch alte Schornsteinindustrien im Grundstoffbereich belastet“.8 Zudem besaß die Tiroler Industrie einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil durch ihre räumliche Nähe und das gut ausgebaute Verkehrsnetz zu den prosperierenden Wirtschaftsräumen Süddeutschlands und Norditaliens, deren Nationalstaaten seit langem Mitglied der EG/EU waren. Drittens entwickelte die Tiroler Industrie in der Zweiten Republik eine hohe Exportorientierung und war dadurch den kommenden Erfordernissen durch die Modernisierung ihrer Produktionsanlagen und eine rege Investitionstätigkeit in neue technologische Entwicklungen angepasst.9
Helmut Alexander resümierte daher in seinem Standardwerk zur Tiroler Industrie, dass sie ob dieser Bedingungen und Voraussetzungen „optimistisch in das 21. Jahrhundert […] schauen und nach Europa […] blicken“ könne.10
Genau hier setzt diese Arbeit an. Sie behandelt die Entwicklung der Tiroler Industrie ab den späten 1970er Jahren und damit auch die Zeit seit dem Beitritt Österreichs zur EG/EU. Somit schließt sie an die Arbeit von Helmut Alexander an, der 1992 im Auftrag der Landesgruppe Tirol der Vereinigung Österreichischer Industrieller (Industriellenvereinigung) eine „Geschichte der Tiroler Industrie“ vorgelegt hatte.11 Alexander skizzierte darin die Vor- und Frühformen der industriellen Wirtschaft in Tirol, den Bergbau, das ländliche Hausgewerbe und Verlagswesen, das städtische Handwerk sowie die Zünfte und beleuchtete die Entstehung der Tiroler Industriezweige in drei Phasen, den Aufschwung bis 1914, die Zwischenkriegszeit sowie die Entwicklung nach 1945. Er legte den Schwerpunkt der Darstellung der dritten Phase auf die ersten Nachkriegsjahre (Umstieg auf Friedensproduktion, Wiederaufbau) sowie auf die Zeit des Aufschwungs ab den 1950er Jahren. Wichtige Jahrzehnte der Tiroler Industrie, insbesondere die Zeit der Krise und des Strukturwandels in den 1970er und 1980er Jahren, konnten nur knapp abgehandelt, bedeutende Ereignisse für die Entfaltung der Wirtschaft wie die Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes (1994) oder der Beitritt Österreichs zur EG/EU (1995) aufgrund des Erscheinungsjahres des Buches (1992) gar nicht dargestellt werden. Die Phase von Liberalisierungen in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte ab den 1990er Jahren sowie die Gründung neuer Unternehmenszweige und Unternehmensformen (start ups) traten ebenso erst nach Erscheinen des Werks auf.
Die verdienstvolle Arbeit von Helmut Alexander lässt sich nicht so einfach fortschreiben. Eine Darstellung der Geschichte der (Tiroler) Industrie erfordert neben dem strukturgeschichtlichen Zugang die Aufnahme jüngerer Ansätze der regionalen Wirtschaftsgeschichte unter Einbeziehung von Aspekten aus der Umwelt-, Geschlechter-, Migrations- und Kulturgeschichte.12 Ebenso sind die Entwicklungen und der Wandel von Energieströmen und -ressourcen zu berücksichtigen und es gilt, die regionale Industriegeschichte in einen überregionalen Rahmen einzubetten.13 Einzelne Industriebetriebe werden nur exemplarisch behandelt, daher ist dieses Buch keine isolierte Industriegeschichte, sondern betrachtet die Voraussetzungen, Bedingungen sowie das Umfeld der Tiroler Industrie.14
Die vorliegende Publikation basiert auf einer intensiven Quellen- und Recherchearbeit. Eine zeitgeschichtlich orientierte Wirtschaftsgeschichte sieht sich hier einer Fülle an Quellen gegenüber, die allerdings mitunter disparat und nicht immer leicht zugänglich, wenn nicht noch mit Schutzfristen belegt sind.15 Daher wurde eine Auswahl der Quellen vorgenommen, wobei allgemein zugänglichen und überblicksmäßigen Quellen der Vorzug gegenüber Einzel- bzw. individualisierenden Akten gegeben wurde. Eingesehen wurden das Archiv der Industriellenvereinigung (IV) Tirol, die Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum sowie Bestände des Tiroler Landesarchivs und der Tiroler Landes- und Universitätsbibliothek. Die seit 1991 erschienene wissenschaftliche Literatur zu dieser Thematik wurde eingearbeitet sowie einschlägige Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet.16 Dabei erwiesen sich die seit 1963 erscheinenden Jahresberichte der IV Tirol als Fundgrube zu den Themen und Problemstellungen dieser Arbeit und liefern zudem ein pointiertes Bild der jeweiligen Zeit.17 Ebenso herangezogen und ausgewertet wurden die seit 1970 erscheinenden Jahresberichte der Sektion Industrie der Wirtschaftskammer (WK) für Tirol.18 Als hilfreich und informativ erwiesen sich auch die seit 1975 erscheinenden zwei- bzw. dreijährigen Berichte der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), die bis auf die letzten beiden Berichte auch einen ausführlichen Teil zu den einzelnen Bundesländern enthalten.19 Anhand dieser Berichte lässt sich für das Bundesland Tirol der Übergang der „unverbindlichen Landesplanung“ in eine gesetzlich geregelte Raumplanung, die eine Fülle von Themen tangiert und somit auch die Belange von Gewerbe und Industrie, sehr gut nachvollziehen.20 Einen Einblick in die wirtschaftspolitischen Dimensionen Tirols seit dem Beitritt zur EG/EU bieten die von 1996 bis 2011 erschienenen Berichte an den Tiroler Landtag unter dem Titel „Tirol in der Europäischen Union. Erfahrungen und Perspektiven“.21 Ebenfalls ausgewertet wurden die auf Entschließungen des Tiroler Landtages vom 5. Juli und 7. Oktober 1977, vom 16. Oktober 1989 sowie vom 4. Juli 2001 beruhenden und vom Amt der Tiroler Landesregierung (ATLR) erstellten „Tiroler Wirtschaftsberichte“, die von 1978 bis 2004 erschienen sind und 2005 vom Tiroler Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht abgelöst wurden.22 Durchgesehen wurden auch die seit 1998 erscheinenden Jahrbücher der Tiroler Wirtschaft mit einer Auflistung der erfolgreichsten Tiroler Unternehmen (Top 500) der Monatszeitschrift Echo.23 Für den Zeitraum davor wurde das österreichweite Unternehmensranking des Wirtschaftsmagazins Trend herangezogen, das seit 1970 erscheint und seit 1981 unter dem Titel „Goldener Trend“ jährlich ein Ranking österreichischer Unternehmen vorlegt.24 Auch das Wirtschaftsmagazin Eco.nova, das seit 1996 monatlich erscheint, enthält ein jährliches Unternehmensranking der Tiroler Wirtschaft (Top 500).25 Die Struktur- bzw. statistischen Daten stammen überwiegend von der Statistik Austria, von der Volkswirtschaftlichen Abteilung der WK Tirol sowie der Tiroler Arbeiterkammer.26 Einen guten Über- und Rückblick liefern die von der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Tiroler WK zusammengestellten Langzeitreihen zur Wirtschaftsentwicklung des Landes Tirol, die aber mit 2016 enden und bislang nicht weitergeführt wurden.27 Nur einmal, 1994/95, sind Wirtschaftsleitbilder für alle Bezirke Tirols erschienen, die von der Tiroler WK bzw. dem Wirtschaftsforum Tirol vorgelegt wurden.28 Als weniger ertragreich für die Bearbeitung der Thematik in diesem Betrachtungszeitraum erwiesen sich die vorhandenen Überblickswerke zur Geschichte Tirols im 20. Jahrhundert, da diese entweder zu Beginn des zeitlichen Rahmens dieser Arbeit erschienen sind oder den Bereich Wirtschaft nur kurz und allgemein abhandeln.29 Spezialliteratur, insbesondere Abschlussarbeiten, liegen für diesen Zeitraum nur zu wenigen Themenbereichen vor.30
Erst jüngst konzedierte Ernst Langthaler in seinem Überblicksbeitrag zur Zeitgeschichte und Wirtschaftsgeschichte in Österreich dem Verhältnis der beiden zueinander, dass dieses „nicht offen zutage“ trete, sondern „sich erst bei genauerem Hinsehen“ erschließe. Nach anfänglichen Kooperationen hätte man aber „immer häufiger getrennte Wege“ bestritten, „begleitet von wechselseitiger Ignoranz“, auch wenn sich zuletzt „die Zeichen der (Wieder-)Annäherung“ mehren würden.31 Zeitgeschichtliche Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte konzentrierten sich in Österreich entweder auf begrenzte Phasen wie die Zeit des Nationalsozialismus oder die unmittelbare Nachkriegszeit sowie auf thematische Bereiche wie zuletzt die Bearbeitung der Arbeitsmigration in Österreich.32 Einzig die ab 1997 erscheinende Reihe „Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945“ enthält auch wirtschaftshistorische Kapitel.33 Durch das Zusammenrücken beider Disziplinen kann das Verhältnis von Struktur und Praxis gemeinsam beleuchtet werden. Wie Langthaler hervorhob, besteht hier die Herausforderung darin, „die Macht von Strukturen – materiellen wie ideellen – und die Macht von Akteur:innen – menschlichen wie nichtmenschlichen – als zwei Seiten derselben Medaille gegeneinander abzuwägen und dafür angemessene Erzählformen zu entwickeln“.34 Diese Thematik ist nicht neu. Bereits in den 1940er Jahren hatte Fernand Braudel sein Modell der drei Zeitschichten vorgestellt, das sehr lange Zeitabläufe („longue durée“) den sehr kurzfristigen Ereignissen („histoire événementielle“) gegenüberstellt, zwischen denen als mittlere Ebene das zugleich determinierte und kontingente Wechselspiel von Strukturen und Praktiken steht.35 Dieser mittleren Ebene, die landläufig auch als Strukturgeschichte bezeichnet wird, kommt in dieser Publikation daher eine große Bedeutung und Aufmerksamkeit zu. „Wer allein die Wirtschaft ins Visier nimmt, versteht auch die Wirtschaft nicht“, lautet ein Kredo der Herausgeber:innen der Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. Daher hat „Wirtschaftsgeschichte […] keine andere Wahl, als sich zu einer allgemeinen Strukturgeschichte auszuweiten“.36
Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes bzw. einer Region vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen äußeren Zwängen, die oft kaum beeinflussbar sind, und inneren Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Wie Patrick Halbeisen, Margit Müller und Béatrice Veyrassant in ihrer Arbeit zur Wirtschaftsgeschichte der Schweiz betonten, ist jede Volkswirtschaft Teil eines größeren Wirtschaftsraumes, in dem „gewisse Besonderheiten […] erfolgreich sein [können], bis sich die Verhältnisse in diesem Wirtschaftsraum ändern und Anpassungen notwendig werden“.37 Es macht daher wenig Sinn, eine Wirtschaftsgeschichte nur aus der Binnenperspektive des Landes bzw. der Region zu verfassen. Geschieht dies dennoch, so bleiben wichtige Interdependenzen ausgeblendet bzw. können Vorsprünge und Rückstände eines Wirtschaftsraumes nicht in den Blick genommen werden und damit auch nicht das Ausmaß, in welchem eine Region an übergreifenden Wirtschaftsräumen partizipieren konnte.38
Werner Plumpe betonte erst jüngst, dass spätestens seit den Arbeiten zur Industrialisierung von Sidney Pollard klar ist, „dass es regionale Faktoren sind, die ökonomischen Strukturwandel ermöglichen und maßgeblich beeinflussen“.39 Dieser Ansatz wurde auch von Martin Knoll und Katharina Scharf in ihrer Einführung zur Europäischen Regionalgeschichte aufgegriffen. Im Kapitel „Regionalgeschichte als Sozialund Wirtschaftsgeschichte“ halten sie fest, dass die „Wirtschaftsgeschichte […] schon deshalb eine hohe Affinität mit der Regionalgeschichte auf[weise], weil verschiedene ökonomische und wirtschaftsgeschichtliche Konzepte eigene (ökonomische) Definitionen von Regionalität bieten“. Konkret nennen sie ökonomische Clusterbildungen „wie die sogenannte Gewerberegion“, die sich durch eine „Verdichtung, Spezialisierung und Arbeitsteilung aus[zeichnet] und […] ihrerseits von einer Arbeitsteilung mit anderen, nicht oder weniger industrialisierten Regionen abhängt“.40 Für den Tiroler Raum muss hier auf „benachteiligte“ Gebiete in den Grenzregionen wie die Bezirke Imst, Landeck, Lienz oder Reutte verwiesen werden, die deshalb in ihrer Entwicklung und Förderung in diesem Band besondere Beachtung finden.
Tirol ist kein Binnenland, sondern, wie das vielstrapazierte „Herz der Alpen“ suggeriert, ein Land mitten in Europa.41 Dies bedingt nicht nur eine gewisse Grenznähe und ein Aushandeln von Interessen und auch Konflikten mit seinen Nachbarn, sondern auch die Einbettung und Einbindung in regions- und grenzüberschreitende Kooperationen und Institutionen. Die Stichworte hierfür sind, in zeitlicher Abfolge, dass „Accordino“ (ab 1949), die Arge Alp (ab 1972), die Alpenkonvention (1991), der Europäische Ausschuss der Regionen (ab 1992), die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (ab 1998), aber auch die EFTA (seit 1960) und seit 1995 die EU/EG mit ihren NUTS-Regionen, Strukturprogrammen und grenzüberschreitenden Projekten. Nicht alle davon können hier in gebührender Weise behandelt werden. Wenn sie im Band vorkommen, dann in ihrer Bedeutung im Zusammenhang mit der produzierenden Wirtschaft.
Vieles muss bei der Abfassung solch einer Überblickarbeit vorausgesetzt bzw. kann nur kurz angesprochen werden. Dies betrifft insbesondere den technologischen Wandel, der als der Treiber des Wachstums gilt. Werner Plumpe hat dieses Faktum in der Einleitung seiner umfassenden Geschichte des Kapitalismus auf den Punkt gebracht: „Kapitalintensität ermöglicht die Produktion von Gütern in großem Maßstab – dabei werden verfügbare Technologien genutzt und die Schaffung neuer Technologien angeregt. Sie bedingt im Regelfall eine Steigerung der Arbeitsproduktivität, wodurch die Massenproduktion preiswerter Güter überhaupt erst möglich wird. Diese lohnt sich freilich wiederum nur, wenn der Massenabsatz gewährleistet ist. […] [D]er Kern und die Bedingung der kapitalistischen Massenproduktion ist die Nachfrage der nichtvermögenden Menschen, deren Anzahl sich seit dem 17. Jahrhundert in Europa dank sukzessiver Fortschritte in der landwirtschaftlichen Güterversorgung fast explosionsartig vermehrte.“42
Daher wird in diesem Band auch die demographische Entwicklung Tirols kurz beleuchtet. Es wird unter anderem der Frage nachgegangen, woher die Arbeitskräfte und Konsument:innen kommen. Angesprochen werden auch Fragen rund um das Thema Energie: Welche Energie wird verwendet, wo wird diese produziert bzw. wie wird sie ins Land gebracht? Der Betrachtungszeitraum fällt ja in die Zeit des Ausbaus der Wasserkraft sowie des Aufstiegs fossiler Energiequellen. In den letzten Jahren wird aber auch in Tirol verstärkt über zukünftige Energiequellen nachgedacht (Biomasse, Sonnenenergie bzw. Wasserkraft). Ebenfalls angesprochen werden Fragen der Ressourcenaufbringung. Welche und wie viel davon werden benötigt? Welche müssen in einem rohstoffarmen Land importiert werden? Eine kapitalistische Wirtschaft, darauf hat Werner Plumpe verwiesen, „zeichnet sich also durch Dezentralität aus, durch eine Vielzahl mehr oder weniger autonomer Akteure, die über preisbildende (Arbeits-)Märkte miteinander verknüpft sind. Das Verhalten der Akteure orientiert sich zumindest grundsätzlich an Preissignalen.“43
Wie alle Überblickswerke leidet auch diese Publikation unter dem Problem der Darstellung. Die Buchform gebietet eine Gliederung in Kapiteln, eine sequenzielle Behandlung der Themen. Damit gehen unweigerlich Beziehungen verloren bzw. kommt es zu Wiederholungen. Will man den Wandel darstellen, darauf hat Werner Bätzing in seinem großen Überblickswerk der Alpen verwiesen, „dann ist es nicht sinnvoll, ihn gleich von Anfang an ganzheitlich oder ‚holistisch‘ darzustellen. Die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sind zwar eng miteinander vernetzt, aber sie besitzen jeweils ausgeprägte Eigendynamiken und Eigenlogiken, die wir erst kennen müssen, bevor wir die wechselseitigen Vernetzungen thematisieren können.“44 Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, in Bezug auf die Industrie in Tirol einige dieser Eigendynamiken und Eigenlogiken aufzuzeigen und anzusprechen. Zum Schluss bleibt es diesen, allen zu danken, die zur Entstehung dieser Publikation beigetragen haben. Den Fachkolleg:innen für ihre Diskussionsbereitschaft zu einzelnen Themen und Kapiteln, dem Studienverlag mit der Projektleiterin Frau Elisabeth Waldhart, MA, für die umsichtige Begleitung bei der Entstehung des Bandes und nicht zuletzt der IV Tirol, allen voran dem scheidenden Präsidenten Dr. Christoph Swarovski, dem neuen wie bisherigen Geschäftsführer DI (FH) Mag. Michael Mairhofer und Dr. Eugen Stark sowie dem alten wie neuen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit Dr. Wolfgang Paulmichl und Daniel Schreier, BA, für ihre Unterstützung und auch dafür, sich auf dieses Wagnis eingelassen zu haben. Wir widmen dieses Buch Helmut Alexander. Er hätte sicher gerne seine „Geschichte der Tiroler Industrie“ weitergeschrieben, höhere Umstände haben dies verhindert. Die nun hier vorliegende ist eine andere geworden, als er sie verfasst hätte, aber hoffentlich dennoch in seinem Sinne.
______________
1 Helmut Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung. Mit einem Beitrag von Claudia Wedekind zur Fabrikarchitektur in Tirol, Innsbruck 1992, hier S. 199.
2 Ingrid Krumschnabel, Der EU-Beitritt als Faktor einer politischen Klimaveränderung in Tirol?, politikwiss. Dipl.-Arb., Innsbruck 1997, hier S. 36–39. Siehe auch Christian Schaller, Die österreichische EG/EU-Diskussion in den Ländern, in: Albrecht Rothacher/Markus Zemanek/Wolfgang Hargasser (Hg.), Österreichs europäische Zukunft. Analysen und Perspektiven, Wien 1996, S. 183–234.
3 Krumschnabel, EU-Beitritt, S. 34.
4 Krumschnabel, EU-Beitritt, S. 35.
5 Krumschnabel, EU-Beitritt, S. 36.
6 Krumschnabel, EU-Beitritt, S. 36 sowie Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich (Hg.), Tirol in der EU, Wien 1995, S. 15–16.
7 Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie, S. 199 f.
8 Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie, S. 199. Vgl. zur „Old Industry“ Michael Steiner, Old Industrial Areas. A Theoretical Approach, in: Urban Studies 22 (1985), Nr. 5, S. 387–398 sowie pars pro toto Lutz Raphael, Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2018, Frankfurt am Main 2021.
9 Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie, S. 199 f. sowie Christian Smekal, Chancen und Herausforderungen der Tiroler Wirtschaft für die Zukunft, in: Adolf Leidlmair/Werner Plunger/Christian Smekal (Hg.), Die Tiroler Wirtschaft auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. 150 Jahre Wirtschaftskammer Tirol (Tiroler Wirtschaftsstudien 50), Innsbruck 2001, S. 151–177, hier S. 156.
10 Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie, S. 200.
11 Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie. Das Buch wurde sehr positiv aufgenommen. Vgl. die Besprechung von Günther Luxbacher, in: Blätter für Technikgeschichte 53/54 (1991/92), S. 292–294.
12 Martin Knoll/Katharina Scharf, Europäische Regionalgeschichte. Eine Einführung (utb 5642), Wien–Köln 2021, hier S. 64–71 sowie 83–93; Patrick Kupper, Umweltgeschichte (Einführung in die Geschichtswissenschaft. Neuere und Neueste Geschichte 3), Göttingen 2021.
13 Vgl. Walter M. Iber/Thomas Krautzer (Hg.), Wirtschaft und Region. Transformationsprozesse im internationalen Vergleich (Wissenschaft kompakt: Wirtschaft, Gesellschaft, Politik 3), Wien 2021 sowie Wolfgang Meixner, Prolegomena zu einer Wirtschafts- Sozial- und Umweltgeschichte des Bundeslandes Tirol im 20. Jahrhundert, in: Andrea Bonoldi/Hans Heiss/Stefan Lechner (Hg.), Regionen der Geschichte/Ragioni della storia. Festschrift für Helmut Alexander (Geschichte und Region/Storia e Regione 31. Sondernummer), Innsbruck-Wien 2022, S. 133–157.
14 Der von der Tiroler Industriellenvereinigung zu Beginn dieses Betrachtungszeitraums herausgegebene Überblick zu Tiroler Industriebetrieben wurde in dieser Weise nicht fortgeführt. Vgl. Norbert Ulf (Hg.), Tirol – Industriebetriebe stellen sich vor, Innsbruck 1986.
15 In dieser Hinsicht die Antwort des Tiroler Landesarchivs vom 3. November 2022, TLA-F-05/4910-2022, auf eine diesbezügliche Anfrage der Autoren betreffend Dokumente zur Tiroler Industrie im Tiroler Landesarchiv. Darin wird einerseits auf das Tiroler Archivgesetz 2017 (LGBl. 128/2017 idfF) verwiesen, das generell eine Schutzfrist von 30 Jahren nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung normiert sowie auf die Datenschutz-Grundverordnung, die Personen über die 30 Jahre hinaus eine Schutzfrist bis zum Tod zuerkennt, wenn diese kein Einverständnis zur Einsichtnahme zu Lebzeiten erteilen. Somit unterliegen alle Akten ab 1993 diesen Fristen und es ist eine Ausnahmegenehmigung zur Einsichtnahme bei der Tiroler Landesregierung einzuholen.
16 Siehe das Verzeichnis der gedruckten Literatur und der verwendeten Quellen am Ende des Bandes.
17 Die ersten beiden Jahre (1963 und 1964) sind nicht mehr auffindbar, ebenso fehlen die Jahrgänge 1966 bis 1968 sowie 1975. Die vorhandenen gedruckten Berichte von 1965 bis 2014 wurden im Zuge dieses Projektes durch Finanzierung der IV Tirol digitalisiert und sind online an der Universitätsund Landesbibliothek Tirol abrufbar unter https://diglib.uibk.ac.at/ulbdigital/topic/titles/8190979 (eingesehen am 31.8.2023).
18 Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für Tirol, Sektion Industrie, Die Tiroler Industrie im Jahre 1969 bis 1994. Jahresbericht, Innsbruck 1969 (1970) bis 1994 (1995); fortgesetzt als Leistungsbericht der Sparte Industrie, Innsbruck 1996 bis 2009; dann bis 2013 wieder unter dem Titel Jahresbericht.
19 Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), Erster Raumordnungsbericht (ÖROK Schriftenreihe 8), Wien 1975 und folgende. Mit dem 15. Raumordnungsbericht, der die Periode 2015 bis 2017 abdeckt, wurde die detaillierte Vorstellung der Aktivitäten in Bezug auf die Raumordnung in den einzelnen Bundesländern aufgegeben. Vgl. ÖROK, 15. Raumordnungsbericht (ÖROK Schriftenreihe 204), Wien 2018.
20 Verbindungsstelle der Bundesländer, Erster Österreichischer Raumordnungsbericht. Länderbeitrag, Beilage zu GZ VST-73/84-1974, o. Ort November 1974, hier S. 12.
21 Amt der Tiroler Landesregierung (ATLR), Tirol in der Europäischen Union. Erfahrungen und Perspektiven. Vorlage an den Tiroler Landtag gemäß Entschließung des Tiroler Landtages vom 13. Oktober 1994, Innsbruck 1995/96 bis 2010/11. Das Erscheinen dieser Publikation beruht auf einer Entschließung des Tiroler Landtags vom 13. Oktober 1994.
22 ATLR, Bericht über die Lage der Wirtschaft Tirols. Entsprechend der Entschließung des Tiroler Landtages vom 5. Juli und 7. Oktober 1977, Innsbruck 1977 bis 1988; ATLR, Bericht über die Lage der Wirtschaft Tirols 1988 bis Anfang 1989 und Bericht zur Lage der Fremdenverkehrswirtschaft in Tirol im Jahre 1988. Entsprechend der Entschließung des Tiroler Landtages vom 5. Juli und 7. Oktober 1977, Innsbruck 1989; ATLR, Tiroler Wirtschaftsbericht. Vorlage an den Tiroler Landtag gemäß Entschließung des Tiroler Landtages vom 16. Oktober 1989 und vom 4. Juli 2001, Innsbruck 1990 bis 2004 passim sowie ATLR, Tiroler Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht. Vorlage an den Tiroler Landtag gemäß Entschließungen vom 4. Juli 2001, Innsbruck 2005 passim. Das Zustandekommen dieses Berichtes geht auf einen Antrag des ÖVP-Abgeordneten und späteren Geschäftsführers der IV Tirol (1965 bis 2000) Dietmar Bachmann zurück, den dieser 1977 im Tiroler Landtag gestellt hatte. Vgl. TOP 14: Bericht und Antrag des Wirtschaftsausschusses, des Land- und Forstwirtschaftsausschusses und des Sozialausschusses zum Antrag der Abgeordneten Bachmann und Genossen betreffend einen jährlichen Bericht über die Lage der Wirtschaft in Tirol. Stenographische Berichte des Tiroler Landtages, VIII. Periode, 15. Tagung, 2. Sitzung am 5. Juli 1977, S. 45.
23 Echo. Tirols erste Nachrichtenillustrierte 1.1998/99 bis 17.2014, damit Erscheinen eingestellt, sowie Echo Wirtschaft. Jahrbuch der Tiroler Wirtschaft mit Top 500 – Die erfolgreichsten Tiroler Unternehmen 2006 bis 2012 und Echo. Top 500 Tirol ab 2013 passim.
24 Trend. Das Wirtschaftsmagazin 1970 bis 2020, abgelöst seit 2021 durch Trend Premium. For leaders in business sowie ab 1981 passim als Beilage Goldener Trend, von 1992 bis 1995 Trend Spezial.
25 Eco.nova. Wirtschaftsmagazin 1996 passim.
26 Statistik Austria. Online unter https://www.statistik.at; WKO, Tirol. Zahlen, Daten, Fakten. Online unter https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/start.html (eingesehen am 18.2.2024); Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol, Der Tiroler Arbeitsmarkt. Eine Gesamtschau des Jahres 2014 bis 2019, Innsbruck 2014 bis 2019, damit Erscheinen eingestellt.
27 WK Tirol/Abteilung Wirtschaftspolitik und Strategie, Tiroler Wirtschaft im Rückblick. Daten und Langzeitreihen zur Wirtschaftsentwicklung des Landes, Innsbruck 2016.
28 WK Tirol/Wirtschaftsforum Tirol (Hg.), Anliegen der Wirtschaft an alle aktiven Kräfte für die regionale Entwicklung des Bezirkes … (Wirtschaftsleitbild für den Bezirk …), Innsbruck 1994/95. Eigene Wege war die Landeshauptstadt gegangen. Vgl. Richard Hammer/Christian Smekal, Wirtschaftsleitbild für die Stadt Innsbruck. Studie im Auftrag der Stadt Innsbruck. Amt für Wirtschaftsförderungen und Tourismus, Innsbruck 1992/1993.
29 Josef Riedmann, Geschichte des Landes Tirol. Band 4/2: Das Bundesland Tirol. Die Zeit von 1918 bis 1970, Innsbruck-Wien 1988; Michael Gehler (Hg.), Tirol „Land im Gebirge“: Zwischen Tradition und Moderne (Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945 3), Wien-Köln-Weimar 1999; Josef Riedmann, Geschichte Tirols, Wien ³2001; Michael Gehler, Tirol im 20. Jahrhundert. Vom Kronland zur Europaregion, Innsbruck-Wien ²2009; Michael Forscher, Kleine Geschichte Tirols, Innsbruck-Wien 2012; Michael Forcher, Tirols Geschichte in Wort und Bild, Innsbruck-Wien 122020.
30 Diese findet sich, auch wenn sie zur Texterstellung nicht immer herangezogen wurde, im Verzeichnis der gedruckten Literatur und der verwendeten Quellen am Ende des Bandes.
31 Ernst Langthaler, Zeitgeschichte und Wirtschaftsgeschichte, in: Marcus Gräser/Dirk Rupnow (Hg.), Österreichische Zeitgeschichte – Zeitgeschichte in Österreich. Eine Standortbestimmung in Zeiten des Umbruchs, Wien-Köln 2021, S. 599–617, hier S. 599–600.
32 Für Tirol vgl. Horst Schreiber, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nazizeit in Tirol (Geschichte & Ökonomie 3), Innsbruck-Wien-Bozen 1994; Karl C. Berger/Wolfgang Meighörner/Anna Horner (Hg.), Hier Zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol. Ausstellungskatalog Tiroler Volkskunstmuseum 2. Juni bis 3. Dezember 2017, Innsbruck 2017.
33 Für Tirol Josef Nussbaumer, Wirtschaftlicher und sozialer Wandel in Tirol 1945–1996, in: Gehler (Hg.), Tirol, S. 139–220.
34 Langthaler, Zeitgeschichte und Wirtschaftsgeschichte, hier S. 615.
35 Fernand Braudel, Histoire et Sciences Sociales. La Longue Durée, in: Annales 13 (1958), S. 725–753; dt. Fernand Braudel, Geschichte und Sozialwissenschaften – Die „longue durée“, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Geschichte und Soziologie, Königstein/Ts. ²1984, S. 189–215. Erstmals entwickelte Braudel dieses Modell im Vorwort zur ersten Auflage seiner monumentalen Abhandlung über das Mittelmeer zur Zeit Philipps II. Vgl. Fernand Braudel, Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Erster Band, Frankfurt am Main 1998 (französische Erstauflage 1949), S. 15–23, hier S. 20.
36 Patrick Halbeisen/Margit Müller/Béatrice Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Basel 2012, hier S. 16.
37 Halbeisen/Müller/Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, S. 29.
38 Halbeisen/Müller/Veyrassat (Hg.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, S. 18 u. 29.
39 Werner Plumpe, Das kalte Herz. Kapitalismus: Die Geschichte einer andauernden Revolution, Berlin 2019, hier S. 28. Plumpe bezieht sich hier auf Sidney Pollard, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe, 1760–1970, Oxford 1981.
40 Knoll/Scharf, Europäische Regionalgeschichte, das Kapitel zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 64–71, hier S. 64.
41 Die Tirol Werbung hat seit 1996 das von Arthur Zelger entwickelte Tirol Logo weiterentwickelt und verwendet den Claim „Herz der Alpen“. Schon 1989 ist die Bildgeschichte des Tourismus in Tirol von Michael Forcher mit dem Titel „Zu Gast im Herzen der Alpen“ erschienen. Bereits 1841 wird die Wendung in der Allgemeinen Literatur-Zeitung in einer Besprechung einer Untersuchung über die Gletscher in den Alpen verwendet. Vgl. Entwicklung der Marke Tirol. Online unter https://www.lebensraum.tirol/marke/geschichte/ (eingesehen am 19.2.2024); Katrin Androschin, Von der Tourismusreklame zur Standortmarke. Die Marke Tirol, in: Anita Kern/Kurt Höretzeder (Hg.), Ikonen und Eintagsfliegen. Arthur Zelger und das Grafikdesign in Tirol. Buch zur WEI SRAUM-Ausstellung im aut. architektur und tirol (Edition WEI SRAUM No1), Innsbruck-Wien 2014, S. 229–247, hier S. 233–246; Michael Forcher, Zu Gast im Herzen der Alpen. Eine Bildgeschichte des Tourismus in Tirol. Dreisprachig, Innsbruck 1989; L. F. Kämtz, Solothurn, b. Jent u. Gassmann: Untersuchungen über die Gletscher von Louis Agassiz u.s.w., in: Allgemeine Literatur-Zeitung 225 (December 1841), S. 579–584, hier S. 581.
42 Plumpe, Das kalte Herz, S. 20.
43 Plumpe, Das kalte Herz, S. 35.
44 Werner Bätzing, Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft, München 42015, hier S. 248.
Standortfaktoren
Die Industrie entwickelte sich anfangs in den Städten oder in deren unmittelbarem Umland, weil dort jene Standortfaktoren vorhanden waren, die für eine industrielle Massenproduktion unabdingbar waren. Auf kleinem Raum waren genügend Arbeitskräfte verfügbar, die Verkehrslage war gut und die Absatzmärkte in der Nähe.45 Diese Voraussetzungen waren in Tirol nicht gegeben. Die kleinen Tiroler Residenz-, Handels- und Gewerbezentren wurden keine Industriestädte, auch wenn sich im 19. Jahrhundert in einigen Stadtzentren Industriebetriebe ansiedelten. So betrieb etwa das Vorarlberger Unternehmen Herrburger & Rhomberg in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum von Innsbruck eine Textilfabrik. Heute befindet sich auf diesem Gelände das Einkaufszentrum Sillpark. Tirol lieferte aber einen anderen bedeutenden Standortfaktor, nämlich Wasserkraft und damit Energie. Es siedelten sich daher energieintensive Industrien in Tirol an, wie die Papierindustrie oder die Glasindustrie. Ein weiterer Vorteil des Tiroler Standorts waren die vergleichsweise billigen Arbeitskräfte des ländlichen Raumes. Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahnanschlüsse nach Westen, Osten und Süden fertiggestellt waren und die auf Wasserkraft basierende Erzeugung von elektrischer Energie sich durchzusetzen begann, nahm die Attraktivität von Tirol als Industriestandort gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu. Erst dann gab es namhafte Betriebsansiedlungen, die Industrialisierung des Landes nahm an Fahrt auf.
Die genannten Standortfaktoren waren zu Beginn der Industrialisierung noch als Grundvoraussetzungen anzusehen und sind auch noch immer mitentscheidend für Betriebsansiedlungen. Ihre Bedeutung ließ gegen Ende des 20. Jahrhunderts aber nach. Institutionelle, infrastrukturelle und qualitative Rahmenbedingungen spielten eine immer größere Rolle bei der Standortwahl. So waren etwa weniger die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte und deren Kosten ausschlaggebend, sondern die Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur einer Region. Auch die politische Stabilität, eine unbürokratische, nicht korrupte Verwaltung, die Lebensqualität, Umweltschutz und Raumplanung zählen heute zu den Standortfaktoren.46 Tirol weist diese Qualitäten neben einer guten Verkehrs-, Kommunikations- und Energieinfrastruktur auf und gehört damit zu den Regionen mit hoher Standortattraktivität.47
Dieser grobe Überblick und der für Tirol günstige Befund darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei genauerer Nachschau unter der Oberfläche zahlreiche Themen brodelten, die von den industriellen Interessensvertretungen immer wieder als belastend für den Standort ins Spiel gebracht wurden. Ein zentrales Thema war stets das Verhältnis der Industrie zum Staatswesen, insbesondere in Bezug auf Steuern und Bürokratie. In blumiger Sprache wurde schon 1970 über die österreichische Bürokratie geätzt: „Die Stolperdrähte einer talentierten austrobyzantinischen Bürokratie müssen ersetzt werden […].“48 „Dienstleistung statt Bürokratie!“49 forderte die IV Tirol 1973, ein „gezielter Abbau der Bürokratie“ sei notwendig.50 1988 legte sie nach und meinte, ein „Übermaß an Vorschriften, Auflagen und Bürokratie ist nicht nur unwirtschaftlich“, sondern verhindere auch Neues.51 Wenn die Forderungen der Interessensvertreter der Industrie ungehört blieben, mutmaßte die IV Tirol, sie „verhallten im lärmdämpfenden Gestrüpp einer strukturkonservierenden Bürokratie“.52





























