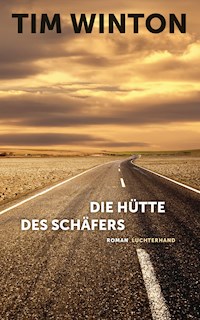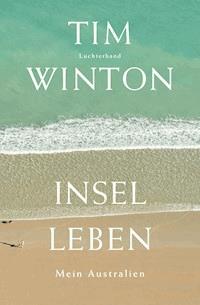
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Bei Tim Winton ist die Natur Australiens allgegenwärtig, und hier erzählt er, wie diese enge Beziehung entstanden ist, wie sehr sie seine Gedanken, sein Schreiben und sein Leben prägt. Sein beeindruckendes, poetisches und intensives Buch ist auch ein Plädoyer für Achtsamkeit, für einen neuen Dialog mit der Natur. Er ist auf Berge geklettert, hat in der Wüste gecampt, am Ningaloo Reef getaucht, ist auf den Wellen rund um seine Insel gesurft, und er hat dabei den Rhythmus, die Gefahren, das eigenständige Wesen der Natur erfahren. Denn trotz aller Konflikte zwischen Wildnis und menschlicher Zivilisation, trotz Umweltzerstörung und Klimawandel: Die Natur ist auch ohne den Menschen da. Tim Winton erzählt davon, wie gut es tun kann, sich bewusst zu machen, dass es immer etwas geben wird, das älter, größer, reicher und komplexer ist als wir, die Menschen; und er berichtet von der Gedankenwelt und dem Erfahrungsschatz der Aborigines, ihrem ganz eigenen Verhältnis zur natürlichen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Zum Buch
Bei Tim Winton ist die Natur Australiens allgegenwärtig, und in seinen Erinnerungen erzählt er, wie diese enge Beziehung zur australischen Landschaft entstanden ist, wie sehr sie seine Gedanken, sein Schreiben und sein Leben prägt. Sein beeindruckendes, poetisches und intensives Buch ist auch ein Plädoyer für Achtsamkeit, für einen neuen Dialog mit der Natur.
Er ist auf Berge geklettert, hat in der Wüste gecampt, am Ningaloo Reef getaucht, ist auf den Wellen rund um seine Insel gesurft, allein, mit Freunden, mit der Familie. Und er hat dabei Schönheit und Schrecken seines Landes erlebt, hat den Rhythmus, die Gefahren, das eigenständige Wesen der Natur erfahren. Denn, trotz aller Konflikte zwischen der Wildnis und der menschlichen Zivilisation, trotz aller bereits manifesten Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel: Die Natur ist auch ohne den Menschen da. Tim Winton erzählt davon, wie gut es tun kann, sich bewusst zu machen, dass es immer etwas geben wird, das älter, größer, reicher und komplexer ist als wir, die Menschen. Die Gedankenwelt und der Erfahrungsschatz der Aborigines spielen in seinen Beobachtungen eine große Rolle, denn ihr ganz eigenes Verhältnis zur natürlichen Welt könnte uns allen, nicht nur in Australien, Mahnung wie Geschenk sein.
Zum Autor
TIM WINTON wurde 1960 in der Nähe von Perth, Westaustralien, geboren und lebt auch heute mit seiner Familie dort. Er hat zahlreiche Romane, Sach- und Kinderbücher sowie ein Theaterstück veröffentlicht und ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Australiens. Zweimal kam er auf die Shortlist des Man Booker Prize, und viermal erhielt er den Miles Franklin Award, den wichtigsten Literaturpreis Australiens. Seine Werke sind in zwölf Sprachen übersetzt, fast alles wurde für Bühne, Radio oder Film adaptiert. Für »Inselleben« wurde er mit dem General Non-fiction Book of the Year Award 2016 ausgezeichnet.
Zum Übersetzer
KLAUS BERR, geb. 1957 in Schongau, Studium der Germanistik und Anglistik in München und Wales, ist der Übersetzer von u. a. Charles Chadwick, Michael Crichton, Lawrence Ferlinghetti, Noah Gordon und Will Self.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Island Home. A Landscape Memoir bei Hamish Hamilton, einem Inprint von Penguin Books Pty Ltd, Penguin Random House Australia, Melbourne/Sydney.
Copyright © der Originalausgabe 2015 Tim Winton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 Luchterhand Literaturverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Illustrationen 2015 Mali Moir
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Covermotiv: © Gerson/Getty Images
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-20738-0 V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Bitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
facebook.com/luchterhandverlag
Tim Winton
INSELLEBEN
Mein Australien
Aus dem australischen Englischvon Klaus Berr
Luchterhand
Für Hannah Rachel Bell
Geh heim, die Sonne versinkt; Schwimmer, geh heim
Judith Wright, »The Surfer«
Meine Inselheimat wartet auf mich
Neil Murray, »My Island Home«
I
County Offaly, 1988
Unter einem schwarzen Himmel, der uns bis zu den Ohren hängt, klettern mein Sohn und ich im eisigen, böigen Wind über den Zauntritt. Hagel prasselt schräg auf uns herab. Weder die Hecke noch die angrenzende Bruchsteinmauer bieten viel Schutz, deshalb stapfen wir rasch die lange, unebene Wiese hinauf zum Cottage und dem wartenden Feuer. Eben noch waren die schwarzen Schieferplatten und der weiße Kamin vor der Hügelkuppe deutlich sichtbar; jetzt ist alles außer der Grasnarbe vor unseren Füßen verdeckt von dem Gestöber, das den Hang herunterfegt. Ich hatte erwartet, dass sich mein Junge von den Eisnadeln und dem unvermittelt wüsten Nachmittag einschüchtern lässt, aber er wirkt wie verzaubert. Er ist fast vier Jahre alt. Der kurze, trübe Tag bringt endlich ein bisschen Aufregung. Seinen Knotenstock schwingend wie ein marodierender Freibeuter, patscht er in seinen orangen Gummistiefeln den Hügel hoch, und gemeinsam scheuchen wir unabsichtlich einen großen Hasen auf. Das Tier hatte sich ins klumpige Gras geduckt, und im ersten Augenblick kann es uns nur schreckenssteif anstarren. Dann rennt es davon. Es jagt den Abhang hinauf, von einem Grasbüschel zum nächsten. Wir schauen uns kurz an, der Junge und ich, dann rennen wir ihm mit Piratengeschrei hinterher.
Später am Feuer stellt er seine heiße Schokolade ab und schaut zu den Schnappschüssen von Zuhause, die wir an die Wand geheftet haben. All die sonnengegerbten Gesichter, Freunde und Familie. Hässliche Fischerhüte und nackte Oberkörper. Hunde in Pick-ups. Der endlose, leere Raum hinter den Leuten, der hohe Himmel und der offene Horizont. Lange verweilt er bei den verträumten, weißen Stränden und den gesprenkelten Kalksteinriffen bei Ebbe, Dünen wie gemeißelt im Sonnenuntergang.
»Ist das echt?«, fragt er, die Wangen rosig, die Haare zerzaust vom Handtuch.
»Natürlich«, antworte ich überrascht. »Erinnerst du dich nicht mehr? Schau. Da ist Granma. Und dort ist Shaz.«
Aber er streicht mit dem Finger über den Himmel und das Meer hinter unseren Lieben, als wäre die Wirklichkeit, die er einmal kannte, so fern, so anders als hier, wo wir jetzt sind, dass sie unglaubwürdig erscheint.
»Das ist unser Zuhause«, sage ich. »Weißt du noch? Das ist Australien.«
Es ist erst ein Jahr her, aber das ist ein großer Teil seines noch kurzen Lebens, und schon hat unser Zuhause phantastische Züge angenommen. Davor waren wir in Paris, was großartig war, auch wenn es nur aus harten Oberflächen und klar getrennten Räumen bestand. Es gab wunderliche Tunnel, Pflastersteine und geschwungene Wände, winzige Autos und rasende U-Bahnen, aber so viele offene Flächen waren verbarrikadiert und eingezäunt, und für ihn war es schwer, andere Kinder kennenzulernen. Die bürgerlichen Kinder in der Nachbarschaft wurden in Wagen geschnallt und von Au-pair-Mädchen geschoben oder zu Fuß in Horden von blaffenden Lehrern vorangescheucht. An den Wochenenden wurden die Sprösslinge in Cafés vorgeführt und zur Schau gestellt wie Mode-Accessoires, als Nachweis des guten Geschmacks und der ausgezeichneten gallischen Gene ihrer Eltern. Im Haus mochten diese Kinder urbane Oberschicht sein, draußen aber sahen sie aus wie Vasallen. In Paris war es illegal, auf dem Rasen zu spielen. Die einzigen ungeplanten sozialen Begegnungen fanden in der Schlange vor dem Karussell auf dem Marktplatz des Viertels statt oder im begrenzten Raum eines weiß bekiesten Spielplatzes, der eingepfercht war wie ein Viehhof. Kinder, die sich nicht kannten, beäugten einander aus der Entfernung.
In vielerlei Hinsicht war Paris eine angenehme Stadt. Wohin man schaute, war Schönheit. Wir hatten zuvor noch nie in einer Wohnung gelebt, und dass wir uns mit den Geräuschen und Gerüchen anderer so dicht über und neben uns herumschlagen mussten, war merkwürdig und aufregend. Doch als der Winter einsetzte und die Brunnen zu kandierten Kaskaden gefroren und wir gezwungen waren, drinnen zu bleiben, staute sich in unserem kleinen Jungen etwas an, das wir nicht ignorieren konnten. Ich spürte sie in mir selbst, diese nagende Erregung, verstand sie aber erst Monate später, als wir in einem irischen Hagelsturm wie zwei Verrückte einen Hügel hinaufrannten. Eine Weile hatte ich angenommen, unser aller wachsende Gereiztheit sei das Resultat kultureller Erschöpfung – die permanente Verwunderung über örtliche Sitten und Gebräuche –, die wahren Ursachen jedoch waren körperliche Einschränkung und das Fehlen von Wildheit.
Während der große Sturm über uns tobte, kam meine Frau ins Zimmer und setzte sich ans Feuer. Sie strich unserem Sohn durch die Haare und schaute mich fragend an. Es war, als hätte sie den Stimmungsumschwung sofort bemerkt.
»Wenn wir nach Hause kommen«, verkündete der Junge, »besorgen wir uns einen Hund. In einem Pick-up.«
Als er dann später oben in seinem Dachzimmer schlief, redeten wir noch lange darüber. Wir wussten, wonach er sich eigentlich sehnte, war nicht wirklich ein Haustier oder das Auto, in dem es sitzen konnte, sondern wofür beides stand – sein australisches Leben. Und die wilden, leeren Räume, die es ermöglichten.
Die Insel gesehen und gefühlt
Ich wuchs auf der größten Insel der Welt auf. Diese nackte Tatsache schwindet einem so leicht aus dem Bewusstsein, dass ich gezwungen bin, mich hin und wieder daran zu erinnern. Doch in einer Zeit, in der sich Kulturen vorwiegend durch Politik und Ideologie definieren, sollte es nicht sehr überraschend sein, dass ich etwas so Grundlegendes vergesse. Unsere Gedanken sind oft woanders. Die materiellen Tatsachen des Lebens, die organischen und konkreten Kräfte, die uns formen, werden oft übersehen, als wären sie unwichtig oder sogar leicht peinlich. Unsere kreatürliche Existenz wird in zunehmend abstrakten Begriffen registriert, vermessen, diskutiert und dargestellt. Vielleicht lässt sich dadurch erklären, warum jemand wie ich, der es eigentlich besser wissen sollte, vergessen kann, dass er Insulaner ist. Der Ort Australien wird dauernd überschattet von der Idee Australien, der wirtschaftlichen Unternehmung Australien. Die Macht dieser Konzepte lässt sich nicht leugnen. Ich wurde von ihnen geformt. Aber das sind nicht die einzigen Kräfte, die auf mich einwirken. Mir wird immer stärker bewusst, in welchem Maß Geographie, Entfernung und Wetter mein Sensorium, meine Phantasie und meine Erwartungen geprägt haben. Der Inselkontinent war nicht nur bloßer Hintergrund. Die Landschaft hat eine Kraft auf mich ausgeübt, die ebenso geologisch ist wie Familie. Wie viele Australier spüre ich dieses tektonische Mahlen – nennen wir es einen familialen Schmerz – am stärksten, wenn ich im Ausland bin.
Als ich in den 1980ern in Europa lebte, machte ich den Fehler, anzunehmen, dass das, was mich von den Bürgern der Alten Welt trennte, lediglich Sprache und Geschichte waren, als wäre ich im Grunde nur ein nicht ganz konformer europäischer Ableger meiner formalen Ausbildung. Aber ich hatte meine eigene Geographie nicht genügend berücksichtigt. Und natürlich auch diejenigen nicht, die mich unterrichteten. Es ging nicht einfach nur darum, was ich gelesen hatte und was nicht – meine körperliche Reaktion auf neue Orte beunruhigte mich. Es war, als rebellierte mein Körper. Außerhalb der großen Städte und charmanten Dörfer der Alten Welt fühlte ich mich, als wäre meine ganze Verdrahtung durcheinandergeraten. Wo ich erwartet hätte, die Denkmale zu bestaunen und die natürliche Umgebung zu genießen, passierte in Wirklichkeit das genaue Gegenteil. Die ungeheure Schönheit vieler Gebäude und Straßenzüge hatte eine unmittelbare und tiefgehende Wirkung, doch in der Natur, in der ich mich im Allgemeinen am wohlsten fühle, war ich zögerlich. Ich war zwar wirklich beeindruckt von dem, was ich sah, fand aber keinen körperlichen und emotionalen Zugang dazu. Da ich aus einem flachen, trockenen Kontinent komme, freute ich mich auf hoch aufragende Berge und tosende Flüsse, saftige Täler und fruchtbare Ebenen, und als ich sie dann tatsächlich vor mir hatte, war ich verwirrt, weil ich so gedämpft darauf reagierte. Meine großenteils eurozentrische Ausbildung hatte mich ein Gefühl des Wiedererkennens erwarten lassen, das ich aber so nicht empfand, und das war verstörend. Die Gemälde und Gedichte über all diese Orte berührten mich noch immer, deshalb konnte ich die seltsame Ungeduld nicht verstehen, die mich überkam, wenn ich sie real in Zeit und Raum sah. Waren diese Landschaften und Panoramen nicht wunderschön? Na ja, natürlich waren sie das, doch mir schien schon ein kleiner Ausschnitt davon für lange Zeit zu reichen. Für jemanden aus einer kargen Landschaft wirkten sie oft zu putzig; sie waren hübsch, sogar süßlich. Mich beschlich das nagende Gefühl, dass ich das alles »nicht kapierte«.
Zuerst einmal hatte ich Probleme mit den Größenverhältnissen. In Europa wirkten die Dimensionen des Raums komprimiert. Die drohend aufragende, vertikale Präsenz der Berge schnitt mich vom Horizont ab. Diese Art räumlicher Beschränkung hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Sogar eine Stadt aus Wolkenkratzern ist durchlässiger als eine schneebedeckte Bergkette. Gebirge bilden eine feste Barriere, ein Hindernis, in erster Linie visuell und physisch, aber auch konzeptuell. Alpine Felsflanken und Steilhänge ragen nicht nur in die Höhe, sie hängen über, lassen ihre Masse vorspringen, und ihre Solidität gibt nicht nach. Auf einen Westaustralier wie mich, dessen Standardeinstellung diametral entgegengesetzt ist und der leeren Raum als prägende Kraft erfahren hat, wirkt das klaustrophobisch. Ich glaube, ich war beständig und instinktiv auf der Suche nach Entfernungen, die nicht zur Verfügung standen, ich maß den Raum, und es war immer zu wenig.
Das Zweite und Bedeutendere, was mich beunruhigte, war die Tatsache, dass jede Landschaft die unausweichlichen Spuren von Kultur und Technik zeigte. Natürlich gibt es auch in den entlegensten Gegenden Australiens Hinweise auf menschliche Aktivität – uralte Buschfeuer haben Lebensräume geformt, und an Orten, die auf den ersten Blick für immer und ewig unbewohnt erscheinen, gibt es Malereien und Petroglyphen –, aber viele Anpassungen, Verbesserungen und Verschönerungen durch Aborigines sind so diskret, dass sie als Menschenwerk kaum wahrgenommen werden; für das ungeübte Auge sind sie tatsächlich unsichtbar. In Europa jedoch sind die dramatischsten und scheinbar einsamsten Landschaften unverkennbar modifiziert. An jedem Gebirgspass und nach jeder Kurve scheint es einen Tunnel, eine Seilbahn, einen mondänen Urlaubsort oder einen Schilderwald zu geben.
Ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass sich mein steigendes Unbehagen schlicht dem Mangel an Ruhe vor meinesgleichen verdankte. Ich hatte noch nie Orte gesehen, die so erbarmungslos denaturiert waren. Über der Schneegrenze gab es immer einen kreisenden Hubschrauber und noch höher das Maßwerk aus Kondensstreifen von Jets, die auf die Tausende verwiesen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit durch den Himmel reisten. Unten in den Tälern und entlang der unglaublich fruchtbaren Ebenen war die Natur nur sichtbar durch die schmückende Hand der Menschen, die sie sich gefügig gemacht hatten. Ob ich in Frankreich war, in Irland, Holland oder dem raueren Griechenland, ich hatte immer den Eindruck, dass jedes Feld, jede Hecke und jede Quelle benannt, zugeteilt und registriert war. Es war ein Bild fast lückenloser Beschränkung und Zähmung. Diese wenigen, nicht komplett bewohnten oder ausgebeuteten Flächen waren unmissverständlich verändert. Wo früher riesige Waldflächen gewesen waren, gab es jetzt nur noch Wäldchen. Naturschutzgebiete waren eher durchgestaltete Parks als ursprüngliche, sich selbst erhaltende Ökosysteme. Sogar der nördliche Himmel wirkte kolonisiert, seine geronnene Atmosphäre eine beständige und deprimierende Mahnung an die menschliche Vorherrschaft. Als Junge war der Himmel für mich eine klare und wachende Linse gewesen, doch in meinen dunkelsten, heimwehkranken Momenten in Europa sah dieses Auge krank und verschleiert aus.
An klaren Tagen war das Licht schieferblau, hübsch auf malerische Art und herzerfrischend nach so langen Perioden der Düsternis, aber ihm fehlte die weißglühende Ladung, nach der mein Körper und mein Geist sich sehnten. Ich war anders geeicht als ein Europäer.
Als ich in einem schäbigen Kino an der rue du Temple mit meinem Sohn Disneys Peter Pan anschaute, wurde mir klar, dass ich, obwohl wir alle in der flackernden Dunkelheit dieselbe Leinwand anstarrten, einen anderen Film sah als der Rest des Publikums. Was auf Pariser Kinder phantastisch und exotisch wirkte, war für mich wie zu Hause. Ich kannte geheime Buchten und Verstecke wie die der Verlorenen Jungs. Ich war in einer Welt von Booten, felsigen Inseln und verhüllendem Buschwerk aufgewachsen. Der einzige Schauplatz, der mir fremd – ja sogar skurril – vorkam, war das kalte, einsame Kinderzimmer auf dem Dachboden der Familie Darling. Das wilde, freie Leben von Nimmerland ohne die Überwachung durch Erwachsene war mir tief und wärmstens vertraut. Während ich den Film zum x-ten Mal und doch neu sah, die Handlung ignorierte und mich gierig auf die Kulisse konzentrierte, begriff ich, was für ein vollkommen Fremder ich in dieser Hemisphäre war. Aber das Eingeständnis meiner Fremdheit half mir, diese Jahre im Ausland leichter zu verdauen und zu genießen.
Als ich 1960 geboren wurde, gab es auf dem Inselkontinent ungefähr einen Quadratkilometer für jede Person. Fünfundfünfzig Jahre später hat die Bevölkerung sich verdoppelt, aber die Dichte ist noch immer außergewöhnlich niedrig. Trotz einer Siedlungsgeschichte von sechzigtausend Jahren bleibt Australien ein Ort mit mehr Land als Leuten, mehr Geographie als Architektur. Aber Australien ist nicht leer und ist es auch nie gewesen. Seit die Menschen zum ersten Mal Afrika verließen und sich auf den Weg machten hinunter zu dieser alten Landmasse Gondwana, die damals noch nicht so weit weg war von Asien und dem Rest der Welt, wurde es erkundet und bevölkert, verändert und mythologisiert, bewandert und besungen. Die Menschen sangen und tanzten und malten hier schon Aberzehntausende von Jahren, bevor Toga und Sandale die Bühne betraten. Das ist wahres Altertum. Nur wenige Landschaften sind so innig bekannt. Und noch weniger so dünn besiedelt.
Die Menschen lernten hier, anders zu leben, weil die Umstände einzigartig waren. Anstelle von vier Jahreszeiten gab es fünf, manchmal sechs. Wasser war rar. Das Erdreich war dünn und unfruchtbar, und die Pflanzen und Tiere waren wie nirgends sonst auf dieser Welt. Hier zu leben war etwas ganz Spezielles. Australien ist überzogen mit uralten Geschichten und menschlichen Erfahrungen, und doch gab es immer viel Platz zwischen diesen Gespinstfäden der Kultur. Sie sind stark und einheitlich straff, so dass sie kaum zu unterscheiden sind, vor allem von jenen, die nach Spuren von Gebäuden oder Hinweisen auf ständige Besiedelung suchen.
Diejenigen, die zu den Aborigines-Völkern dieses Kontinents wurden, waren fast immer gezwungen, nomadisch zu leben. Ihre Besiedelung vieler Regionen war saisonal, manchmal sogar nur imaginär. Entferntes, aber hochgeschätztes Land wurde gehalten mit Strängen des Gesangs und Geflechten der Rituale, so dass sogar Land, das körperlich nicht besiedelt wurde, nie leer war. Orte waren intim bekannt und kulturell vital, doch die Kultur manifestierte sich selten im Konkreten. Artefakte und Konstruktionen waren vergänglich, und Symbole mussten saisonal erneuert werden. So wie ein Kind »empfangen« wurde, indem es als Spiegelbild in einem Wasserloch auftauchte, bevor eine Frau schwanger wurde, entstammte die Kultur dem Land und fügte sich ihm auch.
Zwei Jahrhunderte, nachdem diese Lebensweise für immer unterbrochen wurde, ist Australien noch immer ein Ort mit mehr Landschaft als Kultur. Unsere Insel widersteht dem Grad der Einengung und der permanenten materiellen Präsenz, der auf den meisten anderen Kontinenten vorherrscht. Und wird es wahrscheinlich immer tun.
Ich will damit nicht sagen, dass Australien keine Kultur hat oder sein kulturelles Leben unbedeutend ist. Aber die meisten asiatischen und europäischen Länder können mit menschlichen Begriffen definiert werden. Spricht man von Indien, China, Italien, Frankreich oder Deutschland, kommen einem sehr schnell menschliche Taten oder Artefakte in den Sinn, doch mit Australien assoziiert man auf den ersten Blick etwas Nichtmenschliches. Natürlich ist die Genialität indigener Kultur unbestreitbar, aber sogar sie ist überschattet von der Größe und der Beharrlichkeit des Landes, das sie inspirierte. Die Geographie übertrumpft alles. Ihre Logik untermauert alles. Nach den Jahrhunderten europäischer Besiedelung ist sie noch da, denn nichts, was nach dieser Invasion erreicht und geschaffen wurde, keine Stadt und kein himmelstürmendes Monument, kann sich mit der Erhabenheit des Landes messen. Halten Sie das nicht für eine romantische Vorstellung. Alles, was wir auf diesem Kontinent tun, wird überragt und garantiert vom brodelnden Tumult der Natur. Die aufgefächerten Schalen des Sidney Opera House, die kühne Stahlkonstruktion der Sidney Harbour Bridge, der Eureka Tower mit seiner goldglänzenden Spitze – es sind kreative Wunderwerke, aber als Strukturen wirken sie ziemlich dürftig vor der Natur, in der sie stehen. Denken Sie an die brütende Masse und das beständig sich verändernde Gesicht des Uluru, auch als Ayers Rock bekannt. Werden Architekten je Stein auf diese Art zum Leben erwecken? Betrachten Sie die verwirrende Größe und die Komplexität der Sandsteinbienenkörbe des Purnululu, auch als Bungle-Bungle-Nationalpark bekannt. Es gleicht einer kryptischen Megacity, erbaut von Ingenieuren auf Meskalin. Unwahrscheinlich, dass Menschen je etwas so Wunderschönes und Raffiniertes konstruieren können.
Nur wenige Besucher kommen an diese Gestade wegen Ruhmesbauten der Kultur. Meist sind sie auf der Suche nach Wildnis, wollen Raum auf eine Art erfahren, die in Ländern, in denen es mehr Kultur als Natur gibt, nicht verfügbar oder sogar unvorstellbar ist. Ich bin kein Utopist. Und der natürlichen Welt zu geben, was ihr zusteht, macht einen nicht zum Misanthropen. Ich habe mein Leben mit der Suche nach und der Bewahrung von Kultur zugebracht. Ich liebe es, in den großen Städten dieser Welt zu sein. Und es stimmt – einige Gebäude sind eher Geschenke als Zumutungen. Aber ich bin in ausreichendem Maß Antipode und vielleicht auch alt genug, um mich hin und wieder zu fragen, ob Architektur letztendlich nur das ist, womit man sich tröstet, nachdem die wilde Landschaft unterjocht wurde.
Der Raum war mein ursprüngliches Erbe. Ich wurde geformt von Lücken, genährt in den langen Pausen zwischen Menschen. Ich gehöre zu einer dünnen, porösen menschlichen Kultur, in die aus allen Winkeln, ob gesehen oder gefühlt, Land einfällt wie Sonnenlicht: für jeden mechanischen Lärm fünf natürliche Geräusche, für jede gebaute Struktur eine Landform, die doppelt so groß und zwanzigmal komplexer ist. Und über allem ein unglaublich offener Himmel, der alles zwergenhaft erscheinen lässt.
In dem Halbtrockengebiet, in dem ich heute lebe, lockt einen der Himmel aus der Reserve, wie ein vieldimensionaler Horizont. Fast das ganze Jahr über ist das Erscheinen einer Wolke ein Ereignis. An der Südküste, wo ich meine Jugend verbracht habe, brodelt die Luft vor gotischen Wolken. Der Tumult des Himmels macht einen so fiebrig, dass die Gedanken eher Musik als Sprache sind. In der Wüste saugt der Nachthimmel einen an, Stern um Stern, Galaxie um Galaxie, bis man das Gefühl bekommt, man könnte jeden Augenblick hineinfallen. In Australien ist der Himmel nicht der sicher umschließende Baldachin, der er anderswo zu sein scheint. Es ist die dünnste Membran, die man sich vorstellen kann, kaum ausreichend als Barriere zwischen den erdgebundenen Kreaturen und der Ewigkeit. Wenn man im Morgengrauen allein auf der Nullarbor-Ebene oder draußen auf einer Salzpfanne von der Größe eines kleinen Landes steht, empfindet man einen Anflug von Grauen, weil der Himmel sich ewig auszudehnen scheint. Er hat gefährliche Tiefen und ozeanische Bewegungen. In unserer Hemisphäre lässt der Himmel einen wie angewurzelt stehen bleiben, lässt die Gedanken entgleisen und reißt einen weg von dem, was man tat, bevor er einen am Kragen packte. Kein Wunder, dass australische Maler, von Jarinyanu David Downs aus Kimberley bis zum tasmanischen Philip Wolfhagen, ihn weiter als würdiges Sujet betrachten, trotz der Frustration gewisser Kritiker, die von ihnen erwarten, sich etwas »Anspruchsvollerem« zuzuwenden, womit sie Themen meinen, die frei sind von den Besonderheiten des Ortes. Für einige Insulaner ist das Gewicht der Eigentümlichkeit unerträglich schwer. Sie verschmähen die beschränkte Isolation von Tasmanien, der Lord-Howe-Inselgruppe, der Torres-Straße oder des sogenannten Festlands und suchen Zuflucht im Kosmopolitischen, und wer könnte es ihnen verdenken? Australier spüren diesen Drang seit langem. Umgeben von Ozeanen, ohne Grenzen mit anderen Ländern, werden sie neugierig, unruhig, fühlen sich niedergedrückt von der erbarmungslosen Vertrautheit ihrer Umgebung. Wenn man auf einer Insel wohnt, ist das Gras woanders immer grüner, weil man es nicht über eine Grenze hinweg vergleichen kann. Man grünt im Geiste Orte, die Ozeane entfernt liegen. Insulaner können nicht anders, sie müssen entfernte Paradiese heraufbeschwören. Australier sind große Reisende. Man trifft sie als Auswanderer auf der ganzen Welt. Hin und wieder begegnet man denen der alten Schule, die wegen ihres Selbstexils empfindlich sind, als würden ihre Landsleute es missbilligen, was vielleicht in den 1950ern noch so war. Die größten Selbstrechtfertiger unter ihnen verachten jene, die zu Hause geblieben sind, und es ist lehrreich und ziemlich rührend zu sehen, wie einige später im Leben zurückkehren, um Brücken zu reparieren, und dabei nicht so recht wissen, ob ihre Heimat sympathischer geworden ist oder etwas in ihnen selbst sich mit der Zeit vertieft hat.
Man kann nicht leugnen, dass Australien etwas körperlich Anstrengendes hat, aber da ist auch etwas quälend Paradoxes, denn noch dem ehrfürchtigsten Beobachter kommt es manchmal so vor, als wäre dieser Kontinent mehr Luft als Materie, mehr Pause als Bewegung, mehr Raum als Zeit. Der Ort ist immer noch er selbst. Er zwingt sich einem immer noch auf. Er prägt sich dem Körper ein, und um das zu verstehen, bemüht der Geist sich ständig mitzukommen. Das ist der Grund, trotz der postmodernen und fast postmateriellen Zeit, in der wir leben, warum australische Schriftsteller und Maler auch weiterhin von der Landschaft besessen sind. Dabei sind wir keine Zauderer. Wir leben an einem Ort, an dem man erst einmal mit den materiellen Fakten fertigwerden muss. Es gibt so viele davon. Wir kämpfen ständig darum zurechtzukommen. Die Begegnung zwischen uns und dem Land ist eine Überlebensfrage. Woanders ist diese Sache schon größtenteils abgehakt, die Natur auf dem Rückzug, aber hier bleibt unser Leben in der Natur eine offene Frage, und wie wir die beantworten, definiert nicht nur unsere Kultur und unsere Politik, sondern auch unser Überleben.
Wer sich als Schriftsteller vorwiegend mit Landschaft beschäftigt, muss eine merkwürdige, aber andauernde Spannung zwischen Drinnen und Draußen akzeptieren. Ich bin so dünnhäutig in Bezug auf das Wetter und so gierig auf körperliche Erfahrungen, dass ich, wie es aussieht, eine beschämende Menge an Energie darauf verwende, herumzuzappeln und meine Flucht zu planen, wie ein Schuljunge. Wenn ich in der Schule neben einem Fenster saß, war ich ein Totalausfall. Und jetzt bin ich nicht viel anders. In meinem Arbeitszimmer kann ich nicht einmal ein Bild aufhängen, denn was ist ein Bild anderes als ein Fenster? Meine Gedanken werden nach draußen gezogen; ich bin verzaubert. Was nur eine romantische Umschreibung dafür sein mag, dass mein Hirn völlig vernagelt ist. Deshalb schreibe ich meistens in einer leeren Kammer, mit dem Rücken zum Fenster. Was bedeutet, ich verbringe keinen geringen Teil des Tages damit, aufzustehen und das Zimmer zu verlassen, ein paar Minuten draußen in der Sonne zu stehen, den Wind zu schnuppern, in den Himmel zu schauen. Es ist wie das zwanghafte Justieren eines Ventils. Gelegentlich fühle ich mich besser, weil ich es getan habe. Meistens bedaure ich es. Der Erwachsene in mir gibt zu, dass ich so zumindest etwas vom Tag geschmeckt habe. Aber der Junge in mir spürt nur umso schmerzlicher, was er verpasst.
Hin und wieder mache ich mich natürlich ganz einfach aus dem Staub. Ich werfe ein paar Sachen in den Land Cruiser und fahre los. Ich fahre bis zum Sonnenuntergang und halte dann irgendwo in einem völlig anderen Gemütszustand, manchmal sogar in einem völlig anderen Bundesstaat. Oft haben diese Ausflüge keinen Zweck außer der Freude am Draußensein, in einem Bachbett oder zwischen Dünen den Schlafsack auszurollen, am Feuer zu sitzen und die Sterne zu sehen, die am Himmel aufgehen wie Gänsehaut. Diese überstürzten Exkursionen beginnen als Ausbruch aus der Enge, und ich weiß, das klingt nach Flucht, aber für mich sind sie eher die Reaktion auf einen Ruf. Schon Augenblicke nach dem Aufbruch, sobald ich in Schwung gekommen bin, ist es, als wäre ich einem Heimkehrimpuls unterworfen, den ich selber kaum verstehe. Wenn ich nachts unter freiem Himmel liege, habe ich ein merkwürdiges Gefühl von Rückkehr und Gesundung, so ähnlich wie ich mich als Junge fühlte, wenn ich durch die Hintertür hereinkam zum seifigen Geruch von Wäsche und dem fürsorglichen Gemurmel der Wanne, die im Bad eingelassen wurde.
Doch nach Hause zu kommen ist nicht immer gemütlich. Es kann hart und erschreckend sein. Die Orte, die mir am liebsten sind, können sehr schwer zu erreichen sein. Sie sind karg, wild, unberechenbar. Und wie schweigsame Cousins und argwöhnische Schwager kommen sie einem nicht immer entgegen und sagen, was sie denken. Sie zeigen einem beim Frühstück den Stinkefinger und tun, was sie können, um einem den Aufenthalt unangenehm zu machen. Man kommt mürrisch und abgelenkt an, unvorbereitet auf die Komplexität der familiären Dynamik, als wäre man am Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nicht viel von unserem Land ist ansprechend oder augenblicklich sympathisch. Die Regionen, die ich am besten kenne, sind besonders herausfordernd, und mein Revier im Westen kann harte Arbeit sein – es ist dornig, trocken, abweisend, sogar demütigend, und nach einigen Besuchen fühle ich mich oft erschöpft und bestürzt wie ein Gast bei einem Weihnachtsessen, der sich fragt, warum er sich die Mühe eigentlich gemacht hat. Aber beim Heimkehren geht es ja letztlich auch darum, sich auf das unbequem Familiäre einzulassen, oder etwa nicht? Wie ein unglückseliges erwachsenes Kind kehrt man, fast gegen seinen Willen, zurück, weil man nicht genug kriegen kann, weil man auf ewig versucht, das familiäre Rätsel zu lösen. Auch so bekommt man Nährwert, schon bei dem Versuch, einfach indem man offenbleibt für das Geheimnis und weil man befürchtet, wenn man aufgibt, steht man mit leeren Händen da.
Dieses Land lastet auf einem. Es drückt einen nieder. Wie die Familie. So wie ich es sehe, ist es Familie.
Ich habe viel Zeit damit verbracht, Australiern bei diesem kindhaften Tanz mit der Natur zuzusehen. Urban und wohlhabend wie sie sind, in einem Leben jenseits der Beschränkungen durch Wetter und Natur, wie ihre Vorfahren es sich nie hätten vorstellen können, sind doch viele auf eine fast rituelle, wenn auch widersprüchliche Art fixiert auf das Draußen und geben jedes Jahr ein Vermögen für Geländefahrzeuge, Caravans, Wohnmobile und Abenteuerausrüstung aus. Einiges ist reiner Fetisch, einiges nichts als Prestigedenken, aber Millionen von Menschen sind immer noch wild darauf, sich draußen die Zeit mit Wandern, Klettern, Kajakfahren, Fischen, Surfen oder Segeln zu vertreiben, sobald sie die Chance bekommen. Es geht nicht nur um die Flucht aus der häuslichen Knechtschaft des Arbeitslebens. Es herrscht ein spürbarer Drang nach draußen vor, ein Suchimpuls, etwas, das unserer physischen Kultur, unserer sensorischen Ausstattung eingebettet ist. Offenbar gibt es ein implizites kollektives Verständnis, dass das Land noch immer in unseren Augenwinkeln vorhanden, noch immer da draußen