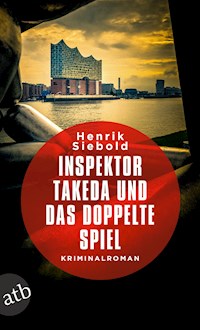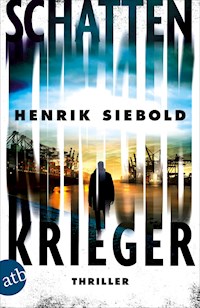9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Takeda ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Feuer in der Nacht.
Beim Brand einer Hamburger Seniorenresidenz sterben acht Bewohner. Alles deutet auf Brandstiftung hin, so dass Inspektor Ken Takeda und Claudia Harms die Ermittlungen aufnehmen. Eine verdächtige Heimleiterin, sich seltsam verhaltende Angehörige – viele der Befragten machen sich verdächtig. Dann stoßen Takeda und Harms auf ein deutsch-japanisches Joint Venture, das einen neuartigen Pflegeroboter erprobt. Bald müssen die Ermittler eine Frage stellen, die ihnen selbst geradezu aberwitzig erscheint: Kann ein Roboter einen Mord begehen?
Der neue Fall des ungewöhnlichsten und charismatischsten Helden im deutschen Kriminalroman.
„Henrik Siebold gelingt es, einen spannenden Krimi einerseits, fesselnde Einblicke andererseits in die Kultur der Japaner zu schreiben.“ Lübecker Nachrichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Feuer in der Nacht.
Beim Brand einer Hamburger Seniorenresidenz sterben acht Bewohner. Alles deutet auf Brandstiftung hin, so dass Inspektor Ken Takeda und Claudia Harms die Ermittlungen aufnehmen. Eine verdächtige Heimleiterin, sich seltsam verhaltende Angehörige – viele der Befragten machen sich verdächtig. Dann stoßen Takeda und Harms auf ein deutsch-japanisches Joint Venture, das einen neuartigen Pflegeroboter erprobt. Bald müssen die Ermittler eine Frage stellen, die ihnen selbst geradezu aberwitzig erscheint: Kann ein Roboter einen Mord begehen?
Der neue Fall des ungewöhnlichsten und charismatischsten Helden im deutschen Kriminalroman
»Henrik Siebold gelingt es, einen spannenden Krimi einerseits, fesselnde Einblicke andererseits in die Kultur der Japaner zu schreiben.« Lübecker Nachrichten
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio gelebt. Unter einem Pseudonym hat er mehrere Romane veröffentlicht. Zurzeit wohnt er in Hamburg.
Bisher erschienen als Aufbau Taschenbuch »Inspektor Takeda und die Toten von Altona«, »Inspektor Takeda und der leise Tod« und »Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder«. »Inspektor Takeda und das doppelte Spiel« ist auch als Audio-CD lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Inspektor Takeda und die stille Schuld
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Nachwort
Impressum
Prolog
Lautlos schob er sich an das Bett des Schlafenden heran. Seine kühlen Augen blickten auf den alten, siechen Körper hinab, der vor ihm lag. Er hörte die röchelnden Atemgeräusche, das Schmatzen der sich im Traum bewegenden Lippen.
Träumte er selbst eigentlich auch? Und wenn ja, warum konnte er sich niemals daran erinnern? Er müsste sich doch erinnern, sein Gedächtnis war schließlich unfehlbar.
Er beugte sich hinab, schlug lautlos die Decke über dem arglosen Alten zurück. Wie klein und zart der Mann war … überraschend. Im Alter wurden die Menschen wieder zu Kindern, im Geist wie im Körper.
Vorsichtig schob er den Leibkittel des Alten herauf, sah auf den blassen, faltigen Bauch, musterte ihn, suchte eine geeignete Stelle. Ein letztes Mal verharrte er. Gab es einen Grund, dies hier nicht zu tun?
Er hatte alle Daten über den Mann zusammengetragen, hatte mit herzloser Logik Bilanz gezogen über die Leistungen und Verfehlungen dieses ohnehin fast beendeten Lebens. Das Ergebnis war eindeutig.
Er musste sterben.
Mit einer langsamen, mechanischen Bewegung hob er die Hand. Die Nadel schimmerte im fahlen Licht der Nacht. Dann stach er zu, schnell und erbarmungslos, ließ die tödliche Medizin eindringen, mehr und immer mehr.
Der Alte zuckte zusammen, fand vom Schlaf in eine verwirrte Wachheit. Er blickte hoch, weitete vor Entsetzen die Augen. Er wollte schreien, konnte es nicht. Er wollte sich wehren, sah sich aber einer unwiderstehlichen Kraft gegenüber. Schließlich bäumte er sich ein letztes Mal auf. Dann fiel er schlaff zurück in die Laken.
Es war vollbracht.
Er bewegte sich rückwärts vom Bett fort, drehte sich zur Tür und verließ das Zimmer so lautlos, wie er es betreten hatte.
Als er im Flur stand, wusste er, dass seine Aufgabe noch nicht vollendet war. Es galt, die Spuren des Geschehenen zu verwischen. Nur dann konnte er in Zukunft das weiterführen, was ihm aufgetragen war.
Er schritt lautlos den Korridor entlang, verteilte die Flüssigkeit, goss sie in die Winkel, schüttete sie vor die Türen. Ätzende Gase erfüllten die Luft. Ihm machte es nichts. Er bewegte sich zum Ausgang. Dort öffnete er die kleine, in die Wand eingelassene Klappe und blickte auf den blass schimmernden Bildschirm. Mit mechanischer Präzision gab er erst den Code, dann die nötigen Steuerungsbefehle ein. Ein leises, fortgesetztes Klackern wie das Fallen aneinandergereihter Dominosteine wanderte von Tür zu Tür. Es waren die Schlösser, die sich automatisch schlossen, eines nach dem anderen. Schließlich entzündete er eine Flamme, ließ sie zu Boden fallen. Noch bevor sie die Flüssigkeit berührte, war der Klang einer Verpuffung zu vernehmen. Der Flammenteppich schoss rasend schnell über den Boden. Heiße Zungen in Grün und Blau griffen nach den Wänden, der Decke, den Türen, allen Gegenständen. Keine Gier war so unersättlich wie die des Feuers.
Er stand reglos da, als könne die Hitze ihm nichts anhaben. In ihm war nichts als eine tiefe Stille. Keinerlei Empfindung. Keine Freude, kein Mitleid. Daran änderte sich auch nichts, als erste Schreie hinter den Türen laut wurden. Als Hände verzweifelt an den Klinken rüttelten.
Wie gerne hätte er jetzt gelächelt. Aber er konnte nicht lächeln.
1.
Inspektor Takeda trat einen Schritt nach vorne in den Schnittpunkt der farbigen Deckenstrahler. Es war Samstagabend, und er stand auf der Bühne des Bird’s, seines angestammten Jazzclubs in Hamburg.
Die Stadt war nun seit einem guten Dreivierteljahr seine Heimat. Er hatte hier viele Orte entdeckt, die er mochte, ja liebte. Den Hafen, die Alster, die prächtigen Straßen im schönen Winterhude. Auch ungewöhnliche Orte waren ihm ans Herz gewachsen. Die futuristischen Häuserschluchten der City Nord, das menschenbunte Treiben in Ottensen, die Wildnis im Wald von Klövensteen.
Doch keiner dieser Orte bedeutete ihm so viel wie der kleine Jazzclub, den er einmal in der Woche aufsuchte, um an den Open Sessions teilzunehmen.
Es war nun an Takeda, das erste Stück des Abends anzukündigen. Zuvor drehte er sich zu seinen Mitspielern um und warf ihnen einen um Verzeihung heischenden Blick zu, deutete dazu eine kleine Verbeugung an. Dann wandte er sich wieder ans Publikum und sprach ins Standmikrophon: »Autumn in New York.«
Im Publikum war erstauntes Gemurmel zu hören. In Hamburg hatte der Frühling Einzug gehalten und der Stadt einige ungewöhnlich heiße, nahezu sommerliche Tage beschert. Dennoch wollte Takeda ein so herbstliches, so melancholisches Stück spielen? Wieso? Das war doch völlig unpassend! Oder hatte der Japaner Gründe für seine Wahl? Bedrückte ihn etwas? Hatte er Sorgen?
Der Eindruck hatte sich bereits zuvor aufgedrängt, denn der Inspektor wirkte an diesem Abend erschöpft und niedergeschlagen. Er war unrasiert und hatte tiefe dunkle Ringe unter den Augen. Auch seine Kleidung entsprach nicht dem Üblichen, denn während Takeda sonst stets elegante Anzüge trug, stand er heute in T-Shirt und knittrigem Leinensakko auf der Bühne. Wer ihn besser kannte, hätte sich wohl an seine Jahre in Tokio erinnert gefühlt, die Takedas Scheidung gefolgt waren. Jene Zeit war ein fortgesetzter, selbstzerstörerischer Rausch gewesen, während der der Inspektor sich in illegalen Mahjong-Höhlen herumtrieb, wo er sich mit Yakuza-Paten verbrüderte und flaschenweise Whisky in sich hineinschüttete. Nachdem ihn das Austauschprogramm der Polizeiorganisationen den Umzug nach Hamburg ermöglicht hatte, schien er diese Phase endgültig hinter sich gelassen zu haben.
War es also ein Rückfall? Oder gab es einen anderen Anlass, der ihn in diesen elenden Zustand versetzt hatte?
Takeda ließ sich nicht beirren, er blies schon die ersten melancholischen Tunes des gefühlvollen Evergreens. Dann geschah etwas, das es noch nie gegeben hatte. Der Inspektor setzte das Saxophon ab, trat dichter an das Mikrophon heran und begann zu singen.
Autumn in New York
Why does it seem so inviting?
Autumn in New York
It Spells the thrill of first nighting
Takedas Stimme war melodisch und rau, ein dunkelsüßer Bariton. Sehr gefühlvoll. Jeder Ton saß. Und doch war seine Darbietung, wie sich sogar seine glühendsten Anhänger im Publikum eingestehen mussten, ein wenig belustigend. Es lag an Takedas eigentümlichem japanischem Akzent. Die Stadt verwandelte sich in Nu Yoruku, und der Thrill wurde zum Turiru.
Dennoch dauerte es nicht lange, und die Melancholie des Liedes nahm vom Publikum Besitz. Kein Gedanke mehr an die milden Frühlingstemperaturen draußen auf den Straßen. Wer Takedas Spiel und seinem Gesang zuhörte, verlor sich in einer Stimmung voll unerfüllter Sehnsucht nach einem unerreichbaren Ort. Hatte Takeda vielleicht Heimweh? War das der Grund seiner Traurigkeit? Und hatte er sich darum für dieses Stück entschieden?
2.
»Er sagt einfach nichts. Er sitzt da, sieht mich an – und schweigt.«
Claudia Harms nutzte die Pause, die entstanden war, als ihre Mutter von der Terrasse aufgestanden und ins Haus gegangen war, um neue Getränke zu holen. Sie war für kurze Momente alleine mit ihrem Vater. Gemeinsam blickten sie über den frühlingshaften Garten, der im Licht des frühen Samstagabends vor ihnen lag.
»Du meinst deinen Japaner? Dann habt ihr also Streit?«
»Er ist nicht mein Japaner.«
»Nicht? Klang bei deinem letzten Besuch so.«
»Tja, die Dinge ändern sich.«
»Dann ist es vorbei? So schnell? Ihr seid doch gerade erst zusammengekommen.«
Claudia sparte sich eine Antwort. Sie war sich ohnehin nicht sicher, ob Jürgen, ihr Vater, wirklich der richtige Gesprächspartner für ein solches Thema war. Nicht nur, weil er selbst alles andere als ein Beziehungsexperte war, wie die vielen Schwierigkeiten im Laufe der langen Ehe mit ihrer Mutter oft genug bewiesen hatten, sondern auch, weil sie sich albern vorkam. Sie war sechsunddreißig Jahre alt und damit definitiv zu alt, um mit ihrem Liebeskummer ausgerechnet bei ihrem Vater anzukommen.
Aber so viel Auswahl hatte sie nicht. Als sie mit ihrer besten Freundin Gudrun versucht hatte, über Takeda zu reden, hatte die ihr laute Vorhaltungen gemacht. Warum nur, hatte Gudrun gefragt, musst du immer das zerstören, was dir guttut, Claudi? Gudrun hatte keinen Widerspruch zugelassen, hatte sie zum Fall für die Couch erklärt. Sie, den dicksten Dickschädel aller Zeiten.
Das Schlimme war, dass Gudrun recht hatte. Es war Claudias Schema, schon seit vielen Jahren. Immer wenn es drohte, ernst zu werden, wenn eine Beziehung auch nur eine kleine Chance hatte, zu funktionieren, zog sie die Reißleine. Sie ging, sie floh. Warum sich auf etwas einlassen, wenn es am Ende doch zum Scheitern verurteilt war?
Bei Takeda aber hatte es sich zum ersten Mal seit Ewigkeiten anders angefühlt. Das mit ihm war etwas Besonderes. Und ja, es könnte klappen. Davon war sie überzeugt gewesen. Es lag auch daran, dass sie sich langsam über viele Monate angenähert hatten. Während dieser Zeit waren sie zunächst nur Kollegen gewesen. Sie entwickelten Vertrautheit. Sie lachten zusammen. Er hatte ihr das Leben gerettet. Und sie ihm. Dann führte ihr letzter Fall sie nach Japan, wo sie sich wirklich nahekamen. Nachdem der Fall abgeschlossen war, nahmen sie sich eine gemeinsame Auszeit in Italien. Perfekte zwei Wochen. Wandern in den Bergen. Mit einem Riva-Boot über den Lago Maggiore brausen. Nachmittage im Café, Nächte im Hotel …
Aber dann waren sie nach Hamburg zurückgekehrt, in ihren Alltag, in ihre Routine. Alles war anders geworden.
Es lag nicht an ihm.
Es lag an ihr.
An ihrer Sucht nach Problemen. An eben dieser Zerstörungswut, die Gudrun ihr vorgehalten hatte. Er war öfter über Nacht bei ihr in ihrer Wohnung geblieben. Zu Anfang hatte sie sich gefreut. Aber dann war sie genervt. Sie hatte angefangen, ihn wegen Kleinigkeiten zu kritisieren. Weil er auf ihrem Balkon rauchte. Weil er seine Klamotten auf dem Boden liegen ließ. Weil er bei seinem Morgenkaffee schlürfte. Weil er nachts, anstatt zu schlafen, Jazz-CDs hörte oder – sie wollte es gar nicht glauben – auf einem dämlichen Gameboy spielte … aber darum ging es gar nicht. Sondern darum, dass sie dabei waren, so etwas wie ein normales Leben zu führen. Dass sie sich einen gemeinsamen Alltag aufbauten. Das war schwer für Claudia. Zu schwer. Also begann sie, zickig zu werden und ihn anzugiften. Aber je mehr sie Ken ärgerte, desto schweigsamer wurde er. Anstatt sich zu wehren oder etwas zu erwidern, sah er sie nur hilflos an. Und immer entschuldigte er sich, als wäre er wirklich schuld an all den Dingen, die sie ihm vorhielt.
Vor zwei Nächten war es dann zum endgültigen Bruch gekommen. Wieder ein Streit. Sie laut und austeilend, er still und in sich gekehrt. Schließlich war er aufgestanden und gegangen.
Claudia sah ihren Vater an und sagte seufzend: »Ich wollte es diesmal anders machen. Ich wollte mich einlassen. Aber ich kriege es nicht hin. Vielleicht bin ich einfach nicht fürs Zusammenleben gemacht.«
In diesem Augenblick kehrte Hannelore, Claudias Mutter, auf die Terrasse zurück. Sie stellte ein Tablett mit Getränken und ein paar Knabbereien auf den Tisch. Mit beiläufiger Stimme fragte sie: »Du hast es also mal wieder geschafft, Schätzchen?«
Claudia sah ihre Mutter aus schmalen Augen an: »Du hast gelauscht?«
»Ich bitte dich! Die Terrassentür stand offen. Hätte ich mir Petersilie in die Ohren stopfen sollen?«
»Wäre besser gewesen.«
»Dieser Japaner war deine letzte Chance, Schätzchen. Die letzte Tankstelle vor der Autobahn! Zum ersten Mal dachte ich, dass du endlich einen Mann gefunden hast, der dich ertragen könnte. Aber ich war wohl mal wieder zu optimistisch.«
Claudia wollte etwas Saftiges erwidern. Ihr Vater jedoch nahm unauffällig ihre Hand und drückte sie. Claudia sah es ein. Jeder Satz, jedes Wort wäre zu viel gewesen. Also sagte sie einfach gar nichts.
Außerdem, und das war das Schlimmste daran, hatte ihre Mutter ja recht. Takeda war wirklich die letzte Tankstelle vor der Autobahn gewesen. Es hätte klappen können. Er hätte sie wohl wirklich ertragen können. Aber sie selbst, sie hielt es nicht aus.
Es war verrückt.
Aber anscheinend konnte sie nicht anders.
Claudia trank einen Schluck Campari. Gemeinsam mit ihren Eltern blickte sie schweigend auf den wunderschönen, üppig blühenden Garten. Der kleine Mähroboter, den ihr Vater vor Kurzem angeschafft hatte, zog leise surrend seine Bahnen auf dem hinteren Teil des Rasens. Ihre Mutter hatte ihr vorhin erzählt, wie vernarrt Jürgen in das Gerät war. Es lag nicht nur daran, dass er endlich die lästige Pflicht des Rasenmähens los war. Es ging viel weiter, und Jürgen schien zu dem technischen Gerät fast ein Verhältnis zu pflegen wie zu einem Hund oder einer Katze. Er hätte sogar schon laut darüber nachgedacht, ob er dem Mähroboter nicht ein Leckerli geben könnte. Zum Beispiel ein paar Tropfen Motoröl …
Jetzt spürte Claudia zu ihrer Überraschung, dass der Anblick der kleinen, drollig wirkenden Maschine auch ihre aufgewühlte Stimmung milderte.
Der Mähroboter näherte sich dem Staudenbeet, aus dem ein paar abgeknickte Stängel auf die Rasenfläche ragten. Die Maschine stockte wegen des Hindernisses. Fast schien es, als sei sie überrascht und ein wenig hilflos. Sie änderte die Richtung, wendete, versuchte es von einer anderen Seite, scheiterte jedoch erneut. Schließlich blieb das Gerät ganz stehen. Claudia musste lachen.
Zu ihrem Vater gewandt sagte sie: »Ich glaube, du musst deinem kleinen Freund helfen. Er sieht ganz unglücklich aus, weil er beim Beet nicht richtig mähen kann.«
»Ja, du hast recht. Ich muss mich kümmern.«
Jürgen erhob sich, ging ein paar Schritte und öffnete eine Klappe an der Oberseite des Mähroboters. Er drückte den Resetknopf. Daraufhin nahm die Maschine wieder leise surrend die Arbeit auf.
Claudia seufzte. Sie wünschte sich, auch ihr festgefahrenes Leben ließe sich mit einem Resetknopf wieder zum Laufen bringen. Genauso ihr Verhältnis zu Ken. Wäre es nicht toll, wenn sie einfach noch einmal von vorne anfangen könnten? Vielleicht nicht als Liebende, aber als Kollegen, als Freunde.
3.
Als Inspektor Takeda am frühen Montagmorgen das Dienstzimmer im Polizeipräsidium betrat, das er sich mit Claudia teilte, saß sie bereits an ihrem Schreibtisch. Das war ungewöhnlich, Claudia war selten, eigentlich nie vor ihm da.
Er blieb in der Tür stehen und sah sie abwartend an. Es war ihr erstes Wiedersehen, seit sie sich am Freitag in ihrer Wohnung voneinander verabschiedet hatten.
Claudia sah blass aus. Erschöpft. Genau wie er. Vermutlich hatte sie ebenso wenig geschlafen wie er.
Dann aber lächelte sie, versuchte es jedenfalls und sagte: »Komm doch rein. Ich habe schon Kaffee aufgesetzt. Ich schenke dir ein.«
»Okay.«
Sie stand auf und trat an die Fensterbank, auf der die Kaffeemaschine stand. Sie schenkte ihm einen Becher voll und stellte ihn auf seinen Schreibtisch. Erst jetzt bemerkte er, dass sie die Schreibtische, die bisher zusammengestanden hatten, voneinander abgerückt hatte. Zudem hatte sie einige ihrer Zimmerpflanzen auf den Rand ihres Tisches gestellt, so dass sie sich nun während der Arbeit nicht mehr unmittelbar ansehen würden. Das heißt, sehen konnten sie sich immer noch, aber nur wenn sie durch die Blätter des Benjamini hindurchlugten.
»Sieht gut aus, die neue Zimmerdekoration«, sagte er.
»Findest du?«
»Aber ja. Deine Pflanzen sind so eine Art entmilitarisierte Zone, richtig? Das ist gut. Kann dabei helfen, aus Feinden Freunde zu machen.«
»Wir sind keine Feinde, Ken.«
»Du hast recht. Das sind wir nicht.«
Er setzte sich, trank bemüht leise von seinem Kaffee. Sie lächelte und sagte: »Kannst ruhig schlürfen … wir sind ja nicht mehr zusammen.«
»Schlürfen stört dich nur bei Männern, mit denen du in einer Beziehung bist? Bei Kollegen nicht?«
Sie hob in einer Geste der Hilflosigkeit die Schultern. Das Eis war dünn, das wussten sie beide, aber es lief besser als erwartet. »Doch, bei denen stört es mich auch. Aber ich habe nicht die Panik, dass ich es für den Rest meines Lebens ertragen müsste. Darum kann ich es aushalten.«
Takeda sah Claudia an, lächelte, ignorierte den Schmerz, der ihm fast das Herz zerriss. »Du bist klug, Claudia. Und du weißt gut über dich selbst Bescheid.«
Auch ihre Züge verrieten, dass sie litt. Aber sie zeigten auch, dass sie fest entschlossen war, es auszuhalten. »Kann sein. Es bedeutet allerdings nicht, dass ich die Dinge dadurch besser hinkriege. Doch lassen wir das. Wie war dein Wochenende? Du siehst müde aus. Hast du getrunken?«
Er lächelte. »Ein wenig. Nicht übertrieben. Nicht wie früher.«
»Das ist gut. Ich würde es mir nicht verzeihen, wenn du meinetwegen wieder damit anfängst.«
Er winkte ab. »In erster Linie habe ich gespielt. Im Bird’s. Nur traurige Lieder. Ich hoffe, das Publikum nimmt es mir nicht übel.«
»Sie lieben dich, Ken. Egal in welcher Stimmung du bist. Ich wünschte …« Claudia brach mitten im Satz ab. Sie saß da und starrte ins Nichts.
»Was wolltest du sagen?«
Sie zögerte. »Ich möchte, dass wir wieder Freunde sind, Ken. So wie früher. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Meinst du, das kriegen wir hin?«
»Aber ja.«
»Wirklich?«
Er schlug die Augen nieder. »Es ist weniger, als ich mir wünsche.«
»Ach, Ken, ich möchte dir so vieles sagen.«
»Was? Was möchtest du mir sagen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Vielleicht später. Jetzt müssen wir los. Zeit für die Morgenrunde. Wir wollen doch nicht zu spät kommen, oder?«
»Nein, wollen wir nicht«, sagte Takeda. Er wusste, dass Pünktlichkeit Claudia eigentlich wenig interessierte, doch nun war alles anders geworden. Auch diese Kleinigkeiten.
Etwa zwanzig Kollegen hatten sich zur großen Montagsrunde versammelt. Die Fälle, die vorgetragen wurden, waren schnell abgehandelt. Ein eskalierter Familienstreit in einer Kleingartensiedlung, eine Messerstecherei an einem S-Bahnhof. Routine. Alles in allem war es ein ruhiges Wochenende gewesen. Niemand stellte Fragen, niemand wollte Einzelheiten wissen. Allen war klar, dass eigentlich etwas anderes anstand.
Holger Sauer, der Leiter der Mordkommission, wusste es ebenfalls. Sein Gesicht war ungewöhnlich ernst. Er blickte sich in der Runde um, ließ sich bestätigen, dass es keine anderen Punkte mehr zu besprechen gab. Dann holte er tief Luft und sagte mit angespannter Stimme: »Ich denke mal, ihr habt alle von dem Großbrand in der Seniorenanlage in Wellingsbüttel gehört?«
Sauer blickte sich um, alle nickten. Auch Claudia, auch Takeda. Die Nachrichten hatten es bereits gestern gebracht, abends sogar die Tagesschau im Ersten. Heute titelten sämtliche Lokalzeitungen mit der Geschichte. In der Nacht zum Sonntag war in einer Seniorenresidenz im Hamburger Norden ein Feuer ausgebrochen. Dabei war eines der Wohngebäude vollständig niedergebrannt. Acht Bewohner hatten ihr Leben verloren. Eine einzige Bewohnerin konnte mit schwerer Rauchvergiftung gerettet werden und rang im Krankenhaus um ihr Leben. Es sei die schlimmste Brandkatastrophe in Hamburg seit Jahrzehnten gewesen, hieß es in den Medien.
Holger Sauer fuhr fort. »Die Brandstelle konnte erst heute Morgen untersucht werden. Da steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die alten Leute sind in ihren Zimmern verbrannt, die meisten wohl schlafend. Keiner hat es nach draußen geschafft. Vorhin hat mich der Kollege Runge von den Brandermittlern angerufen, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat. Er meinte, dass es ein Fall für uns wird.«
»Also Brandstiftung?«, rief einer der Kollegen in den Raum.
Sauer nickte. »Runge hat diverse Spuren gefunden, die er noch auswerten muss. Zweifel hat er allerdings jetzt schon keine.«
Der Leiter der Mordkommission blickte sich in der Runde um, sah dann zu Claudia und Takeda. Er war kurz irritiert. Anders als sonst saßen die beiden nicht nebeneinander, tuschelten nicht, machten keine spöttischen Bemerkungen über ihn. War das jetzt ein Fortschritt?
»Herr Takeda, Kollegin Harms, Sie übernehmen das bitte. Fahren Sie zur Alster-Residenz, so heißt die Einrichtung. Lassen Sie sich vom Kollegen Runge den Tatort zeigen, und ziehen Sie erste Erkundigungen ein. Heute Nachmittag oder spätestens morgen entscheiden wir, ob Sie Unterstützung durch weitere Kollegen bekommen. Und noch etwas. Das gilt für alle hier! Bisher ist das mit der Brandstiftung nicht öffentlich. Dabei soll es erst einmal bleiben, um die Ermittlungen nicht unnötig zu erschweren. Irgendwelche Fragen? Gut, dann an die Arbeit!«
4.
Das Erste, was Claudia wahrnahm, war der Brandgeruch. Er war allgegenwärtig und durchdringend. Verkohltes Holz, versengtes Plastik.
Doch da war auch noch etwas anderes.
Der Duft, der sie um Fassung ringen ließ, war … verbranntes Fleisch.
Sie machte sich keine Illusionen.
Es war Menschenfleisch.
Sie und Takeda waren gerade erst aus dem Auto gestiegen, standen auf dem Parkplatz der Alster-Residenz. Die Senioreneinrichtung befand sich im feinen Stadtteil Wellingsbüttel im Hamburger Norden. Das mehrstöckige, an ein Hotel erinnernde Eingangsgebäude wirkte unversehrt.
Aber der Eindruck täuschte. Gebrannt hatte es nicht hier vorne, sondern in einem der rückwärtigen Nebengebäude. Hier ließ sich das Ausmaß der Katastrophe auch erahnen. Obwohl das Feuer seit mehr als vierundzwanzig Stunden gelöscht war, standen auf dem Parkplatz immer noch zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, dazu mehrere Leichenwagen. Überall liefen Menschen herum. Einsatzkräfte in Uniform, aber auch Angehörige. Einige in professioneller Geschäftigkeit. Andere in fassungsloser Trauer.
Claudia stieß ein erschöpftes, verzweifeltes Schnauben aus. Sie wusste jetzt schon, dass dies hier einer jener Fälle sein würde, um den sie sich wahrlich nicht riss. Auch nicht als erfahrene Polizistin, die sie war und die schon so manches erlebt und gesehen hatte.
Sie spürte Takedas besorgte Blicke. »Bist du okay?«
Sie nickte tapfer, sah ihn aber nicht an. Das war vielleicht der größte Unterschied zu früher. »Denke schon. Und du?«
Er zuckte mit den Schultern. »Muss ja!«
Claudia lachte und wunderte sich darüber, dass ihr das gelang. Solche Floskeln wie Muss ja klangen aus Kens Mund einfach drollig. Es lag an seinem Akzent, aber auch an der immer noch tastenden, unsicheren Art, in der er sie aussprach. Sein Deutsch war zwar nahezu perfekt, er hatte die Sprache auf Geheiß seines Vaters immerhin schon als Jugendlicher gelernt, doch einige Redewendungen kamen ihm nicht so ohne Weiteres über die Lippen. Trotzdem liebte er es, so etwas wie Darauf kannst du einen lassen oder Da wird der Hund in der Pfanne verrückt zu sagen.
Eine Stimme, laut rufend, etwas entfernt, riss sie aus ihren Gedanken. »Hey, seid ihr die Kollegen vom Mord? Harms und Takeda?«
Claudia blickte hoch. Links neben dem Hauptportal stand ein Mann, korpulent, Schnauzbartträger, vielleicht Anfang sechzig, mit einer blau-gelben Funktionsjacke. Er winkte ihnen zu und deutete an, dass sie zu ihm kommen sollten. Hinter ihm führte ein schmaler, asphaltierter Weg in das parkartige Gelände der Residenz.
Claudia winkte zurück, sagte dann zu Takeda: »Das ist Tilmann Runge von den Brandermittlern. Er scheint sich nicht an mich zu erinnern. Dabei habe ich schon einmal vor ein paar Jahren mit ihm zusammengearbeitet.«
Takeda setzte sich in Bewegung. »Hören wir uns an, was er zu sagen hat.«
5.
Claudia hatte Tilmann Runge bei einem Fall kennengelernt, der einige Jahre zurücklag. Damals war die Turnhalle einer Schule niedergebrannt. Der Hausmeister hatte schwer verletzt überlebt, war dann aber doch seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen hatten zu einer Gruppe Siebtklässlern geführt, die gedankenlos gezündelt hatten. Ein Streich, für den ein Mensch mit seinem Leben bezahlt hatte. Die Kinder waren zu jung gewesen, um bestraft zu werden. Aber in Wahrheit würden sie die Bürde ihrer Tat für den Rest ihres Lebens tragen.
Claudia rief Runge den Fall in Erinnerung. »Klingelt da etwas, Kollege? Wir haben damals schon zusammengearbeitet.«
Runge runzelte die Stirn. Dann grinste er, ließ seinen Blick demonstrativ an ihr auf- und wieder abgleiten. »Jetzt, wo du es erwähnst. Claudia Harms … bist immer noch genauso lecker wie damals.«
Claudia rollte mit den Augen, eigentlich sollten solche Sprüche der Vergangenheit angehören. »Kann ich von dir nicht behaupten, Tilmann. Du bist mehr geworden.«
Sie tätschelte die ausgeprägte Wampe des Kollegen. Runge winkte ab. »Ein Mann, ein Bauch. Das ist meine Devise. Meine Frau stört es im Übrigen nicht. Sagt sie jedenfalls.«
Claudia lachte, sparte sich jedoch jede weitere Bemerkung. Sie stellte Runge Takeda vor, der ihrem Geplänkel mit leicht verwirrter Miene gelauscht hatte.
Der Brandermittler streckte ihm die Hand entgegen und erklärte, dass er schon einiges von dem Inspektor aus Tokio gehört habe. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. Und er sei neugierig, von Takeda etwas über Brandermittlungen in Japan zu erfahren. Er habe nämlich gehört, dass Brandstiftung in Takedas Heimatland ein durchaus häufiges Delikt sei.
Der Inspektor nickte und erklärte: »Das ist richtig, Herr Runge …«
»Tilmann, bitte.«
»Tilmann. Es ist, wie du sagst, Hōka, wie wir Brandstiftung nennen, kommt in Japan leider nicht zu selten vor. Da wir immer noch sehr viel mit Holz bauen, ist es ein ernstzunehmendes Problem. Gerne können wir uns bei Gelegenheit darüber unterhalten.«
»Abgemacht, Ken. Aber jetzt zeige ich euch erst einmal, womit wir es hier und heute zu tun haben.« Runge machte eine unbestimmte Geste in Richtung des Residenzgeländes, fügte hinzu: »Euch erwartet eine ziemliche Scheiße. Ich hoffe, euer Frühstück ist schon eine Weile her.«
»So schlimm?«, fragte Claudia.
»Schlimmer. Ihr werdet es gleich sehen.«
Claudia warf Takeda einen fragenden Blick zu. Er nickte ihr zu. Lächelte. Sie lächelte ebenfalls. Es hieß, dass er bereit war, mit den Ermittlungen loszulegen. Und es hieß, dass sie nun wirklich wieder das waren, womit sie vor einem Dreivierteljahr begonnen hatten: Kollegen.
Runge führte sie über den schmalen Weg, von dem aus sich ein guter Überblick über das weitläufige Gelände der Residenz bot. Das Areal war leicht abschüssig und lag zwischen der nahen Hauptstraße und dem parallel verlaufenden Alstertal, grenzte im Westen unmittelbar an den Fluss.
Runge deutete auf das hochgeschossige Hauptgebäude, das nun seitlich hinter ihnen lag, und erklärte, dass sich dort die Verwaltung und die Zimmer für die intensiv pflegebedürftigen Bewohner befänden. Hier im rückwärtigen Teil lägen hingegen die sogenannten Servicewohnungen, jeweils acht bis zehn Wohneinheiten pro Gebäude. Darunter sei auch das Haus, das nun vollständig abgebrannt sei.
Claudia ließ ihren Blick über das Gelände schweifen. Sie zählte ein gutes Dutzend moderner, zweistöckiger Gebäude, die an amerikanische Motels erinnerten. Sie waren locker in der weitläufigen Parklandschaft verteilt und durch schmale, asphaltierte Wege verbunden. Anders als bei Motels gab es statt offener Laubengänge solide gebaute Korridore, von denen aus es in die Wohnungen zu gehen schien. Alles wirkte edel und gepflegt, auch die Parkanlage war in einem tadellosen Zustand. Die Rasenflächen waren penibel gemäht, die Büsche auf kunstvolle Weise gestutzt, die Wege fein säuberlich von Laub und Dreck befreit. Hier wurde auf alles geachtet.
Hamburg war eine reiche Stadt, mit entsprechend vielen reichen Senioren, wie Claudia wusste. In Residenzen wie dieser konnte man ohne Weiteres einen hohen viertstelligen Eurobetrag im Monat ausgeben, wofür man eine nicht einmal sonderlich große Altersunterkunft geboten bekam. Den Betreibern versprachen solche Einrichtungen satte Renditen, den Bewohnern ein sorgenfreies Leben im Alter. Die Alster-Residenz zählte selbst für die Verhältnisse der Hansestadt zu den hochpreisigen Einrichtungen, allein schon wegen der exklusiven Lage am Alsterlauf.
Während sie sich dem eigentlichen Unglücksort näherten, wurde der stechende Geruch immer intensiver. Claudia spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Sie blieb kurz stehen, verzog das Gesicht. Runge dachte sich wohl seinen Teil. Er nickte ihr aufmunternd zu und erklärte: »Ich bin’s gewöhnt. Und glaub mir, in ein paar Minuten merkst du es auch nicht mehr. Einfach ignorieren.«
Kurz darauf standen sie vor der eigentlichen Brandruine. Sie war weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Zur Sicherung standen einige uniformierte Polizeikollegen an den Seiten, nickten nun einen flüchtigen Gruß herüber. Etwas weiter entfernt hatten sich einige Schaulustige versammelt, darunter zwei junge Mädchen, die sich für ein Selfie in Pose brachten. Ein paar Meter entfernt stand ein junger Mann mit einem Mountainbike, der ebenfalls ein Foto mit seinem Smartphone machte.
»Wie kommen die Leute hierher? Sind das Mitarbeiter?«, erkundigte sich Takeda.
Runge verzog das Gesicht. »Das sind einfach nur Gaffer. Das Gelände ist nach unten zum Wanderweg am Alsterufer offen. Es gibt nur ein paar Schilder, die auf das Privatgelände hinweisen. Interessiert aber offenbar niemanden. Theoretisch kann hier jeder reinmarschieren. Und Selfies machen an einem Ort, an dem Menschen gestorben sind, scheint bei jungen Leuten hoch im Kurs zu stehen.«
Claudia und Takeda wechselten einen kurzen Blick. Nicht nur wegen der Selfie-süchtigen jungen Leuten. Ihnen beiden war sofort klar, was Runges Aussage für ihre Ermittlungen bedeutete. Jeder konnte das Gelände betreten. Also konnte auch jeder das Feuer gelegt haben. Sollten sie es tatsächlich mit Brandstiftung zu tun haben, schränkte das den Kreis der potenziellen Täter nicht gerade ein.
Das eigentliche Gebäude bestand nur noch aus einem Haufen verkohlter Balken und wenigen kümmerlichen Mauerresten. Lediglich an einer Seite war eine aus Beton errichtete Struktur einigermaßen erhalten geblieben. Sie reichte bis zum ehemaligen ersten Stock empor und beherbergte die Reste eines Treppenaufgangs und einen ausgebrannten Fahrstuhlschacht. Direkt daran angrenzend waren im ersten Stock Teile eines Zimmers erhalten geblieben. Es war nach vorne offen wie bei einer Puppenstube. Claudia und Takeda sahen ungläubig auf ein Bett, einen Fernseher, weitere Möbelstücke. Die Dinge waren verrußt, aber alles in allem erstaunlich intakt.
Runge, der die Blicke der Kollegen bemerkte, erklärte: »Feuer ist ein launisches Element. Das eine zerstört es, das andere verschont es. Wir erleben immer wieder Situationen, die man mit Physik oder Chemie kaum erklären kann.«
»Hat da die Frau gewohnt, die überlebt hat?«, fragte Takeda.
Runge bestätigte es. »Das Gemäuer ist genau vor ihrem Bett weggebrochen, so dass sie in Sicherheit war. Ob sie allerdings wirklich durchkommt, steht noch nicht fest. Sie liegt auf der Intensivstation. Schwere Rauchgasvergiftung. Und das in dem Alter. Die Dame ist fast neunzig …«
Während der Brandermittler und Takeda weitergingen, blieb Claudia zögerlich stehen. Sie schloss die Augen und spürte dem Ort der Zerstörung und des vielfachen Todes nach. In einem Spielfilm hätte der Regisseur jetzt vermutlich schnipselartige Rückblenden von der lodernden Feuersbrunst eingefügt, hätte sie mit dem Ton knisternder Flammen und schreiender Menschen unterlegt.
In der Wirklichkeit aber war es einfach nur still. Claudia hatte das immer wieder erlebt. An Tatorten war es lautlos wie in einer Landschaft im Schnee. Als zöge der Tod ein Echo der vollkommenen Stille nach sich.
6.
Bevor sie die Brandruine betraten, stattete Runge Claudia und Takeda mit Sturzhelmen und Atemmasken aus. Beides sei unerlässlich, auch wegen giftiger Ausgasungen, die an einer Brandstelle auch nach vielen Stunden oder Tagen noch auftreten konnten.
Dann führte Runge sie zwischen zwei schwarz verfärbten Mauerresten hindurch ins Innere des Gebäudes. Da die meisten Außenmauern wie auch die Decke zum ersten Stock und das Dach fehlten, standen sie eigentlich weiterhin im Freien.
Takeda deutete auf die ölig glänzenden Wasserpfützen und die Spuren verkrusteter Rinnsale, die sich wie ausgetrocknete Flussdelten über den Boden zogen. Runge, dessen Stimme unter der Maske näselnd klang, erklärte, dass es Reste des Löschwassers der Feuerwehr seien. Die Sprinkleranlage, über die das Gebäude eigentlich verfüge, habe offenbar versagt. Aber das könne er noch nicht mit Sicherheit sagen. Mit einem Schnauben fügte er hinzu: »Ich habe gestern Abend mit dem Wehrführer gesprochen, der den Einsatz geleitet hat. Guter Mann, wir kennen uns schon lange. Er war ziemlich am Ende. Als der erste Löschzug eintraf, sei schon nichts mehr zu machen gewesen, meinte er. Alles stand meterhoch in Flammen. Keine Chance, noch jemanden lebendig rauszuholen. Wenn der so etwas sagt, wird es stimmen. Ich habe ein Protokoll angefertigt, da könnt ihr die Details seiner Aussage nachlesen. Von mir aus hätten die Jungs das mit dem Löschen auch ganz lassen können. Zu retten war sowieso nichts mehr, und das Wasser macht mir meine Arbeit nicht einfacher. Andererseits ist es in diesem Fall auch so eindeutig genug.«
»Das heißt?«, fragte Claudia, ebenfalls mit dumpfer Stimme unter dem Atemschutz.
Runge machte eine auffordernde Handbewegung. »Ich zeig’s euch. Kommt mit.«
Sie staksten weiter zwischen den Mauerresten hindurch. Die kalte Asche knisterte unter ihren Schuhen. Die meisten Gegenstände und Möbelstücke, die sie sahen, waren zusammengeschmolzen und kaum noch zu erkennen. War das einmal ein Fernseher? Oder ein Kühlschrank? Es könnte genauso gut ein Sessel oder ein Rollstuhl gewesen sein. Was überhaupt noch aus der Asche herausragte, war nur noch ein Gerippe aus verbogenem Stahl und zerschmolzenem Plastik.
Andererseits entdeckten sie auch Dinge, die überraschend unversehrt waren. Eine Puppe, ein Handspiegel, ein Kochtopf. Die Sachen lagen wie Farbtupfer in einem Schwarzweißfilm inmitten der Asche.
»Wie gesagt, Feuer ist launisch«, erklärte Runge. »Das eine frisst es, das andere lässt es links liegen.«
Sie gingen weiter, doch mit einem Mal stockte Claudia. Sie starrte auf einen Aschehaufen, der unterhalb eines ehemaligen Türsturzes lag. Aus der schwarzen Masse lugte die weiß glänzende Wölbung eines Schädels hervor. An einzelnen Stellen klebte noch Haut, auf der graue Haarbüschel wuchsen.
Takeda, der Claudias Erschütterung bemerkte, griff instinktiv nach ihrer Hand. Sie ließ es geschehen. In diesen Sekunden spielte nichts eine Rolle. Sie war froh, dass Ken da war.
Runge erklärte: »Eure Kollegen von der Rechtsmedizin haben die meisten menschlichen Überreste bereits abtransportiert. Aber noch nicht alle. Die Feuerwehr hat uns ja überhaupt erst heute Morgen gestattet, mit der Arbeit loszulegen. Vorher herrschte hier eine mörderische Hitze. An ein Betreten war nicht zu denken.«
Claudia nickte. »Machen wir einfach weiter.«
Der Brandermittler führte sie entlang einem Streifen, der einmal der Korridor des Gebäudes gewesen war. Takeda erkannte die ehemaligen Eingänge zu den Wohnungen, konnte aus Mauerresten die Umrisse der Zimmer erahnen. Es war nicht die erste Brandstelle, die er besichtigte. Und doch war er auch dieses Mal wieder erstaunt, dass ein Feuer ein solide errichtetes Haus so restlos zerstören konnte.
Runge lenkte seine und Claudias Aufmerksamkeit immer wieder auf spezielle Rußflecken oder Putzabplatzungen an den Wänden, soweit sie überhaupt noch standen. Er zeigte auf eingebrannte Muster auf dem Boden. Den Mordermittlern sagten sie nicht viel, Runge aber gaben sie offenbar Hinweise auf den Verlauf des Feuers. Einmal beugte er sich hinab, scharrte mit dem Fuß einen Schutthaufen zur Seite und deutete auf Verfärbungen im Untergrund. Er sprach von Zündquellen und Konvektionen, vom Durchbrand durch Wände und Decken, von Kamineffekten und Flashover.
Schließlich gab er eine Art Seufzen von sich und führte sie wieder nach draußen ins Freie. Sie zogen ihre Atemmasken ab und rieben sich über die verschwitzten Gesichter. Runge zündete sich eine Zigarette an, Takeda folgte seinem Beispiel. Claudia blickte die beiden irritiert an, sparte sich jedoch einen Kommentar.
Der Brandermittler erklärte: »Alles in allem sind die Spuren so eindeutig, wie ich es mir nur wünschen kann. Der oder die Täter haben sich keinerlei Mühe gegeben, es nach etwas anderem als Brandstiftung aussehen zu lassen. Allerdings ist das nicht der entscheidende Punkt …«
Runge machte eine Kunstpause. Takeda sah ihn neugierig an: »Worauf willst du hinaus, Tilmann?«
»Ich glaube nicht, dass es dem Täter darum ging, Feuer zu legen.«
»Sondern?«
»Er wollte Menschen töten. Viele Menschen. Der Brand war nicht sein Ziel, er war nur Mittel zum Zweck. Eine Mordwaffe.«
Für einige Momente herrschte Stille zwischen ihnen. Dann fragte Takeda: »Was macht dich so sicher?«
»Das ganze Vorgehen. Vor allem die Menge an Brandbeschleuniger, die ausgebracht worden ist. Ich nehme an, dass es Petroleum war, vielleicht auch Benzin. Das werden die Kollegen von der KTU feststellen. Aber es ist auch ganz egal. Es hatte jedenfalls zur Folge, dass sich das Feuer unglaublich schnell ausgebreitet hat. Keiner der Bewohner hatte eine Chance zu entkommen. Das muss dem Täter klar gewesen sein. Oder nein, ich glaube, es ging ihm genau darum. Jeder hier sollte sterben.«
»Dann besteht also kein Zweifel. Wir haben es mit Mord zu tun«, sagte Takeda.
Runge nickte. »In mindestens acht Fällen, je nachdem, ob die alte Dame überlebt … ja, davon könnt ihr ausgehen.«
Wieder schwiegen sie einen Moment. Dann sagte Claudia kopfschüttelnd: »Mein Gott, wer macht so etwas nur?«
Runge stieß ein zorniges Schnauben aus. »Wenn du willst, dass ich rate, würde ich euch empfehlen, die Mitarbeiter der Residenz unter die Lupe zu nehmen.«
»Hast du dafür einen Anhaltspunkt?«
»Nicht direkt. Es ist Erfahrungssache. Brandstiftung ist hinterhältig. Und hinterhältig sind Menschen, die sich nicht trauen, ihre Konflikte offen auszutragen. Also überlegt selbst, wer in so einem Laden in der Hackordnung ganz unten steht …«
Claudia und Takeda sahen sich an, nickten beide. Runges Vermutung hatte einiges für sich.
In der folgenden Viertelstunde stellten die Ermittler eine ganze Reihe von Routinefragen, erkundigten sich nach der genauen Uhrzeit des Brandes und dem Eintreffen der Feuerwehr, nach möglichen Zeugen oder Aufnahmen von Überwachungskameras, nach Spuren rund um den Tatort. Runge erläuterte, dass das Feuer gegen halb drei in der Nacht von Samstag zu Sonntag ausgebrochen war, die Feuerwehr sei keine zehn Minuten nach Eingang des Alarms eingetroffen. Zu dem Zeitpunkt standen bereits einige der Beschäftigten um die Feuerstelle. Er habe sie bereits einer ersten Befragung unterzogen, natürlich nur unter brandtechnischen Aspekten. Etwas Brauchbares habe er nicht herausgefunden, auch weil die meisten unter Schock standen. Dasselbe gelte für die Leiterin der Residenz, eine Frau namens Ilona Stemann. Nett, aber bisher zu keiner vernünftigen Aussage fähig. Takeda und Claudia sollten sie möglichst bald ebenfalls befragen. Kameras gebe es auf dem Gelände keine, und auch sonst sei bisher nichts gefunden worden, das einen Hinweis auf den Täter biete. Das Gelände sei abgesucht worden, ohne Ergebnis. Die Hoffnung, eventuell auf einen Kanister oder ein anderes Gefäß zu stoßen, in dem das Petroleum oder das Benzin transportiert worden war, hatte sich nicht erfüllt. Er werde sich nun weiter um die Auswertung der Brandspuren kümmern, in der Hoffnung, doch noch etwas zu entdecken. Die Suche nach dem oder den Tätern aber sei ab sofort Aufgabe von Claudia und Takeda.
7.
Die Ermittler folgten Runges Rat und suchten als Erstes Ilona Stemann auf, die Heimleiterin der Alster-Residenz. Die Frau empfing sie in einem kleinen, penibel aufgeräumten Büro im Hauptgebäude.
Claudia war überrascht davon, wie jung Stemann war, höchstens Anfang dreißig, schätzte sie. Eine kühl und geschäftsmäßig wirkende Frau im tadellos sitzenden Businesskostüm, gut frisiert, dezentes Make-up. Bestimmt hatte sie BWL studiert und könnte genauso gut teure Autos, Schmuck oder Aktien verkaufen. Oder eben Wohnungen in einer exklusiven Seniorenresidenz.
Die Heimleiterin bot Kaffee an, die Ermittler nahmen dankend an. Sie stand auf und machte sich an einer modernen Kaffeemaschine zu schaffen, die auf einem Sideboard stand. Während die Maschine mit lautem Surren Bohnen mahlte, stellte Stemann drei Tassen bereit. Dabei zitterten ihre Hände so stark, dass das Geschirr in einem fort klirrte.
Doch nicht so geschäftsmäßig, dachte Claudia. Der erste Eindruck hatte getäuscht. Sie stand auf, nahm Stemann die Tassen aus der Hand. »Lassen Sie mal, ich mache das schon.«
»Danke … ich bin fertig mit den Nerven. Ich kann immer noch nicht fassen, was passiert ist. Seit ich in der Nacht angerufen worden bin, habe ich kein Auge zugemacht. Gestern ist dann auch noch eine weitere Bewohnerin hier im Haupthaus verstorben … die Aufregung … Ich kann nur hoffen, dass es nicht noch weitere Fälle gibt. Alle sind schrecklich aufgewühlt. Nicht nur die Bewohner, auch meine Mitarbeiter. So ein schreckliches Unglück haben wir nie für möglich gehalten.«
Claudia war versucht, ihr zu widersprechen und deutlich zu machen, dass es kein Unglück war, sondern ein Verbrechen. Mord.
Angesichts des Zustandes der Frau entschloss sie sich jedoch, damit noch zu warten und zunächst einfühlsamere Worte zu finden.
Claudia reichte sowohl Takeda als auch Ilona Stemann Kaffee, setzte sich dann wieder hin. Mit stummen Blicken verständigte sie sich mit Takeda darauf, dass sie das Gespräch führen würde.
So machten sie es immer, wenn sie gemeinsam ermittelten. Einer redete, einer beobachtete. Hinterher trugen sie ihre Eindrücke zusammen.
»Frau Stemann, wir müssen Ihnen eine ganze Reihe von Fragen stellen. Auch wenn es Ihnen nicht gut geht, muss ich Sie bitten, sich zu konzentrieren. In Ordnung?«
Die Heimleiterin fuhr sich durch die Haare, setzte sich dann aufrecht hin, nickte. »Ja, natürlich.«
»Schildern Sie mir bitte, wie die Nacht des Brandes aus Ihrer Sicht verlaufen ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren Sie selbst nicht hier im Haus?«
»Das ist richtig. Ich war zu Hause und habe geschlafen. Aber natürlich waren einige Nachtschwestern und Pflegekräfte hier. Ich bin, ungefähr eine halbe Stunde nachdem ich angerufen wurde, hier gewesen. Da stand das Haus immer noch in Flammen. Die Feuerwehr war bei der Arbeit, meinte aber schon, dass wohl niemand rausgekommen sei. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich bin durch den Park gerannt und habe gerufen. Ich habe so sehr gehofft, dass sich einer der Bewohner doch in Sicherheit hatte bringen können … aber so war es nicht. Sie waren alle tot. Verbrannt. Schließlich habe ich eingesehen, dass ich nichts tun konnte. Ich bin dann hier ins Büro gegangen und habe so viele meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angerufen wie möglich.«
»Mitten in der Nacht?«, fragte Claudia.
»Ich hatte keine Wahl. Der Lärm durch das Feuer und die Einsatzfahrzeuge, dazu die Aufregung, der Rauch … viele unserer Bewohner waren aufgewacht. Sie müssen sich vorstellen, dass die meisten von ihnen hochbetagt sind, nicht wenige außerdem krank oder dement. Wenn da Panik ausbricht … es hätte noch viel mehr Opfer gegeben. So weit durften wir es nicht kommen lassen. Außerdem hatte uns die Feuerwehr angewiesen, die beiden Häuser, die dem Feuer am nächsten lagen, sicherheitshalber zu räumen. Es gab mehr als genug zu tun. Um ehrlich zu sein, war ich dankbar dafür. Es hielt mich davon ab nachzudenken.«
In die Augen der Heimleiterin traten Tränen. Claudia ließ ihr einen Moment, dann fragte sie: »Sie sagten, dass zuvor einige Ihrer Mitarbeiter hier waren? Wie viele genau?«
»Das müsste ich nachsehen. Zwischen zehn und zwanzig. Einige waren wach, andere in Bereitschaft. Viele unserer Bewohner sind rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen, und sei es nur, um auf die Toilette zu gehen. Außerdem sind immer einige ausgebildete Krankenschwestern hier, falls jemand gesundheitliche Probleme bekommt.«
»Im betroffenen Haus selbst aber war niemand? Ich meine, zum Zeitpunkt des Feuers? Keine Pflegekräfte oder ähnliches?«
»Nein. In den Häusern mit den Servicewohnungen leben ausschließlich Herrschaften, die sich noch selbst versorgen können. Sie erhalten von uns die Mahlzeiten, wenn sie es wünschen, werden ärztlich betreut und so etwas. Einige sind aufgrund ihres Alters bewegungseingeschränkt oder sitzen sogar im Rollstuhl. Es kann also sein, dass sie nachts schon einmal Hilfe brauchen. Aber es gibt keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung.«
»Wer hat denn das Feuer bemerkt? Und wer hat die Feuerwehr alarmiert?«
»Soweit ich weiß, sind die Rauchmelder losgegangen. Die lösen nicht nur vor Ort einen Alarm aus, sondern auch hier im Haupthaus. Eine der Pflegerinnen ist hinübergerannt, hat gesehen, was los ist, und hat sofort die 112 gewählt.«
»Ich verstehe. Nun etwas anderes. Gab es in letzter Zeit Konflikte hier im Haus, sei es unter den Bewohnern oder auch mit dem Personal?«
Ilona Stemann sah Claudia irritiert an. »Ich verstehe Ihre Frage nicht.«
»Wurde zum Beispiel einer Ihrer Mitarbeiter entlassen oder zumindest abgemahnt? Vielleicht weil er nicht gut gearbeitet oder etwas gestohlen hat? Fühlte sich jemand ungerecht behandelt? Fällt Ihnen irgendetwas ein, ganz egal, was es ist?«
»Aber bedeutet das denn …?«
Claudia beschloss, dass die Zeit der Zurückhaltung vorbei war. »Ja, Frau Stemann, genau das bedeutet es. Wir haben es mit Brandstiftung zu tun. Daran kann kein ernsthafter Zweifel bestehen.«
Ilona Stemann gab ein lang gezogenes Stöhnen von sich. Sie wollte etwas sagen, doch ihre Stimme versagte. Erneut traten ihr Tränen in die Augen und liefen über ihre Wangen.
Sie zog ein Taschentuch aus der Tasche ihres Blazers, tupfte sich das Gesicht ab. Dann straffte sie ihre Haltung. Ihr Ausdruck wurde sachlich.
»Sie glauben, dass es einer unserer Mitarbeiter gewesen sein könnte? Wie kommen Sie darauf?«
»Ich glaube zurzeit noch gar nichts. Aber wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Von daher darf ich Sie bitten, auf meine Frage zu antworten. Gab es Ärger mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin?«
Ilona Stemann schlug die Augen nieder, dachte für einige Momente nach. »Also, eine Entlassung gab es nicht, auch keine Abmahnung. Das Klima unter der Belegschaft ist gut. Allerdings bekomme ich natürlich nicht alles mit. Ich müsste Frau Kramer fragen.«
»Frau Kramer?«
»Unsere Pflegedienstleiterin. Sie ist in engerem Kontakt mit dem Personal als ich, jedenfalls zu den Pflegerinnen.«
»Ich denke, wir sprechen lieber selbst mit Frau Kramer. Ist sie im Haus?«
Ilona Stemann schüttelte den Kopf. »Sie ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Es geht ihr nicht gut. Sie kannte die Bewohner, gerade in dem betroffenen Haus, besser als ich. Einigen stand sie richtig nahe. Der Vorfall hat sie sehr mitgenommen.«
»Verständlich. Trotzdem müssen wir möglichst schnell mit ihr sprechen.«
»Ich suche Ihnen gleich die Adresse heraus.«
Claudia war nicht entgangen, dass ein Wandel mit Ilona Stemann vorgegangen war. Er hatte eingesetzt, als sie nach möglichen Konflikten gefragt hatte. Seitdem wirkte sie angespannt, noch mehr als ohnehin schon. Claudia sah Takeda fragend an, der nickte und signalisierte wortlos, dass er es ebenfalls bemerkt hatte.
Sie beschloss, direkt darauf zuzusteuern. »Frau Stemann, als ich Sie gerade gefragt habe, ob es mit den Angestellten Ärger gab, woran haben Sie da gedacht? Ich habe das Gefühl, dass Sie etwas Konkretes vor Augen haben. Betrifft es vielleicht nicht die Mitarbeiter, sondern die Bewohner? Gab es Streit unter ihnen?«
Ilona Stemann starrte Claudia an, wirkte hilflos und ängstlich zugleich, blieb jedoch stumm.
»Frau Stemann, antworten Sie bitte. Ich werde sonst so lange hier bleiben und Sie danach fragen, bis Sie es mir sagen.«
Die Heimleiterin gab ein erschöpftes Seufzen von sich. Mit leiser Stimme sagte sie: »Ich habe es nicht ernst genommen. Aber ich konnte ja nicht wissen …«
Ihre Stimme verlor sich. Sie saß da, schüttelte den Kopf, rang um Fassung.
»Was haben Sie nicht ernst genommen? Wovon sprechen Sie?«
Claudias Stimme war streng. Die Heimleiterin starrte sie an, stand dann wortlos auf. Sie zog die Schublade eines Aktenschranks auf, der sich hinter ihrem Schreibtisch befand. Dort holte sie eine Hängemappe hervor, blätterte mit zitternden Fingern einige Papiere durch. Schließlich zog sie einen einzelnen Briefbogen daraus hervor und schob ihn über den Tisch vor Claudia.
Gemeinsam mit Takeda überflog Claudia die wenigen, offenbar von einem Computer ausgedruckten Zeilen.
Du wirst büßen. Du und dein ganzes verschissenes Haus. Du wirst dir wünschen, es wäre nie passiert.
8.
Claudia brauchte einige Momente, um ihre Überraschung zu überwinden. Ein Seitenblick zeigte ihr, dass es Takeda nicht anders ging.
Zu Ilona Stemann gewandt, sagte sie: »Ein anonymes Schreiben. Kam das als E-Mail?«
»Nein, als Brief.«
»Ohne Absender?«
»Richtig.«
»Die Drohung ist ziemlich heftig. Wann ist das Schreiben eingetroffen?«
»Vor drei Wochen.«
»Sind Sie damit zu unseren Kollegen gegangen? Ich meine, auf eine Wache? Haben Sie Anzeige erstattet?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Ilona Stemann schüttelte verzweifelt den Kopf. »Weil ich es nicht ernst genommen habe, jedenfalls damals nicht. Mein Gott, wenn ich gewusst hätte, was passiert …«
Claudia zog einen Latexhandschuh aus ihrer Jackentasche, streifte ihn über und nahm den Brief in die Hand. Sie las die ersten Zeilen noch einmal laut vor. »Du wirst büßen. Du und dein ganzes verschissenes Haus … Wie kann man solche Worte nicht ernst nehmen?«
Ilona Stemann schüttelte mit verzweifeltem Gesichtsausdruck den Kopf. »Weil der Brief nicht wirklich anonym war, nicht für mich.«
Claudia und Takeda waren gleichermaßen überrascht. Der Inspektor mischte sich nun doch ins Gespräch ein und fragte: »Dann wissen Sie, wer diese Zeilen geschrieben hat?«
»Ich denke schon. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Darum konnte ich mir nicht vorstellen, dass es mehr sein könnte als eine leere Drohung. Derjenige, der es geschrieben hatte, wollte Dampf ablassen. Vielleicht mir Angst machen. Aber mehr nicht. Dachte ich jedenfalls …«
Wieder starrte die Leiterin der Residenz mit glasigem Blick vor sich hin.
Takeda, der bemerkte, dass Claudia ungeduldig wurde, kam ihr erneut zuvor und sagte mit milder Stimme: »Erklären Sie es uns, bitte. Wer, glauben Sie, ist der Verfasser dieses Briefes?«
Ilona Stemann sah Takeda an und lächelte zum ersten Mal. Claudia registrierte es mit seltsamen, irritierenden Gefühlen, die sie sofort zur Seite schob.
Die Heimleiterin sagte: »Ich muss ein wenig ausholen, um es Ihnen zu erklären. Ist das in Ordnung?«
»Selbstverständlich. Wir haben Zeit. Seien Sie lieber genau als hastig«, erklärte Takeda.
Ilona Stemann schenkte ihm erneut ein Lächeln. Als sie zu Claudia sah, war ihr Gesicht um mehrere Nuancen unfreundlicher.
Dann begann sie auszuführen, dass die Alster-Residenz mit rund hundertzwanzig Wohnungen und sechzig weiteren Plätzen für Schwerstpflegebedürftige zu den größeren Häusern in der Stadt gehöre. Natürlich komme es daher regelmäßig zu Sterbefällen unter den Bewohnern. Die meisten Angehörigen reagierten mit Verständnis, kämen nicht auf die Idee, dem Haus die Schuld am Tod ihres Mannes oder ihrer Frau, ihrer Mutter oder ihres Vaters zu geben. Im Gegenteil, oft wurde die Residenz sogar im Testament bedacht oder die Angehörigen spendeten im Nachhinein noch etwas für die Mitarbeiter …
Ilona Stemann machte eine Pause, sagte dann: »Aber es gibt eben auch andere Fälle. Die verlaufen weniger friedlich. Die Angehörigen machen uns Vorwürfe, bezichtigen die Pflegekräfte oder auch mich persönlich, dass wir Fehler gemacht hätten. Oder sie behaupten sogar, dass wir ganz direkt Schuld am Tod ihres Angehörigen wären. Um so einen Fall geht es hier.«
»Und? Haben Sie einen Fehler gemacht?«, fragte Claudia kühl. Sie wusste, dass ihre Frage direkt und unsensibel war. Warum tat sie das? Lag es an der Art, wie die Frau Takeda angesehen hatte?
Takeda, der sich seinen Teil dachte, versuchte die Situation zu entschärfen. Er räusperte sich und erklärte: »Verzeihen Sie bitte unsere direkte Art, Frau Stemann. Wir müssen solche Fragen stellen. Zumal einiges dafürspricht, dass diese Sache mit dem Feuer zusammenhängt.«
Die Heimleiterin blickte Takeda an, nickte, fand sogar zu einem Lächeln zurück. Claudia aber ignorierte sie, woran sich im Verlaufe des Gesprächs auch nichts mehr ändern sollte. »Ja, es sind Fehler gemacht worden. Ob wir damit am Tod eines Menschen schuld sind? Ich glaube es nicht.«
»Bitte, berichten Sie, was passiert ist.«
»Ja, natürlich.«
Sie trank von ihrem Kaffee, legte sich ihre Worte zurecht, begann dann zu sprechen. »Es geht um einen Bewohner, der Paul Sieversen hieß. Er hat etwa drei Jahre bei uns gelebt. Viele meiner Mitarbeiterinnen mochten ihn. Aber es wurde zunehmend mühsam. Herr Sieversen war über achtzig Jahre alt und litt an einer zunehmenden Demenz. Er war zuletzt kaum noch Herr seiner Sinne. So etwas ist für die Pflegekräfte, auch für die erfahrensten unter ihnen nicht einfach. Menschen wie Herr Sieversen sind wie Kleinkinder. Sie könnten weder selbstständig essen noch sich ankleiden, sich nicht waschen, gar nichts. Sie haben Angst, bestohlen zu werden, sie können ausfallend sein, sind zänkisch … Eigentlich müssen wir sie rund um die Uhr beaufsichtigen. Auch, weil sie immer wieder versuchen, aus dem Haus fortzulaufen. Wohin, wissen sie meistens selbst nicht. Natürlich tun wir alles, um es zu verhindern. Im Fall von Paul Sieversen ist uns das nicht gelungen.«
»Er konnte das Haus verlassen?«, fragte Takeda.
»Ja. Das war vor etwas mehr als vier Wochen, und zwar mitten in der Nacht. Wir haben es leider viel zu spät gemerkt.«
Ilona Stemann, überwältigt von quälenden Erinnerungen, schüttelte den Kopf. Sie blickte Takeda an und sagte mit leiser Stimme: »Es war eine Verkettung tragischer Umstände. Wir hatten in der Woche mehrere Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern. Unsere Personalsituation ist ohnehin angespannt, wie in jeder Pflegeeinrichtung. Wenn dann noch Kollegen krank werden, wird es schlimm. So war es auch in der betreffenden Nacht. Das Haupthaus war unterbesetzt. Am Ende musste eine neue, noch nicht eingearbeitete Pflegekraft alleine in dem betreffenden Stockwerk eingesetzt werden. Die junge Frau trifft keine Schuld. Sie kannte die Abläufe nicht, wusste nicht, welche Bewohner sie besonders im Augen behalten musste. So gelang es Paul Sieversen zu verschwinden. Im Morgenmantel, einfach so. Wir haben ihn erst am nächsten Morgen gefunden, draußen im Park. Er war gestürzt und hatte sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Er war unterkühlt und kaum noch bei Bewusstsein. Er kam sofort ins Krankenhaus. Die Operation verlief nicht gut. Am Ende ist er nicht mehr aus der Narkose erwacht …«
Dem Bericht der Heimleiterin folgte ein langes Schweigen. Claudia blickte zu Takeda. Sie hatte eingesehen, dass sie ihm die Gesprächsführung überlassen musste, alles andere wäre in Feindseligkeiten ausgeartet, und die würden sie kaum weiterbringen.
Takeda nickte kurz, wandte sich an Ilona Stemann. »Sie glauben also, dass das anonyme Schreiben von den Angehörigen dieses Herrn Sieversen stammt?«
»Es kam wenige Tage, nachdem er gestorben war. Ja, ich bin fest davon überzeugt. Beweisen kann ich es natürlich nicht.«
»Haben Sie die Familie darauf angesprochen?«
»Nein, das erschien mir unpassend. Sehen Sie, wir haben uns nach dem Tod des alten Herrn Sieversen gegenüber der Familie entschuldigt. Wir haben eingeräumt, dass die personelle Situation in der Nacht schwierig war. Aber ich habe auch deutlich gemacht, dass ein solcher Vorfall niemals ganz zu verhindern ist, auch nicht unter normalen Umständen und bei voller Besetzung.«
»Wie hat die Familie reagiert?«
»Der Sohn, Joachim Sieversen, hat uns mit einer Klage gedroht. Er ist Anwalt. Er war mit seiner Mutter hier, der Witwe des Verstorbenen. Die alte Dame war außer sich und hat mir schreckliche Vorwürfe gemacht. Auch Herr Sieversen ist laut und ausfallend geworden. Ich dachte, dass ich die beiden beruhigen könnte. Aber kurz nach unserem letzten Aufeinandertreffen ist der Brief gekommen.«
Takeda stieß ein nachdenkliches Brummen aus. »Du und dein ganzes verschissenes Haus … Das klingt nicht nach den Worten einer alten Dame. Und auch nicht nach denen eines Anwalts, wenn ich mich nicht täusche?«
»Da haben Sie recht. Vielleicht haben die beiden es nicht selbst geschrieben.«
»Es gibt weitere Familienangehörige?«
»O ja, die Familie ist groß.«
»Haben Sie jemand Bestimmten in Verdacht?«
»Nein. Ich hatte immer nur mit der Frau und dem Sohn zu tun.«
»Trauen Sie einem der beiden zu, das Feuer gelegt zu haben? Glauben Sie, ihre Wut ging so weit?«
»Eigentlich nicht. Aber jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vor allem, weil …«
Takeda wartete eine Weile, fragte dann: »Frau Stemann, was wollten Sie sagen?«
»Die Stelle, an der wir damals den alten Herrn Sieversen gefunden haben … es war direkt vor dem Haus, das abgebrannt ist.«
9.
»Was hältst du von der Geschichte?«, fragte Claudia, als Takeda und sie wieder auf dem Parkplatz vor der Alster-Residenz standen.
Der Inspektor steckte sich eine Zigarette an. Er rauchte viel. Deutlich mehr als in den Wochen zuvor. War das ihre Schuld?, fragte Claudia sich. Was denn sonst?
Das schlechte Gewissen meldete sich mit einem schmerzhaften Stich. Sollte sie Ken darauf ansprechen? Ihm noch einmal erklären, wie leid ihr alles tat? Dass es aber dennoch besser so sei, auch für ihn? Dass er froh sein sollte, eine Zicke wie sie los zu sein. Dass er bestimmt jemand Besseren fände … Aber wohin sollte das führen? Sie hatte ihm wehgetan. Das konnte sie mit Worten nicht heilen. Es gab nichts mehr zu sagen.
»Ich weiß es nicht«, erklärte Takeda. »Der Brief könnte durchaus eine Spur sein. Er enthält eine klare Drohung. Andererseits ergibt es keinen Sinn. Die Familie betrauert den tragischen Tod eines Angehörigen. Das ist verständlich. Aber würden sie deshalb zahllose andere Menschen ins Unglück reißen?«
Claudia ließ Takedas Worte sacken. Er hatte recht. Und zugleich war sein Gedanke zu … logisch. Menschen waren nicht logisch. Sie waren emotional. Sie waren unberechenbar.
»Ich bin mir nicht so sicher. Du wirst dir wünschen, dass es nie passiert wäre … Das ist eindeutig ein Bezug auf etwas, das zuvor geschehen ist, zum Beispiel ein Todesfall. Wer so etwas schreibt, der denkt nicht darüber nach, welches Leid er seinerseits auslöst. Hauptsache, er findet ein Ventil für seine Wut.«
»Du hast schon recht. Hinzu kommt der Ort, wo der alte Mann gefunden wurde.«
»Also sollten wir mit der Familie sprechen. Im Zweifel lässt sich der Verdacht schnell bestätigen oder auch ausräumen. Außerdem habe ich nichts dagegen, einmal einen echten Sieversen kennenzulernen …«
Takeda sah Claudia fragend an. Die lächelte und sagte: »Ich will es mal so sagen, der Name Sieversen klingt für die Ohren eines Hamburgers wie Rockefeller für einen Amerikaner. Oder Onassis für einen Griechen.«
»Du meinst, die Familie ist reich?«
»Das bestimmt auch. Ist aber nicht das Entscheidende. Es geht um Geschichte. Um Macht, um Einfluss. Hanseatischer Adel, nur ohne von und zu. Alte Pfeffersäcke. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt wirklich zu den berühmten Sieversens gehören, aber wenn es so ist, würde es mich nicht wundern. Schließlich ist die Alster-Residenz eindeutig etwas für die oberen Zehntausend.«
»Okay, dann lass uns dorthin fahren.«
»Gegenvorschlag. Ich fahre alleine. Und du könntest in der Zeit mit dieser Frau Kramer sprechen.«
»Du meinst die Pflegedienstleiterin, die Frau Stemann erwähnte?«
»Genau. Denk dran, was Tilmann Runge gesagt hat. Wir sollten den Täter in den Reihen der Mitarbeiter suchen. Die Frau kann uns dabei am ehesten weiterhelfen. Danach telefonieren wir uns wieder zusammen. Oder wir sehen uns auf dem Präsidium. Vielleicht landet einer von uns einen Treffer. Einverstanden?«
»Ja, einverstanden«, erklärte Takeda. Dann sah er Claudia fragend an: »Aber wie willst du dorthin kommen? Wir sind mit meinem Wagen gefahren. Soll ich dich hinbringen?«
Claudia winkte ab. »Einer der uniformierten Kollegen kann mich fahren. Ist kein Problem. Und Ken …«
»Ja?«
Sie trat auf ihn zu, nahm ihm die Zigarette aus dem Mund und trat sie auf dem Asphalt aus. »Du rauchst zu viel. Das ist nicht gut für dich.«
Er lächelte, auch wenn seine Augen traurig blieben. »Andere Dinge in meinem Leben sind noch weniger gut für mich.«
10.
Takeda steuerte seinen Dienstwagen von Wellingsbüttel in südlicher Richtung nach Altona, in den Ortsteil Ottensen. Dort wohnte Merit Kramer, die Pflegedienstleiterin der Residenz.
Warum fuhren er und Claudia nicht gemeinsam dorthin? Anschießend dann ebenso gemeinsam zur Familie Sieversen, die möglicherweise den anonymen Brief geschrieben hatte? Weil es schnell gehen musste? Sicher. Aber auch, weil Claudia die Zeit ihres Zusammenseins eben doch reduzieren wollte.
Es würde nicht mehr so sein wie früher. Egal, was Claudia sagte. Nie mehr.
Takeda klopfte sich eine Mild Seven, seine japanische Stammmarke, aus der Packung und zündete sie an. Eigentlich durfte er in dem BMW, einem Dienstwagen, nicht rauchen. Jeder ging davon aus, dass er sich strikt daran hielt. Weil er Japaner war. Die hielten sich ja bekanntlich immer an alle Regeln.
Takeda nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette und blies lächelnd den Rauch aus.
Merit Kramer empfing ihn in der Tür ihrer Altbauwohnung, unweit des Spritzenplatzes im Zentrum von Ottensen. Takeda schätzte sie auf Mitte vierzig, auch wenn es ihm immer noch schwerfiel, das Alter von Deutschen, überhaupt von Europäern richtig einzuschätzen. Sie war schlank, etwa so groß wie er. Ihr dunkles Haar trug sie kurz geschnitten, was ihr hageres Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den großen Augen zur Geltung brachte. Eine schöne Frau.
Im Moment wirkten ihre Züge allerdings geprägt von Erschöpfung und Trauer. Sie schien unendlich müde zu sein.
»Kommen Sie herein«, sagte sie und gab die Wohnungstür frei. Dann stockte sie, sah Takeda zum ersten Mal richtig an, kniff