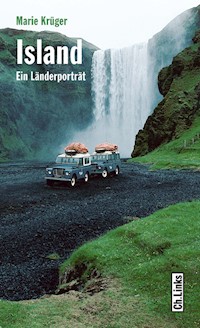
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Länderporträts
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Bis vor wenigen Jahren assoziierten die Deutschen mit Island vor allem unberührte raue Landschaften, heiße Quellen und Fischfang. Das änderte sich, als 2008 Bankenkrise und wirtschaftliche Turbulenzen weltweit für Schlagzeilen sorgten und zwei Jahre später die Asche des Eyjafjallajökull den internationalen Flugverkehr lahmlegte.
Marie Krüger, die seit mehr als zehn Jahren zwischen Reykjavík und Berlin pendelt, lässt sich weder von Katastrophenmeldungen noch von idyllischen Naturvorstellungen den Blick auf jenen Inselstaat verstellen, der geographisch wie kulturell zwischen Europa und Amerika liegt. Sie schreibt von der jahrhundertelangen Friedfertigkeit der Isländer, ihrem Faible für das Mittelalter, von einer ausgeprägten Blogger-Kultur und Geländewagen im Stadtverkehr, vom ersten weiblichen Staatsoberhaupt der Welt und komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen. Eine echte Entdeckungsreise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Ähnliche
Marie Krüger
Island
Ein Länderporträt
Ch. Links Verlag, Berlin
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
2., aktualisierte Auflage, Juli 2020
entspricht der 2. Druckauflage vom Juli 2020
© Christoph Links Verlag GmbH, 2011/2020
Prinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Karte: Christopher Volle, Freiburg
ISBN 978-3-96289-051-3
eISBN 978-3-86284-173-8
Inhalt
Vorwort
Zwischen den Kontinenten
Europäische Pioniere unter amerikanischem Schutz
Freund oder Feind: Europa oder Amerika?
Englisch oder Dänisch?
Das gelobte Land: Kanada oder Skandinavien?
Die nördlichste Hauptstadt der Welt
Kranzkuchen und Hamburger
Willkommen zu Hause!
Die goldenen Zeitalter: Mittelalter und Nationalromantik
Texte, Sprache und Bildung: Von Götterliedern, Elfen und Blogs
Natur und Technik: Von Perlmuttwolken, Lawinen und Aluminiumhütten
Unabhängigkeit und Individualität: Von Republikgründung bis Kabeljaukrieg
Demokratie und Gleichheit: Von Godentümern bis Verfassungsrat
Geld und Besitz: Von Fischereirecht bis Wohnwagen
Wessen Sohn? Wessen Tochter?
Guðrún und Jón: Mehr als nur Namen
Die Sippe ist heilig
Der gläserne Isländer
Die Wunschverwandten: Egill, Snorri, Jón, Jónas, Halldór, Vigdís und Björk
Islands Frauen oder Wer ist »die Frau vom Berg«?
Familie Gunnarsson/Jónsdóttir
Die Toten mittendrin
Nachwort: Inspired by Iceland
PS: Und dann kam Covid-19 …
Anhang
Literatur und nützliche Internetseiten
Übersichtskarte
Basisdaten Island
Vorwort
Es fing alles mit zwei kleinen Stücken schwarzer und roter Lava an, die mir als Kind in die Hände fielen und mich erstaunten, weil sie so leicht waren. Als meine Eltern mir dann erzählten, dass beide vor nicht allzu langer Zeit noch flüssiges Gestein gewesen waren, war mein Interesse für Island geweckt. Heute weiß ich, dass Island ein sogenannter Hot Spot ist, wo ungewöhnlich heißes Gestein aus dem Erdinneren nach oben strömt und dabei alles, was sich über dieses Gebrodel schiebt, immer weiter abschmilzt. Es ist, als fräse sich eine Flamme von ganz weit drinnen nach und nach durch alle über ihr liegenden Schichten. Das dabei eingeschmolzene Material muss irgendwo hin, kommt früher oder später an die Erdoberfläche, erkaltet und bildet Paradiese wie die Azoren, Madeira, Hawaii oder eben Island – die größte Vulkaninsel der Welt.
Über einen anderen Zufall entdeckte ich zu Schulzeiten die mir völlig unverständlichen Gedichte der Lieder-Edda. Ich fand die Vorstellung faszinierend, dass Menschen sich solche Storys voller absurder Gestalten, seltsamer Begegnungen und auf den ersten Blick unlogischer Handlungsverläufe ausgedacht haben sollten. Später lernte ich, dass die Texte nicht nur wegen ihrer Stoffe, sondern vor allem wegen ihrer Sprache so bedeutend seien. Mein Staunen darüber war zusammen mit den Lavastückchen der Ausgangspunkt für meine nun schon mehr als zwanzig Jahre andauernde Erkundung des isländischen Alltags.
Die Prioritäten haben sich unterdessen genauso verschoben, wie Island sich verändert hat. Es kann noch so genau kartografiert sein; einen Vulkanausbruch, einen Gletscherlauf oder ein Erdbeben später sieht alles schon wieder ganz anders aus. Es ist gerade diese Unberechenbarkeit, die Island so interessant macht und es immer wieder für Überraschungen gut sein lässt. Deshalb kann ein Porträt Islands auch nicht dem einen roten Faden folgen, vielleicht aber drei verschiedenen.
Der erste ergibt sich beim Blick auf Islands geografische Lage und heißt hier »Zwischen den Kontinenten«. Island liegt gut sichtbar zwischen Amerika und Europa – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Osten des Landes befindet sich auf der eurasischen, der Westen auf der nordamerikanischen Kontinentalplatte. Das Driften mal in die eine, mal in die andere Richtung ist aber auch kennzeichnend für Islands politische Stellung in der Welt, denn im Laufe seiner Geschichte hat es sich mal mehr an den Ländern Nordeuropas, mal mehr an denen Nordamerikas orientiert. Dieses Pendeln offenbart sich im Alltag zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht in der Schule, bei Auswanderungswellen und Essgewohnheiten genauso wie im Stadtbild Reykjavíks.
Mit Velkominn heim! – »Willkommen zu Hause!« werden am Flughafen in Keflavík Isländer oder all jene begrüßt, die Isländisch verstehen. Ich habe diesen Satz schon aus dem Mund der Frau am Bankschalter vernommen, aber auch von einem Zollbeamten gehört. Zudem prangt er auf einem Plakat, an dem man auf dem Weg zum Gepäckband vorbeikommt, und an der Parkplatzausfahrt. Es genügt offenbar, dass ich isländisch spreche, um »zu Hause« willkommen geheißen zu werden, denn sowohl der Bankangestellten als auch dem Zollbeamten musste klar sein, dass ich keine gebürtige Isländerin bin. Als Schachlegende Bobby Fischer 2005 die isländische Staatsbürgerschaft annahm und aus Japan, wo ihm die Abschiebung in die USA drohte, nach Island kam, wurde seine Ankunft live im isländischen Fernsehen übertragen – unter der Überschrift: »Velkominn heim!« Was aber macht einen Isländer neben Staatsbürgerschaft und Sprachkenntnissen zu einem Isländer? Die Wertvorstellungen und identitätsstiftenden Momente stehen im Mittelpunkt des zweiten Kapitels, wo es unter anderem um den Umgang der Isländer mit »ihren« Texten, Natur und Technik, aber auch Freiheit, Geld und Besitz geht. Inwieweit Haifisch, Trachten, Sagas, Milchtüten, Pferde, die Jagd, Schwimmbäder, der Präsident, britische Trawler, Autofahren, Leuchttürme und Kredite ein Heimatgefühl stiften, wird hier erzählt.
Der rote Faden im dritten Kapitel ist die Genealogie. Mit »Wessen Tochter bist du?« bzw. »Wessen Sohn bist du?« fragt man auf Isländisch nach dem Nachnamen und landet schnell bei den urisländischen Themen »Abstammung« und »verwandtschaftliche Verhältnisse«. Schon die ältesten überlieferten Texte handeln davon und somit von den Menschen. Im dritten Kapitel geht es also um »die Isländer«, ihre Namen, ihre Helden, die Frauen sowie ihre Einstellungen zu Verwandtschaft, Familie, Privatsphäre und Tod.
Auch wenn Isländisch und Deutsch derselben Sprachfamilie angehören, sind die Möglichkeiten zur Übersetzung hin und wieder begrenzt. Ich versuche mein Bestes, die spezifischen Bezeichnungen entweder zu übertragen oder zu erklären, glaube aber auch, dass man manchmal dem isländischen Wort ansehen kann, was es meint. Deshalb wird es ab und zu isländische Bezeichnungen geben, wobei es zu Abweichungen zwischen beiden Sprachen kommen kann, was den Artikel angeht. So ist Buch auf Isländisch weiblich und Gemeinde sächlich, weshalb es im Folgenden die Landnámabók und das Ásatrúarfélag heißt.
Das Nachwort ist der Versuch einer Bestandsaufnahme im Jahr 2020. Es baut, wie alle anderen Kapitel auch, auf persönlichen Eindrücken, Interpretationen und Erfahrungen auf und erhebt nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein. In Wirklichkeit gibt es so viele Islandporträts, wie es Islandbesucher gibt. Außerdem liegt es in der Natur der Sache, dass nie alles erzählt werden kann, denn Island ist ja ein Hot Spot an Überraschungen.
Zwischen den Kontinenten
Europäische Pioniere unter amerikanischem Schutz
Geografisch ist Island ein sehr junges Land, das sich fortlaufend verändert und neu entsteht. Als vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier von der Erde verschwanden, gab es Island noch nicht. Wo nordamerikanische und eurasische Platte auseinanderdriften, gibt es einen sogenannten Mantel-Plume – einen ständigen Strom magmatischen Materials, das hin und wieder als Lava die Erdoberfläche erreicht. Der jüngste Teil Islands ist die Insel Surtsey, die südwestlich des Festlandes liegt und 1963 vor den Augen der Weltöffentlichkeit entstand. Sie ist heute Sperrgebiet und nur für Forscher geöffnet. Im Grunde ist der Alltag in Island also ein permanenter Tanz auf dem Vulkan. Dessen sind sich alle bewusst und entsprechend ruhig laufen die Reaktionen bei Vulkanausbrüchen ab. Als sich 1973 eines Nachts mitten auf der dicht besiedelten Hauptinsel der Westmännerinseln eine Erdspalte öffnet und Lavafontänen in die Luft schießen, verlassen etwa 4000 Menschen ruhig und geordnet ihre Heimat, ohne zu wissen, ob und wann sie zurückkehren würden. Ähnlich gelassen sind die Reaktionen, als zu Beginn des Jahres 2010 der Vulkan unter dem Eyjafjalla-Gletscher ausbricht und zumindest die Bauernhöfe an seinem Fuße bedroht. In zahlreichen Fernsehinterviews schildern die Anwohner, dass sie vorerst bleiben wollten, schließlich könne ein Ausbruch genauso plötzlich enden, wie er begonnen habe.
Diese Abgeklärtheit in Hinblick auf natürliche Gegebenheiten wird sich schon bei den allerersten Siedlern gefunden haben, die in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts von Nordeuropa aus die Reise wagten, um auf einem Flecken Land zu siedeln, der ihnen auf den ersten Blick sehr unwirtlich erschienen sein muss. Im Angesicht der Gletscher war dann auch die Namensgebung naheliegend: Eisland – Island. Dies in Kauf zu nehmen und nicht zu wissen, ob und wie Ackerbau, Viehzucht und Jagd glücken könnten, zeugt von einem stoischen Optimismus und gewissen Leichtsinn – Eigenschaften, die auch die Investmentbanker an den Tag gelegt haben, die 2008 entscheidend zum Zusammenbruch der Isländischen Krone beigetragen haben.
Entgegen der etablierten Meinung, die Besiedlung Islands sei hauptsächlich von Norwegen aus geschehen, zeigen neueste genetische Untersuchungen, dass ein Großteil der Siedler von den keltischen Orkneys, Hebriden und Shetlandinseln gekommen sein muss. Mitten in Reykjavík findet sich eine interessante Ausstellung, die die Besiedlung Islands mithilfe eines an Ort und Stelle gefundenen Siedlungsrests erklärt und greifbar macht. Die Isländer können bei der Suche nach ihrem Ursprung nicht auf Völkerwanderung und Stammesgeschichte zurückblicken. Umso bemühter sind sie, ihr Jahr null zu finden, das lange bei ungefähr 874 vermutet wurde – einer Zeit also, zu der das lateinische Alphabet kaum etabliert war. Die Zeitangabe stammt aus der Landnámabók (»Buch von der Landnahme«), einer schriftlichen Quelle aus dem 13. Jahrhundert, und muss kritisch bewertet werden. Deshalb trägt die Ausstellung auch den Titel Reykjavík 871 ± 2, denn die gefundenen Siedlungsreste stammen aus dem Zeitraum zwischen 869 und 873, was wiederum nicht bedeutet, dass nicht schon vor 869 in Island gesiedelt wurde.
Archäologische Funde und deren Untersuchung wiegen bei der Suche nach dem Ursprung heute schwerer als das Vertrauen auf die schriftliche Überlieferung, die für Island enorm identitätsstiftend gewirkt hat. Aus keinem anderen europäischen Land sind so viele mittelalterliche Quellen – noch dazu in der eigenen Sprache – überliefert. Deshalb treffen in Reykjavík 871 ± 2 drei Komponenten aufeinander, die für das Selbstverständnis der Isländer entscheidend sind: Abstammung, mittelalterliche Schriftkultur und Vertrauen in technologische Entwicklungen.
Warum die ersten Siedler ihre Heimat verlassen haben, wird nach wie vor viel diskutiert. Fest steht, dass sie über gewissen Reichtum verfügt haben müssen. In Nordeuropa nahmen die Auseinandersetzungen zwischen immer stärkeren Bauern und König Harald Schönhaar zu, der in Norwegen ein Steuer- und Lehnsystem einführte, dem sich einige mächtige Männer nicht beugen wollten. Außerdem wuchs die Bevölkerung im 9. Jahrhundert in Nordeuropa sprunghaft an. Da zu dieser Zeit technische Fortschritte im Schiffbau erzielt wurden, eröffnete sich die Möglichkeit zur Seereise, von der die Wikinger Gebrauch machten, als sie von etwa 800 bis 1050 Gebiete in Schottland, Irland, Frankreich, England sowie Osteuropa und später auch in Südeuropa besetzten. Dabei kamen sie auch immer weiter nach Norden und siedelten erst auf den Färöer Inseln zwischen Norwegen und Island und schließlich in Island selbst. Um das Jahr 900 erreicht der Strom der Aussiedler seinen Höhepunkt, und mit einiger Sicherheit ist davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt etwa 20 000 Menschen in Island lebten. Insofern muss die Besiedlung Islands auch als typisches Phänomen einer Ära gesehen werden, die den Namen Wikingerzeitalter trägt.
So ist es nicht erstaunlich, dass die Isländer gern auf die Wikinger als ihre Vorfahren verweisen, doch ist dies wohl nur die halbe Wahrheit. Genetische Untersuchungen zeigen, dass zwar das Gros der männlichen Siedler aus dem skandinavischen, der Großteil der Frauen jedoch aus dem keltischen Raum kam. Das legt die Vermutung nahe, die Siedler hätten auf ihrer Überfahrt nach Island keltische Sklavinnen an Bord genommen oder aber zuerst keltisches Land erobert und/oder dort gesiedelt, bevor sie weiter nach Norden fuhren. Island musste zudem – im Gegensatz zu Irland und England – weder erobert noch später verteidigt werden, da es ja menschenleer war. Dennoch wird das Stereotyp des Wikingers gern bemüht, wenn die Isländer bei Spielen ihrer Fußball- oder Handballnationalmannschaft nicht nur Schals in Rot und Blau, sondern auch Helme mit Hörnern tragen. Und auch als Souvenir ist der Wikinger allgegenwärtig, was vermutlich daher rührt, dass das Wort Wikinger zum Beispiel im Englischen zum Synonym für Nordeuropäer geworden ist.
Ein Grund, sich in Island niederzulassen, war, dass es genug weites Land und eine Natur voller essbarer Tiere wie Seevögel, Fisch und Robben gab. Kriegerische Auseinandersetzungen waren kaum zu erwarten, und die Aufteilung des Landes geschah wohl relativ friedlich, eben weil es genug Raum gab und es sinnlos gewesen wäre, mehr Land zu beanspruchen, als man bewirtschaften konnte. Auch das will nicht so recht zum Bild des kriegerischen Berserkers passen, und es ist gerade Friedfertigkeit, die die isländische Geschichte in großen Teilen kennzeichnet.
Neben Gelassenheit, Mut und gewissem Startkapital waren auch technische Kenntnisse vonnöten, um die Seereise zu bewältigen. Für die Islandfahrt wurde meist ein besonderer Schiffstyp, die sogenannte Knorr verwendet, die wendiger als die für die Wikinger typischen Langschiffe war, schwere Ladung aufnehmen konnte, den Reisenden aber erstaunlich wenig Schutz bot. Der beeindruckende, originalgetreue Nachbau eines solchen Schiffes in einem Museum ganz in der Nähe des Internationalen Flughafens erlaubt es, sich ein Bild von den unfassbaren Lebensbedingungen an Bord zu machen. Auf diesem Schiff segelten im Jahr 2000 tatsächlich neun Isländer nach New York, um den Spuren Leif Erikssons zu folgen, von dem später noch berichtet wird. Außer Menschen kamen Haushaltsgegenstände, heidnische Reliquien und Haustiere mit an Bord. Die damals eingeführten Hühner, Rinder, Hunde, Schafe und Pferde sind die Urahnen der heutigen isländischen Rassen, die dem modernen Island als Werbeträger dienen.
Doch die Siedler importierten auch das Thing-System, das sich bei vielen germanischen Stämmen etabliert hatte, und legten so die Grundlage für eine Selbstverwaltung. Bei Versammlungen besprachen sich die mächtigen Männer und fällten gemeinsam Entscheidungen und Richtersprüche auf Grundlage der mitgebrachten norwegischen Rechtssprechung. Zudem wurde der Boden schon in den ersten Jahren der Besiedlung verbindlich untereinander aufgeteilt. Wuchs die Bevölkerung an einem Ort besonders, wurde das Land einer Sippe in mehrere kleine Einheiten aufgeteilt. Island war somit anfänglich für mittelalterliche Verhältnisse erstaunlich »demokratisch«, ja »republikanisch« organisiert. Das Ende der Besiedlungszeit markiert das Jahr 930, in dem die gesamtisländische Thingversammlung, das Alþingi, erstmals zusammentrat. Auch hier gilt, wie immer, wenn von den ersten Jahrhunderten die Rede ist, dass die schriftliche Überlieferung erst 200 bis 300 Jahre später beginnt und die Angaben somit vage bleiben müssen. Nichtsdestotrotz transportiert die unsichere Tradierung Geschichte(n), die für Islands Selbstverständnis so wichtig ist (sind), dass es fast schon eine geringere Rolle spielt, ob es sich um tatsächliche Ereignisse oder Mythen handelt. Besiedlung, Gründung des Alþingi, Selbstverwaltung und wikingisches Erbe sind in der allgemeinen Vorstellung zu Fakten geworden.
Wer Island, wie es heute ist, verstehen will, muss über den europäischen Tellerrand hinausblicken. Ziemlich genau tausend Jahre nach der Landnahme kam es nämlich zu einer Art zweiten Besiedlung, die für das heutige Island wohl genauso prägend wie die Landung der Nordeuropäer war. Am 9. April 1940 besetzt Deutschland Dänemark, dessen König auch Staatsoberhaupt der Isländer ist, auch wenn die ihre innenpolitischen Angelegenheiten seit 1918 selbstständig regeln. Großbritannien nimmt sofort Kontakt mit Island auf, weil es fürchtet, dass Island das gleiche Schicksal wie Dänemark ereilen könne. Am Morgen des 10. Mai 1940 landen Kriegsschiffe im Hafen von Reykjavík. 2000 britische Soldaten dringen ins Stadtzentrum vor, riegeln es ab und nehmen den deutschen Botschafter in Gewahrsam. Die isländische Regierung protestiert zwar, ruft jedoch gleichzeitig die Bevölkerung dazu auf, die Soldaten als Gäste zu behandeln, die lediglich verhindern wollen, dass Deutschland sein Einflussgebiet auf Island ausdehne. Die Briten versprechen, sich aus den inneren Angelegenheiten Islands herauszuhalten, und beginnen sogleich mit dem Errichten von Unterkünften und Niederlassungen im ganzen Land und dem Ausbau der Infrastruktur – beispielsweise dem Bau des Flughafens mitten in Reykjavík.
Churchill und Roosevelt vereinbaren 1941, dass die Amerikaner Island übernehmen. Weil die USA noch nicht in den Krieg eingetreten sind, soll die isländische Regierung sie offiziell um den Wechsel bitten. Im Sommer 1941 stimmt diese unter der Bedingung zu, dass die Freiheit und Selbstständigkeit der Isländer gewahrt werden und die Amerikaner bei Kriegsende sofort abziehen. Am 7. Juli 1941 wird der Vertrag über den militärischen Schutz Islands durch die USA unterzeichnet, sodass Island kein besetztes Land mehr ist, aber seine seit 1918 verfolgte Politik der politischen Neutralität aufgibt. Es ist außerdem das erste europäische Land, in das amerikanische Soldaten während des Zweiten Weltkrieges ihren Fuß setzen.
Der Ausbau der Infrastruktur durch Briten und Amerikaner lässt die Arbeitslosigkeit auf der Insel quasi über Nacht verschwinden. Plötzlich ist die isländische Arbeitskraft ein wertvolles Gut. 1942 arbeiten etwa 4000 Isländer für die Armee. Dabei werden nicht nur Gebäude, Straßen und Flugplätze gebaut sowie Häfen vergrößert, sondern auch Dienstleistungen wie Wäschereinigung und Bewirtung für die Soldaten übernommen. Die Lebensmittelindustrie gewinnt aufgrund des Krieges in Europa an Bedeutung, da die Nachfrage nach isländischem Fisch steigt. Dies eröffnet den isländischen Arbeitnehmern plötzlich die Möglichkeit, Forderungen zu stellen. Die Gewerkschaften können in den Kriegsjahren ihre größten Erfolge verzeichnen und die umfassendsten Lohnerhöhungen aller Zeiten, gesetzlich garantierten Urlaub, die Bezahlung von Überstunden und den Acht-Stunden-Tag durchsetzen.
Gleichzeitig bringt die »Britenarbeit« (bretavinnan) auch Probleme mit sich. Viele Bauern widmen sich ganz der lukrativen Tätigkeit für die Besatzer bzw. Beschützer und »vernachlässigen« so die Versorgung der eigenen Bevölkerung. Außerdem versuchen sowohl Regierung als auch Armee der sich ausweitenden Streiks Herr zu werden, indem sie sie verbieten. Dies führt zwar dazu, dass die Gewerkschaften keine Streiks mehr ausrufen. Die Arbeitnehmer bleiben ihren Arbeitsplätzen dennoch fern. In der Folge müssen Soldaten deren Aufgaben übernehmen, was als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten gewertet wird. Es werden sogar isländische Aktivisten, darunter auch ein Abgeordneter, verhaftet und nach Großbritannien verbracht.
Heute überwiegen die positiven Erinnerungen an die Zeit der »Besetzung« durch die Briten und des Schutzes durch die Amerikaner. Neben ihrem Know-how und der Nachfrage nach Arbeitskräften bringen vor allem die Amerikaner auch technische Neuerungen wie Bagger und Geländewagen mit ins Land, die den Isländern lieb und teuer werden und ihnen auch nach Kriegsende von großem Nutzen sind. 1944 besitzt Island aufgrund des stark angewachsenen Exports einen größeren Devisenfonds als jemals zuvor und legt so die Grundlage für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, der eigentlich erst 2008 ein jähes Ende nimmt. Das agrarisch geprägte Land der Bauern und Fischer, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den ärmsten in Europa zählt, ist über Nacht eine neureiche Nation geworden, während der Rest des Kontinents seine schwärzesten Stunden erlebt.
In den Jahren 1941 bis 1945 werden – in jeglicher Hinsicht – die Grundlagen für das spezielle Verhältnis zwischen den USA und Island gelegt, denn der Kontakt zwischen Amerikanern und Isländern findet auf allen Ebenen statt. Die Baracken für die Soldaten werden größtenteils als Fertigbauten geliefert und überall aufgebaut, wo Platz ist. So entstehen neben den Enklaven der Armee auch gemischte Siedlungen, in denen Warentausch und Schwarzhandel blühen. Kneipen und Gaststätten sprießen aus dem Boden, und Reykjavík erlebt zum ersten Mal das wilde Nachtleben, für das es in den 1990er Jahren weltweit berühmt wurde. Die Nachfrage nach Alkohol steigt so enorm an, dass Versuche unternommen werden, über den Verbrauch Buch zu führen und die Zuteilung zu rationieren.
Und natürlich entwickeln sich auch Beziehungen anderer Art zwischen den Soldaten und einheimischen Frauen. Dieser »Zustand« (ástandið) des Männerüberschusses ist genauso zu einem festen Begriff geworden wie die »Britenarbeit« und wird von vielen Männern und einigen Frauen als so bedrohlich empfunden, dass auch hier Versuche zur Sanktionierung gestartet werden. So wird der Vorschlag, Frauen zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens den Zutritt zum Hafengelände zu verbieten, abgelehnt. 1942 leben 122 000 Isländer auf der Insel, darunter 40 000 Frauen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die auf etwa 50 000 Soldaten treffen. Es wird ernsthaft befürchtet, es gäbe nicht mehr genug Frauen für isländische Männer, dafür aber einen moralischen Verfall, da plötzlich viele uneheliche Kinder zur Welt kommen. Sie und ihre Mütter werden oft noch jahrelang gesellschaftlich ausgegrenzt.
Außer für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen die Amerikaner auch für erhebliche Veränderungen im kulturellen Leben. Zwar gelangen bereits nach dem Ersten Weltkrieg moderne Strömungen über Zeitungen, Zeitschriften, Schallplatten und Touristen kontinuierlich nach Island. Dennoch wird es den Amerikanern zugeschrieben, beispielsweise Jazz und Spielfilme im großen Stil im breiten Bewusstsein etabliert zu haben. Die Isländer können während des Zweiten Weltkrieges regelmäßig ins Kino gehen und sich mit der neuesten Mode auseinandersetzen. Schon kurz nach Kriegsende kommen amerikanische Filmstars nach Island, das 1944 Republik wird. Seit 1952 sendet ein amerikanisches Radioprogramm, dem 1954 ein Fernsehsender folgt – elf Jahre, bevor das isländische Fernsehen auf Sendung geht. Parallel werden Stimmen laut, die durch den Einfluss des »Amisenders« (kanasjónvarp) die einheimische Kultur und gar die isländische Sprache in Gefahr sehen. Der amerikanische Fernsehsender durfte schließlich immerhin bis 1974, der Radiosender sogar bis zum Truppenabzug 2006 senden. Nicht zuletzt deshalb wirkt der amerikanische Lebensstil prägend für die neugierige junge Generation, die in einer freien und plötzlich wohlhabenden Republik lebt und sich somit gewisser Kaufkraft erfreut.
Die Kriegsjahre bringen also eine Loslösung Islands auf zwei Ebenen mit sich: Zum einen wird 1944 die Autonomie durch die Unabhängigkeit gekrönt und Island so von seiner jahrhundertelangen Zugehörigkeit zum Königreich Dänemark und damit in gewisser Weise auch von Europa abgekoppelt. Zum anderen wendet sich die junge Republik den USA zu, die die Industrialisierung des Inselstaates enorm vorantreiben und – entgegen der ursprünglichen Vereinbarung – auch nach Kriegsende im Land bleiben. Es sind der Frei- und Pioniergeist der ersten Siedler, die Besinnung auf das mittelalterliche kulturelle Erbe und der American way of life, die identitätsstiftend für die Isländer wirken.
Freund oder Feind: Europa oder Amerika?
Auch wenn es pathetisch klingt: Das nationale Herz schlägt direkt über der Kontinentaldrift und so gesehen sowohl in Amerika als auch in Europa. Der isländischste aller Orte heißt Þingvellir (»Thingfeld«), liegt unweit des Hauptstadtgebietes im Landesinneren und gehört zusammen mit dem aktiven Geysir Strokkur und dem Wasserfall Gullfoss zum sogenannten golden circle. Meine allerersten isländischen Vermieter betrachteten es offenbar als ihre staatsbürgerliche Pflicht, mir, kaum dass ich meine Taschen ausgepackt hatte, diesen Ort zu zeigen, denn hier haben die Isländer ihre wichtigen Entscheidungen getroffen und jahrhundertelang über Recht und Unrecht bestimmt.
Das Jahr 930 gehört zu den Sternstunden der isländischen Geschichte und jedes Kind kennt diese Jahreszahl, da sich damals die wichtigen Männer des Landes wohl erstmals in Þingvellir versammelten. Die Wahl fiel auf genau jenes, damals noch namenlose Plateau als Versammlungsort, da es sich in der Nähe der seinerzeit wichtigsten Siedlungen befand und aus allen vier Himmelsrichtungen gut zu Pferd zu erreichen war. Bis 1798 fand hier einmal jährlich die »nationale« Thingversammlung, das Alþingi statt – unter günstigen natürlichen Bedingungen: Es gab genug ebene Fläche zum Errichten der Lagerstätten, Feuerholz, Trinkwasser, Schutz vor Wind und eine Art natürliche Bühne. Von dem sogenannten Lögberg, dem Gesetzesberg, wurden eben wichtige Entscheidungen, Nachrichten und die gültigen Gesetze verkündet.
Da der Ort ständig in Benutzung war, gibt es bis auf die Reste einiger Thinghütten nichts wirklich Altes zu besichtigen. Man wird aber anhand von angelegten Wegen, Bild- und Texttafeln über das Feld geleitet, wo an vielen Stellen die Kontinentaldrift beeindruckend sichtbar ist und man einen von Islands größten Seen, den schönen Þingvallavatn (»Thingfeldsee«) betrachten kann. Man spürt anhand der Aufbereitung, wie wichtig die Stätte den Isländern war und ist. Themen, die Þingvellir betreffen, können die Gemüter erhitzen – egal, ob es um die Frage nach einem Ehrenfriedhof, der »richtigen« Bepflanzung oder um die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands geht, der im Zweifel eine Brücke zum Opfer fallen würde. Zum 1000. Geburtstag des Alþingi wurden neben der Kirche aus dem Jahr 1859 kleinere Häuser errichtet, die heute als Sommerresidenz des Ministerpräsidenten dienen. So wurde letztlich auch die – für isländische Verhältnisse neue – Institution der Regierung, die es hier erst seit dem 20. Jahrhundert gibt, mit dem nationalen Herzort verbunden, an dem Parlament und Gerichtsbarkeit schon immer gegenwärtig waren. Deshalb fanden hier in den Jubeljahren alle Nationalfeiern statt. 1874 waren 1000 Jahre Besiedlung und die erste Verfassung der Anlass, 1930 feierte das Alþingi seinen 1000. Geburtstag, 1944 wurde hier die Republik ausgerufen, was 50 Jahre später nochmals Anlass für eine große Party in þingvellir war, und im Jahr 2000 feierte man 1000 Jahre Christentum. Diese Daten sind für die Isländer von immenser Bedeutung, weshalb es sich lohnt, sie im Kopf zu haben, da ständig auf sie Bezug genommen wird. Þingvellir hat also geschichtliche, ideologische und geologische Bedeutung, sodass sowohl die Gründung eines Nationalparks im Jahr 1930 als auch die Aufnahme ins Weltkulturerbe der UNESCO im Jahr 2004 geradezu logische Konsequenzen sind.
Gefeiert werden ausschließlich Ereignisse, die etwas mit freier Entscheidung, Unabhängigkeit und Demokratie zu tun haben. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist »Freistaat«, womit die Jahre von der Besiedlung bis 1262 gemeint sind, in denen Island ein freies Land war, seine Obrigkeiten selbst ernannte und die Entscheidungen eben gemeinsam auf den lokalen Thingen und dem Alþingi getroffen wurden. »Freistaat« ist in den Augen meiner isländischen Freunde, die des Deutschen mächtig sind, eine unglückliche Übersetzung, da þjóðveldi eher »Volksreich« bedeutet und exklusiv Island in jener Zeit bezeichnet, während der Begriff »Freistaat« auf Deutsch auch noch anderweitig verwendet wird. Diese Epoche passt in vielem zu heutigen Wertevorstellungen und ist zudem für das mittelalterliche Europa so einzigartig, dass deren Verklärung kaum überrascht. Diese glorreiche »Staatsform« bekam jedoch schon im 12. Jahrhundert erste Kratzer, weil einige Familien begannen, massiv Macht an sich zu reißen. Eigentlich ist spätestens für das Island des 13. Jahrhunderts der Begriff »Freistaat« nicht mehr angemessen, da es de facto eine Oligarchie ohne politisches Gleichgewicht geworden war, die sich zudem in einem heftigen Teufelskreis aus Fehden und Blutrache befand. Irgendwann wussten die Isländer sich offenbar selbst nicht mehr zu helfen und orientierten sich nach Osten, also nach Europa.
1262 wurde ein Vertrag unterzeichnet, der den norwegischen König verpflichtete, den Krieg in Island zu beenden, Isländern die kostenlose Einreise nach Norwegen zu garantieren und das Land von Norwegen aus mit genug Waren zu versorgen, da die Isländer selbst keine Schiffe hatten. Es sollten weiterhin isländische Gesetze gelten und die Möglichkeit bestehen, sich von dem Vertrag loszusagen, wenn der König die Isländer enttäuschte. Auf der einen Seite zwang der Vertrag die Isländer, dem König Steuern zu zahlen. Er setzte außerdem Beamte, meist Isländer, ein, die seine Interessen vertreten und zum Beispiel die Steuern eintreiben sollten. So wurden einerseits die »demokratische« Organisation und das System der Selbstbestimmung ausgehebelt, da die gesetzgebende Gewalt nicht mehr ausschließlich beim Alþingi, sondern eben auch beim König bzw. dessen Gesandten lag. Es dauerte nur ein paar Jahre, bis die Isländer ihre Gesetze im norwegischen Sinne überarbeiteten und die Blutrache abschafften. Auf der anderen Seite kehrte Frieden ein und das »Schreibezeitalter« (ritöld) begann. Dieses ist neben dem Freistaat eine andere glorreiche Epoche der Isländer, in der sie mit den eddischen und skaldischen Gedichten, ihren Chroniken und den Sagas erneut Einzigartiges schaffen, das sie noch heute weltberühmt macht.
Auch wenn sich die Isländer im 14., 15. und 16. Jahrhundert immer wieder auf den Vertrag von 1264 und ihre eigenen Gesetze beriefen, waren sie doch stark von Norwegen und ab 1383 von Dänemark – also Nordeuropa – abhängig. Damals schworen sie Ólafur, dem Sohn des verstorbenen norwegischen Königs und der Tochter des dänischen Königs, die Treue. Als Ólafur im Alter von 17 Jahren starb, verstand es seine Mutter danach, die Vorherrschaft der Dänen in Nordeuropa auszubauen, sodass Island sozusagen sang- und klanglos über Norwegen Provinz des dänischen Reiches wurde. Der Einfluss des jeweiligen Herrschers auf die isländische Gesetzgebung wuchs, zumal der König die oberste Gerichtsbarkeit war. Seine Beamten entwickelten sich zum isländischen Adel, und das Alþingi wurde mal mehr, mal weniger zu einer Institution, die die Interessen des Königs in Island installierte. Die Isländer beharren heute trotzdem darauf, dass in jenen Jahrhunderten das Alþingi noch eine gewisse gesetzgebende und richterliche Gewalt hatte und der König auf der anderen Seite des Ozeans war. Trotzdem begann er spätestens mit der Reformation, die hier 1541 unter Christian III. vollzogen wurde, sich an Island zu bereichern.
In der isländischen Wahrnehmung werden jedoch die Elemente betont, die für ein weiterhin unabhängiges Volk und ein gutes Verhältnis zu Nordeuropa sprechen. Isländische Abhandlungen zur eigenen Geschichte tun sich bis heute schwer damit, Begriffe wie »Unterdrückung«, »Ausbeutung«, »Kolonie« oder »Isolation« zu verwenden. Liest man zum Beispiel den Geschichtsatlas (Söguatlas), der sich an eine breite Masse wendet, finden sich immer wieder Formulierungen wie diese: »Auch wenn die Isländer seit 1262 mit einem ausländischen König und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit einem [dänischen] Handelsmonopol lebten, durften sie größtenteils frei schalten und walten. Die dänische Herrschaft versuchte eigentlich nicht, die Isländer zu irgendetwas zu zwingen, und die meisten waren mit der Regierungsform zufrieden.« Es klingt immer, als wolle man es sich nicht verscherzen.
So wurde im Unionsgesetz von 1918 nicht nur Islands weitgehende Souveränität, sondern auch dessen uneingeschränkte Neutralität festgeschrieben. Island war stets ein unbewaffnetes Land mit wenigen Menschen und somit, wenn es hart auf hart kam, dem Gutdünken der Großmächte ausgeliefert. So konnte es sich zwar 1940 bei der Ankunft der Briten auf seine Neutralität berufen, sie aber nicht durchsetzen. Neutralität war deshalb letztlich immer eher ein frommer Wunsch denn Realität. Diese gewisse Hilflosigkeit ist tief im Bewusstsein verankert, wie mir in Gesprächen immer wieder versichert wird, und könnte mit eine Ursache für das Anlehnen an Europa und Amerika und das gleichzeitige Zurückschrecken vor beiden sein. Ein anderer Grund ist unzweifelhaft, dass Island in wirtschaftlicher Hinsicht schon immer vom Ausland abhängig war und auch immer sein wird, denn es ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen.
In dem Spannungsfeld zwischen »unbedingtem Willen zu Unabhängigkeit« und »auf Andere angewiesen sein« muss auch das Verhältnis zu den USA nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden, in dessen Verlauf Island aufgrund mehrerer glücklicher Umstände die volle Unabhängigkeit erreicht. Schon 1941, mit der Akzeptanz der USA als Schutzmacht, hatte es seine Neutralität aufgegeben und seine zunehmende Orientierung nach Westen begonnen. Zwar war ursprünglich vereinbart worden, dass die Amerikaner bei Kriegsende das Land sofort verlassen, sie äußerten aber den Wunsch, bleiben zu dürfen. Aufgrund der zunehmenden Teilung Europas in eine westliche und eine östliche Interessensphäre wuchs Islands strategische Bedeutung zum Beispiel als Zwischenlandeplatz zwischen Amerika und Europa. Schließlich unterzeichnete die isländische Regierung 1946 einen Vertrag, der die Amerikaner zum Abzug innerhalb von 180 Tagen verpflichtete und den Flughafen in Keflavík den Isländern übereignete. Gleichzeitig sollten die Amerikaner ihn und die dortige Technik jedoch nutzen dürfen, »um ihren Pflichten als Besatzungsmacht in Deutschland« nachkommen zu können. Was das genau bedeutete, wurde nicht ausgeführt. Der »Keflavík-Vertrag« sollte fünf Jahre unkündbar sein. Er wurde mit 32 Stimmen und 19 Gegenstimmen vom Alþingi verabschiedet, was einen Generalstreik zur Folge hatte und die Gemüter so sehr erregte, dass aus der Affäre der Stoff für den Roman Atomstation des späteren Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness wurde.
Es ist heute schwierig nachzuvollziehen, dass so viele Isländer in dem Vertrag die Fortführung der Besetzung und eben eine Einschränkung ihrer Unabhängigkeit sahen. Ich habe oft erlebt, dass dieses Thema Menschen, die 1946 schon geboren waren, auch heute noch einen hochroten Kopf beschert – entweder weil sie sich über die Unterzeichnung noch immer empören oder weil sie sich weiterhin über die Proteste echauffieren. Ein Grund war sicherlich, dass die unabhängige Republik Island gerade erst zwei Jahre alt war und deshalb auf die militärische Präsenz einer Großmacht besonders empfindlich reagierte.
Doch Island setzte seine Orientierung nach Westen weiter fort und schloss nach Ablauf des »Keflavík-Vertrages« als Mitglied der NATO, das es 1949 geworden war, erneut einen Vertrag mit den USA, die Island als unbewaffnetem NATO-Mitgliedsstaat militärischen Schutz garantierten. Zu diesem Zweck blieb die amerikanische Armee auf ihrem Stützpunkt am Flughafen bzw. sie kam dahin zurück, denn die Soldaten hatten infolge des »Keflavík-Vertrages« das Land zwischenzeitlich ja verlassen. Auch der neue Vertrag wurde dem Alþingi erst nach heftigen Protesten der Sozialisten und schon unterzeichnet vorgelegt. 1953 gründete sich eine Partei, deren Hauptziel der Abzug der Amerikaner war und die bei den Wahlen im selben Jahr immerhin zwei Mandate gewann.
Die Opposition erst gegen den Vertrag und dann gegen den Militärstützpunkt flaute auch in den 1960er Jahren nicht ab, als die Gegner sich organisierten und regelmäßig Demonstrationen, Kundgebungen und Unterschriftensammlungen veranstalteten. Zwischendurch gab es immer mal Regierungen, die sich für einen Abzug starkmachten, ihn dann jedoch nicht durchsetzen konnten. Man kann sagen, dass im Hinblick auf die Militärbasis in Keflavík niemals Einigkeit herrschte und das Thema von 1941 bis 2006 immer irgendwie aktuell war. Es fanden allerdings keine Proteste statt, als mit großzügiger finanzieller Unterstützung durch die USA und die NATO der Flughafen so ausgebaut wurde, dass er seit 1987 dem internationalen Flugverkehr gewachsen und der isländischen Allgemeinheit sehr von Nutzen ist. Über die US-Armee waren über viele Jahre Devisen ins Land gekommen und mehrere hundert Arbeitsplätze gesichert worden. Das wird sicher mit ein Grund für die isländische Unterstützung des Einmarschs der USA im Irak 2003 gewesen sein.
Als im September 2006 der letzte amerikanische Soldat Island verlässt, bedauert die Mehrheit der Isländer den Komplettabzug der Amerikaner – vor allem das bürgerlich-konservative Lager um die – ausgerechnet – Unabhängigkeitspartei. Es gibt aber auch einige jubelnde Stimmen. So bleiben die Bevölkerung und das Land gespalten zwischen der Angst vor Vereinnahmung und der Sehnsucht nach ausländischer Unterstützung.
Englisch oder Dänisch?
Streng genommen ist die Orientierung nach Westen den Isländern von Anbeginn eingeschrieben und begann nicht erst im Zweiten Weltkrieg. Schließlich kamen sie selbst aus östlicher Richtung, um Land westlich ihrer ursprünglichen Heimat zu besiedeln – so auch laut Landnámabók Erik der Rote. Er musste Norwegen wegen eines Tötungsverbrechens verlassen. Demut war offenbar nicht seine Stärke, denn auch in seiner neuen Heimat legte er sich schnell mit seinen Nachbarn an und wurde verbannt. Anstatt in bekannte, südlich gelegene Gefilde segelte er um 985 in westliche Richtung und fand eine Küste, von der er vielleicht schon gehört hatte, die ihm besiedelbar erschien und der er bei seiner Rückkehr aus der Verbannung den euphemistischen Namen Grönland (»Grünland«) gab. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass es zu Eriks Zeiten wirklich wärmer war und er tatsächlich eine grüne Küste gefunden haben könnte. Vielleicht nicht zuletzt deshalb folgten ihm bei seiner Auswanderung dorthin 100 bis 150 Isländer. Die Neugrönländer gingen den isländischen Weg: Sie gründeten ein Thing, traten zum Christentum über und trieben mit Elfenbein aus Walross- und Narwalzähnen Handel mit Norwegen. Im 15. Jahrhundert verliert sich ihre Spur.
Der Entdecker Erik der Rote ist somit einer der wenigen Isländer (oder doch eher Norweger?), die die Bezeichnung »Wikinger« verdienen. Er spielt in zwei Sagas die Hauptrolle und bekam an dem Ort, an dem er es sich mit den Isländern verscherzte, mit Eiríksstaðir ein Museum, das – wie so viele andere im Lande auch – vor allem das Lebensgefühl jener Zeit transportieren soll. Auf Grundlage einiger archäologischer Ausgrabungen vor Ort wurde ein damaliges Wohnhaus nachempfunden, wo kostümierte Isländer am gasbetriebenen Lagerfeuer erklären, wie seinerzeit der Alltag war. Überdachte Texttafeln vermitteln die spektakulärsten Episoden aus Eriks Leben und gehen auch auf seinen Sohn Leif ein.
Dieser muss das West-Gen seines Vaters geerbt haben, da er weiter segelte – entweder weil vor ihm schon ein anderer isländischer Grönländer im Westen Land gefunden hatte, das Leif nun erkunden wollte, oder weil er selbst dort Land vermutete. Vermutlich sah er die Baffin-Insel, Labrador und Neufundland, wo Ausgrabungen eine wikingerzeitliche Siedlung ans Tageslicht brachten. Es steht also außer Frage, dass Nordeuropäer vor Kolumbus in Amerika gesiedelt haben. Leifs »Entdeckung« blieb für die Weltgeschichte jedoch ohne große Folgen, was die Isländer bis heute schmerzt. Stoisch feierten sie im Jahr 2000 die »Entdeckung Amerikas«, die sich ungefähr im Jahr 1000 ereignet haben muss, sowohl mit einer Überquerung des Atlantiks mit einer Knorr als auch mit der Herausgabe einer 1000-Kronen-Münze mit Leifs Konterfei. Ein Jahr später wurde mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Sonderprägung die Leif-Eriksson-Stiftung gegründet, um die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Island und den USA zu vertiefen.
Diese muss auch vorher schon ganz gut funktioniert haben, da die Isländer seit vielen Jahren in den USA studieren, obwohl sich die isländische Hochschullandschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat und ein weiterführendes Studium in vielen Fächern mittlerweile auch hier möglich ist. Interessant ist, dass gerade zum 1000. Jubiläum der »Entdeckung« die Zahl isländischer Studenten in den USA mit knapp 500 am höchsten war. Die meisten von ihnen belegten gesellschaftswissenschaftliche Fächer, Jura und Wirtschaftswissenschaften. Seit 2000 ist die Zahl rückläufig und lag 2017 bei 245 Isländern, die in den USA isländisches Auslandsbafög bezogen. Dennoch halten die USA damit einen Spitzenplatz unter den Ländern, die Isländer zum Studieren bevorzugen.
Die jüngeren Isländer haben eine insgesamt sehr positive Einstellung zu den USA, was auch an deren Allgegenwärtigkeit liegen kann. So wird das Fernsehprogramm – zumindest auf den Privatsendern – von US-amerikanischen Serien und Filmen dominiert. Untersuchungen zeigen, dass heute im isländischen Fernsehen mehr Englisch als Isländisch gesprochen wird, weil die importierten Programme nicht synchronisiert, sondern untertitelt sind. Für 364 000 Menschen würde sich der Aufwand nicht lohnen. Deshalb kommen hier amerikanische Fernsehserien schneller auf den Markt als in Deutschland, wo meine isländischen Bekannten dann das kalte Grauen packt, wenn das Personal von Game of Thrones plötzlich mit überdrehter Stimme deutsch spricht, ohne die Lippen im Einklang zum Gesagten zu haben. Auch Menschen, die in den Nachrichten zu Wort kommen, werden in Island nicht übersprochen. Wird also ein Däne interviewt, hört man ihn dänisch sprechen und muss ihm durch die Untertitel folgen. Deshalb sind die Isländer sehr daran gewöhnt, andere Sprachen zu hören. Vor allem diejenigen, die mit den Privatsendern aufgewachsen sind, haben ausgesprochen gute Englischkenntnisse und einen großen Wortschatz, mit dem sie sehr selbstverständlich umgehen. Englisch ist außerdem seit 1999 die erste Fremdsprache, die die Kinder in der Schule lernen, und längst die Wissenschaftssprache.
Vorher war das Dänische dominierend, das nun im Allgemeinen als zweite Fremdsprache gelehrt wird. Bis Island 1911 seine eigene Universität bekam, musste man zum Studieren nach Kopenhagen, sodass die meisten wissenschaftlichen Texte von Isländern aus jener Zeit auf Dänisch sind. Die Priorität, die dem Dänischen noch immer eingeräumt wird, mag überraschen. Sie ist jedoch weniger eine Reminiszenz an die ehemalige Zugehörigkeit zu Dänemark als vielmehr zu Nordeuropa. Denn auch wenn das moderne Island in vielerlei Hinsicht US-amerikanisch geprägt ist, beruft es sich bei offiziellen Anlässen immer wieder darauf, ein Teil Nordeuropas zu sein. Isländische Gesetze werden oft mit einem Verweis darauf eingeleitet, dass man sich an der in den anderen nordischen Ländern üblichen Rechtsprechung orientiert habe. Island ist u.a. Mitglied des Nordischen Rats, dessen Arbeitssprachen Schwedisch, Norwegisch und Dänisch sind. Deshalb ist das Beherrschen einer dieser Sprachen für Isländer unabdingbar. Viele meiner Freunde fluchen über den Zwang zum Dänischlernen, da sie Französisch, Deutsch oder Spanisch erst als dritte Fremdsprache wählen können. Die wenigsten sind nach dem Abitur wirklich in der Lage, Dänisch zu sprechen, und geben auch ihrer mangelnden Motivation die Schuld daran. Allerdings können es fast alle gut lesen. Mit der Vermittlung von Dänisch schlägt man zudem mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Die weitaus meisten Isländer, die sich für ein Studium im Ausland entscheiden, gehen zu diesem Zweck nämlich nach Dänemark. In Kopenhagen kann man sich nicht sicher sein, mit Isländisch eine »Geheimsprache« zu sprechen. Während besonders nach dem 11. September 2001 ein Studium in den USA schwieriger geworden und dort sowieso sehr teuer ist, ist es in Dänemark gebührenfrei. Außerdem werden Isländer dort – wie in den anderen nordischen Ländern auch – vom Gesundheits- und Sozialsystem aufgefangen und können sich für viele Stipendien bewerben. 2018 bezogen allein 372 Isländer, die ein Vollzeitstudium in Dänemark absolvierten, die dänische Ausbildungsförderung, die in der Regel nicht zurückgezahlt werden muss. Hinzu kommen Hunderte isländische Studenten, die ihren isländischen Studienkredit für ein Studium in Dänemark nutzen. Also liegt der heimelige Wohlfahrtsstaat mit der belächelten Sprache doch näher als die auf Eigeninitiative setzenden USA. Leif Eriksson ließ sich letztlich auch nicht in Nordamerika nieder, sondern kehrte nach Grönland zurück.
Das gelobte Land: Kanada oder Skandinavien?
Die Isländer, die ich kenne, lieben ihr Land und begründen dies mit einem einzigen Satz: Ísland – best í heimi!





























