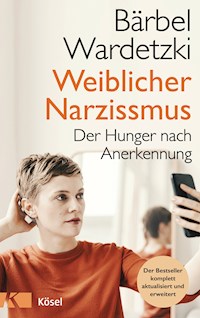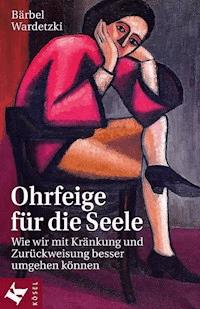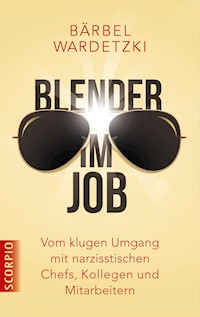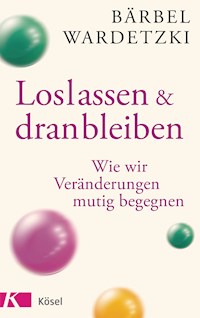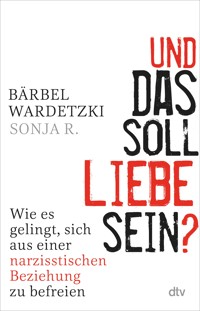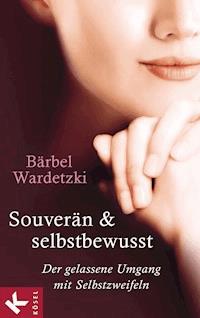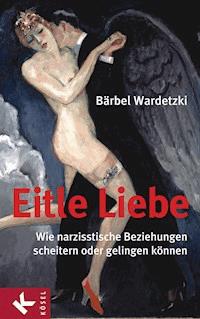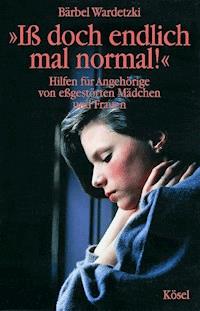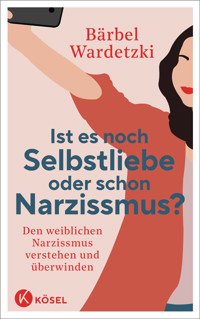
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Von der Autorin des Bestsellers »Weiblicher Narzissmus«
»Dr. Bärbel Wardetzkis neues Buch fasst ihr immens großes Wissen zum Thema Weiblicher Narzissmus kompakt zusammen. Sie ebnet damit vielen Frauen den Weg zum inneren Gleichgewicht.« Caro Matzko, deutsche Moderatorin, Journalistin und Autorin
Fühlt sich dein Leben anstrengend an, weil du immer zerrissen bist zwischen maximal großartig und abgrundtief minderwertig? Kennst du das Gefühl, du müsstest perfekt sein, weil dich sonst keiner mag? Bricht für dich manchmal wegen einer blöden Bemerkung die Welt zusammen? Die Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki erklärt anschaulich, wie du erkennen kannst, ob du vielleicht unter einem weiblich-narzisstischen Persönlichkeitsstil leidest. Sie gibt leicht nachvollziehbare Impulse, um dich selbst besser zu verstehen, dein authentisches Selbst zu entdecken und ein positives Lebensgefühl zu entwickeln.
»Aus der Praxis ins pralle Leben: Bärbel Wardetzki schafft es, die Herausforderungen von Frauen anschaulich zu machen, die zwischen Grandiosität und Selbstzweifeln hin- und hergerissen sind. Ihr neues Buch gibt wichtige Impulse dafür, sich zu akzeptieren – ohne abzuheben – und authentisch mit anderen Menschen umzugehen, ohne sich schwach zu fühlen.« Prof. Dr. Mitja Back, Professor für Persönlichkeitspsychologie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Ähnliche
Der Weg zu innerer Stärke und Lebendigkeit
Frauen mit einer weiblich-narzisstischen Struktur leben im Spannungsfeld von Grandiosität und Selbstzweifeln. Es fällt ihnen schwer herauszufinden, wer sie wirklich sind, und sich selbst so anzunehmen. Da sie Bestätigung von außen brauchen, versuchen sie ihre Zerrissenheit hinter einer perfekten Fassade zu verstecken, was noch mehr Druck aufbaut. Doch wie können sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen? Die Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki zeigt anschaulich, wie sich der weibliche Narzissmus auf das Innenleben und die Beziehungen zu anderen auswirkt und wie man damit umgehen kann. Reflexionen und Impulse helfen, ein ausgeglicheneres Kräfteverhältnis zwischen den unterschiedlichen inneren Anteilen zu schaffen und die eigene Autonomie zu entdecken. So können die Betroffenen sich selbst besser verstehen lernen, ihr Selbstwertgefühl stärken und zu mehr Lebendigkeit und zu erfüllten Beziehungen finden.
Dr. Bärbel Wardetzki, geb. 1952, ist Diplom-Psychologin. Sie ist in München als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach tätig. Darüber hinaus ist sie eine viel gefragte Referentin im In- und Ausland, häufiger Gast bei Funk und Fernsehen sowie erfolgreiche Autorin zahlreicher Bestseller.
Bärbel Wardetzki
Ist es noch
Selbstliebe
oder schon
Narzissmus?
Den weiblichen Narzissmus verstehen und überwinden
Weitere Bücher der Autorin im Kösel-Verlag:
Weiblicher Narzissmus. Der Hunger nach Anerkennung
Eitle Liebe. Wie narzisstische Beziehungen scheitern oder gelingen können
Ohrfeige für die Seele. Wie wir mit Kränkung und Zurückweisung umgehen können
Nimm’s bitte nicht persönlich. Der gelassene Umgang mit Kränkungen
Souverän und selbstbewusst. Der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln
Loslassen und dranbleiben. Wie wir Veränderungen mutig begegnen
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle Methoden, Hinweise, Ratschläge und Vorschläge in diesem Buch sind von der Autorin sorgfältig geprüft worden. Sie ersetzen jedoch keine ärztliche Abklärung. Für eine korrekte Diagnose und entsprechende Behandlung muss stets ein Arzt/eine Ärztin bzw. ein Therapeut/eine Therapeutin aufgesucht werden. Eine Haftung vonseiten der Autorin oder des Verlags wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: Sunrise Cat / Shutterstock.com
Redaktion: Silke Foos, München
Satz: TypoGraphik Anette Bernbeck, Gelnhausen
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-30882-7
www.koesel.de
Für Nora
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Zwischen Selbstzweifel und Grandiosität
Weiblicher Narzissmus, was ist das eigentlich?
Das Erleben im weiblichen Narzissmus
Habe ich eine weiblich-narzisstische Störung?
Sinn und Unsinn von Alltagsdiagnosen
Narzisstische Anteile hat jeder
Wann ist es Selbstliebe, wann ist es Narzissmus?
Die narzisstische Wunde
Sieh mich!
Trennungsangst
Umgang mit Selbstwertverletzungen
Die Sehnsucht nach dem schönen Bild
Ich bin mir selbst fremd
Teil 2 Den weiblichen Narzissmus verstehen und überwinden
Drei Selbstanteile einer narzisstischen Persönlichkeit:die weiblich-narzisstische Fassade
Das Zusammenspiel der drei Erlebnisqualitäten
Entdecke deine drei individuellen Selbstanteile
Selbstdarstellung und die Rolle der sozialen Netzwerke
Impulse zur Veränderung
Wer ist die Authentische?
Der Zugang zu deinen drei Selbstanteilen
Selbstliebe und Selbstakzeptanz
Perfektionistische Ansprüche
Sich mit den Augen der anderen sehen
Selbstkontrolle
Selbstoptimierung: Gut ist nicht gut genug
Leistung
Getriebensein
Neid
Ein Leben in Extremen
Auf- und Abwertung
Das narzisstische Körpererleben
Teil 3 Narzissmus in Beziehungen
Toxische Beziehungen und Kommunikation
Opfer-Täter-Dynamik
Ich fühle mich ausgenutzt
Wenn das Du nicht zählt
Idealisierung und Entwertung
Narzisstische Kränkbarkeit
Die narzisstische Verführung
Macht und Unterwerfung
Das Beziehungsdilemma
Das Verschmelzen zum Milchkaffee
Fehlende Grenzen und Autonomie
Liebe hat ihren Preis
Die Suche nach dem Kick und dem Rausch
Sexualität und Nähebedürfnisse
Ich habe Angst, verlassen zu werden
Das Fehlen von Empathie und einem Wir-Gefühl
Teil 4 10 Impulse für innere Stärke, Autonomie und Selbstliebe
1. Hinterfrage die überhöhten Ideale deiner Großartigen
2. Beende deine Selbstabwertungen
3. Unterstütze dich selbst
4. Stärke deine Selbstakzeptanz
5. Komm vom Kopf in deinen Körper
6. Finde die positiven Seiten deiner drei Selbstanteile
7. Übe Empathie und Mitgefühl
8. Der liebende Blick ist nicht narzisstisch
9. Stärke deine Grenzen
10. Selbstliebe, Selbstbestimmung und ein authentisches Leben
Anhang
Weiterführende Literatur
Online-Kurse
Anmerkungen
Vorwort
Narzissmus ist in der letzten Zeit zu einem Modewort geworden. Jede unangenehme Person ist sofort ein Narzisst oder eine Narzisstin. Ich möchte daher in diesem Buch erklären, was es mit dem weiblich-verdeckten und männlich-offenen Narzissmus auf sich hat, warum wir vorsichtig sein sollten mit Alltags- und Selbstdiagnosen, welche Schwierigkeiten in Beziehungen auftreten können, wenn sie aus narzisstischen Motiven heraus geschlossen werden, und welche Möglichkeiten es gibt, weiblich narzisstische Strukturen zu erkennen, zu verstehen und zu verändern.
Dieses Buch beruht auf Erkenntnissen meiner vierzigjährigen psychotherapeutischen Berufserfahrung mit narzisstisch strukturierten Menschen, speziell Frauen, eingeschlossen all jene, die sich als solche fühlen. Ich stütze mich dabei auch auf meine anderen Bücher, die ich über Narzissmus und narzisstische Beziehungen geschrieben habe.
Die Lektüre ist auch spannend für Männer, da sie sich ebenso in der weiblich-verdeckten narzisstischen Struktur wiederfinden können. Ich schreibe allerdings aus Sicht der Frauen und für Frauen, die unter ihrer narzisstischen Ausprägung leiden.
Der weibliche Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein instabiles Selbstwertgefühl und die Frage »Wer bin ich?« Beides soll durch die narzisstische Fassade ausgeglichen werden.
Die Frauen stellen sich nach außen hin anders dar, als sie sich innerlich fühlen, und signalisieren der Welt: Ich bin selbstbewusst und habe alles im Griff. Vor allem in Beziehungen kann diese Fassade allerdings bröckeln und dann erleben sich die betroffenen Frauen als minderwertig, nicht liebenswert und passen sich so stark an ihr Gegenüber an, dass sie sich dabei verlieren. Auf der anderen Seite sind sie starke Persönlichkeiten, die im Beruf ihre Frau stehen und ihr Leben meistern können. Dieser innere Zwiespalt zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Großartigkeit ist ein Charakteristikum des weiblichen Narzissmus und führt die Betroffenen zu der Frage: Wer bin ich eigentlich?
Dieses Buch will dabei helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Es bietet darüber hinaus viele Reflexionsmöglichkeiten und Impulse, wie man zu einem besseren Selbstwertgefühl findet, zu mehr Selbstliebe und einem authentischen Leben. Denn das ist das beste Gegenmittel zum Narzissmus, der lediglich Selbsterhöhung verursacht, die nicht zufrieden macht. Es lohnt sich, sich auf diesen Weg nach innen zu begeben. Die therapeutische Erfahrung zeigt, dass Veränderung nicht nur möglich ist, sondern dass Zuwendung zu sich selbst, so wie ich sie hier beschreibe, ein Tor zu einem zufriedenen und erfüllten Leben sein kann.
Ich danke all jenen, die an der Entstehung dieses Buches mithalfen, indem sie mich mit wertvollen Hinweisen unterstützt haben.
Alle Beispiele im Buch wurden auf der Basis unterschiedlicher Fallgeschichten entwickelt. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist nicht beabsichtigt und rein zufällig.
München im März 2023
Bärbel Wardetzki
Teil 1
Zwischen Selbstzweifel und Grandiosität
Weiblicher Narzissmus, was ist das eigentlich?
Diese Frage möchte ich in diesem Buch beantworten und erklären, was unter weiblichem Narzissmus zu verstehen ist, wie er sich äußert, welche Probleme damit verbunden sind und wie er sich von der männlichen Form unterscheidet.
Auffällig beim weiblichen Narzissmus ist, dass er nach außen gar nicht so erscheint, wie man Narzissmus erwarten würde, der sich ja oft in einer arroganten Selbstbezogenheit und grandiosen Überheblichkeit äußert. Frauen mit einer weiblich-narzisstischen Struktur sind dagegen eher zurückhaltend und brillieren durch eine starke Anpassungsfähigkeit. Dahinter stecken jedoch dieselben Bedürfnisse und Wünsche wie bei jeder narzisstischen Thematik, nämlich Anerkennung und Bewunderung zu bekommen.
Aus diesem Grunde spricht man auch vom sogenannten verdeckten oder vulnerablen Narzissmus – im Gegensatz zum offenen Narzissmus.
Der offene Narzissmus ist charakterisiert durch Dominanzstreben, Misstrauen, Arroganz und Aggressivität, Egozentrismus, Überheblichkeit und einer geringen Wahrnehmung der Reaktionen anderer. Ein solcher Mensch macht sich zum »Sender«, von dem alle Information ausgeht, hört aber schlecht zu und nimmt kaum auf, was andere sagen. Den weiblich-verdeckten Narzissmus zeichnet dagegen eine hohe »Empfängerqualität« aus. Das bedeutet, dass diese Menschen sorgfältig zuhören, um Anzeichen von Kritik und Ablehnung zu registrieren. Sie sind höchst sensibel gegenüber den Reaktionen anderer und vermeiden es, im Zentrum zu stehen. Sie sind charakterisiert durch Empfindlichkeit, Gehemmtheit, Depressivität, Scham und Gefühle von Demütigung. Statt überheblich aufzutreten, spüren sie mehr ihre Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle und neigen dazu, sich infrage zu stellen. Wer offen narzisstisch ist, käme nicht auf die Idee, an sich zu zweifeln, da er sich immer im Recht fühlt.
Auch mit dem weiblichen Narzissmus ist eine Form von Grandiosität beziehungsweise Überheblichkeit verbunden, die sich jedoch subtiler äußert als beim offenen Narzissmus. Inhaltlich ist sie mehr auf Attraktivität, Perfektionismus, Anpassungsfähigkeit und Leistung ausgerichtet. Allgemein kann man sagen, dass das Charakteristische am Narzissmus die Grandiosität und Selbstüberhöhung ist, das ständige Bemühen, ein perfektes Bild von sich abzugeben, und die Stabilisierung des Selbstwerts durch die Anerkennung und Bewunderung von außen: »Bin ich erst schön und erfolgreich genug, werden mich alle lieben.«
Auch wenn diese Form des Narzissmus »weiblich« genannt wird, können genauso Männer eine verdeckte, weiblich-narzisstische Struktur und Frauen einen offenen Narzissmus haben. Der Begriff »weiblicher« Narzissmus darf nicht missverstanden werden als Diskriminierung von Frauen durch eine geschlechtsspezifische Zuschreibung. Er dient lediglich der Kategorisierung der narzisstischen Ausprägungen und kann durch das genderneutrale Wort »verdeckter« Narzissmus ersetzt werden. Da der verdeckte Narzissmus aber häufiger bei Frauen auftritt und dieses Buch vorwiegend für Frauen geschrieben ist, beschreibe ich ihn aus dieser Sicht. Von der Dynamik her ist es jedoch dasselbe, ob es sich um einen Mann oder eine Frau mit einer weiblich-narzisstischen Struktur handelt.
Das Erleben im weiblichen Narzissmus
Frauen mit einer weiblich-narzisstischen Struktur zeigen sich selbstsicher, obwohl sie sich unsicher fühlen. Sie wissen nicht, wer sie wirklich sind, und glauben, besonders sein zu müssen, um gesehen und gemocht zu werden. Auch schwankt ihre Selbsteinschätzung zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Größenfantasien hin und her.
Die Grundthematik beim weiblichen Narzissmus ist ein instabiles Selbstwertgefühl und das Nichtwissen, wer man wirklich ist. Beides soll durch die narzisstische Fassade ausgeglichen werden. Auf der einen Seite leiden diese Frauen unter starken Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstabwertung, auf der anderen Seite haben sie eine überhöhte Vorstellung von sich selbst, in der sie sich größer, besser und toller machen, als sie wirklich sind.
Ihnen fehlt also ein stabiles Selbstwertgefühl, das es ihnen möglich macht, sich so wahrzunehmen, wie sie sind. Stattdessen schwanken sie zwischen dem Gefühl, nichts wert, dumm, hässlich, dick, zu klein oder zu groß und vor allem nicht liebenswert zu sein. Da dieses Gefühl sehr unangenehm ist, bietet die narzisstische Grandiosität die Rettung: Die betroffenen Frauen versuchen, ein ideales Bild von sich zu präsentieren, das sie großartiger erscheinen lässt, als sie sind, um sich damit aufzuwerten.
Dieses Ideal wird zum Maßstab für ihre Zufriedenheit, stellt jedoch unmenschlich hohe Anforderungen an sie: Sie müssen makellos, perfekt und besonders sein, dürfen keine Fehler machen, müssen immer das Richtige tun und fühlen, sie müssen intelligent sein, Höchstleistungen erbringen und vieles mehr. Das Hemmende an diesem Ideal ist die Absolutheit der Eigenschaften, die diese Frauen besitzen müssen, um sich zu akzeptieren. In den überhöhten Ansprüchen liegt daher zugleich deren Unerfüllbarkeit: Kein Mensch kann perfekt, fehler- und makellos sein, worin das ständige Gefühl wurzelt, versagt zu haben und nicht gut genug zu sein. Die Folge ist, dass Frauen mit einer weiblich-narzisstischen Struktur beispielsweise bei Kritik ihre perfekte Fassade nicht mehr aufrechterhalten können und in ein seelisches Loch und tiefe Wertlosigkeit fallen.
Zusammenfassung
Der männlich-offene Narzissmus unterscheidet sich in der Erscheinungsform vom weiblich-verdeckten Narzissmus.Beiden liegt eine tiefe Selbstwertverletzung zugrunde.Die narzisstische Fassade schützt das Selbstwertsystem vor dem Zusammenbrechen.Die Grundthematik beim weiblichen Narzissmus ist das fehlende oder instabile Selbstwertgefühl und das fehlende Wissen, wer man ist.Beides wird überdeckt durch ein idealisiertes Bild von sich selbst, das zum Maßstab für die eigene Zufriedenheit wird.Durch Kritik oder Zurückweisung zerbricht die perfekte Fassade und die Betroffenen drohen in ein seelisches Loch und tiefe Wertlosigkeit zu fallen.Habe ich eine weiblich-narzisstische Störung?
Falls du dich bis hierher in dem einen oder anderen wiedererkannt hast, fragst du dich vielleicht, ob du eine weiblich-narzisstische Störung hast. Diese Frage liegt nahe, führt dich aber nicht wirklich weiter. Statt dir über eine mögliche Diagnose Gedanken zu machen, wäre es für dich effektiver zu verstehen, welche Schwierigkeiten du mit dir und mit anderen Menschen hast und welche Wege es gibt, diese zu überwinden, um zufriedener und innerlich ausgeglichener zu werden. Noch dazu handelt es sich beim weiblichen Narzissmus nicht um einen diagnostischen Begriff, sondern um die Beschreibung einer spezifischen narzisstischen Ausprägung, die häufig insbesondere bei Frauen auftritt.
Vom weiblichen Narzissmus betroffen zu sein, bedeutet nämlich nicht, dass man gestört ist oder sich gar dafür verurteilen muss. Es besagt lediglich, dass man in seinem Selbstwertgefühl stark schwankt und sich oft unsicher im Umgang mit sich selbst und anderen Menschen fühlt.Außerdem hat eine narzisstische Struktur auch positive Seiten, denn damit sind häufig eine hohe Leistungsfähigkeit und beruflicher Erfolg verbunden, gepaart mit der Fähigkeit, sich gut darzustellen. Probleme treten mehr in nahen Beziehungen auf, in denen man sich so sehr auf das Gegenüber einstellt, dass man sich selbst verliert und seinen Selbstwert kaum noch spürt.
Trotz allem geht es nicht darum, diesen weiblichen Narzissmus oder die narzisstischen Anteile auszumerzen und loszuwerden wie eine ungeliebte Gewohnheit. Das wird sowieso nicht gelingen, denn diese Anteile gehören zur betroffenen Person dazu, können aber verändert werden. Und genau dabei möchte dich dieses Buch unterstützen.
Es geht hier darum, narzisstische Verhaltensweisen und Gefühlszustände zu verstehen und ihre negativen und positiven Wirkungen zu erkennen. Wie beeinflussen Selbstbezogenheit und Selbstunsicherheit dein Wohlbefinden und deine Beziehungen? Was daran möchtest du verändern, um glücklicher zu werden und deine Selbstzweifel in positive, stärkende Gedanken umzuwandeln? Welche Kräfte kannst du aus der narzisstischen Großartigkeit ziehen?
Lies dieses Buch bitte mit der Haltung, dass du etwas für dich lernen möchtest, und nicht, dass du dir eine Diagnose zuschreibst und dich deshalb als minderwertig betrachtest.
Sinn und Unsinn von Alltagsdiagnosen
In letzter Zeit fällt auf, wie oft Menschen sich selbst oder anderen eine psychologische Krankheitsbezeichnung zuschreiben, die einer Diagnose nahekommt. »Narzisst« und »Narzisstin« sind so beliebt, dass sie geradezu Modewörter geworden sind. Es scheint fast so, als wenn jeder schwierige Mensch schon ein Narzisst/eine Narzisstin sei. Damit jedoch steckt man Menschen in eine Schublade, aus der sie schwer wieder rauskommen.
Ich höre oft die Klagen von Ratsuchenden: »Mein Mann ist ein Narzisst« oder »Meine Partnerin hat sicher eine weiblich-narzisstische Störung!«. Sie leiden unter der Unberechenbarkeit der anderen Person, die einmal ablehnend und entwertend, das andere Mal überschwänglich liebevoll und zugewandt ist. Es ist ein ständiges Schwanken zwischen einem emotionalen Hochgefühl und der seelischen Hölle. Sie stellen sich die Frage, wie sie mit dem Partner/der Partnerin umgehen sollen und was sie tun können, damit diese sich therapeutische Hilfe holen. Diese Reaktionen sind verständlich, da Menschen mit einer narzisstischen Struktur oftmals nicht merken, wie negativ sie im Umgang mit anderen agieren. Es läuft eher unbewusst ab, weshalb sie selbst selten darunter leiden, stattdessen ihre Umgebung.
Überheblichkeit, Arroganz, abwertendes Verhalten und Empathielosigkeit sind zwar Charakteristika des offenen Narzissmus, machen einen Menschen aber noch nicht zum Narzissten. Die Bezeichnung Narzisst oder Narzisstin ist sehr ungenau und häufig nicht einmal zutreffend, weil damit im Alltag meist jemand gemeint ist, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Das ist eine psychopathologische Diagnose, also die Bezeichnung einer seelischen Erkrankung, und kann nur von jemandem gestellt werden, der dafür ausgebildet ist und entsprechendes Testmaterial besitzt. Im Alltag hat eine solche Diagnose nichts zu suchen, weil sie Menschen unangemessen etikettiert. Denn im Grunde gibt es keine Narzissten, sondern »nur« Menschen, die aus Not eine narzisstische Struktur ausgebildet haben, oder auch: Menschen, die in narzisstische Nöte geraten, wie es Klaus Eidenschink nennt.1
Sicherlich kann es ein Gewinn sein, für ein Problem einen Namen zu haben, um das eigene Verhalten oder das des anderen besser zu verstehen. Menschen sind erleichtert, dass es nicht nur an ihnen liegt, wenn es Probleme in einer Beziehung gibt, sondern an der narzisstischen Persönlichkeit des Gegenübers. Das stärkt sie innerlich und macht ihnen Mut, die Beziehung zu überdenken oder sich sogar aus ihr zu lösen.
Und dennoch löst die Zuschreibung »Narzisst« oder »Narzisstin« keine Beziehungsschwierigkeiten. Bezeichnet jemand eine andere Person als narzisstisch, glaubt derjenige zwar endlich zu wissen, wie der andere »wirklich« ist, und meint, die Lösung für seine Probleme gefunden zu haben. Auf diese Weise wird der andere jedoch zum Hauptschuldigen, und man selbst fühlt sich als Opfer dieser narzisstischen Person und kann sich dadurch von aller Verantwortung und Schuld freisprechen. Das führt jedoch in eine Sackgasse, denn wir wissen, dass eine Beziehung immer aus zwei Menschen besteht, die zusammen eine Begegnung gestalten. Insofern ist es nie nur eine Person, die verantwortlich gemacht werden kann und in diesem Sinne »schuld« ist. Diagnosen haben nur im medizinischen Bereich einen Sinn, da unser Krankenkassensystem auf ihnen beruht. Sie haben jedoch keinen Nutzen, um zwischenmenschliche Probleme zu lösen, sondern verstärken sie oftmals noch. Die Person nämlich, der die Diagnose aufgedrückt wird, fühlt sich entwertet und dadurch noch weniger bereit zu einer konstruktiven Auseinandersetzung.
Aber es kann auch sein, dass unser Gegenüber uns als narzisstisch gestört bezeichnet und für die Schwierigkeiten verantwortlich macht, die man miteinander hat. Oft übernehmen die Frauen die Rolle der Schuldigen, die eine Therapie machen müssen, um die Beziehung zu retten. Auch hier gilt, dass beide einen Anteil am Gelingen der Beziehung haben und es deshalb nicht reicht, einseitig in Vorleistung zu gehen.
Du siehst also, dass es mit der Alltagsdiagnose Narzisst oder Narzisstin nicht getan ist – du etikettierst dich selbst und/oder den anderen unangemessen und kommst zu keiner Lösung. Mit den Worten meines Kollegen Frank Stemmler kann man auch sagen, dass Etiketten gut für Flaschen, aber nicht für Menschen sind.2
Zusammenfassung
Das Wissen um die narzisstische Thematik kann helfen, eigene Probleme besser zu verstehen und Wege der Veränderung zu finden.Eine weiblich-narzisstische Thematik bedeutet nicht gleichzeitig eine Persönlichkeitsstörung.Alltagsdiagnosen sind sinnlos und bringen einen nicht weiter. Man sollte sie weder sich noch anderen aufdrücken, denn Etiketten sind für Flaschen und nicht für Menschen.Diagnosen gehören in die Hand von Fachleuten.Narzisstische Anteile hat jeder
In der Psychologie geht man davon aus, dass alle Menschen narzisstische Anteile haben, da die Erhöhung des Selbstwertgefühls ein menschliches Grundbedürfnis ist. Es drückt sich aus im Wunsch nach Anerkennung, Erfolg, Ansehen und Wertschätzung. Und narzisstisch heißt ja nichts anderes als »den Selbstwert und die Selbstliebe betreffend«. Werden wir gelobt, steigt unser Selbstwertgefühl, werden wir kritisiert oder missachtet, dann sinkt es. Jeder von uns ist daher immer wieder gezwungen, sein Selbstwertgefühl auszugleichen und in Balance zu bringen. Menschen unterscheiden sich darin, wie gut ihnen das gelingt. In der Psychologie sprechen wir in diesem Zusammenhang vom sogenannten positiven Narzissmus. Damit ist gemeint, dass eine Person ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl besitzt, sowohl um ihre Stärken als auch um ihre Schwächen weiß und sich selbst unterstützen kann. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel bei Kritik oder Misserfolg kurzfristig einen Selbstwerteinbruch erlebt, den sie jedoch selbstständig ausgleichen kann, indem sie sich freundlich sich selbst zuwendet, tröstet und Zuspruch gibt, trotz des Misserfolgs ein wertvoller Mensch zu sein.
Dadurch findet sie in ihre innerliche Balance zurück. Sie spürt vielleicht den Schmerz, der mit dem unangenehmen Erlebnis zusammenhängt, und möglicherweise auch die Scham, nicht gut genug gewesen zu sein, aber sie würde nicht in ein tiefes Loch der Selbstverachtung stürzen, wie es bei Menschen mit einer starken weiblich-narzisstischen Ausprägung der Fall ist. Diese klagen sich an und werten sich ab, sobald sie nicht gelobt werden. Im weiblichen Narzissmus kann man nicht auf ein realistisches, gesundes Selbst zurückgreifen, das helfen würde, das Selbstgefühl optimal zu regulieren, was umso abhängiger von der Bestätigung von außen macht.
Ob man weiblich-narzisstische Anteile besitzt und wie stark diese ausgeprägt sind, zeigt sich nicht nur im Umgang mit Versagenssituationen, sondern auch bei Lob, Anerkennung, Bewunderung und Applaus. Wie geht jemand damit um? Hält man sich durch die Anerkennung für besser als die anderen und wertet diese vielleicht sogar als Versager ab oder freut man sich über seinen Erfolg und ist stolz, ohne sich über die anderen zu erheben? Bei einer realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten würde man zu sich sagen: »Toll, dass ich diese Bestätigung kriege. Ich finde mich klasse und weiß, dass ich es besser gemacht habe als die anderen. Aber ich kann sie lassen, wie sie sind, und stelle mich nicht über sie.« Je stärker allerdings die narzisstischen Anteile ausgeprägt sind, umso unrealistischer wird die eigene Wahrnehmung, indem man seine Kompetenzen aufbläht, sie den anderen aber abspricht.
Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Kontinuum der narzisstischen Stärke. Es reicht vom positiven Narzissmus, also einem stabilen Selbstwertgefühl, über den narzisstischen Persönlichkeitsstil bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die allerdings nur in drei bis fünf Prozent der Fälle auftritt.