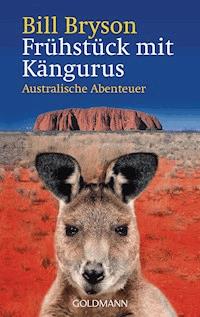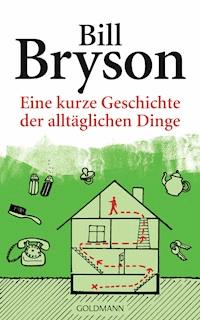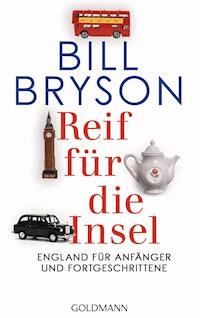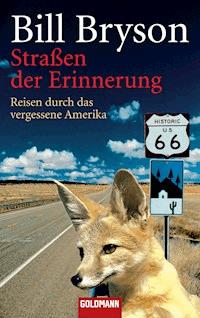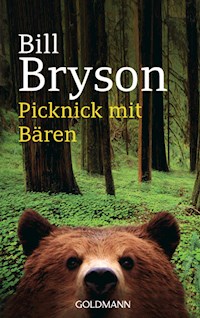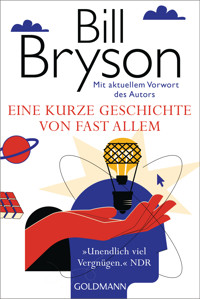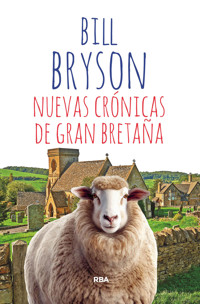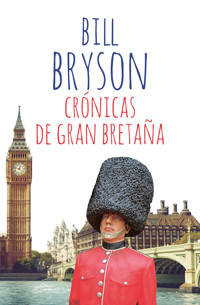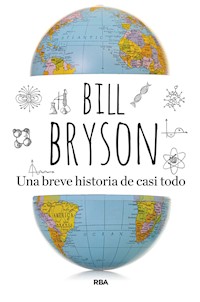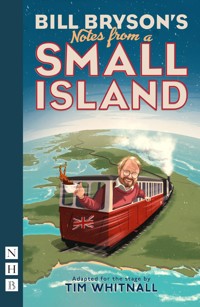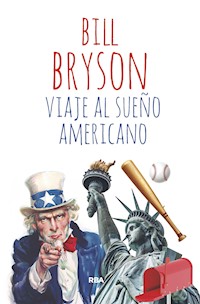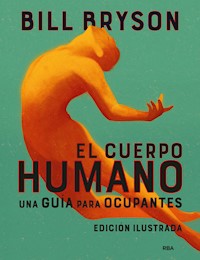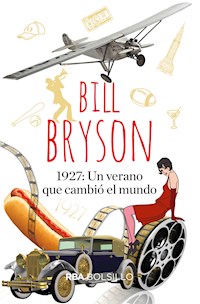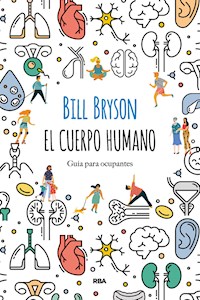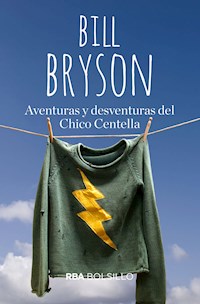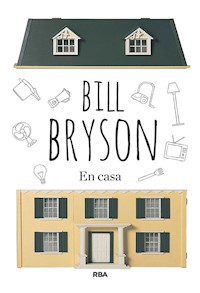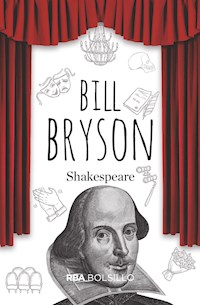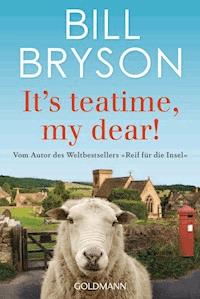
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Abwarten, Tee trinken, weiterreisen!
Vor über dreißig Jahren beschloss der Amerikaner Bill Bryson, England zu seiner Wahlheimat zu machen und für einige Jahre dort zu leben. Damals brach er auf zu einer großen Erkundungsreise quer über die britische Insel. Inzwischen ist er ein alter Hase, was die Eigentümlichkeiten der Engländer betrifft, aber dennoch entdeckt er immer wieder Neues, was ihn fasziniert und amüsiert. Kein Wunder also, dass es ihn reizt, diese Insel erneut ausgiebig zu bereisen. Von Bognor Regis bis Cape Wrath, vom englischen Teehaus bis zum schottischen Pub, von der kleinsten Absteige bis zum noblen Hotel, Bryson lässt nichts aus und beantwortet zahlreiche Fragen. Wie heißt der Big Ben eigentlich wirklich? Wer war Mr. Everest? Warum verstehen sich Amerikaner und Engländer nur bedingt? Bill Bryson will noch einmal wissen, was dieses Land so liebenswert macht, und begibt sich auf den Weg – schließlich ist er wieder reif für die Insel!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Ähnliche
Buch
Vor über zwanzig Jahren hat sich Bill Bryson aufgemacht, seine damals neue Heimat Großbritannien zu entdecken. Er reiste quer über die Insel, stolperte über so unaussprechliche Orte wie Penrhyndeudraeth und Llywyngwril, reihte sich brav in jede Schlange ein und amüsierte sich über die liebenswerten Marotten der Engländer. Sein charmanter und witziger Bestseller »Reif für die Insel«, den er im Anschluss schrieb, wurde schnell zum beliebtesten Werk über das Vereinigte Königreich. In der Zwischenzeit hat Bryson viel dazugelernt und würde sich eigentlich als Kenner der englischen Eigentümlichkeiten bezeichnen. Er geht sogar so weit, dass er sich zusätzlich zu seiner US-Staatsbürgerschaft auch zum Bürger Großbritanniens erklären will. Doch als er sich dann dem Einbürgerungstest stellen muss, entdeckt er, dass es immer noch Momente gibt, die ihn in Erstaunen versetzen. Außerdem war er noch nie in Bognor Regis oder Cape Wrath, den beiden äußersten Punkten der Insel, wollte immer mal wieder nach Cornwall und hat noch so einiges in London zu erkunden. Daher zögert er nicht lang und entschließt sich, loszugehen und »seine Insel« erneut zu bereisen. Dabei merkt er allerdings schnell, dass er inzwischen alles mit etwas anderen Augen sieht …
Weitere Informationen zu Bill Bryson sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Bill Bryson
It’s teatime, my dear! Wieder reif für die Insel
Ins Deutsche übertragen von Thomas Bauer
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Road to Little Dribbling« bei Doubleday, an imprint
of Transworld Publishers, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2015 by Bill Bryson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Illustrationen und Karte: Copyright © Neil Gower 2015
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-11133-5V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für James, Rosie und Daphne.
Willkommen.
Inhalt
Prolog
1 Scheiß auf Bognor!
2 Seven Sisters
3 Dover
4 London
5 Motopia
6 Ein großartiger Park
7 In den Wald
8 An der Küste
9 Tagesausflüge
10 Nach Westen
11 Devon
12 Cornwall
13 Altes Britannien
14 East Anglia
15 Cambridge
16 Oxford und Umgebung
17 Die Midlands
18 Es ist so belebend!
19 Der Peak District
20 Wales
21 Der Norden
22 Lancashire
23 Die Seen
24 Yorkshire
25 Durham und der Nordosten
26 Prolog
Kurzes Nachwort und Danksagung
Prolog
I
Wenn man älter wird, entdeckt man eine Menge neuer Möglichkeiten, wie man sich verletzen kann. Erst vor Kurzem wurde ich in Frankreich von einer automatischen Parkplatzschranke auf den Kopf getroffen, was ich in jüngeren, wachsameren Jahren vermutlich nicht hinbekommen hätte.
Eigentlich gibt es nur zwei Methoden, wie man von einer Parkplatzschranke getroffen werden kann. Die eine ist die, dass man sich unter eine geöffnete Schranke stellt und sich absichtlich von ihr treffen lässt. Das ist natürlich der einfache Weg. Die andere Methode – und hierbei ist leicht verminderte geistige Kapazität eine große Hilfe – besteht darin, die Schranke zu vergessen, die man soeben hochgehen gesehen hat, an die Stelle zu treten, an der sie sich gerade noch befand, mit gespitzten Lippen dazustehen, während man überlegt, was man als Nächstes tun soll, und dann aus allen Wolken zu fallen, wenn sie einem auf den Kopf knallt wie ein Vorschlaghammer auf einen Nagel. Ich entschied mich für diese Variante.
Lassen Sie mich vorausschicken, dass es sich um eine ernstzunehmende Schranke handelte, die sich nicht auf ihren Gabelstützpfosten senkte, sondern mit der Wucht einer Gerüststange auf ihn krachte. Der Schauplatz dieses Schädeltrauma-Dramas war ein Parkplatz in dem netten Badeort Étretat in der Normandie, nicht weit von Deauville entfernt, wo meine Frau und ich ein paar Tage Urlaub machten. Ich war zu diesem Zeitpunkt allerdings allein unterwegs und auf der Suche nach dem Pfad, der auf der anderen Seite des Parkplatzes oben an der Steilküste entlangführt, doch den Weg dorthin versperrte besagte Schranke, die zu niedrig war, als dass jemand mit meiner Statur unter ihr hätte hindurchtauchen können, und viel zu hoch, als dass ich über sie hätte springen können. Während ich dastand und zögerte, hielt ein Auto an, der Fahrer zog einen Parkschein, die Schranke hob sich, und der Wagen fuhr durch. Das war der Moment, den ich mir aussuchte, um einen Schritt vorzutreten und mir zu überlegen, welche Richtung ich einschlagen sollte, ohne mir dabei zu vergegenwärtigen, dass es für mich jeden Augenblick Richtung Boden gehen würde.
Nun, ich wurde noch nie so unvorbereitet und so hart getroffen. Plötzlich war ich der am meisten verdutzte und gleichzeitig der am meisten entspannte Mensch in ganz Frankreich. Meine Beine gaben nach und knickten unter mir ein, und meine Arme machten sich mit einer solchen Lebendigkeit selbstständig, dass ich es schaffte, mir selbst mit den Ellbogen ins Gesicht zu schlagen. Anschließend bewegte ich mich ein paar Minuten lang ungewollt und überwiegend seitwärts voran. Eine freundliche Dame half mir zu einer Bank und gab mir ein Stück Schokolade, das ich – wie ich feststellte – am nächsten Morgen noch immer umklammerte. Während ich dort saß, fuhr ein weiteres Auto auf den Parkplatz, und die Schranke fiel mit einem nachhallenden Scheppern wieder nach unten. Es schien unmöglich, dass ich einen derart heftigen Schlag überlebt hatte. Da ich ein bisschen paranoid bin und insgeheim zu Theatralik neige, kam ich allerdings zu der Überzeugung, dass ich in der Tat schwere innere Verletzungen davongetragen hatte, die sich nur noch nicht bemerkbar gemacht hatten. In meinem Kopf sammelte sich Blut wie in einer Badewanne, die sich langsam füllt, und irgendwann würden meine Augen nach hinten rollen, ich würde ein dumpfes Stöhnen von mir geben, still und heimlich umkippen und nie wieder aufstehen.
Das Positive an dem Gedanken, man stünde kurz davor zu sterben, ist, dass man sich über das bisschen Leben freut, das einem noch bleibt. Ich verbrachte den Großteil der folgenden drei Tage damit, anerkennend auf Deauville zu starren, seine Sauberkeit und seinen Wohlstand zu bewundern, lange Spaziergänge an seinem Strand und seiner Uferpromenade zu unternehmen oder einfach nur dazusitzen und das wogende Meer und den blauen Himmel zu betrachten. Deauville ist eine sehr schöne Stadt. Man kann an viel schlimmeren Orten umkippen.
Als meine Frau und ich eines Nachmittags auf einer Bank mit Blick auf den Ärmelkanal saßen, sagte ich in meiner neuen grüblerischen Stimmung zu ihr: »Ich wette, dass die Stadt, die sich genau gegenüber auf der englischen Seite befindet, angeschlagen ist und ums Überleben kämpft, während Deauville auch in Zukunft wohlhabend und hübsch sein wird. Woran liegt das deiner Meinung nach?«
»Keine Ahnung«, entgegnete meine Frau. Sie las gerade einen Roman und wollte nicht wahrhaben, dass ich bald sterben würde.
»Was befindet sich eigentlich direkt gegenüber?«, fragte ich.
»Keine Ahnung«, erwiderte sie und blätterte um.
»Weymouth?«
»Keine Ahnung.«
»Hove vielleicht?«
»Welchen Teil von ›keine Ahnung‹ verstehst du nicht?«
Ich sah auf ihrem Smartphone nach. (Ich bekomme kein eigenes Smartphone, weil ich es verlieren würde.) Wie genau die Karten sind, weiß ich nicht – wir werden oft nach Michigan oder Kalifornien gelotst, wenn wir nach einem Ort in Worcestershire suchen –, doch der Name, der auf dem Display erschien, lautete Bognor Regis.
Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir dabei nichts, bald kam es mir jedoch beinahe wie eine Prophezeiung vor.
II
Das erste Mal kam ich am anderen Ende meines Lebens nach England, da war ich noch ziemlich jung, gerade einmal zwanzig.
Damals stammte für einen kurzen, aber intensiven Zeitraum ein sehr großer Teil dessen, was auf der Welt beachtenswert war, aus Großbritannien: die Beatles, James Bond, Mary Quant und die Miniröcke, Twiggy und Justin de Villeneuve, das Liebesleben von Liz Taylor und Richard Burton, das Liebesleben von Prinzessin Margaret, die Rolling Stones, die Kinks, Anzugjacken ohne Kragen, Fernsehserien wie Mit Schirm, Charme und Melone und Nummer 6, Spionagethriller von John le Carré und Len Deighton, Marianne Faithfull und Dusty Springfield, skurrile Spielfilme mit David Hemmings und Terence Stamp in den Hauptrollen, die wir in Iowa nicht ganz verstanden, Harold-Pinter-Stücke, die wir überhaupt nicht verstanden, Peter Cook und Dudley Moore, That Was the Week That Was, die Profumo-Affäre – eigentlich fast alles.
In Zeitschriften wie dem New Yorker oder dem Esquire befanden sich mehr Werbeanzeigen für britische Produkte als zu irgendeinem späteren Zeitpunkt: für Gilbey’s und Tanqueray Gin, Tweedkleidung von Harris, BOAC-Flugzeuge, Anzüge von Aquascutum und Hemden von Viyella, Keen-Filzhüte, Pullover von Alan Paine, DAKS-Hosen, Sportwagen von MG und Austin Healey, hundert verschiedene Sorten Scotch Whisky. Wer auf Qualität Wert legte und weltmännisch wirken wollte, war sich bewusst, dass das vor allem britische Produkte boten. Man muss allerdings sagen, dass schon damals nicht alles wirklich einen Sinn ergab. Ein zu jener Zeit beliebtes Eau de Cologne hieß »Pub«. Mir ist nicht ganz klar, welche Assoziationen das wecken sollte. Ich trinke seit vierzig Jahren in England und kann nicht behaupten, dass ich jemals in einem Pub auf etwas gestoßen bin, das ich mir gern ins Gesicht schmieren würde.
Aufgrund all der Aufmerksamkeit, die wir Großbritannien schenkten, glaubte ich, ziemlich viel über die Insel zu wissen, musste aber schon kurz nach meiner Ankunft feststellen, dass ich damit völlig falschgelegen hatte. Ich konnte dort nicht einmal meine Muttersprache sprechen. Anfangs war ich nicht in der Lage, zwischen collar und colour,khaki und car key,letters und lettuce,bed und bared sowie karma und calmer zu unterscheiden.
Als ich einen Haarschnitt brauchte, wagte ich mich in Oxford in den Salon eines Unisex-Friseurs, wo mich die wuchtige und irgendwie Furcht einflößende Inhaberin zu einem Stuhl führte und mir dort knapp mitteilte, mir würde das Haar heute von avet geschnitten werden.
Ich war schockiert. »Von jemandem, der kranke Tiere behandelt?«, fragte ich mit stillem Entsetzen.
»Nein, sie heißt Yvette«, entgegnete die Salonbesitzerin und warf mir einen recht kurzen Blick zu, mit dem sie mir zu verstehen gab, dass sie mich für den anstrengendsten Idioten hielt, der ihr seit Langem über den Weg gelaufen war.
Einmal erkundigte ich mich in einem Pub, welche Sandwiches es gäbe.
»Schinken und Käse«, meinte der Mann.
»Oh ja, bitte«, sagte ich.
»Ja, bitte, was?«, erwiderte er.
»Ja, bitte, Schinken und Käse«, sagte ich, inzwischen weniger selbstbewusst.
»Nein, es gibt Schinken oder Käse«, erklärte er.
»Man kann nicht beides bekommen?«
»Nein.«
»Oh«, entgegnete ich überrascht, dann beugte ich mich zu ihm vor und fragte leise und in einem vertraulichen Tonfall: »Warum denn nicht? Wäre das zu schmackhaft?«
Er starrte mich an.
»Dann nehme ich Käse«, bemerkte ich zerknirscht.
Als das Sandwich kam, war der Käse aufwendig gerieben – ich hatte noch nie gesehen, dass ein Milchprodukt vor dem Servieren derart misshandelt worden war –, und dazu gab es etwas, von dem ich heute weiß, dass es sich um Branston Pickle handelte, das damals für mich aber aussah wie etwas, das man findet, wenn man die Hand in eine verschlammte Sickergrube steckt.
Ich knabberte zaghaft daran und stellte angenehm überrascht fest, dass es köstlich schmeckte. Nach und nach dämmerte es mir, dass ich ein Land entdeckt hatte, das mir zwar völlig fremd, aber trotzdem irgendwie großartig war. Dieses Gefühl hat mich seitdem nie verlassen.
Meine Zeit in Großbritannien beschreibt eine Gauß-Kurve, die in der linken unteren Ecke in der »Weiß-fast-gar-nichts«-Zone beginnt und dann langsam in einem Bogen ansteigt bis »Ziemlich-gute-Bekanntschaft« ganz oben. Als ich diesen Scheitelpunkt erreicht hatte, nahm ich an, ich würde auf Dauer dort bleiben, doch in letzter Zeit rutsche ich auf der anderen Seite wieder Richtung Unwissenheit und Verunsicherung ab, da ich zunehmend das Gefühl habe, in einem Land zu leben, das ich überhaupt nicht mehr wiedererkenne. Es wimmelt dort von Prominenten, deren Namen mir fremd sind und noch mehr deren Talente, von Akronymen (BFF, TMI, TOWIE), die ich mir erklären lassen muss, und von Leuten, die offenbar eine andere Art von Realität erleben als ich.
Ich gerate in dieser neuen Welt ständig in Verlegenheit. Neulich schlug ich einem Besucher die Tür vor der Nase zu, da ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste. Zunächst freute ich mich, ihn zu sehen. Seit Edward Heaths Amtszeit als Premierminister war kein Zählerableser bei uns im Haus gewesen, deshalb ließ ich ihn gern ein und holte sogar eine Leiter, damit er hinaufsteigen und besser seine Tätigkeit verrichten konnte. Erst als er ging und kurz darauf wieder zurückkam, fing ich an, unsere vertiefte Beziehung zu bereuen.
»Tut mir leid, ich muss auch noch den Zähler auf der Herrentoilette ablesen«, sagte er zu mir.
»Wie bitte?«
»Hier steht, es gibt noch einen zweiten Zähler auf der Herrentoilette.«
»Wir haben aber keine Herrentoilette, weil das hier ein Wohnhaus ist, sehen Sie?«
»Hier steht, es ist eine Schule.«
»Es ist aber keine. Das ist ein Wohnhaus. Sie waren doch gerade drin. Haben Sie Räume voller junger Leute gesehen?«
Er dachte einen Augenblick lang angestrengt nach.
»Stört es Sie, wenn ich mich mal umsehe?«
»Wie bitte?«
»Nur ein kurzer Blick. Dauert keine fünf Minuten.«
»Glauben Sie etwa, Sie finden eine Herrentoilette, die wir bislang irgendwie übersehen haben?«
»Man kann nie wissen!«, entgegnete er freudestrahlend.
»Ich mache jetzt die Tür zu, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll«, sagte ich und machte die Tür zu. Ich hörte ihn durch das Holz ein bisschen meckern. »Außerdem habe ich einen wichtigen Termin«, rief ich ihm durch die Tür zu. Und das stimmte auch. Ich hatte tatsächlich einen wichtigen Termin – und zufällig einen, der von größter Bedeutung für das vorliegende Buch war.
Ich war auf dem Sprung nach Eastleigh, um einen britischen Einbürgerungstest abzulegen.
Die Ironie daran entging mir nicht. Genau in dem Moment, in dem mich das Leben im modernen Großbritannien vor neue Rätsel stellte, wurde ich herbeizitiert, um unter Beweis zu stellen, dass ich meine Wahlheimat verstand.
III
Lange Zeit hatte man zwei Optionen, um britischer Staatsbürger zu werden. Die erste, kompliziertere, aber paradoxerweise wesentlich gebräuchlichere Vorgehensweise war, den Weg in eine britische Gebärmutter zu finden und neun Monate zu warten. Die andere bestand darin, ein paar Formulare auszufüllen und einen Eid abzulegen. Seit 2005 müssen Anwärter aus der zweiten Kategorie zusätzlich Englischkenntnisse nachweisen und einen Wissenstest bestehen.
Der Sprachtest blieb mir erspart, da Englisch meine Muttersprache ist, doch um den Wissenstest kommt niemand herum, und dieser hat es in sich. Ganz egal, wie gut man Großbritannien zu kennen glaubt, man weiß nicht die Dinge, die man wissen muss, um den Life in Britain Knowledge Test zu bestehen. Dazu muss man nämlich beispielsweise wissen, wer Sake Dean Mahomet war. (Er war derjenige, der Shampoo in Großbritannien eingeführt hat. Kein Scherz.) Man muss wissen, unter welcher anderen Bezeichnung der Education Act von 1944 noch bekannt ist (»Butler Act«). Man muss wissen, seit wann es die Adelstitel (Peerages) auf Lebenszeit gibt (1958) und in welchem Jahr der Arbeitstag für Frauen und Kinder auf maximal zehn Stunden begrenzt wurde (1847). Man muss in der Lage sein, Jenson Button zu identifizieren. (Es hat keinen Sinn zu fragen, warum.) Die Staatsbürgerschaft kann einem verweigert werden, wenn man nicht weiß, wie groß die Anzahl der Mitgliedsstaaten des Commonwealth ist, wer im Krimkrieg zu den Feinden Großbritanniens gehörte, wie viel Prozent der Bevölkerung sich als Sikhs, Muslims, Hindus oder Christen bezeichnen und wie der Turm von Big Ben tatsächlich heißt. (Es ist der Elizabeth Tower.) Man muss sogar ein paar Dinge wissen, die in Wirklichkeit gar nicht wahr sind. Wenn man zum Beispiel gefragt wird: »Welches sind die beiden am weitesten voneinander entfernten Punkte auf der britischen Hauptinsel?«, muss man antworten: »Land’s End und John o’Groats«, obwohl das gar nicht stimmt. Dieser Test hat es wirklich in sich.
Zur Vorbereitung bestellte ich mir die gesamte Palette von Arbeitshilfen, die aus einem glänzenden Taschenbuch mit dem Titel Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents und zwei zusätzlichen Bänden bestand: einem Official Study Guide, der einem sagt, wie man das erste Buch verwenden soll (im Wesentlichen, indem man auf Seite eins beginnt und dann mit den folgenden Seiten der Reihe nach weitermacht), sowie einem Band mit »offiziellen Übungsfragen und Antworten«, der siebzehn Übungstests enthält. Selbstverständlich machte ich ein paar davon, bevor ich auch nur ein Wort in den anderen Arbeitshilfen las, und war geschockt, wie schlecht ich abschnitt. (Wenn man gefragt wird: »Wie nennt man walisische Abgeordnete?«, lautet die Antwort nicht: »Meistens Gareth oder Dafydd.«)
Der offizielle Leitfaden ist ein interessantes Buch, angenehm unprätentiös, manchmal sogar nichtssagend, hat sein Herz aber am rechten Fleck. Großbritannien, lernt man, ist ein Land, das Fairplay zu schätzen weiß, das hervorragend in Kunst und Literatur ist, das auf gute Manieren Wert legt und das sich schon oft lobenswert erfinderisch gezeigt hat, vor allem, was Dinge anbelangt, die mit Dampf betrieben werden. Bei seinen Einwohnern handelt es sich im Großen und Ganzen um anständige Leute, die gern Gartenarbeit verrichten, Spaziergänge in der freien Natur unternehmen und sonntags Roastbeef und Yorkshire Pudding essen (es sei denn, sie sind Schotten, dann entscheiden sie sich womöglich für Schafsinnereien). Sie machen an der Küste Urlaub, halten sich an den Green Cross Code zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr, stellen sich geduldig an, wählen vernünftig, respektieren die Polizei, verehren ihre Königin und üben sich in allen Belangen in Zurückhaltung. Hin und wieder begeben sie sich in eine Gaststätte, um zwei oder weniger Einheiten guten englischen Biers zu trinken und eine Partie Pool zu spielen oder eine Runde zu kegeln. (Man hat manchmal den Eindruck, die Verfasser des Leitfadens sollten öfter unter Leute gehen.)
Stellenweise ist das Buch so sehr darum bemüht, harmlos zu sein, dass eigentlich überhaupt nichts gesagt wird, wie in der folgenden Beschreibung der modernen Musikszene, die hier ungekürzt wiedergegeben wird: »Es gibt zahlreiche verschiedene Spielorte und Musikveranstaltungen, die überall im Vereinigten Königreich stattfinden.« Vielen Dank für diesen umfassenden Einblick. (Ich möchte kein Besserwisser sein, aber Spielorte finden nicht statt. Sie existieren einfach.) Manchmal ist das Buch inhaltlich schlichtweg verkehrt, das Beispiel von Land’s End und John o’Groats erwähnte ich schon, und manchmal ist es inhaltlich dubios und verkehrt. Es bezeichnet den Schauspieler Anthony Hopkins als jemanden, auf den die Briten stolz sein können, ziemlich offensichtlich ohne innezuhalten und sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Anthony Hopkins inzwischen amerikanischer Staatsbürger ist und in Kalifornien lebt. Außerdem wird sein Vorname falsch buchstabiert. Den Bereich der Westminster Abbey, in dem sich die Grabmäler von Literaten befinden, bezeichnet es als »Poet’s Corner« (im Singular), möglicherweise in dem Irrglauben, dass dort immer nur ein Dichter ruht. Gewöhnlich versuche ich, nicht übermäßig pingelig zu sein, was solche Dinge anbelangt, wenn jedoch vorausgesetzt wird, dass diejenigen, die den Test ablegen, die englische Sprache beherrschen, wäre es vermutlich eine gute Idee sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für den Test ähnliche Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Und so kam nach einem Monat harter Vorbereitung der Tag meines Tests. Nach meinen Instruktionen sollte ich mich zum vereinbarten Zeitpunkt an einem Ort namens Wessex House in Eastleigh, Hampshire, einfinden, dem Testcenter, das meinem Wohnsitz am nächsten gelegen ist. Eastleigh ist eine Satellitenstadt nicht weit von Southampton entfernt und wurde allem Anschein nach im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert. Die Stadt ist erstaunlich wenig denkwürdig: nicht erdrückend hässlich, aber auch nicht gerade ansprechend; nicht bitterarm, aber wohlhabend ebenso wenig; nicht völlig tot in ihrem Zentrum, aber ganz gewiss nicht florierend. Bei der Bushaltestelle handelte es sich um die Außenwand eines Sainsbury’s-Supermarkts, an der ein Glasvordach befestigt war – ganz offensichtlich, um Tauben einen trockenen Ort zum Kacken zu bieten.
Wie so viele britische Städte hat Eastleigh seine Fabriken und Produktionsbetriebe geschlossen und richtet seine gesamte wirtschaftliche Energie stattdessen auf die Zubereitung und das Trinken von Kaffee. In der Stadt gab es im Wesentlichen zwei Arten von Läden: leere Läden und Kaffeeläden. Einige der leeren Läden waren Schildern in ihren Schaufenstern zufolge im Begriff, in Kaffeeläden umgewandelt zu werden, und viele Kaffeeläden erweckten aufgrund ihres Mangels an Kundschaft den Eindruck, als wären sie nicht weit davon entfernt, wieder zu leeren Läden zu werden. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, vermute aber, dass das ein Beispiel für einen sogenannten positiven Kreislauf ist. Ein oder zwei abenteuerlustige Unternehmer hatten Ein-Pfund-Läden und Wettbüros eröffnet, ein paar Wohltätigkeitsorganisationen andere leer stehende Geschäfte übernommen, doch letztlich schien Eastleigh ein Ort zu sein, an dem man entweder einen Kaffee trinken oder sich hinsetzen und Tauben beim Defäkieren zusehen konnte. Ich trank der Wirtschaft zuliebe eine Tasse Kaffee, sah einer Taube auf der anderen Straßenseite beim Defäkieren zu und begab mich dann zum Wessex House, um meinen Test abzulegen.
An diesem Morgen waren außer mir noch vier weitere Kandidaten anwesend. Wir wurden in einen Raum voller Schreibtische geführt, auf denen sich jeweils ein Computermonitor und eine Maus auf einer schlichten Unterlage befanden, und so hingesetzt, dass keiner von uns auf den Bildschirm eines anderen sehen konnte. Nachdem wir Platz genommen hatten, wurde uns ein Übungstest mit vier Fragen ausgehändigt, um zu überprüfen, ob wir in der Lage waren, sicher mit dem Gerät umzugehen. Da es sich um einen Übungstest handelte, waren die Fragen ermutigend einfach und lauteten ungefähr so:
Manchester United ist
(a) eine politische Partei
(b) eine Tanzkapelle
(c) ein englischer Fußballverein
Vier von uns brauchten etwa fünfzehn Sekunden, um die Übungsfragen zu beantworten, doch eine Dame – freundlich, mittleren Alters, etwas pummelig und vermutlich aus einem jener nahöstlichen Länder stammend, in denen eine Menge klebriger Süßigkeiten gegessen werden – brauchte wesentlich länger. Der Testaufseher ging zweimal zu ihr, um sich zu vergewissern, dass bei ihr alles in Ordnung war. Ich verbrachte die Zeit damit, einen diskreten Blick in die Schubladen meines Schreibtischs zu werfen – die nicht abgeschlossen, aber leer waren – und auszuprobieren, ob man Spaß dabei haben kann, wenn man einen Cursor auf einem leeren Bildschirm hin und her bewegt. Fehlanzeige.
Nach einiger Zeit verkündete die Frau, sie sei fertig, und der Aufseher ging zu ihr, um ihre Antworten zu überprüfen. Er beugte sich zu ihrem Monitor hinunter und sagte in einem Tonfall stiller Verwunderung: »Sie haben alle vermasselt.«
Sie lächelte zögerlich und schien sich nicht sicher zu sein, ob es sich dabei um eine Errungenschaft handelte.
»Möchten Sie es noch mal versuchen?«, erkundigte sich der Aufseher hilfsbereit. »Sie haben ein Recht darauf, es noch mal zu versuchen.«
Die Frau hatte allem Anschein nach keine klare Vorstellung, was eigentlich vor sich ging, entschied sich aber mutig dafür weiterzumachen, und so konnte der Test beginnen.
Die erste Frage lautete: »Sie haben Eastleigh gesehen. Sind Sie sicher, dass Sie in Großbritannien bleiben möchten?« Um ehrlich zu sein, kann ich mich weder an den Wortlaut der ersten Frage noch an den der folgenden Fragen erinnern. Da wir nichts mit an den Schreibtisch nehmen durften, konnte ich mir keine Notizen machen oder mir mit einem Bleistift nachdenklich gegen die Zähne klopfen. Der Test bestand aus vierundzwanzig Multiple-Choice-Fragen und dauerte nur ungefähr drei Minuten. Entweder weiß man die Antworten, oder man weiß sie nicht. Als ich fertig war, ging ich zum Schreibtisch des Testaufsehers, und wir warteten gemeinsam, während der Computer meine Antworten überprüfte – ein Vorgang, der etwa genauso lang dauerte wie der Test selbst –, und schließlich teilte er mir mit einem Lächeln mit, dass ich bestanden hätte, er mir aber nicht genau sagen könne, wie ich abgeschnitten hatte. Der Computer zeige nur bestanden oder nicht bestanden an.
»Ich drucke Ihnen nur schnell Ihr Ergebnis aus«, sagte er. Das dauerte wieder eine kleine Ewigkeit. Ich hoffte auf ein schickes pergamentartiges Zeugnis, wie man es bekommt, wenn man die Sydney Harbour Bridge erklimmt oder an einem Kochkurs der Supermarktkette Waitrose teilnimmt, doch es handelte sich einzig um einen blassen Ausdruck, der bestätigte, dass ich für das Leben im modernen Großbritannien intellektuell tauglich war.
Lächelnd wie die Dame aus dem Nahen Osten (die auf der Suche nach einer Tastatur zu sein schien, als ich sie zum letzten Mal erspähte) verließ ich das Gebäude und war zufrieden, ja sogar ein wenig beschwingt. Die Sonne schien. An der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite genehmigten sich zwei Männer in Bomberjacken einen vormittäglichen Aperitif aus identischen Bierdosen. Eine Taube pickte an einer Zigarettenkippe und presste ein bisschen Kot heraus. Das Leben im modernen Großbritannien, so schien es mir, war ziemlich gut.
IV
Einen Tag später traf ich mich mit meinem Verleger, einem reizenden und allseits beliebten Zeitgenossen namens Larry Finlay, in London zum Mittagessen, um über ein Thema für mein nächstes Buch zu sprechen. Larry lebt in stiller Angst davor, dass ich irgendeinen haarsträubend unkommerziellen Stoff vorschlagen könnte – eine Biografie Mamie Eisenhowers vielleicht oder etwas über Kanada –, und versucht deshalb immer, mich mit einem Alternativvorschlag in eine andere Richtung zu lenken.
»Wussten Sie«, fragte er, »dass es zwanzig Jahre her ist, dass Sie Reif für die Insel geschrieben haben?«
»Tatsächlich?«, entgegnete ich und war erstaunt darüber, wie viel Vergangenheit man anhäufen kann, ohne sich anzustrengen.
»Haben Sie jemals über eine Fortsetzung nachgedacht?« Sein Tonfall war beiläufig, aber in seinen Augen sah ich kleine funkelnde Pfund-Zeichen, wo sich normalerweise seine Iris befand.
Ich überlegte kurz. »Eigentlich kommt das genau zur rechten Zeit«, sagte ich. »Ich bin nämlich drauf und dran, die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen.«
»Tatsächlich?«, erwiderte Larry. Die Pfund-Zeichen leuchteten auf und fingen an, leicht zu pulsieren. »Sie geben Ihre amerikanische Staatsbürgerschaft auf?«
»Nein, die behalte ich. Ich habe dann die britische und die amerikanische.«
Larry eilte plötzlich voraus. In seinem Kopf nahmen Marketingpläne Gestalt an. Im Geiste sah er bereits Poster – nicht die ganz großen, sondern die deutlich kleineren – an U-Bahn-Haltestellen hängen. »Sie können ja eine Bestandsaufnahme von Ihrer neuen Heimat machen«, schlug er vor.
»Ich möchte am Ende nicht wieder an all dieselben Orte fahren und über all dieselben Dinge schreiben.«
»Dann fahren Sie an andere Orte«, stimmte mir Larry zu. »Fahren Sie doch nach« – er suchte nach einem Vorschlag, nach einem Ort, an dem noch nie jemand war – »Bognor Regis.«
Ich sah ihn interessiert an. »Das ist diese Woche schon das zweite Mal, dass jemand mir gegenüber Bognor Regis erwähnt«, sagte ich.
»Betrachten Sie es als Zeichen«, entgegnete Larry.
Später am Nachmittag kramte ich zu Hause meinen uralten, zerfledderten AA Complete Atlas of Britain hervor (der so alt ist, dass die M25 darin noch als gepunktete Zukunftsvision abgebildet ist), um nur einmal einen Blick zu riskieren. Besonders neugierig war ich zu erfahren, welches die größte Entfernung ist, die man in Großbritannien in einer geraden Linie zurücklegen kann. Es ist ganz gewiss nicht die Verbindung zwischen Land’s End und John o’Groats, auch wenn das in meinem offiziellen Leitfaden gestanden hatte. (Was genau darin stand, war – fürs Protokoll: »Die größte Entfernung auf der Hauptinsel liegt zwischen John o’Groats an der Nordküste Schottlands und Land’s End in der südwestlichsten Ecke Englands. Sie beträgt etwa 870 Meilen.«) Zunächst einmal ist die nördlichste Landzunge nicht John o’Groats, sondern Dunnet Head, acht Meilen weiter im Westen, und mindestens sechs weitere Ausbuchtungen am selben Küstenabschnitt liegen nördlicher als John o’Groats. Das tatsächliche Problem besteht jedoch darin, dass die Reise von Land’s End nach John o’Groats einen Zickzackkurs erfordern würde. Wäre ein Zickzackkurs erlaubt, könnte man auf jeder beliebigen Route kreuz und quer durchs Land tingeln und somit die Strecke praktisch unendlich in die Länge ziehen. Ich wollte wissen, welches die maximale Entfernung ist, die man in einer geraden Linie zurücklegen kann, ohne dabei Salzwasser zu überqueren. Als ich ein Lineal auf die Seite legte, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass es von Land’s End und John o’Groats wegschwenkte wie eine ausschlagende Kompassnadel. Die längste gerade Linie begann in Wirklichkeit in der oberen linken Ecke der Karte an einer abgelegenen schottischen Landspitze, die Cape Wrath genannt wird. Noch interessanter war, dass sie unten genau durch Bognor Regis verlief.
Larry hatte recht gehabt. Es war ein Zeichen.
Für kurze Zeit zog ich die Möglichkeit in Betracht, entlang meiner neu entdeckten Linie (der Bryson-Linie, wie der Name lauten würde, unter dem sie allgemein bekannt werden sollte, nachdem ich sie erkundet hatte) durch Großbritannien zu reisen, doch ich erkannte fast sofort, dass das weder praktisch noch erstrebenswert gewesen wäre. Hätte ich die Linie wörtlich genommen, hätte es für mich bedeutet, durch die Häuser und Gärten anderer Leute zu marschieren, über weglose Felder zu stapfen und durch Flüsse zu waten, was natürlich völliger Blödsinn gewesen wäre. Und wenn ich nur versucht hätte, mich möglichst nah daran zu halten, hätte ich ständig meinen Weg durch Vorstadtstraßen in Orten wie Macclesfield und Wolverhampton suchen müssen, was auch nicht gerade verlockend klang. Aber ich konnte die Bryson-Linie zumindest als eine Art Leuchtfeuer verwenden, um mir den Weg weisen zu lassen. Ich beschloss, meinen Start und mein Ziel auf ihre Endpunkte zu legen und ihr von Zeit zu Zeit einen Besuch abzustatten, wenn das bequem möglich war und wenn ich daran dachte, aber ich wollte mir nicht den Zwang auferlegen, ihr peinlich genau zu folgen. Sie sollte eher mein Terminus ad quem sein, was auch immer das genau bedeuten mochte. Unterwegs wollte ich – sofern möglich – die Orte meiden, die ich bei meiner ersten Reise besucht hatte (die Gefahr wäre zu groß, dass ich an einer Ecke stehen und missbilligend brummen würde, weil seit meinem letzten Besuch alles den Bach hinuntergegangen ist), und mich stattdessen auf Orte konzentrieren, an denen ich noch nie war, in der Hoffnung, sie mit frischen, unvoreingenommenen Augen betrachten zu können.
Besonders gefiel mir die Idee mit Cape Wrath. Ich wusste nichts darüber – was mich betraf, hätte es sich dabei auch um einen Wohnwagen-Abstellplatz handeln können –, doch es klang zerklüftet und von der Brandung malträtiert und schwer zugänglich: ein Ziel für einen erstzunehmenden Reisenden. Wenn mich jemand fragen würde, wohin ich unterwegs wäre, könnte ich den Blick mit versteinerter Miene auf den nördlichen Horizont richten und sagen: »Nach Cape Wrath, so Gott will.« Ich stellte mir vor, wie mein Gegenüber vor Bewunderung leise pfeifen und erwidern würde: »Donnerwetter, das ist ein weiter Weg.« Ich würde das mit einem grimmigen Nicken bestätigen und hinzufügen: »Ich bin mir nicht mal sicher, ob es dort überhaupt eine Teestube gibt.«
Doch vor diesem fernen Abenteuer lagen noch Hunderte Meilen mit historischen Städten und bezaubernder Landschaft, die ich hinter mich bringen musste, sowie ein Besuch in dem berühmten englischen Seebad Bognor.
1. Kapitel
Scheiß auf Bognor!
Bevor ich zum ersten Mal nach Bognor Regis fuhr, wusste ich nur, wie man es schreibt und dass irgendein britischer Monarch zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit in einem Anflug von Bissigkeit auf dem Sterbebett, kurz bevor er seinen letzten Atemzug tat, die Worte »Scheiß auf Bognor!« gerufen haben soll. Um welchen Monarchen es sich dabei handelte und weshalb es sein letzter Wunsch auf Erden war, dass auf ein mittelgroßes englisches Seebad defäkiert werden solle, sind jedoch Fragen, die ich nicht beantworten konnte.
Der Monarch, das habe ich inzwischen erfahren, war König George V., und er soll angeblich 1929 nach Bognor gereist sein, und zwar auf Anraten seines Arztes Lord Dawson of Penn, der dem König vorschlug, eine Weile an der frischen Seeluft zu verbringen, da ihm das womöglich dabei helfen werde, sich von seinen starken Lungenbeschwerden zu erholen. Die Tatsache, dass Dawson zur Behandlung nichts Besseres einfiel als ein Tapetenwechsel, spiegelt vermutlich sein markantestes Merkmal als Arzt wider: Inkompetenz. Dawson war in der Tat so berüchtigt für sein medizinisches Unvermögen, dass ihm zu Ehren sogar ein Liedchen komponiert wurde. Sein Text lautete:
Lord Dawson of Penn
Hat viele Menschen getötet.
Deshalb singen wir
Gott schütze den König.
Für Bognor entschied sich der König nicht, weil es ihm besonders am Herzen lag, sondern weil sein reicher Busenfreund Sir Arthur du Cros dort einen herrschaftlichen Wohnsitz mit Namen Craigwell House besaß, den er dem König zur freien Verfügung stellte. Craigwell war dem Vernehmen nach ein hässlicher und unbequemer Zufluchtsort, und dem König gefiel es dort überhaupt nicht, doch die Seeluft tat ihm gut, und nach ein paar Monaten hatte er sich ausreichend erholt, um nach London zurückzukehren. Falls er Bognor mit irgendwelchen schönen Erinnerungen verließ, behielt er diese für sich.
Als der König sechs Jahre später einen Rückfall erlitt und im Sterben lag, gab ihm Dawson das leere Versprechen, es werde ihm bald gut genug gehen, um wieder in Bognor Urlaub machen zu können. »Scheiß auf Bognor!«, soll der König darauf erwidert haben und anschließend gestorben sein. Diese Geschichte wird fast immer als Fiktion abgetan, doch Kenneth Rose, einer der Biografen von König George V., ist der Ansicht, dass sie durchaus wahr sein könnte und sicher nicht dem Naturell des Königs widerspricht.
Aufgrund des kurzen Aufenthalts des Regenten stellte Bognor den Antrag, dass der Name der Stadt um das Wort »Regis« ergänzt werde. 1929 wurde diesem Antrag stattgegeben, sodass der absolute Höhepunkt des Seebads und der Beginn seines Niedergangs zeitlich fast genau zusammenfallen.
Wie ein sehr großer Teil der britischen Küste hat Bognor schon bessere Zeiten gesehen. Früher strömten fröhliche, gut gekleidete Besucher in Scharen in die Stadt, um dort ein unbeschwertes Wochenende zu verbringen. Bognor besaß ein Theatre Royal, einen prachtvollen Pavillon mit einer Tanzfläche, die als die beste in ganz Südengland galt, und einen hochgeschätzten, wenn auch nicht völlig korrekt bezeichneten Kursaal, in dem niemand von etwas geheilt wurde, sondern die Gäste zur Musik eines dort ansässigen Orchesters Rollschuh fahren und anschließend unter riesigen Palmen dinieren konnten. All das ist inzwischen längst Vergangenheit.
Der Pier von Bognor hat überlebt, allerdings nur mit Mühe und Not. Früher war er 300 Meter lang, doch verschiedene Eigentümer fanden Gefallen daran, ihn nach Brand- oder Sturmschäden zurechtzustutzen, sodass es sich bei ihm heutzutage nur noch um einen knapp hundert Meter langen Stummel handelt, der das Meer nicht mehr ganz erreicht. Lange Zeit wurde in Bognor ein sogenannter Vogelmenschen-Wettbewerb abgehalten, bei dem die Teilnehmer versuchten, am Ende des Piers mithilfe verschiedener selbst gebastelter Vorrichtungen abzuheben – mit Fahrrädern, an die seitlich Raketen geschnallt waren, und anderen Dingen dieser Art. Die Teilnehmer legten ausnahmslos nur eine lächerlich kurze Strecke zurück, ehe sie zur Freude der Zuschauermenge ins Wasser platschten, doch der gekürzte Pier sorgte schließlich dafür, dass sie auf eine Weise auf Sand und Kies bruchlandeten, die eher beunruhigend als amüsant war. Der Wettkampf wurde 2014 gestrichen und ist jetzt allem Anschein nach dauerhaft ein paar Meilen die Küste entlang nach Worthing umgezogen, wo die Preisgelder höher sind und der Pier tatsächlich bis ins Meer hineinragt.
In dem Bemühen, Bognors langsamen, sanften Niedergang umzukehren, rief der Arun District Council 2005 die Bognor Regis Regeneration Task Force ins Leben, mit dem Ziel, der Stadt Investitionen in Höhe von 500 Millionen Pfund zu verschaffen. Als klar wurde, dass eine Summe in dieser Größenordnung niemals zusammenkommen würde, wurde die Zielsetzung still und heimlich zuerst auf 100 Millionen Pfund und dann auf 25 Millionen Pfund herunterkorrigiert. Doch auch diese Beträge erwiesen sich als zu ehrgeizig. Letztlich kam man zu dem Schluss, dass eine Summe von ungefähr null Pfund ein realistischeres Ziel war. Als sich die Erkenntnis einstellte, dass dieses Ziel bereits erreicht worden war, wurde die Task Force aufgelöst, da sie ihre Arbeit erledigt hatte. Soweit ich es beurteilen kann, tun die Behörden nicht mehr für Bognor, als es auf Sparflamme köcheln zu lassen – wie einen Patienten, der künstlich am Leben gehalten wird.
Trotz allem ist Bognor gar nicht so übel. Es hat einen langen Strand mit einer geschwungenen asphaltierten Strandpromenade und einen Stadtkern, der zwar nicht floriert, aber zumindest kompakt und sauber ist. Ein kleines Stück landeinwärts vom Meer befindet sich ein bewaldeter Zufluchtsort namens Hotham Park, mit gewundenen Pfaden, einem kleinen Bootsteich und einer Spielzeugeisenbahn. Allerdings muss man sagen, dass das auch schon alles ist. Wenn man im Internet sucht, was man in Bognor unternehmen kann, erscheint der Hotham Park ganz oben auf der Liste. Die zweite Attraktion, die einem vorgeschlagen wird, ist ein Laden, der Elektromobile für Senioren verkauft.
Ich ging zum Meer hinunter. Etliche Leute schlenderten umher und genossen die Sonne. Uns stand ein herrlicher Sommer bevor, und bereits um halb elf vormittags zeigte sich, dass dieser Tag nach englischen Maßstäben brütend heiß werden würde. Mein ursprünglicher Plan war, am Ufer entlang Richtung Westen nach Craigwell zu spazieren, um mir anzusehen, wo der König gewohnt hatte, doch dieses Vorhaben wurde im Keim erstickt, als ich erfuhr, dass Craigwell 1939 abgerissen wurde und sein ehemaliger Standort heute irgendwo unter einer Wohnsiedlung begraben ist. Deshalb ging ich stattdessen die Promenade entlang nach Osten Richtung Felpham, da fast alle anderen Spaziergänger ebenfalls in diese Richtung gingen und ich annahm, sie wussten, was sie taten.
Auf der einen Seite befanden sich der Strand und das glitzernde Meer, auf der anderen stand eine Reihe schicker moderner Häuser, geschlossen von hohen Mauern umgeben, die sie vor den Blicken der Spaziergänger auf der Promenade abschirmen sollten. Den Eigentümern war es aber nicht gelungen, das offensichtliche Problem zu lösen, dass eine Mauer, die Passanten daran hindert hineinzuspähen, auch diejenigen, die sich hinter ihr befinden, daran hindert, nach draußen zu sehen. Wollten die Bewohner dieser stilvollen Häuser aufs Meer schauen, mussten sie sich in den ersten Stock begeben und auf den Balkon setzen, womit sie wieder unseren Blicken ausgesetzt waren. Wir konnten alles sehen: ob sie gebräunt oder blass waren, ob sie etwas Kaltes oder etwas Warmes tranken, ob sie eine Boulevardzeitung oder den Telegraph lasen. Die Leute auf den Balkonen taten so, als wäre ihnen das egal, doch man merkte, dass es ihnen nicht egal war. Schließlich war das auch ziemlich viel verlangt: Zunächst einmal mussten sie so tun, als ob ihre Balkone sie irgendwie unsichtbar für uns machen würden, und dann mussten sie auch noch so tun, als ob wir ohnehin nur ein so nebensächlicher Teil des Panoramas wären, dass sie eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen hätten, wie wir von dort unten zu ihnen hinaufblickten. Das war eine ganze Menge So-tun-als-Ob.
Als Test versuchte ich, Augenkontakt mit den Leuten auf den Balkonen herzustellen. Ich lächelte, als wollte ich sagen: »Hallo, da oben, ich sehe Sie!«, aber sie wendeten immer schnell den Blick ab oder täuschten vor, mich überhaupt nicht wahrzunehmen, da ihre gesamte Aufmerksamkeit irgendetwas in der Ferne am Horizont galt, in der Nähe von Dieppe oder möglicherweise Deauville. Manchmal denke ich, dass es ziemlich anstrengend sein muss, Engländer zu sein. Auf jeden Fall hatte ich keinen Zweifel daran, dass wir es auf der Strandpromenade viel besser hatten, da wir das Meer die ganze Zeit über anschauen konnten, ohne uns auf eine höhere Ebene begeben zu müssen, und nie so tun mussten, als könne uns niemand beobachten. Das Allerbeste war jedoch, dass wir letzten Endes in unsere Autos steigen und uns zurück zu einem Zuhause chauffieren konnten, bei dem es sich nicht um Bognor Regis handelte.
Mein Plan war, von Bognor aus mit dem Bus an der Küste entlang nach Brighton zu fahren, und ich war darauf insgeheim ziemlich gespannt. Diesen Küstenabschnitt kannte ich überhaupt nicht, und ich setzte große Hoffnungen in ihn. Ich hatte mir einen Fahrplan ausgedruckt und sorgfältig den Bus um 12:19 Uhr als den am besten für meine Zwecke geeigneten ausgewählt. Doch als ich in der Meinung, noch ein paar Minuten Zeit zu haben, zur Bushaltestelle schlenderte, musste ich mit leichtem Entsetzen feststellen, wie mein Bus unmittelbar vor einer Wolke schwarzen Rauchs abfuhr. Ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass meine Uhr falsch ging. Offenbar machte ihre Batterie schlapp. Da ich eine halbe Stunde totschlagen musste, bis der nächste Bus kam, betrat ich einen Juwelierladen, in dem sich ein trübselig wirkender Mann die Uhr ansah. Dann teilte er mir mit, dass eine neue Batterie 30 Pfund kosten würde.
»Aber so viel habe ich kaum für die Uhr bezahlt«, protestierte ich.
»Das erklärt womöglich, warum sie nicht mehr funktioniert«, erwiderte er und gab mir die Uhr mit einem Ausdruck majestätischer Gleichgültigkeit zurück.
Ich wartete darauf, ob er noch irgendetwas sagen wollte, ob er einen Schimmer von Interesse daran hatte, mir dabei zu helfen, wieder die richtige Uhrzeit am Handgelenk zu haben, und zugleich sein Geschäft am Laufen zu halten. Allem Anschein nach nicht.
»Also ich lasse das erst mal«, sagte ich. »Ich sehe ja, dass Sie sehr beschäftigt sind.«
Falls er auch nur das geringste Verständnis für meinen Sinn für Humor hatte, gelang es ihm nicht, das zu zeigen. Er zuckte mit den Schultern, und das war das Ende unserer Beziehung.
Ich hatte Hunger, doch mir blieben jetzt nur noch zwanzig Minuten, bis der nächste Bus auftauchte, deshalb betrat ich eine McDonald’s-Filiale, um Zeit zu sparen. Ich hätte es besser wissen sollen. Sie wiederum müssen wissen, McDonald’s und ich haben eine Vorgeschichte. Nach einem großen Familienausflug vor ein paar Jahren hielten wir als Reaktion auf das Geschrei einer Rückbank voller Enkel, die um eine ungesunde Mahlzeit flehten, bei McDonald’s an, und mir wurde die Verantwortung übertragen, die Bestellung aufzugeben. Ich interviewte gewissenhaft jeden Einzelnen aus unserer Reisegruppe – ungefähr zehn Leute in zwei Autos –, notierte die Bestellung auf der Rückseite eines alten Briefumschlags und trat an den Tresen.
»Okay«, sagte ich entschlossen zu dem jugendlichen Angestellten, als ich an der Reihe war. »Ich hätte gern fünf Big Macs, vier Viertelpfünder mit Käse, zwei Schoko-Milchshakes …«
In diesem Moment trat jemand an mich heran, um mir mitzuteilen, dass eines von den Kindern anstelle eines Bic Mac lieber Chicken McNuggets wolle.
»Entschuldigung«, sagte ich und fuhr dann fort: »Also bitte vier Big Macs, vier Viertelpfünder mit Käse, zwei Schoko-Milchshakes …«
In diesem Augenblick zog ein kleiner Mensch an meinem Ärmel und ließ mich wissen, dass er keinen Schoko-Milchshake, sondern lieber einen Erdbeer-Milchshake hätte. »Gut«, sagte ich und wandte mich wieder dem jungen Angestellten zu, »also bitte vier Big Macs, vier Viertelpfünder mit Käse, einen Schoko-Milchshake, einen Erdbeer-Milchshake, dreimal Chicken McNuggets …«
Und so ging es weiter, als ich mich durch die lange und komplizierte Gruppenbestellung arbeitete und diese von Zeit zu Zeit korrigierte.
Als das Essen kam, stellte mir der junge Mann ungefähr elf Tabletts mit dreißig oder vierzig Tüten hin.
»Was ist denn das?«, fragte ich.
»Ihre Bestellung«, erwiderte er und las mir meine Bestellung noch einmal vom Display der Kasse vor: »Vierunddreißig Big Macs, zwanzig Viertelpfünder mit Käse, zwölf Schoko-Milchshakes …« Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann meine Bestellung nicht korrigiert, wenn ich noch einmal von vorne begonnen hatte, sondern einfach alles hinzugefügt.
»Ich habe nicht zwanzig Viertelpfünder mit Käse bestellt, ich habe fünfmal vier Viertelpfünder mit Käse bestellt.«
»Ist doch dasselbe«, sagte er.
»Das ist überhaupt nicht dasselbe. So dumm können Sie doch nicht sein.«
Zwei oder drei Leute, die hinter mir anstanden, schlugen sich auf die Seite des jungen Angestellten.
»Sie haben das alles bestellt«, sagte einer von ihnen.
Der Filialleiter erschien und warf einen Blick auf das Display der Kasse. »Hier steht: zwanzig Viertelpfünder mit Käse«, stellte er fest, als handle es sich um eine Pistole mit meinen Fingerabdrücken.
»Ich weiß, was da steht, aber das habe ich nicht bestellt.«
Einer meiner erwachsenen Söhne kam herbei, um in Erfahrung zu bringen, was los war. Ich erklärte ihm, was passiert war, worauf er die Angelegenheit mit Bedacht abwog und zu dem Schluss gelangte, dass das Ganze unter Berücksichtigung aller Umstände meine Schuld war.
»Ich fasse es nicht, dass Sie alle so dumm sind«, sagte ich zu einem Publikum, das inzwischen aus etwa sechzehn Personen bestand, von denen ein paar gerade erst eingetroffen waren, sich aber bereits gegen mich verschworen hatten. Schließlich eilte auch noch meine Frau herbei und führte mich am Ellbogen weg, wie ich sie früher vor sich hin brabbelnde Psychiatriepatienten in einen stillen Raum habe führen sehen. Sie löste das Problem gütlich mit dem Filialleiter und dem Angestellten, brachte innerhalb von etwa dreißig Sekunden zwei Tabletts mit Essen an den Tisch und teilte mir mit, dass ich nie wieder ein McDonald’s-Restaurant betreten dürfe, weder allein noch unter Beaufsichtigung.
Und jetzt war ich zum ersten Mal seit dem erwähnten Tumult wieder bei McDonald’s. Ich nahm mir fest vor, mich zu benehmen, aber so ein Laden ist einfach zu viel für mich. Ich bestellte einen Chickenburger und eine Cola light.
»Möchten Sie Pommes dazu?«, fragte der junge Mann, der mich bediente.
Ich zögerte einen Moment und sagte dann in gequältem, aber geduldigem Tonfall: »Nein. Deshalb habe ich auch keine Pommes bestellt, wissen Sie?«
»Wir haben die Anweisung zu fragen«, erklärte er.
»Wenn ich Pommes möchte, sage ich in der Regel so was wie: ›Außerdem hätte ich gern Pommes.‹ Das ist das Prinzip, das ich anwende.«
»Wir haben die Anweisung zu fragen«, wiederholte er.
»Soll ich Ihnen aufzählen, was ich auch nicht möchte? Das ist allerdings eine ziemlich lange Liste. Da steht alles drauf, was es hier gibt, bis auf die zwei Sachen, die ich bestellt habe.«
»Wir haben die Anweisung zu fragen«, wiederholte er noch einmal, allerdings in einem finstereren Tonfall, stellte meine beiden Dinge aufs Tablett und wünschte mir, ohne die geringste Spur von Aufrichtigkeit, noch einen schönen Tag.
Mir wurde bewusst, dass ich für McDonald’s wahrscheinlich noch nicht ganz bereit war.
Die Busverbindung von Bognor Regis über Littlehampton nach Brighton wird als »Coastliner 700« angepriesen, was modern und elegant klingt, möglicherweise sogar turboaufgeladen. Ich stellte mir vor, dass ich hoch oben über der Straße in klimatisiertem Komfort in einem vornehmen Samtsessel sitzen und durch leicht getönte Scheiben – von der so zart eingefärbten Sorte, dass man versucht ist, sich zu seinem Sitznachbarn zu drehen und zu sagen: »Sind die Scheiben leicht getönt, oder hat Littlehampton einen schwachen Blaustich?« – den Ausblick auf das glitzernde Meer und die hügelige Landschaft genießen würde.
Als der Bus angekeucht kam, verfügte er in Wirklichkeit über keines dieser Merkmale. Es handelte sich um einen überfüllten, stickigen Eindecker mit harten Metallkanten und Plastikschalensitzen: ein Vehikel, wie man es erwarten würde, wenn man von einem Gefängnis zu einem anderen transportiert wird. Das Positive daran war, dass er billig war: 4,40 Pfund für die Fahrt nach Hove – weniger, als ich am Abend zuvor in London für ein Bier bezahlt hatte.
Ich war immer noch voller vorsichtiger Vorfreude darauf, gleich durch eine Reihe kleiner und, wie ich hoffte, reizender Ferienorte zu fahren: Littlehampton, Goring-by-Sea, Angmering, Worthing, Shoreham. Ich stellte mir sie als glückliche Ortschaften vor, wie man sie in einem Ladybird-Buch aus den Fünfzigerjahren finden würde, mit Hauptstraßen, in denen es einladende Teestuben und Geschäfte mit leuchtenden und gestreiften Markisen gab, die Windrädchen und Strandbälle verkauften, dazu Leute, die mit Waffeln mit gelben Eiskugeln in der Hand umherspazierten. Doch die meiste Zeit – eine gute Stunde lang oder sogar länger – näherten wir uns weder dem Meer noch irgendwelchen identifizierbaren Ortschaften. Stattdessen rollten wir auf Umgehungsstraßen und doppelspurigen Schnellstraßen durch ein endloses Vorstadtgewirr, kamen an nichts als riesigen Supermärkten, den »Superstores« (eine der am wenigsten korrekten Bezeichnungen im modernen britischen Leben), Tankstellen, Autohäusern und all den anderen unverzichtbaren Hässlichkeiten unserer Zeit vorbei. Ein früherer Fahrgast hatte in der Aufbewahrungstasche neben mir zwei Hochglanzmagazine zurückgelassen, und ich zog in einem Moment gelangweilter Neugier eines davon heraus. Es handelte sich um eine von den Zeitschriften mit seltsam eindringlichem Titel – Hello!,OK!,Now!,What Now! Not Now! –, und den Überschriften auf dem Cover zufolge schien es ausschließlich um weibliche Promis zu gehen, die in letzter Zeit stark zugenommen hatten, wobei nicht eine einzige von denen, die abgebildet waren, vor der Gewichtszunahme besonders reizvoll ausgesehen hatte. Bei keiner von ihnen hatte ich eine Ahnung, wer sie war, aber über ihr Leben mehr zu erfahren war faszinierend. In meinem Lieblingsartikel – womöglich der tollste gedruckte Text, den ich jemals gelesen habe – ging es um eine Schauspielerin, die ihren nichtsnutzigen Partner der Lächerlichkeit preisgab, indem sie ihm eine Vaginalrenovierung für 7500 Pfund in Rechnung stellte. Das nenne ich Rache! Aber was bitte bekommt man mit einer Vaginalrenovierung? WLAN? Eine Sauna? Bedauerlicherweise ging der Beitrag darauf nicht ein.
Ich hatte angebissen und ertappte mich dabei, dass ich in die prunkvoll heruntergewirtschafteten Leben von Prominenten vertieft war, deren gemeinsamer Nenner winzige Gehirne, riesige Brüste und die Gabe, sich auf bedauernswerte Beziehungen einzulassen, zu sein schien. Etwas weiter hinten in derselben Ausgabe stieß ich auf die faszinierende Überschrift: »Töte nicht aus Ruhmsucht dein Baby!« Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen Rat von Katie Price (eine Doppelgängerin des nicht mehr existenten Models Jordan, wenn Sie mich fragen) an ein aufsteigendes Sternchen namens Josie. Ms Price nahm kein Blatt vor den Mund. »Hör mal, Josie«, schrieb sie. »Ich finde dich echt widerlich. Möpse zu haben und abtreiben zu lassen macht dich noch lange nicht berühmt!« Obwohl ich geneigt war, Katie in diesem Punkt verstandes- und gefühlsmäßig zuzustimmen, ließ der Beitrag eher den Eindruck entstehen, dass Josie der lebende Beweis für das Gegenteil war.
Die Fotos von Josie zeigten eine junge Frau mit Brüsten wie Luftballons und Lippen, bei denen man unweigerlich an schwimmende Sperren denken musste, wie sie zum Eingrenzen von Ölteppichen verwendet werden. Dem Artikel zufolge erwartete sie »ihren dritten Sohn in zwei Monaten«. Wir sind uns vermutlich einig, dass das eine beträchtliche Fortpflanzungsrate ist – selbst für jemanden, der aus Essex stammt. In dem Artikel hieß es weiter, Josie wäre so enttäuscht darüber, schon wieder einen Jungen zu bekommen und nicht das Mädchen, das sie sich sehnlichst wünschte, dass sie wieder mit dem Rauchen und Trinken begonnen hatte, um ihrem Reproduktionssystem ihr Missfallen zu signalisieren. Sie hatte sogar eine Abtreibung in Betracht gezogen, weshalb Ms Price sich so emotional ins Getümmel gestürzt hatte. Der Beitrag erwähnte flüchtig, dass die junge Josie mit zwei Buchverlagen in Verhandlung stehe. Sollte sich herausstellen, dass mein eigener Verlag einer davon ist, werde ich seine Büroräume eigenhändig niederbrennen.
Ich hasse es, wie ein alter Mann daherzukommen, aber warum sind solche Leute berühmt? Welche Fähigkeiten besitzen sie, die sie bei einer breiten Öffentlichkeit beliebt machen? Talent, Intelligenz, Attraktivität und Charme können sofort von der Liste gestrichen werden, und was bleibt dann noch übrig? Zierliche Füße? Frischer Pfefferminzatem? Ich habe keinen blassen Schimmer. Anatomisch betrachtet wirken etliche von ihnen nicht einmal wie Menschen. Viele haben Namen, die den Eindruck erwecken, als wären sie aus einer fernen Galaxie zu uns gelangt: Ri-Ri, Tulisa, Naya, Jai, K-Pez, Chlamydia, Toss-R, Mo-Ron. (Möglicherweise habe ich ein paar davon frei erfunden.) Während ich die Zeitschrift las, hörte ich unaufhörlich eine Stimme in meinem Kopf, die klang wie aus dem Trailer eines zweitklassigen Fünfzigerjahre-Spielfilms und sagte: »Sie kommen vom Planeten der Schwachsinnigen!«
Woher auch immer sie stammen, sie existieren heutzutage in Scharen. Als wollte er meinen Standpunkt veranschaulichen, bestieg kurz nach Littlehampton ein junger Mann in Baggy Pants und mit lässiger Haltung den Bus und ließ sich gegenüber von mir auf einem Sitz nieder. Er trug eine Baseballkappe, die für seinen Kopf mehrere Nummern zu groß war, und nur seine übergroßen Ohren hinderten sie daran, ihm über die Augen zu rutschen. Das Schild der Kappe sah aus wie platt gewalzt, und auf ihm prangte noch das glänzende, hologrammartige Preisschild. An der Stirnseite stand in Großbuchstaben das Wort OBEY, »GEHORCHE«. Ohrhörer schickten dröhnende Schallwellen auf die Reise durch die überwältigende interstellare Leere seines Schädels, auf der Suche nach dem entlegenen, ausgedörrten Staubpartikel, bei dem es sich um sein Gehirn handelte. Das hatte vermutlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Jagd nach dem Higgs-Teilchen. Würde man sämtliche junge Männer in Südengland mit solchen Mützen und einer solchen Haltung nehmen und sie in einen Raum stecken, hätte man trotzdem nicht genug IQ-Punkte zusammen für einen Halbidioten. Wahrscheinlich bin ich jetzt unfair.
Ich widmete mich der zweiten Zeitschrift, Shut the Fuck Up! Aus dieser erfuhr ich, dass Katie Price vielleicht doch nicht das weisen Rat erteilende Vorbild war, für das ich sie bis dahin gehalten hatte. Der Leser bekam eine Führung durch Katies verwirrend weitläufiges Liebesleben, das drei Ehen, zwei gelöste Verlobungen, mehrere Kinder sowie sieben weitere ernste, aber kurzlebige Verbindungen umfasste – und dabei handelte es sich nur um den jüngsten Abschnitt ihres viel beschäftigten Daseins. Sämtliche Beziehungen von Ms Price waren erstaunlich unbefriedigend gewesen, allen voran ihre jüngste. Sie hatte einen Typen geheiratet, Kieran, dessen Hauptbegabung meiner Ansicht nach in der Fähigkeit bestand, seine Haare auf interessante Art und Weise zu Berge stehen zu lassen. Nicht lange, nachdem die beiden in Katies 1100-Zimmer-Villa gezogen waren, fand Katie heraus, dass Kieran mit ihrer allerbesten (inzwischen vermutlich ehemals allerbesten) Freundin zugange gewesen war. Als hätte das nicht schon genügt (aber in Katies Welt kann es nie zu viel sein), kam sie dahinter, dass noch eine ihrer allerbesten Freundinnen Kieran in der Praxis erprobte. Verständlicherweise war Ms Price stinksauer. Ich denke, wir können uns hier womöglich auf den Buckingham-Palast der Vaginalrenovierungen gefasst machen.
ENDE DER LESEPROBE