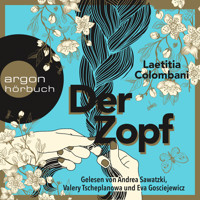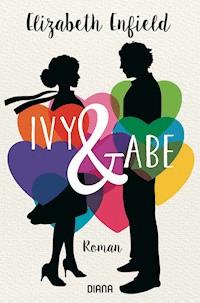
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ivy und Abe – zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind. Sie begegnen sich zu verschiedenen Zeiten in ihrem Leben. Doch das perfekte Glück verpassen sie immer. Mal wechseln sie ein paar Worte in einem Café, dann trennen sich ihre Wege wieder. Ein anderes Mal haben sie eine Affäre miteinander. Später sind sie verheiratet, aber ihre Ehe steckt in einer tiefen Krise. Ihr Leben lang tragen Ivy und Abe etwas von dem anderen in sich. Innige Momente, in denen sie ihre Liebe spüren. Wird sie je von Dauer sein?
Ivy & Abe – eine spannende Reise ins Labyrinth der Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Ähnliche
Das Buch
Ivy und Abe – zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind. Sie begegnen sich zu verschiedenen Zeiten in ihrem Leben. Doch das perfekte Glück verpassen sie immer. Mal wechseln sie ein paar Worte in einem Café, dann trennen sich ihre Wege wieder. Ein anderes Mal haben sie eine Affäre miteinander. Später sind sie verheiratet, aber ihre Ehe steckt in einer tiefen Krise. Ihr Leben lang tragen Ivy und Abe etwas von dem anderen in sich. Innige Momente, in denen sie ihre Liebe spüren. Wird sie je von Dauer sein?
Die Autorin
Elizabeth Enfield ist sowohl Schriftstellerin als auch freie Journalistin. Sie schreibt für verschiedene englische Zeitungen und Zeitschriften und unterrichtet Kreatives Schreiben und Journalismus. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Brighton. Mit ihrem Roman Ivy und Abe erscheint sie erstmals auf Deutsch.
Aus dem Englischen von Babette Schröder
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Elizabeth Enfield
Die Originalausgabe erscheint 2018 unter dem Titel Ivy and Abe bei Michael Joseph, an imprint of Penguin Random House UK, London
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Allies Interactive, KoQ Creative, bel_ka, Kues, Elena_Titova /Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-20376-4V001
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Für Mick – in Liebe
Laut der »M-Theorie« ist unser Universum nicht das einzige, das existiert. Stattdessen behauptet die »M-Theorie«, dass aus dem Nichts eine Vielzahl verschiedener Universen entstanden sind.
STEPHEN HAWKING, DER GROSSE ENTWURF
LONDON, 2026
Ich weiß, es ist hart. Eines Menschen Leben hängt mit so vielen anderen zusammen. Wenn eins davon fehlt, gibt es gleich eine große Lücke, nicht wahr?
FRANK CAPRA, IST DAS LEBEN NICHT SCHÖN
MIR WAR BEWUSST, dass er mich ansah.
Welche Gabe auch immer uns dazu befähigte, Dinge wahrzunehmen, die wir eigentlich nicht wahrnehmen durften – ich spürte sie gerade sehr deutlich.
Ich wurde nervös.
Würde ich seinem Blick begegnen, wenn ich aufsah? Und wenn, würde ich dann einfach nur freundlich lächeln oder unwillkürlich den Blick abwenden? Beschämt?
Er kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich wusste nicht, woher. Sein Gesicht war zum Teil von einer Mütze verdeckt, der Art, wie Max sie als Student getragen hatte.
Ich bezeichnete sie damals als griechische Fischermütze, woraufhin Richard mir erklärte, das sei eine Mao-Mütze.
»Ich glaube, unser ältester Sohn möchte wie ein revolutionärer Arbeiter aussehen, nicht wie ein Fischer vom Mittelmeer«, gab er zu bedenken. »Gemischt mit einem Hauch Dylan und einem Spritzer Guthrie.«
Max hatte damals auf geradezu lächerliche Weise auf sein Image geachtet, doch das tun die meisten Jungs in dem Alter.
Connor mit seinen vier Jahren war das genaue Gegenteil: Er achtete überhaupt nicht auf das, was er anzog, selbst wenn er als Tiger verkleidet mit mir auf die Straße ging.
»Oh, wie siehst du denn aus! Bist du ein Tiger?«, fragten wohlmeinende Passanten, woraufhin mein Enkelsohn nur den Kopf schüttelte. Manchmal erklärte er auch, dass er »einfach nur ein Tigerkostüm trage«.
Heute war er ein ganz normaler kleiner Junge mit blauen Shorts und einem gestreiften Pullover, und ich schien diejenige zu sein, die die Aufmerksamkeit auf sich zog. Was eher selten vorkommt, wenn man die siebzig überschritten hat.
Ich fuhr fort, meine Einkäufe an der Kasse zu scannen. Die Unsicherheit, die sich einstellte, weil ich mich beobachtet fühlte, machte mir die routinemäßigen Handgriffe seltsam bewusst – wie ich Brot, Croissants und eine Packung Schokoladentaler, mit denen ich Connor auf dem Rückweg zu meiner Wohnung bestechen würde, durch die Selbstbedienungskasse zog.
Hannah würde sagen: »Hoffentlich hat Grandma dir nicht zu viel ungesundes Zeug gegeben«, wenn sie ihn nach der Arbeit abholte. Aber sie war mir nicht wirklich gram. Oder vielleicht schon, doch sie behielt es für sich. Falls ich mich als Schwiegermutter zu sehr einmischte, zeigte sie es mir jedenfalls nie.
Schließlich wagte ich einen kurzen Seitenblick.
Er erinnerte mich an jemanden, oder vielleicht war es auch nur die Mütze.
Ich kümmerte mich wieder um meine Einkäufe, scannte die restlichen Artikel, bezahlte und nahm die Tasche. Jetzt begegnete ich seinem Blick, lächelte kurz.
Und das wäre es auch schon gewesen, hätte er nicht selbst gerade bezahlt. »Entschuldigen Sie«, sprach er mich an.
»Ja?«
»Sind Sie nicht Ivy?«
»Ja.« Woher kannte ich ihn?
»Ivy Trent«, sagte er, nun war es keine Frage mehr.
»Ja.« Er kam mir sehr bekannt vor, aber woher? War er ein ehemaliger Kollege, jemand aus Lotties und Max’ Kindheit? Oder einer von Richards Freunden? Irgendwie konnte ich ihn nirgends einordnen.
»Das ist mein Enkel Connor.« Ich wollte Zeit gewinnen, in der ich hoffentlich einen weiteren Hinweis auf seine Identität entdeckte. »Ich glaube, den kennen Sie noch nicht.«
»Es muss mindestens sechzig Jahre her sein.« Er bemerkte meine Verwirrung und stellte sich vor.
»Ich bin …«, hob er an, doch ich kam ihm zuvor.
»Abe?« Langsam dämmerte mir, woher ich das Gesicht kannte.
»Abe? Abe McFadden?«
Er nickte.
Plötzlich überkam mich eine Flut von Gefühlen.
Da stand er. Mein ältester Freund aus Kindertagen. Mein bester Freund.
»Ich kann es nicht fassen.«
Das beschrieb nicht annähernd, was ich empfand.
Ich hatte im Laufe der Jahre oft an ihn gedacht: mich gefragt, wie es ihm ging, und gehofft, dass das Leben es gut mit ihm meinte. Besser als damals, als wir zusammen aufgewachsen waren.
Die Zeit schien sich zurückzudrehen, dann machte sie einen Sprung.
Zu dem Moment, als Abe und ich fünf Jahre alt waren und an unserem ersten Tag in der Grundschule schüchtern auf dem Schulhof standen. Als ich ihn damals sah, wünschte ich mir, er möge mein Freund werden. Und dann wurden wir Freunde. Die Art von Freunden, die im Haus des anderen ein und aus gingen, in die Familien aufgenommen wurden, die Art von Freunden, die die Leute in einem Atemzug nannten: »IvyundAbe.«
Erneut blickte ich ihn an.
Er war gealtert, doch der junge Abe war noch zu erkennen – wie er von einem Fuß auf den anderen trat und nicht wusste, was er sagen sollte. Sein Haar war grau, aber noch immer dicht und etwas widerspenstig. Haar, das man kurz tragen musste, um es zu zähmen, wozu er jedoch zu schüchtern war, weil dann zu viel von seinem ansprechenden Gesicht zum Vorschein gekommen wäre.
Nun lächelte er, und in den Falten, den Furchen, die sich mit den Jahren in sein Gesicht gegraben hatten, las ich Freundlichkeit, sanften Humor und eine Spur Traurigkeit.
Dann sprangen meine Gedanken ein paar Jahre weiter – zu der Tragödie, die das Ende unserer Freundschaft einleitete.
Doch Connor, der an meinem Ärmel zupfte, holte mich in die Gegenwart zurück. »Grandma, ich will Enten füttern.«
»Gleich.« Ich strich ihm über den Kopf, noch immer erstaunt, wie glücklich es mich machte, sein seidiges Haar zu berühren.
Mit Connor, um den ich mich hin und wieder kümmerte, war die Freude in mein Leben zurückgekehrt. Kinder verleihen allem einen Sinn. All dem Schmerz und dem Verlust, den man im Leben erleidet.
Hätte ich keine Kinder gehabt, wie viel schwerer wäre es gewesen, den Tod ihres Vaters zu verkraften? Und hätte Hannah nicht Connor zur Welt gebracht, wäre ich dann über den Tod meines Bruders Jon hinweggekommen, der fast auf den Tag genau ein Jahr später verstarb? Selbst in den dunkelsten Stunden fand ich Hoffnung in Lottie und Max, weil so viel von meinem Mann in ihnen steckte. Ihre Gegenwart erinnerte mich daran, dass das Leben weiter- und die Sonne immer wieder aufging. Dass sich die Teilchen des Universums immer wieder neu formten und die Welt sich weiter um ihre Achse und um die Sonne drehte – neuen Morgenröten und neuen Zeiten entgegen.
Wenn im Frühling die ersten Pflanzen aus dem Boden sprossen, erfüllte mich das mit einer Freude, die mir neu war. Egal wie hart der Winter ist, irgendwann kehrt der Frühling zurück.
»Ich möchte mich einen Moment mit diesem Mann unterhalten.« Erneut blickte ich zu Abe, und Connor wühlte in der Einkaufstasche, die ich ihm zum Tragen gegeben hatte.
»Können die Enten auch Croissants anstatt Brot essen?«
»Nein, die sind für mich!«
»Können sie nicht eins haben? Du brauchst doch keine vier.«
»Ich glaube nicht, dass sie das mögen, Connor.«
Stand dort nicht irgendwo ein Schild im Park, auf dem die Leute gebeten wurden, die Enten nicht mit Croissants zu füttern? Oder hatte ich mir das nur ausgedacht? Ich konnte zunehmend schwerer auseinanderhalten, ob etwas wirklich geschehen oder ob es nur ein Witz oder eine Geschichte war – von mir oder von jemand anderem.
»Sie sollten es probieren«, insistierte Connor. »Woher sollen sie wissen, ob sie etwas mögen oder nicht, wenn sie es gar nicht probiert haben?«
Ich lachte, weil er wie Max klang, der heute so mit ihm sprach wie ich mit Max, als er noch klein gewesen war. Abe lächelte. Hatte er auch Enkelkinder?
»Können wir jetzt gehen?«
»Nur noch eine Minute, Schätzchen. Ich kenne diesen Mann schon sehr lange, seit ich ungefähr so alt war wie du.«
Connor blickte auf diese entgeisterte Weise zu mir auf, auf die Kleinkinder einen ansehen, wenn sie eine völlig unerwartete Seite an einem entdecken. »Aber du bist doch immer alt gewesen«, sagte er im Brustton der Überzeugung.
Abe lachte. »In meiner Vorstellung bist du immer jung gewesen«, bemerkte er. »Was für eine Überraschung, dich wiederzusehen.«
»Können wir jetzt gehen?«
»Es tut mir leid«, entschuldigte ich mich bei Abe. »Wir gehen in den Park, um die Enten zu füttern. Könntest du uns ein Stück begleiten?«
»Ja.«
So wie er das sagte, war es mehr als eine simple Zusage. Es war, als hätte er nur darauf gewartet, dass ich ihn fragte, und bereits beschlossen, all seine Pläne über den Haufen zu werfen.
»Ein Rotschopf, genau wie du einer warst.« Abe sah lächelnd zu Connor, der die Enten mit Brot fütterte. »Hat dein Sohn auch rote Haare?«
»Nein, meine Tochter auch nicht. Es hat eine Generation übersprungen.«
Mein eigenes Haar, das eher heller als grau geworden war, hatte inzwischen einen silbrig weißen Ton.
»Die Glatze meines Vaters hat auch eine Generation übersprungen.« Er nickte, als müsste er sich bestätigen, dass sein Haar noch da war. »Das Haar meines Sohnes wird jetzt schon dünn. Das ist irgendwie ungerecht. Aber Gene erinnern sich auf gemeine Weise an Familientraditionen.«
Er sinnierte vor sich hin, doch der Gedanke weckte Erinnerungen. Das wusste er nicht. Woher auch? Er merkte allerdings, dass er etwas in mir ausgelöst hatte.
»Es tut mir leid.« Er blickte mich an. »Wir haben uns so viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.«
Doch dazu kamen wir nicht. Nicht jetzt.
»Ich habe Hunger.«
»Connor, wir gehen gleich zum Mittagessen in ein Café. Warum guckst du nicht, ob du einen Frosch entdeckst?«
»Aber ich habe Hunger.«
»Möchtest du ein Stück?« Abe fischte in seiner Einkaufstasche, holte eine Clementine heraus und begann, sie zu schälen.
Connor wirkte skeptisch, nahm jedoch ein Stück.
Ich lächelte. »Weißt du noch?«
Abe nickte. »Als wäre es gestern gewesen.«
Es war so schön, ihn wiederzusehen, doch Connor schien weniger begeistert. Es war sein Tag mit mir. Großeltern sollten Erwachsene sein, die nicht ständig von anderen Dingen abgelenkt werden.
»Kommt der Mann etwa auch mit?«, fragte er, als ich vorschlug, mittagessen zu gehen.
»Das ist nicht sehr nett«, hob ich an.
Doch Abe unterbrach mich. »Nein, ich muss nach Hause.«
»Oh.«
Ich hatte bereits herausgefunden, dass er in der Nähe wohnte, dass er als Berater für ein Büro von Landschaftsarchitekten tätig gewesen war, Kinder und Enkelkinder hatte, aber noch nicht, ob zu Hause jemand auf ihn wartete.
Und das wollte ich wissen.
Nach all den Jahren. Lag es an der Traurigkeit, die ich in den Falten seines Gesichts zu erkennen glaubte? War es meine eigene Einsamkeit, die mir jetzt zwar erträglich schien, die ich aber immer noch spürte? Wollte ich herausfinden, ob ich sie im Leben anderer wiederfand, so wie ich als junge Mutter wissen wollte, ob andere Leute auch Kinder hatten? Oder lag es schlichtweg daran, dass ich Abe mein ganzes Leben lang nicht vergessen und mich manchmal gefragt hatte, ob unsere Freundschaft unter anderen Umständen vielleicht gewachsen und sich zu etwas anderem entwickelt hätte?
Gelegentlich las ich solche Dinge, Geschichten über Menschen, die mithilfe sozialer Medien Leute aus ihrer Vergangenheit aufspürten, weil sie meinten, sie würden in ihr heutiges Leben passen – häufig mit desaströsem Ergebnis. Man spürte Verflossene auf und ließ zu, dass sie einem die Ehe zerstörten, grub alte Freunde aus und hoffte, längst vergangene Zeiten heraufzubeschwören. Wenn ich davon las, dachte ich an Abe und fragte mich vergeblich, was aus ihm geworden, zu was für einem Mann er herangewachsen war und welche Menschen wohl heute zu seinem Leben gehörten.
Errötete ich leicht, als ich ihn fragte: »Wartet jemand auf dich? Habe ich dich aufgehalten?«
Ich merkte, dass meine Hand zu meinem Haar glitt, dass ich mir eine Strähne hinters Ohr strich, plötzlich unsicher, wie ich wirkte.
»Nein. Aber hier störe ich jetzt, Ivy. Vielleicht können wir uns ein anderes Mal treffen?«
»Sehr gern.«
Wir tauschten Telefonnummern aus, und er umarmte mich. Dann berührte er flüchtig mein Haar. »Ivy Trent.« Er nickte. »Ivy Trent.«
»Was?«
»Einfach du.«
So wie er das sagte, musste ich lächeln, innerlich, äußerlich und überall.
»Aber du hast ihn doch gerade erst kennengelernt.« Lottie schüttelte ungläubig den Kopf.
Ich saß in ihrer Küche, während sie Tee zubereitete. Obwohl ich eigentlich warten wollte, bis er fertig war und wir ihn im Wohnzimmer trinken konnten, hatte ich ihr schon von Abe und mir erzählt.
»Ich meine, du hast ihn nicht sehr lange gekannt.« Mit derselben ruhigen Zielstrebigkeit, die ihrem Vater zu eigen gewesen war, füllte sie eine gelbe Kanne aus Emaille mit losen Teeblättern.
»Das stimmt nicht«, erinnerte ich sie. »Ich habe ihn kennengelernt, als ich vier war.«
»Aber du hast ihn sechzig Jahre lang nicht gesehen.« Sie zögerte, ehe sie Wasser in die Teekanne füllte, und sah mich an. »Du kannst ihn heute nicht besonders gut kennen. Nicht wirklich.«
Sie war nicht ungehalten oder verärgert, sie verstand es nur nicht, und ich war mir nicht sicher, ob ich es ihr erklären konnte. Es war, als hätte ich Abe immer gekannt. Ich musste nicht Monate und Jahre damit verbringen, mehr über ihn zu erfahren, um die Lücken zu schließen. Ich kannte ihn instinktiv, so wie ich ihn als Kind gekannt hatte.
Es gab ein Spiel, das wir früher bei ihm zu Hause im Wohnzimmer gespielt hatten. Vor dem Kamin standen sich zwei Sessel gegenüber, über der Lehne des einen lag eine Decke.
Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wer von uns zuerst auf die Idee gekommen war, aber es wurde unser Lieblingsspiel. Wir besetzten jeder einen Sessel und fassten jeweils ein Ende der Decke, dann saßen wir uns still gegenüber, bis ein Blickwechsel das Startsignal für ein sanftes und verspieltes Tauziehen gab.
Einer von uns zog an der Decke, und der Sessel des anderen bewegte sich ein Stück nach vorn, dann zog der andere. Das Ziehen verstärkte sich, bis die Sessel auf ihren Rollen in einem zunehmend dynamischen Tanz über den Parkettboden rutschten.
Manchmal spielten wir eine der Schallplatten von Abes Dad und zogen zu den Klängen von Little Richard oder Woody Guthrie. Doch immer war das Spiel von unserem glockenhellen Lachen begleitet. Wie wir wortlos miteinander kommunizierten, uns nur mit Blicken und durch das Ziehen der Decke verständigten, der vorsichtige Kampf um ihren alleinigen Besitz – all das bewirkte, dass wir uns vor Lachen nicht mehr halten konnten.
Irgendwann entriss einer von uns dem anderen die Decke, wodurch beide Sessel ein Stück nach hinten sausten, und erklärte sich selbst zum Sieger. Einer gewann immer, aber es war egal, wer.
»Noch mal«, waren wir uns einig, wenn das Spiel vorüber war, und begannen von Neuem in der stillschweigenden Übereinkunft, dass es diesmal andersherum sein würde. Dass derjenige, der zuletzt gewonnen hatte, nun den anderen triumphieren lassen würde. Nicht sofort, aber wenn ein unausgesprochenes Signal anzeigte, dass es Zeit für einen von uns war, etwas fester zu ziehen.
Manchmal spielten wir das stundenlang.
»Schwachköpfe«, meinten Jackie und Alan, Abes ältere Brüder, wenn sie uns sahen, und wir lachten nur noch mehr über die Vorstellung, dass wir »Schwachköpfe« waren. Ich hatte den Begriff noch nie zuvor gehört.
Manchmal ertappte ich mich dabei, dass ich es zu Connor sagte, wenn er herumalberte oder sich irgendwelche komischen Spiele ausdachte.
»Du hast dich nicht verändert«, stellte Abe fest, als wir uns das erste Mal zum Kaffeetrinken trafen, nur wir zwei, in einem Café in der High Street von Richmond. Der Vorschlag war von ihm gekommen, allerdings war er selbst noch nie dort gewesen, und als wir uns setzten, merkten wir, dass aus einem Lautsprecher Musik plärrte. Laut genug, dass sich eine Unterhaltung für Menschen unseres Alters schwierig gestaltete.
Ich blickte Abe nur an, zog eine Augenbraue nach oben und neigte ganz leicht den Kopf. Er nickte, und wir standen auf, ein wenig zu hastig, weil wir uns davonstehlen wollten, ehe uns jemand die Karte brachte oder sich nach unseren Wünschen erkundigte.
Als wir draußen waren, lachte ich. »Ich komme mir vor, als hätten wir die Zeche geprellt!«
Da sagte er, ich hätte mich nicht verändert.
Und später wiederholte er es noch einmal, als wir in einem anderen Café saßen, in dem es leiser zuging und das Publikum eine Spur älter war. Wir hatten einen Platz am Fenster, waren für jeden sichtbar, der im Vorbeigehen zufällig einen Blick hereinwarf. Da nahm Abe über den Tisch hinweg meine Hand, sah mich voller Gefühl an. »Du hast dich nicht verändert.«
»Ich bin ziemlich gealtert.« Ich drückte seine Hand, ohne mich darum zu scheren, wer uns sah. Ich war glücklich – in einem Lebensabschnitt, in dem ich mein Maß an Glück eigentlich bereits ausgeschöpft zu haben glaubte.
»Das sind wir beide. Aber du hast dich nicht verändert. Du bist noch genauso herzlich, genauso energiegeladen.«
»Danke«, erwiderte ich. »Das ist …« Ich verstummte, unfähig, die passenden Worte zu finden, und betrachtete die Teekannen auf dem Regal, das den Raum umfing.
»Was?«
»Einfach sehr nett.«
»Das Café?«, fragte er, als die Kellnerin gelangweilt auf uns zuschlappte.
»Nein.« Lächelnd schüttelte ich den Kopf. Er wusste ganz genau, was ich gemeint hatte.
»Haben Sie gewählt?«
Wir bestellten Scones für zwei und erhielten einen Korb mit diversen Miniaturmarmeladengläsern wie im Hotel, die Abe aus dem Korb nahm und gedankenverloren auf dem Tisch zwischen uns aufstellte.
»Ich habe nachgedacht.«
»Ja?«
»Vor ein paar Jahren. Nein, wahrscheinlich ist es schon zwanzig Jahre her, vielleicht auch länger. Da habe ich mich um einen Auftrag in Kopenhagen beworben.«
»Für einen Brunnen?«
Ich fand es herrlich, dass Abe, von dem ich immer gedacht hatte, dass er Architekt werden würde, Brunnendesigner geworden war. Bis er es mir erzählt hatte, war mir nie der Gedanke gekommen, dass es einen solchen Beruf überhaupt geben könnte. Seit ich es wusste, betrachtete ich die Dinge mit etwas anderen Augen. Natürlich wurde alles von irgendwem entworfen: das Sternenmuster auf den Papierservietten, die ordentlich gefaltet unter den Messern mit Porzellangriffen lagen. Die Messer selbst. Der Korb mit den Marmeladengläschen, sogar der Verschluss des Schiebefensters knapp oberhalb unserer Augen. Wir waren umgeben von Produkten, die Menschen in ihrem Berufsalltag erschufen, fragten uns jedoch kaum jemals, wer darüber befunden hatte, dass sich winzige weiße Sterne auf gelbem Untergrund hervorragend eigneten, um die Krümel eines Scones verblassen zu lassen, oder dass das Messingscharnier an einem Fenster abgeschrägt sein sollte.
»Ja, aber ich habe den Auftrag nicht bekommen«, fuhr Abe fort. »Ich glaube, mein Entwurf war zu ambitioniert. Ich habe versucht, eine Überlegung aus der Quantenphysik zugrunde zu legen, die ich nicht ganz verstanden hatte.«
»Ist das bei der Quantenphysik nicht immer so?«
»Was?«
»Wenn man glaubt, sie verstanden zu haben, hat man sie nicht verstanden?«
Abe lachte. »Wahrscheinlich.«
»Und wie sah dieser Brunnen aus?«
»Er basierte auf einer Uhr.« Er nahm die Marmeladengläschen und ordnete sie kreisförmig auf dem Tisch an. »Kannst du dir vorstellen, dass die Marmeladengläser Düsen sind, aus denen Wasser spritzt?«
Ich nickte, während er einen Salzstreuer vom Nachbartisch nahm und ihn in der Mitte des Marmeladenkreises platzierte.
»Und das auch.« Seine Bewegungen wirkten derart engagiert, dass man sich vorstellen konnte, wie er seine Arbeit geliebt hatte.
»Der Strahl aus dem Salzstreuer stellt den Tag dar, und die Strahlen aus den Marmeladengläsern zeigen die jeweilige Stunde an.«
Ich lächelte.
»Natürlich waren es zwölf, aber die Marmeladen reichen nicht! Und dann …« Er sah sich nach weiteren Requisiten um, und da er keine fand, bewegte er einfach die Finger über den Tisch. »Um diese Düsen befand sich ein weiterer Ring.«
Ich sah sie dort im Geiste vor mir, wo seine Fingerspitze eine zarte Spur auf der Platte des Holztischs hinterließ.
»Ein weiterer Ring mit kleineren Düsen, die die Minuten darstellten.«
Ich beobachtete, wie er die Hände geschickt über den Tisch bewegte, die Abfolge so weit wie möglich nachstellte und versuchte, mir einen Eindruck seiner Arbeit zu vermitteln. Sie wirkten wie die Hände eines Pianisten: kräftig, aber flink. Ihre Bewegungen waren faszinierend.
Er beendete die virtuelle Darstellung und schob die Marmeladengläser zur Seite, als die Kellnerin mit dem Tee zurückkehrte. Eine Weile rührten wir ihn nicht an, sondern unterhielten uns weiter.
»Hast du deine Entwürfe noch?«
»Schon möglich. Irgendwo. Aber es ist nie über das Planungsstadium hinausgegangen. Ich erwähne es nur deshalb, weil ich mich erinnere, dass ich damals an dich gedacht habe.«
»Wirklich?« Ich freute mich im Stillen. »Warum?«
»Weil ich bei meinen Recherchen auf die Theorie der Quantenverschränkung gestoßen bin. Hast du davon schon einmal gehört?«
»Vielleicht, irgendwann! Aber ich habe keine Ahnung, was das ist.«
»Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe, aber eine zuverlässige Quelle hat mir erklärt, dass man die Quantenphysik wahrscheinlich nicht verstanden hat, wenn man glaubt, sie verstanden zu haben.«
Ich lachte. »Dann versuche ich, schlau zu wirken und die Quantenverschränkung nicht zu verstehen!«
»Sie hat mit dem Verhalten von Teilchen zu tun, winzigen Teilchen wie Elektronen, die in der Vergangenheit miteinander interagiert und sich dann voneinander wegbewegt haben.«
»Und wie verhalten sie sich?«
»Nun, merkwürdigerweise hat man herausgefunden, dass sie, auch wenn sie Millionen von Meilen oder Galaxien entfernt voneinander landen, sich immer noch gegenseitig beeinflussen. Wenn man den einen kitzelt, tanzt der andere, um es wissenschaftlich auszudrücken.«
»Das klingt unheimlich.«
»Mit der Einschätzung befindest du dich in bester Gesellschaft«, sagte er. »Das hat Einstein auch so gesehen. Er nannte es ›spukhafte Fernwirkung‹.«
Ich lachte, weil er die Worte so übertrieben betonte.
»Seltsam, wie einem diese Dinge im Kopf bleiben«, überlegte Abe, nahm die Teekanne und schenkte mir ein. »Ich kann mich inzwischen kaum noch an die Bezeichnungen alltäglicher Gegenstände erinnern, aber ›spukhafte Fernwirkung‹ weiß ich noch. Das sitzt in dem Bereich des Gehirns, in dem man unnützes Wissen speichert. Milch?«
Er schob mir das Kännchen zu.
»Und warum, abgesehen von der Tatsache, dass Einstein und ich offensichtlich ähnliche Gedankengänge hatten, hat dich das an mich erinnert?«
»Ich weiß, es klingt seltsam und wahrscheinlich ein wenig wirr. Ich habe auch nicht die ganze Zeit an dich gedacht, aber ab und zu habe ich dich sehr stark gespürt.«
»Inwiefern?«
»Ich kann es nicht richtig erklären. Es war ein bisschen wie ein Déjà-vu, aber eher so, als hätte ich vergessen, dass du jemand aus der Vergangenheit und nicht aus der Gegenwart warst.«
Ich trank einen Schluck von meinem Tee. »Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe.«
»Ich habe mich hin und wieder bei dem Gedanken erwischt, dass ich dir etwas erzählen müsste. Weißt du, so wie es einem passiert, wenn jemand erst kürzlich gestorben ist. Eigentlich weiß man, dass derjenige tot ist, dennoch geschieht es. Aus einer Gewohnheit heraus.«
»Ja. Das geht mir noch immer mit Richard so, obwohl er inzwischen zehn Jahre tot ist.«
Es kam zwar seltener vor, aber ich erwischte mich noch oft dabei, dass ich darüber nachdachte, ob Richard gern einen speziellen Film anschauen würde oder am Abend Fisch essen wollte. Dann fiel mir wieder ein, obwohl ich es natürlich die ganze Zeit über wusste, dass er nicht mehr bei mir war. Außer natürlich in meinen Gedanken.
»Manchmal war das Gefühl so stark, dass es mich verunsicherte. So als würde ich mir einbilden, ein Gespenst zu sehen, wo keines war.«
»Erzähl weiter.«
»Es gab ein spezielles Ereignis, es liegt Jahre zurück, aber ich erinnere mich noch gut daran, weil es ohnehin ziemlich bedeutsam war. Weißt du noch, als in den Docklands eine Bombe hochgegangen ist?«
»Vage.« Das ist noch so eine Sache, wenn man alt wird: Man vergisst sogar Ereignisse, die einen einmal stark beunruhigt haben.
»Ich war damals in der Gegend. Mir ist nichts passiert, aber ich war so nah am Geschehen, dass ich es gesehen habe und ziemlich schockiert war.«
»Das tut mir leid.«
»Ich war damals schon verheiratet, doch ich weiß noch, dass ich direkt danach dachte, ich müsste dir Bescheid geben, dass mir nichts passiert sei.«
»Mir?«
»Ja. Vermutlich war es der Schock. Aber das war mein erster Gedanke. ›Ivy muss wissen, dass mir nichts passiert ist.‹ Ivy, nicht Lynn. Das fand ich damals merkwürdig. Ich hatte jahrelang nicht wirklich an dich gedacht, und plötzlich dachte ich, ich müsste dir sagen, dass es mir gut ginge.«
»Zum Glück ist dir nichts passiert.«
Plötzlich erschien die Kellnerin und sah, dass wir die Scones noch nicht angerührt hatten. »Ist alles in Ordnung?«
»Ja, vielen Dank.« Ich nahm das Messer mit dem Porzellangriff, schnitt meinen Scone auf und strich wie wild Butter darauf, damit sie verschwand.
»Als ich mich für diesen Brunnen in Kopenhagen bewarb, ist es mir wieder passiert. Ich war ein paar Tage dort, und Lynn hat mich begleitet.«
Abe war zu sehr mit der Geschichte beschäftigt, um von seinem Tee zu trinken.
»Ich weiß es noch, weil ich sie eines Abends beim Essen Ivy nannte und sie außer sich vor Wut war. Wir machten eine etwas schwierige Zeit durch, und sie dachte, ich habe eine Affäre. Es hat eine Weile gedauert, sie davon zu überzeugen, dass du eine Freundin aus Kindheitstagen warst, die ich seit Jahren weder gesehen noch gesprochen hatte.«
»Kanntest du irgendwelche anderen Ivys?«
»Nein, ich habe nie eine andere Ivy kennengelernt. Es war nicht so, als hätte ich zu ihr Liz anstatt Lynn gesagt. Es war schon sehr besonders.«
»Ja.« Ich biss in meinen Scone und versuchte, es mir vorzustellen.
»Dass ich dich manchmal gespürt habe – selten zwar, aber dann sehr stark –, habe ich mir damit erklärt, dass ein Teil von dir noch bei mir war.«
»Verstehe.« Die Unterhaltung wühlte mich ein wenig auf. Auch ich hatte von Zeit zu Zeit an Abe gedacht, allerdings nicht auf die Weise, die er beschrieb.
»Was ich vermutlich sagen will, ist: Mir ist klar geworden, dass unsere frühe Freundschaft nicht einfach nur so passiert ist. Sie hat die Grundlage für alle künftigen Beziehungen gebildet. Eine gute Grundlage.«
»Das hast du schön gesagt.« Ich lächelte.
»In diesem Sinn habe ich unsere Freundschaft vermutlich als Metapher für die Quantenverschränkung benutzt, als ich flüchtig mit ihr in Berührung kam.«
Die ruhige, konzentrierte Art, mit der er die Worte betonte und die so ganz anders war als die Lebendigkeit, mit der er zuvor von dem Brunnen erzählt hatte, weckte das Bedürfnis in mir, mich ihm zu öffnen. Es gab nichts Spezielles, worüber ich mit ihm reden wollte, nicht in diesem Moment, aber ich spürte, wie ich begann, Vertrauen zu ihm zu fassen. Dass er jemand war, dem ich mich anvertrauen, dem ich mich offenbaren konnte, ohne fürchten zu müssen, was er über mich dachte.
Fühlte sich so der Beginn von Liebe an?
»Ich weiß, das ergibt alles nicht viel Sinn.« Abe dehnte seine Finger, als wollte er damit das Ende seines Gedankengangs signalisieren. »Ich versuche nur zu sagen, dass ein Teil von dir bei mir geblieben ist und ich sehr froh bin, dass ich dich wiedergetroffen habe. Ich denke immer wieder darüber nach, was wohl passiert wäre, wenn ich an jenem Tag nicht in den Supermarkt gegangen wäre, wenn du nicht mit deinem Enkel in den Park gegangen wärst.«
Erneut drückte er meine Hand und sah mich an, und da wusste ich mit einer Sicherheit, die mich selbst überraschte, ganz genau, welche Entwicklung der Dinge ich mir erhoffte.
Aber wie sollte ich das meiner Tochter erklären, die die letzten fünf Jahre damit verbracht hatte, so vorsichtig wie möglich herauszufinden, ob sie mit dem liebenswerten, netten Freund, der immer für sie da war, den Rest ihres Lebens verbringen wollte?
Endlich hatte sie sich entschieden, im September würden sie heiraten. Ich fürchtete, sie könnte denken, ich würde ihr die Show stehlen. Das war nicht meine Absicht, aber jetzt, wo ich Abe wiedergefunden hatte, würde ich ihn nicht wieder gehen lassen.
»Ich weiß, es ist überraschend für dich, und es kommt dir bestimmt komisch vor, als hätte ich es mir nicht lange genug durch den Kopf gehen lassen. Aber das brauche ich auch nicht. Es ist das Richtige.«
»Hast du ihn immer geliebt?«, wollte Lottie plötzlich wissen, und ich wünschte, wir wären nicht in ihrer Wohnung, wo Richard mich aus einem gerahmten Foto vom Kaminsims herab anblickte.
Lottie war damals sechs gewesen. Wir waren am Strand, vermutlich in Greatstone. Dorthin gingen wir damals oft, als sie und Max noch klein waren, und im Hintergrund waren die Umrisse der Dünen zu erahnen. Lottie saß im Badeanzug auf Richards Schultern, sie hielt sich an seinen Haaren fest und lächelte. Richard lächelte ebenfalls, aber mit einem leicht gequälten Blick, vielleicht, weil er in die Sonne blinzelte oder weil Lottie an seinen Haaren zog.
»Nein. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen«, sagte ich und wandte den Blick von Richard und von den Dingen ab, die Lottie mit der Vergangenheit unserer Familie verbanden.
Ein Stück Berliner Mauer, das Richard von einer Geschäftsreise mitgebracht hatte. Er war zufällig dort gewesen, als die Mauer fiel. Ein winziges Gemälde von einem Stand am Ufer der Seine, das Max ihr geschenkt hatte, als er von einem Schüleraustausch aus Frankreich zurückgekommen war. Und am Kamin lehnte eine bemalte Holzleiste, das Seitenteil eines Regals, das in unserem alten Haus unter der Treppe gestanden hatte. Daran hatten wir zu verschiedenen Gelegenheiten die Größen der Kinder markiert. Ich hatte überlegt, das Brett zu übermalen, bevor ich das Haus verkaufte, doch Lottie wollte die Leiste behalten.
»Wir haben uns nur als Kinder gekannt«, erzählte ich ihr. »Und nachdem er weggezogen war, haben wir den Kontakt verloren. Aber jetzt liebe ich ihn.«
»Aber wie kannst du dir so sicher sein?« Lottie war vorsichtig, das war sie immer schon.
Erneut blickte ich auf das Foto von ihr und Richard. Sie konnte das Abenteuer nicht ganz genießen, hoch auf seinen Schultern zu sitzen. Ihr fehlte das Vertrauen, dass er sie nicht fallen ließ, deshalb klammerte sie sich an ihn.
Max war stets wagemutiger gewesen. Er hätte mit den Armen in der Luft herumgefuchtelt, es genossen, so hoch über dem Boden zu schweben, hätte noch weiter nach oben gegriffen, noch höher hinaufgewollt.
»Ich weiß es einfach.«
»Hast du so auch bei Dad empfunden?«
»Das war anders.«
»Wie?«
»Ich habe deinen Dad sehr geliebt. Er war ein starker Mann. Als er sich auf mich einließ, hat er viel auf sich genommen, und er war sich des Risikos bewusst, als wir dich und Max bekommen haben. So etwas macht nur ein ganz besonderer Mann.«
Ich folgte Lotties Blick zurück zu der Fotografie und konnte mir ungefähr vorstellen, was sie dachte.
»Lottie, Liebes.« Ich wollte, dass sie mich ansah. »Ich werde deinen Dad immer lieben. Er war ein großer Teil meines Lebens und wird es immer sein. Andere wären meilenweit vor mir und den ganzen Schwierigkeiten davongelaufen, doch Richard war immer bereit, sich der Welt zu stellen, mit allem zurechtzukommen, was das Leben für ihn bereithielt. Er hat all meine Entscheidungen mitgetragen, auch wenn er für sich anders entschieden hätte. Für all das und für so vieles andere habe ich ihn geliebt. Das ist etwas anderes.«
»Warum?«
»Ich kann es nicht richtig erklären. Aber manchmal liebt man jemanden für seine Art, für seine Handlungen, weil er tut, was er tut. Und manchmal liebt man jemanden einfach um seiner selbst willen.«
»Dann hast du Dad wegen der Dinge geliebt, die er getan hat?«
»Nein«, entgegnete ich etwas zu schnell. »Doch, ja, aber das schmälert das, was wir miteinander hatten, kein bisschen. Ganz im Gegenteil. Ehe bedeutet so viel mehr, als sich nur in jemanden zu verlieben. Das allein reicht nicht, damit sie funktioniert. Dazu braucht es mehr.«
»Was?«
»Liebe und die Bereitschaft, sich an jemanden zu binden. Sich zu verlieben ist leicht. Es ist leicht, seinen Seelenverwandten zu finden, aber vielleicht ist ein Seelenverwandter nicht der Mensch, den man heiraten sollte, wenn das ganze Leben noch vor einem liegt.«
»Ihr wirkt so glücklich zusammen, du und Abe.« Lottie sah mich an. »Die Art, wie ihr zusammen herumwerkelt, wirkt irgendwie so unbeschwert.«
»Was?« Ich lachte über die Vorstellung, dass Abe und ich als Alte herumwerkelten. Natürlich, wir waren beide über siebzig, aber ich fühlte mich jünger, so viel jünger, seit ich ihn wiedergetroffen hatte. Vielleicht war ich auch einfach nur zufriedener – mit mir und mit dem Leben.
Dem Leben, das einem, wie ich auf harte Weise erfahren musste, große Verluste zumutete, aber manchmal auch versuchte, diese Verluste wiedergutzumachen, wenn man am wenigsten damit rechnete. Und zwar auf die wundervollste Weise.
»Du wirkst so locker.« Lottie blickte mir nun so forschend in die Augen, dass es mich verunsicherte. »Du wirkst jetzt glücklicher als damals, als Dad noch gelebt hat. Als wärst du endlich mit dem Richtigen zusammen.«
»Vielleicht ist es einfach der richtige Zeitpunkt«, gab ich zu bedenken.
Ich wollte Richards Andenken in keiner Weise beflecken. Er war ein wunderbarer Mann, aber das Leben war für uns nicht immer leicht gewesen. Wer weiß, ob es mit einem anderen Mann einfacher gewesen wäre.
»Abe und ich …« Ich hielt kurz inne. »Wir haben nichts, um das wir uns sorgen müssen, abgesehen davon, dass wir älter werden. Ich habe deinen Dad sehr geliebt, aber manchmal waren wir zu sehr in unserem Alltag gefangen, um einander zu schätzen. Und unser Alltag ist oft auch sehr schwierig gewesen.«
»Ich weiß, Mum«, entgegnete Lottie. »Das weiß ich. Es ist nur …«
Ich beobachtete, wie sie uns aus der Teekanne nachschenkte, die in Ermangelung eines Couchtischs auf dem Fußboden stand. Wie sie sorgfältig eingoss und dabei über ihre nächsten Worte nachdachte.
Erneut blickte sie auf das Bild von sich und Richard, als bräuchte sie unser beider Bestätigung. »Glaubst du, dass ich den falschen Mann heirate?«, brach es schließlich aus ihr heraus.
»Nein, Liebes. Natürlich nicht. Ich glaube, dass du einen wunderbaren Mann heiratest, der dich liebt und bereit ist, sich an dich zu binden. Ihr zwei passt perfekt zusammen.«
Allmählich sorgte ich mich, dass ich womöglich das Falsche tat. Dass die Entscheidung, selbst zu heiraten, meine Kinder in einer Weise aufwühlte, mit der ich nicht gerechnet hatte.
»Wenn man noch jung ist, ist das etwas anderes«, erwiderte ich. »Vielleicht sucht man zu sehr nach Dingen, die man niemals haben wird, und sieht nicht immer, was man hat. In meinem Alter stellt man fest, dass man eigentlich immer nur jemanden gesucht hat, der einem die Hand hält. Vor allem am Ende. Vielleicht wusste ich das auch schon, als ich jung war, aber ich glaube nicht, dass es mir bewusst war.«
»Sag das nicht, Mum.«
»Ich wollte nicht, dass es so düster klingt.«
»Aber was, wenn Tim nicht der Richtige ist?«
»Das ist er. Das weißt du.«
»Ich bin mir anscheinend nicht so sicher wie du.«
»Lottie, wahrscheinlich gibt es viele richtige Männer dort draußen. Die kannst du aber nicht alle heiraten. Du wirst auch nicht allen begegnen. Aber du bist Tim begegnet, und ihr wollt heiraten. Das ist richtig.«
»Manchmal macht es mir Angst«, gestand sie leise.
»Du hast es dir doch nicht anders überlegt, oder?«
»Nein. Ich liebe Tim, und ich will ihn heiraten. Ich weiß, es klingt lächerlich, aber …«
»Was?«
»Ich bin ein bisschen eifersüchtig auf dich. Weil du dir bei Abe so sicher bist.«
»Das bin ich mir heute. Vielleicht wäre ich mir weniger sicher gewesen, hätte ich ihn in deinem Alter getroffen. Mir läuft die Zeit davon.«
»Jetzt redest du schon wieder so!«
»Okay. Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir beide noch Zeit.«
»Wie meinst du das?«
»Nichts zwingt uns, überstürzt zu handeln. Du musst tun, was jetzt das Richtige für dich ist.«
»Ich habe nicht viel Zeit, falls ich Kinder haben möchte. Und wenn Tim nicht der Richtige ist? Sondern nur zur rechten Zeit zu haben?«
»Dann macht ihn das zum Richtigen …«, wollte ich sie bestärken, doch sie wirkte noch immer nicht vollständig überzeugt.
»Lottie, Liebes. Wenn es dich zu sehr mitnimmt, dass ich heirate, werde ich es nicht tun. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob wir heiraten oder nicht, auch wenn wir es gern tun würden. Ich würde so oder so mit Abe zusammen sein. Macht das einen solchen Unterschied für dich?«
»Nein, Mum.« Sie bekam feuchte Augen. »Ich freue mich für dich. Wirklich. Es kommt nur etwas überraschend, und es scheint alles so schnell zu gehen.«
»Ich weiß. Aber ich werde nicht jünger. Keiner von uns. Ich habe im Leben viele Menschen verloren, und nachdem ich Abe jetzt wiedergetroffen habe, will ich die Chance, noch einmal glücklich zu sein, nicht wegwerfen.«
»Oh, Mum …« Etwas in Lotties Stimme ließ mich näher zu ihr rücken.
»Was ist, Liebes?« Ich legte den Arm um sie. »Was ist los? Was bedrückt dich?«
»Nichts.« Sie drehte sich um und umarmte mich. »Wirklich nichts.«
Wir hielten einander einen Moment fest.
»Ich glaube, ich freue mich einfach nur für dich.« Lotties Stimme bebte, als versuchte sie, nicht zu weinen.
Und mir ging es genauso.
So ist das manchmal mit dem Glück. Glück und Traurigkeit liegen viel dichter beieinander, als wir meinen.
Max reagierte weniger emotional, als ich es ihm erzählte. Vielleicht war er ebenso überrascht wie seine Schwester, doch seine Fragen waren eher praktischer Natur.
»Wo werdet ihr leben?« Er schenkte uns beiden ein Glas Wein ein, als verlange die anstehende Unterhaltung nach einem Drink.
»Ich ziehe zu Abe in sein Haus und überschreibe euch die Wohnung. So müsst ihr keine Erbschaftssteuer zahlen.«
Ich dachte, mein Pragmatismus würde ihn beeindrucken, doch stattdessen sorgte er sich. »Es ist besser, wenn du die Wohnung behältst, nur für den Fall …« Er verstummte und nahm einen Schluck Wein.
»Dass es nicht funktioniert?«
»Man weiß nie, Mum«, gab er zu bedenken. »Vielleicht ist es doch nicht das Richtige für dich.«
»Doch.« Ich wiederholte, was ich vor einigen Stunden bereits meiner Tochter erklärt hatte.
»Wie kannst du dir so sicher sein?«
»Weil ich dafür sorge, dass es funktioniert.«
»Und was ist mit seinen Kindern? Sind die glücklich darüber?«
»Ich glaube schon.«
Abe hatte heute mit Sam und Ruby zu Mittag gegessen und mir anschließend am Telefon berichtet, dass sie »erfreut« seien.
»Obwohl seine Frau noch nicht mal ein Jahr tot ist?«, fragte Max. »Finden sie das nicht ein bisschen früh?«
»Ich weiß, dass das vielleicht so wirkt, aber Lynn ist lange krank gewesen, und ich glaube, er hatte sie in vielerlei Hinsicht schon verloren, bevor sie gestorben ist. Und er wusste schon lange, dass sie sterben würde.«
»Ich will es nicht kompliziert machen, Mum«, lenkte Max ein. »Ich mache mir nur Sorgen um dich.«
»Ich weiß«, erwiderte ich und berührte auf dem Tisch seine Hand.
Er überraschte mich, indem er meine ergriff und sie festhielt.
»Das ist es, was ich mir wünsche, Max.« Ich blickte ihn an. »Was wir uns beide wünschen.«
»Dann trinke ich darauf.« Er hob sein Glas. »Auf dich und Abe McFadden.«
Wer hätte das gedacht? Ich ganz bestimmt nicht. Niemals hatte ich damit gerechnet, mit über siebzig noch einmal in den Genuss von Liebe und von Sex zu kommen. Ich dachte, dieser Teil meines Lebens sei endgültig vorbei. In meinem Alter machte man sich eher Gedanken über den Tod als über Sex.
Natürlich war es anders. Der Körper war nicht mehr so gefügig, nicht mehr so biegsam. Doch wenn der Geist willig ist, findet das Fleisch einen Weg.
Beim ersten Mal war ich nicht so nervös, wie ich gedacht hätte. Abe und ich hatten uns ausreichend oft zum Kaffeetrinken, Mittagessen, Abendessen, zu Theater- und Museumsbesuchen getroffen. Die Lücke seit unserer Kindheit war ausreichend aufgearbeitet. Im Großen und Ganzen wussten wir über das Leben des anderen Bescheid und kannten auch einige Details.
»Alan ist Stand-up-Comedian geworden?« Ich lachte, als er mir die Laufbahn seines älteren Bruders schilderte.
»In den frühen Achtzigern versuchte er eine Zeit lang, davon zu leben. Dann hat er eine Ausbildung zum Buchhalter gemacht.«
»Und Tessa?«
»Sie hat als Lehrerin angefangen, dann ist sie eine große Nummer in irgendeinem Thinktank im Bildungswesen geworden.«
»Und geht es ihnen allen noch gut? Deinen Geschwistern?«
»Ja.« Er berührte meine Wange. »Es tut mir so leid mit Jon. Das muss sehr hart für dich gewesen sein.«
»Du weißt, wie es ist, einen Bruder zu verlieren.«
Er nickte. »Es ist lange her, aber so etwas hinterlässt für immer seine Spuren. Mum ist nie wirklich darüber hinweggekommen.«
»Wie kann man über den Verlust eines Kindes hinwegkommen? Für Dad war es auch schwer, als Jon gestorben ist. Ich glaube sogar, dass ihn eher der Kummer umgebracht hat als die Lungenentzündung.«
Im Laufe der Zeit schienen eine Menge Menschen, die uns etwas bedeutet hatten, gestorben zu sein. Eltern, Geschwister, Partner. Seine Frau Lynn war noch nicht so lange tot wie Richard.
Er beschrieb ihre Ehe als »sehr glücklich«. Sofort fragte ich mich, ob ich eifersüchtig war, stellte jedoch fest, dass das nicht zutraf. Seine glückliche Ehe schien uns den Weg in die Zukunft zu ebnen, eine schlechte hätte Abe vielleicht zögern lassen.
»Hör uns nur an. Wie trübsinnig wir klingen.« Abe schüttelte den Kopf. »Und schwimmst du noch?«
»Ja. Ich gehe ein paarmal in der Woche ins Schwimmbad und im Sommer an den Strand.«
Lachend legte er den Arm um mich und zog mich an sich.
Wir waren wieder dort, wo wir angefangen hatten, als wir uns als Kinder begegnet waren. Wir fühlten uns auf eine Weise zueinander hingezogen, die man nicht in Worte fassen konnte.
Noch immer passten wir zueinander, nach all diesen Jahren. Zumindest unsere Charaktere. Wie es sich mit unseren Körpern verhielt, wussten wir nicht, würden es jedoch früher oder später herausfinden.
»Ich bin kein guter Koch«, setzte Abe an, als wir eines Morgens, nachdem wir uns zum Kaffee getroffen hatten, durch den Park gingen und wie die Kinder mit den Füßen das Herbstlaub aufwirbelten. »Aber ich würde abends gern einmal für dich kochen. Bei mir.«
»Ich bin keine große Feinschmeckerin. Also, was immer du kochst, es ist sicher köstlich. Und ich komme gern.«
»Morgen? Oder sogar schon heute?«
»Ich hole Connor von der Schule ab. Darum muss ich erst nach Hause. Aber ich könnte vorbeikommen, nachdem Max ihn abgeholt hat.«
»Wenn du dann nicht zu müde bist?«
»Nein. Wenn ich den Bus nehme, könnte ich um acht Uhr bei dir sein. Ist das okay?«
»Perfekt.« Abe sah mich noch immer an. »Und ich habe mich gefragt …«
»Ja?«
»Ich möchte nicht, dass du so spät noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fährst. Ich könnte dir ein Taxi rufen, das dich nach Hause bringt. Oder …«
»Sehr gern.« Ich merkte, wie ich errötete.
Wir standen noch immer am Eingang zum Park, wo eine Gruppe Teenager auf einer Asphaltbahn Skateboard fuhr.
»Gut.« Abe legte die Arme um mich. »Wir müssen nichts tun. Aber es wäre wundervoll, wenn du bleiben könntest.«
»Danke.« Ich war dankbar für seine beruhigenden Worte und genoss die Aussicht, mit ihm zusammen zu sein.
Dann küsste er mich – ein kleiner Vorgeschmack auf den Abend, der vor uns lag. Er küsste mich, bis die Teenager auf ihren Boards stehen blieben und riefen: »Nimm dir ein Zimmer, Opa!«
»Da ist er!« Noch ehe Abe ihn sah, entdeckte ich Sam. Er hielt ein Schild mit der Aufschrift »Mr. und Mrs. McFadden« hoch, auf das mit Filzstift Herzen und Blumen gemalt waren.
»Das haben die Kinder gemacht.« Er zuckte die Schultern und ließ das Schild sinken, dann küsste er seinen Vater auf beide Wangen und zog ihn an sich, so wie er es immer tat. Sie waren so unbefangen herzlich zueinander.
»War es schön, Ivy?« Sam ließ von seinem Vater ab und gab mir einen trockenen, warmen Kuss auf die Wange.
»Wundervoll. Wirklich wundervoll. Und wie lieb von dir, uns abzuholen.«
Wir hatten beide betont, dass das nicht nötig sei. Sam war eingespannt genug, mit seiner Arbeit und den zwei kleinen Kindern, aber er bestand darauf.
»Dad hat Ruby und mich genug herumgefahren. Und es sind schließlich eure Flitterwochen. Da will man doch nicht zurückkommen und erst mal stundenlang in der U-Bahn sitzen.«
Er hatte auch die Flitterwochen arrangiert – Abe war eingeweiht gewesen, ich nicht. Ein Geschenk von allen vier Kindern gemeinsam. Bevor sie buchten, hatten sie Abe in die Details einbezogen, ihn jedoch angehalten, mir nichts zu verraten.
»Wir fahren ans Meer, und es ist warm, aber nicht heiß«, war alles, was Abe sich entlocken ließ, als ich ihn fragte, was ich einpacken sollte.
»Geht es nach Nordeuropa?« Wollte er mir vielleicht seinen Brunnen am Hamburger Hafen zeigen? »Oder nach Spanien?« Hatte er ein wenig zu interessiert gewirkt, als ich eine Geschäftsreise nach Almería erwähnte und betonte, wie gern ich noch einmal dorthin zurückkehren würde? »Oder nach Nordafrika?« Ich wusste, dass wir nicht lange fliegen würden, aber vielleicht ging es irgendwo nach Marokko.
Er war öfter mit Lynn, Sam und Ruby dort gewesen, als sie noch Kinder waren. »So ein schönes Land. Das Licht, die Farben und die Gastfreundschaft der Menschen machen es zu etwas ganz Besonderem.«
Ich war mir nicht sicher, wie ich es fand, die Flitterwochen an einem Ort zu verbringen, an dem er so oft mit seiner Frau und seiner jungen Familie gewesen war, aber egal wohin wir fuhren – jetzt war es zu spät, noch etwas dagegen einzuwenden.
»Hör auf, so viele Fragen zu stellen!«, mahnte Abe, als ich weiterbohrte.
»Habe ich einen Roman gelesen, der dort spielt?« »Brauche ich Wanderschuhe?« »Soll ich Mittel gegen Mücken einpacken?«
»Ehrlich, du bist wie ein Kind, das schon vor Weihnachten wissen will, was es zu Weihnachten bekommt.«
»Ich will nur vorbereitet sein.«
»Ich habe dir erklärt, was du einpacken sollst, und ich sorge für alles andere, was wir brauchen.«
»Aber was soll ich lesen? Ich lese gern Bücher, die mit dem Ort zu tun haben, an den ich reise.«
»Es ist eine Überraschung, Ivy«, erklärte Abe mit Nachdruck, lächelte jedoch. »Bitte hab Nachsicht mit mir und lass es eine bleiben.«
Die eigentliche Überraschung war jedoch, dass nicht Abe die Reise geplant hatte, sondern die Kinder. Dass es ihr gemeinsames Geschenk war, bedeutete mir weitaus mehr als die Reise selbst. Alle akzeptierten sie unsere Hochzeit, sie freuten sich für uns und waren vereint in dem Bemühen, uns das zu zeigen.
Wir befanden uns in einem italienischen Restaurant in der Nähe des Standesamts, als mir Lottie die Karte überreichte. »Das ist von uns allen«, erklärte sie durch das Geschirrgeklapper, das Stimmengewirr und die Musik aus Sams iPod, den er an die Anlage des Restaurants angeschlossen hatte, um nach seiner Rede ein Lied für uns zu spielen. Es sei immer das Lieblingslied seines Vaters gewesen.
»Und jetzt weiß ich auch, warum!«
Es war For the Love of Ivy von The Mamas and the Papas, ein Song, den ich oft vor mich hin gesummt hatte, wie man es tut, wenn in einem Song der eigene Name vorkommt.
Es wurde eine laute, ausufernde Feier, obwohl wir nur Familie und ein paar enge Freunde eingeladen hatten. Von beidem besaßen wir mehr, als uns bewusst gewesen war, sodass wir schließlich mit fünfunddreißig Personen in einem Extraraum feierten, der sich zu einem Hinterhof mit terrakottafarbenen Mauern, Töpfen mit Olivenbäumchen und Lorbeer öffnete. Fast hätte man meinen können, wir wären in Italien: Das Wetter war warm, das Essen mediterran und köstlich, und die Kellner bemühten sich reizend um uns.
»Bellissimo?«, erkundigte sich der eine jedes Mal, wenn er mir Prosecco nachschenkte. Er behandelte mich wie eine siebzehnjährige und nicht wie eine einundsiebzigjährige Braut.
Doch auch das familiäre Umfeld trug zu dem italienischen Flair bei: Ruby und Lottie saßen auf einer Bank in der Sonne, steckten die Köpfe zusammen und plauderten vertraulich miteinander, als würden sie sich schon ihr ganzes Leben lang kennen. Ilona, Sams polnische Frau, zeigte Connor und Tomas, wie man aus einer Serviette einen Schwan faltete, während Sam und Max heimlich auf ihren Smartphones die Spielstände beim Cricket verglichen und vorgaben, etwas anderes zu tun, als Hannah sie danach fragte. Um bei der Hochzeit ihrer alten Eltern dabei zu sein, verpassten sie ein Testspiel, aber eben doch nicht ganz!
»Mach auf«, forderte Lottie, als ich auf den Umschlag blickte.
Die Karte zeigte ein Bild von Eric Slater – eine malerische englische Landschaft, die man nicht gleich zuordnen konnte, wenn man nicht in Sussex aufgewachsen war.
»Die Hütten der Küstenwache. Das war einer meiner Lieblingsorte.« Ich öffnete die Karte.
Sie kauerten gefährlich nah am Rand der Klippen, wo der Cuckmere River sich ins Meer ergoss, auf der anderen Seite die markanten weißen Felsen der Sieben Schwestern.
»Ich weiß«, freute sich Ruby. »Dads auch.«
Sie hatten alle etwas in die Karte geschrieben: Unsere Kinder, ihre Partner und die Enkelkinder adressierten uns auf mancherlei Weise. »Mum und Abe« hieß es da, »Dad und Ivy«, rührend auch »Grandma und Grandpa Abe« oder »Granddad und Nana Ivy«. Sie alle gratulierten uns und wünschten uns viele glückliche Jahre. Und in der Mitte stand in Sams Handschrift: »Wir alle wünschen euch schöne Flitterwochen.«
Ich blickte in ihre erwartungsvollen Gesichter und war unbeschreiblich gerührt.
Es hatte einen bitteren Beigeschmack, dass die Beziehung zwischen Abe und mir, die wir auf eine neue, erwachsene Weise wiederaufleben ließen, mich derart erfüllte, wie ich es mit niemand anderem je zuvor erlebt hatte.
All die Beziehungen meines Erwachsenenlebens waren auf ihre Weise gut und erfüllt gewesen, doch ich hatte mich immer als eine Hälfte gefühlt, nicht als Teil eines Ganzen.
Mit Abe war das anders. Vielleicht lag es an unserem Alter und daran, dass wir uns in einer Phase begegnet waren, in der wir viel Zeit miteinander verbringen konnten: Weder Arbeit, Karriere noch Familie lenkten uns voneinander ab. Das sagte ich mir, weil ich sonst ein wenig traurig wegen der anderen Männer gewesen wäre, die ich geliebt und verloren hatte.
Ich dachte, dass das Getrenntsein, von dem die anderen Beziehungen geprägt gewesen waren, natürlich war. Es war normal, dass man sich als eigenständige Persönlichkeit niemand anderem und dessen Bedürfnissen unterordnen wollte. Doch jetzt wollte ich Ivy und Abe sein.
An dem Tag, an dem es passierte, fuhr ich morgens einkaufen. Nachbarn hatten uns zur Feier ihrer Rubinhochzeit eingeladen. Es war das erste Ereignis seit unserer Trauung, zu dem Abe und ich gemeinsam gingen, die erste Einladung auf dem Kaminsims, auf der handschriftlich »Ivy und Abe« über den gedruckten Details zur Feier stand. Wir waren jetzt seit achtzehn Monaten wieder vereint, und es war etwas über ein halbes Jahr her, dass wir geheiratet hatten und ich zu Abe gezogen war.
Wir waren schon vorher gemeinsam zu Abendessen eingeladen gewesen oder zu Familientreffen, sowohl von meiner als auch von seiner Seite, aber dies fühlte sich mehr nach einem richtigen Ereignis an. Anlass genug, um nach einem neuen Kleid Ausschau zu halten.
»Bist du zum Mittagessen zurück, oder isst du etwas in der Stadt?«, fragte Abe.
»Ich weiß noch nicht. Zu lange will ich nicht wegbleiben, aber rechne lieber nicht mit mir.«
»Wahrscheinlich mache ich mir einfach ein Sandwich, aber sag Bescheid, wenn du wiederkommst.« Dabei sah er auf seine Armbanduhr, als würde er überschlagen, wie viele Stunden er das Haus für sich hatte.
»Ich glaube, ich besorge mir unterwegs etwas«, antwortete ich. Vielleicht brauchte er etwas Zeit für sich.
»Mir ist beides recht«, verabschiedete er mich mit einem Kuss.
Am frühen Nachmittag kehrte ich zurück, und Abe sprang sogleich herbei, um mir die Tür zu öffnen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich, etwas verstimmt über die Begrüßung.
Normalerweise nahm Abe Rücksicht darauf, dass ich bei meiner Rückkehr gern erst einmal ankam, mir in Ruhe den Mantel auszog und meine Taschen sortierte.
»Willst du einen Kaffee? Ich wollte mir gerade einen machen.«
»Okay. Ich will nur eben die Taschen loswerden und auf die Toilette.«
»Natürlich.« Er verschwand in der Küche. »Ich bringe den Kaffee ins Wohnzimmer.«
»In Ordnung.« Ich ging nach oben und stellte meine Einkaufstasche mit dem neuen Kleid auf unserem Bett ab.
Vor dem Schlafzimmerfenster sah es jetzt kahler aus als bei meinem Einzug. Unser Garten war klein und pflegeleicht, doch es schloss sich ein größerer daran an. Dort stand ein wundervoller Ahorn, den wir von unserem Bett aus sehen konnten, wenn die Vorhänge offen waren.
Jetzt gab es ihn nicht mehr, von einem Gärtner gefällt, weil er krank war. Abe war hinausgegangen und hatte den Mann angesprochen, als wir die Kettensäge hörten und die Äste fallen sahen.
»Ich vermisse den Baum«, sagte ich mehr als einmal zu Abe. »Es scheinen nicht mehr so viele Vögel da zu sein. Und die Amseln habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr gehört.«
Häufig waren wir im Morgengrauen vom Gesang der Amseln aufgewacht, und ein Paar schien regelmäßig auf dem Rasen vor dem Wohnzimmer zu landen.
Abe sprach von ihnen als von »unseren Amseln«, und ich staunte über die Schönheit der Natur und stellte fest, wie viel intensiver ich sie wahrnahm, wenn ich sie mit jemandem gemeinsam beobachtete.
Mit Abe an meiner Seite schien die Welt so viel strahlender, doch die Abwesenheit des Baums betrübte mich dennoch, wenn ich aus dem Schlafzimmerfenster blickte. Ohne ihn wirkte der Garten leblos, als wäre der Winter zu früh gekommen.
Ich versuchte, die leichte Melancholie abzuschütteln, die mich überkam, und ging nach unten.
Abe las im Wohnzimmer die Zeitung.
»Ich habe dir Kaffee gemacht.« Er deutete auf eine Tasse auf dem Tisch am Fenster.
Ich zögerte einen Moment, ehe ich mich setzte, und war völlig zu Unrecht etwas verschnupft, weil Abe auf der Seite des Sofas saß, wo normalerweise mein Platz war. Dadurch, dass er mir den Kaffee woanders servierte, zwang er mich, den Platz zu wechseln.
Mir war klar, dass er sich nichts dabei gedacht hatte, aber mir gefiel es, dass eine gewisse Routine um sich griff, zu der feste Plätze gehörten, auf denen wir »normalerweise« saßen. Es verlieh der Beziehung den Anschein, als bestünde sie schon länger, als es eigentlich der Fall war.
»Danke.« Ich setzte mich, blickte aus dem Fenster und verstand sofort, warum ich woanders sitzen sollte. Weshalb er so erpicht darauf gewesen war, dass ich heute Morgen das Haus verließ. Warum er bei meiner Rückkehr gleich zur Tür gesprungen war.
In der einen Ecke des Rasens, wo wir häufig »unseren« Amseln beim Picken zusahen, lag etwas aufgeworfene Erde, in der Mitte erhob sich anmutig ein Setzling. Bei seinem Anblick brach ich in Tränen aus.
»Es ist ein Apfelbaum.« Abe stand auf und kam zu mir. »Ein halbhoher, damit er den Garten nicht überschattet. Er wächst aber hoch genug, dass wir ihn von unserem Schlafzimmerfenster aus sehen können und er ein paar Vögel anzieht.«
Es verschlug mir vor Rührung die Sprache, und ich glaube, meine Reaktion verwirrte Abe.
Er redete weiter. »Wahrscheinlich werden im Frühjahr ein paar Blaumeisen dort ihr Nest bauen, und wenn die Blüte vorüber ist, kommen Fliegenfänger und Grasmücken. Und im Herbst und im Winter, wenn die Früchte auf dem Boden liegen, diverse Amseln und Drosseln.«
Er setzte sich, legte den Arm um mich. »Ich dachte, er würde dir gefallen, Liebes.«
»Er ist wundervoll.« Ich kuschelte mich an ihn.
»Warum weinst du dann? Hier hast du ein Taschentuch.«
Ich putzte mir die Nase und versuchte, meine Gefühle in Worte zu fassen. »Weil ich so glücklich bin.« Ich wischte mir die Augen. »Ich habe einen Großteil meines Lebens nicht gewagt, mich auf etwas zu freuen, weil ich Angst vor der Zukunft hatte. Aber jetzt …«
»Das ist sehr viel Gefühl für ein paar Äpfel.« Abe legte mir die Hand aufs Knie.
Uns beiden war klar, dass ich nicht von dem Baum sprach, nicht nur jedenfalls, sondern vor allem davon, wofür er stand: das Leben – unser gemeinsames Leben.
»Hast du schon mal darüber nachgedacht«, Abe nahm meine Hand, als wir später an jenem Abend im Bett lagen, »was wohl passiert wäre, wenn wir uns früher begegnet wären?«
»Das sind wir.«
»Ich meine, später, nicht als wir Kinder waren. Wenn wir uns zum richtigen Zeitpunkt begegnet wären.«
»Darüber habe ich vor gar nicht langer Zeit mit Lottie gesprochen.«
»Über uns?«
»Eigentlich über sie. Gibt es den einen Richtigen oder nur den richtigen Zeitpunkt?«
»Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen?«
»Ich glaube, es gibt den Richtigen zum richtigen Zeitpunkt und den Falschen zum richtigen Zeitpunkt – und den Richtigen zum falschen Zeitpunkt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt begegnet wären? Vielleicht wären wir nicht gut füreinander gewesen. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen.«
»Es sei denn, du bist Nordkoreaner.« Abe blickte auf die leuchtende LED-Anzeige an seinem Radiowecker neben dem Bett. »Sie stellen ihre Uhren zurück. Es ist eine symbolische Geste, um zu zeigen, dass sie die Jahre unter japanischer Herrschaft hinter sich haben.«
»Das ändert aber nichts an der Vergangenheit«, gab ich zu bedenken. »Wer weiß, was eine andere Vergangenheit gebracht hätte?«
»Wir haben so ein Glück.« Er drehte sich zu mir und legte den Arm um mich. »Dass wir uns zu diesem Zeitpunkt wieder getroffen haben.«
Ich rutschte zu ihm hinüber und küsste ihn, anstatt etwas zu sagen. Es war ein langer Kuss, und unterdessen suchte ich nun schon zum zweiten Mal an diesem Tag nach den richtigen Worten, um auszudrücken, was ich empfand.
Ich wollte ihm erklären, dass ich mich ganz fühlte, auf eine Weise, wie ich es niemals zuvor erlebt hatte. Er sollte wissen, wie glücklich er mich machte, doch da spürte ich, dass er ganz leicht zusammenzuckte, während wir uns küssten, und ich hielt inne. »Ist alles in Ordnung?« Ich kuschelte mich dichter an ihn und genoss die Wärme seines Körpers und das Gefühl seiner Brusthaare an meinen Brüsten.
»Ja. Aber ich werde alt.«
Ich lachte. »Das werden wir beide.«
Abe stieß lautstark die Luft aus. Es klang bekümmert, aber ich wollte nicht noch einmal fragen.
»Irgendwie finde ich nicht die richtigen Worte.«
»Du sagst immer das Richtige.«
Er klang angestrengt, doch ich redete weiter.
»Ich bin immer froh darüber gewesen, dass wir uns begegnet sind, als wir Kinder waren. Es war ein großes Glück, dass wir diese Freundschaft erleben durften. Es war wie ein Maßstab für mich, etwas, auf das ich mich zu anderen Zeiten in meinem Leben beziehen konnte. Zeiten, in denen ich mich ungeliebt und nicht geschätzt fühlte. Unsere Freundschaft hat meinem Leben eine feste Grundlage gegeben.«
Ich sah Abe an. Ich wollte sichergehen, dass er mir zuhörte. »Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich noch einmal.
Er schien sich nicht wohlzufühlen. »Ivy«, flüsterte er und verzog beim Sprechen leicht das Gesicht. »So etwas Schönes hat mir nur selten jemand gesagt, aber meine Brust fühlt sich so eng an.« Er japste nach Luft. »Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt.«
Ich schaltete das Licht an und konnte jetzt deutlich sein schmerzverzerrtes Gesicht sehen. Mir war sofort klar, dass ich einen Krankenwagen rufen musste.
»Ich glaube, mein Mann hat einen Herzinfarkt.« Ich stand nackt neben der Nachttischlampe und lauschte den Anweisungen. Er sollte ruhig liegen bleiben und sich entspannen. Ich musste versuchen, ihn zu beruhigen, bis der Krankenwagen kam.
Ich fühlte mich schlecht, als ich mich anzog, während er dort lag. Ob es ihm etwas ausmachte, wenn die Sanitäter ihn nackt im Bett vorfanden, oder überschattete der Schmerz, was mir noch Sorgen bereitete?
Doch der junge Mann und die Frau, denen ich die Tür öffnete, sahen so etwas ganz sicher nicht zum ersten Mal. Sie verhielten sich professionell und mitfühlend.