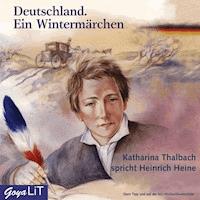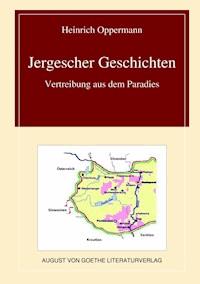
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Jergescher Geschichten Vertreibung aus dem Paradies werden lebendige und lebensfrohe Geschichten und Geschehnisse kurz vor, während und nach dem II. Weltkrieg in Kaposszekcsö, Ungarn, erzählt. Dahin siedelten einst die Ahnen des Autors vor Jahrhunderten und wurden zwischen 1946-1948 enteignet und wieder vertrieben. Jener Region, die die Türken zwischen 1556-1686 ausraubten, plünderten und verwüsteten und nach 1700 wieder durch eingewanderte Deutsche in mühevoller Kleinarbeit, mit Fleiß und Ausdauer urbar gemacht und zum blühen gebracht wurde. Sie empfanden ihre Enteignung, Vertreibung von Haus und Hof und schließlich aus dem Land, das sie als ihr blühendes Heimatland ansahen, wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Die im April 1947 enteigneten, aus Haus und Hof getriebenen Deutschen sollten in andere Dörfer gebracht werden, die Familie des Autors fand eine Bleibe im Weingebirge, dem Jergesch, dem nur von ungarischen Kleinbauern und Häuslern bewohnten Teil des Dorfes. Ihr Leben im Jergesch währte nur wenige Monate, denn schon am 11. Mai 1948 fuhren Fuhrwerke vor, luden sie auf, brachten sie zur nahegelegenen Bahnstation, wo sie in Viehwaggons geladen und außer Landes gebracht wurden. Die Ankunft in der Heimat ihrer Ur-Ur-Ahnen, nach Registrierung, Entlausung und Sortierung im Auffanglager Pirna, wurden die Familien auf die Regionen in Sachsen verteilt. Heinrich Oppermann, Chemiker, Prof. Dr. Dr. h. c., war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZfW Dresden der ADW und Direktor und Lehrstuhlleiter am Institut für Anorganische Chemie der Technischen Universität Dresden. Er verfasste über 270 wissenschaftliche Publikationen und schrieb und schreibt Geschichten, Erzählungen und Gedichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Meinen Freunden
Ein Wort vorher
Heumahd
Kukuruzschälen
Die Jaroschquelle
Die Sarád
Hanfsäcke
Hinz und Kunz, zwei Säulen im Dorf
Leitoles Herrche
In Memoriam Heinrich Leitol
Kaposszekcsö, fast Gesellmannszekcsö
(Heinrich Gesellmann gewidmet)
Straner Vilmos - „pap“
Besuch im Jergesch
Deutsche und Ungarn
Mit Juden im Dorf
Die Zigeuner - Roma oder Sinti?
Vagabunden und Bettler
Hudwaad Markt
Die Flucht aus dem Paradies 21)
Die Russen kommen
Kis Kati néni, eine Seele im Jergesch
Personengebundene Hunde
Der Schulweg
Die Strecke
Handwerkerwettstreit
Hudwaadfußball
Vorführmusiker
Melonenklau im Jergesch 26)
Traubenklau im eigenen Weingarten
Gewitter über dem Jergesch
Akazienseilflug
Lausbuben
Vertreibung aus dem Paradies
Zur Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
Ankunft in der neuen Heimat
Eingliederung
Ein Fliegerschicksal
Ein Brief aus der fremden Heimat
Im fremden Land
(von Anna Maria Weckerle)
Heimat
Der Schnapsfahnder
Fasenenkrähen
Pfauenfedern
Sektschier Dialekt
Jakob Justus *)
(In Memoriam)
Heimat im Wandel der Zeiten
Die Galle
Meine Leistenschau
Inhalt
Zitate, Anmerkungen
Heinrich Oppermann
Jergescher Geschichten
Vertreibung aus dem Paradies
AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG
FRANKFURT A.M. • LONDON
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit. Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2017 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE
AKTIENGESELLSCHAFT
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.publicbookmedia.de
www.august-goethe-von-literaturverlag.de
www.fouque-literaturverlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de
www.haensel-hohenhausen.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
ISBN 978-3-8372-2046-9
Meinen Freunden
Ein Wort vorher
In „Jergescher Geschichten. Vertreibung aus dem Paradies“ erzähle ich lebendige und lebensfrohe Geschichten, insbesondere Geschehnisse kurz vor, während und nach dem II. Weltkrieg in Sektschi/ Kaposszekcsö, Ungarn, einem Dorf im Dreieck Donau - Drau und Plattensee, der ehemaligen Schwäbischen Türkei, den sogenannten „Hessendörfern“. Dorthin siedelten einst meine Ahnen vor Jahrhunderten und wurden zwischen 1946 - 1948 wieder vertrieben. Es war jene Region, die die Türken zwischen 1556 - 1686 ausraubten, plünderten und verwüsteten, ihre Bewohner flüchteten oder umkamen. Nach 1700 siedelten dort mehr und mehr Deutsche und haben die Regionen in mühevoller Kleinarbeit, Fleiß und Ausdauer urbar gemacht und zum Blühen gebracht. Die Enteignung und Vertreibung nach dem II. Weltkrieg vollzog sich über das ganze Land Ungarn und die Schwäbische Türkei in mehreren Etappen zwischen 1946-1948. Als einer der letzten Zeitzeugen dieser für die Ungarndeutschen so aufregenden, dramatischen und schicksalhaften Tage und Jahre will ich diese Zeiten möglichst vielen Lesern nahe bringen.
In „Die Enkel der Donauschwaben“1) und im „Erinnerungsgarten“2) sind Geschichten zu der Zeit der Verschleppung deutscher Männer und Frauen Ende Dezember 1944 zur Zwangsarbeit, der sogenannten „Malenkij Robot“, in Russland, exakt dem Russischen Teil der Ukraine, enthalten. Auch zur Flucht vor der Verschleppung und der Zeit unmittelbar nach dem Kriege sind Geschichten beschrieben und es sollen nun mit meinen „Jergescher Geschichten“ insbesondere zu der Zeit zwischen Enteignung und Vertreibung 1947-1948 zusammengestellt und vorgestellt werden. Auch aus einem Gesichtspunkt, der aus Reaktionen auf meine ersten Bücher hervorging. Nämlich, dass viel zu wenigen Menschen Deutschlands viel zu wenig über das Schicksal von über 16 Millionen Deutschen aus den Ostländern, Polen, der Tschechei und Slowakei, Ungarn, Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien wissen, die in Folge des Krieges aus ihrer Heimat flohen oder vertrieben wurden. Deren Ahnen vor Jahrhunderten auswanderten, wie unsere Ahnen, die ab 1720 nach Ungarn gingen. Dies zu Zeiten wirtschaftlicher Not in Deutschland und aus verschiedenen Regionen, wie Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz u. a. nach dem Osten und Südosten zogen, wo sie sich bessere Lebensbedingungen erhofften.
So ist es mir ein Bedürfnis, als einer der Generation, die diese Zeit der Enteignung, Entwürdigung und Vertreibung der Deutschen in und aus Ungarn mit erlebt hat, den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen, mit Geschichten zu dokumentieren, die zeigen, dass das Leben der einfachen Menschen miteinander kameradschaftlich, freundschaftlich, tolerierend und von gegenseitiger Hilfe getragen war. Es waren wenige, nationalistisch, chauvinistisch und fanatisch aufgehetzte Politiker und Kleingeister, die sich durch die Vertreibung der Deutschen Besitzvorteile erhofften.
Die Jergescher Geschichten sollen etwas aus der Vertreibungszeit 1947-1948 widerspiegeln, die für meine Generation, die wir als Kinder die Bedrückung, die Sorgen unserer Eltern und Großeltern nur im geringen Grade erfassten, erspürten, diese Zeit mehr als Abwechslung und als ein besonderes Abenteuer erlebten. In und durch meine Geschichten soll so im weiten Erzählrahmen Geschichte eingefangen und herübergebracht werden und der Leser stimmungsvoll unterhalten, eingefangen und in die Geschichte entführt werden.
Heumahd
Im zeitigen Frühjahr 1946, wurden in Sektschi / Kapos-szekcsö an die zwanzig deutsche Familien, über 85 Menschen, enteignet und aus ihren Häusern vertrieben. Es war die erste Enteignungswelle des Dorfes, das Auswahlprinzip nicht klar. Mit einem Bündel Wäsche unterm Arm mussten sie Haus und Hof verlassen. Sie fanden Unterschlupf bei ihren Verwandten und Freunden im Dorf. Es sickerte durch, dass die Ungarische Regierung beschlossen habe, alle Deutschen aus dem Land zu verweisen, was auch in einer ersten Durchführungsverordnung im Januar 1946 festgelegt sei. Unter diesen ersten 20 Familien war auch die Familie der Schwester unseres Vaters aus dem Oberdorf, Margarethe, mit ihrem Sohn, unserem Cousin, Hans Hild und Hild Großvater, Johann. Ihr Mann, Johann Hild, war noch in Gefangenschaft 1). Hilds kamen mit ihren Bündeln zu uns ins Unterdorf, sie schliefen in der Vorderstube und das Leben ging normal weiter, so dass wir Kinder kaum eine Lebensveränderung merkten. Die Großeltern und Eltern arrangierten sich in Großfamilie, gingen allen häuslichen Arbeiten, den Stall- und Feldarbeiten gemeinsam nach, wir Kinder besuchten die Schule weiter.
Die Frühjahrsfeldbestellung erfolgte mit den Rindern unterm Joch, Vater mit seiner Verwundung 2), die ihn besonders im Gehen stark behinderte, hatte mit den zwei Großvätern eine Unterstützung und zuweilen mussten auch wir, die drei Jungs ran und altersuntypische Arbeiten verrichten. Besonders bei der Heumahd, in den Ferien, waren unsere Dienste gefordert.
Um das Dorf waren viele ausgedehnte Wiesenflächen, die von Nordost bis Süd das Dorf weit umspannten. Da sie etwas tiefer als der Ort lagen, der nach West, Nordwest anstieg, und oft vom Kanal und Bach überflutet waren, gedieh das Gras prächtig, war die Heuernte gut. Und die Bauern hatten große Wiesenflächen und die Heuernte, die Heumahd, das Mähen der Wiesen zu Heu und Grumt war ein besonderes Ereignis und eine Augenweide. Früh am Morgen zogen unsere drei Schnitter, kurz nach getaner Stallarbeit, Vater und Großvater mit Schwager, mit ihren geschulterten Sensen und dem Wetzstein im Schlockerfaß 3) am Gürtel, in die Wiesen hinter dem Dorf vor dem Graben. Zu dritt mähten sie im Gleichtakt und gleichem Abstand die lange Wiese hinunter, dem Graben zu. Vater mähte vornweg, er sollte die Geschwindigkeit und den Takt vorgeben. Die Großväter mit ihren 65, bzw. 61 Jahren, glaubten ihm folgen zu können. In dunkler Hose und Weste und weißem Hemd schwangen sie durch die Wiese, wie drei Störche. Und wie sie, waren an vielen Stellen auf dem ausgedehnten Wiesenareal zwischen Dorf, Hutweide und Graben, Mähtrupps unterwegs und das Wetzen der Sensen und das gelegentliche Dengeln und ihr stetes Luftholen übermalte das rhythmische Schlürfsummen „schwüpp, schwüpp“ der blanken Sensen im lauten Atmen der Schnitter. Wie die Wetzpausen, die Trinkpausen, so waren auch die Hub- und Schwadenbreiten vom Vorausschnitter vergeben. Zu den Jausen- und Trinkpausen glichen die Schnittergrüppchen, über die weite Fläche gestreut, wie Storchennester auf grünem Teppich, über dem die Schwaden sich wie Zimmermannsschnüre aneinander reihten.
Wir Jungs hatten das Trinkwasser in Krügen, im Graben am Ende der Wiese gekühlt, heranzutragen, brachten die Pausen- und Mittagsversorgung in die Wiese. Die Schnitter blieben auch über Mittag in der Wiese und ruhten nach dem Mahl im Schatten von Weidenbüschen in der Wiese aus. Nach etwas befeuchteter Kehle, stiegen und schwebten aus einigen Weidenbüschen selbst Notenbündel über die Wiesen in den azurnen Himmel. Die Schnitter zogen erst bei untergehender Sonne über dem Jarosch, oder gar erst Jergesch, im müden Schritt und Reihung, wie bei der Mahd, heimwärts. Nach lautem Prusten und Spritzen beim Waschen ihrer schweißgebadeten Körper am Brunnentrog, zogen sie ihre von den Frauen bereitgelegten frischen Hemden über und traten ihren Stalldienst an.
Tage darauf war die weibliche Hälfte der Familie mit uns Kindern dran, das Heu um zu wenden. In der Regel wurde das Heu zwei mal gewendet, an sehr warmen Sonnentagen reichte ein einmaliges Wenden. Der Wendetakt von Mutter und ihrer Schwägerin, Gretel, vorgegeben, wurde im kurzen Abstand, der schon stark oberflächlich getrocknete, Schwaden mit Holzrechen gewendet, das Untere nach oben gekehrt. Wir, Cousin Hans und ich, mussten im Wendetakt Schritt halten, klein Hänschen, der Bruder, war erst Zehn und durfte den Wasserkrug in dem Graben kühlen, nach Fröschen und Fischen schauen und in den Weidenbüschen nach Vogelnestern stöbern. Auch beim Heuwenden stiegen zuweilen im Rechentakt fröhliche Liedtakte durch die weiten Wiesen.
Dem Einfahren des Heus ging das Heukuppensetzen in der Wiese voran. Die Männer, Frauen und Kinder zogen und schoben die Heuschwaden zusammen, die Männer stapelten das Heu der Wiesen zu kuppigen Schobern, dass auftretende Gewitter wenig Schaden anrichten konnten. Die Heukuppen, die bei passender Gelegenheit eingefahren wurden, waren in dem Jahr so zu setzen, dass die Rindergespanne mit Joch und Leiterwagen bequem zwischen zwei Kuppen passten. Das Heu wurde auf großen, langen Leiterwagen eingefahren und auf der Hohstell zu Heuschobern als Wintervorrat gesetzt. Dabei ahnten sie noch nicht, dass es die letzte Heumahd ihres Lebens war. Denn im Frühjahr 1947 stürzte die zweite Enteignungswelle über das Dorf, alle Deutschen mussten Haus und Hof verlassen, ihr Eigentum stehen und liegen lassen. Uns wurde mit Hilds und Habel Konrads das bereits ein Jahr leerstehende Haus von Schultheiß Peters zugewiesen und die Eltern durften im Juli noch die Ernte von den gepachteten Gemeindefeldern einbringen. Wir mussten jedoch, welch Niedertracht, am 20. Juli auch aus diesem Haus und die gerade eingebrachte Ernte darin stehen und liegen lassen und sollten aus dem Dorf gebracht werden. Doch Kis Ferkó bácsi und seine Frau, Kati néni, brachten uns in ihrem leerstehenden alten Haus im Jergesch unter.
Kukuruzschälen
Eine schöne gesellige Gepflogenheit in der Schwäbischen Türkei war auch das Maisschälen oder „Kukrucschäle“. Türkischer Weizen, Welschkorn, Kukuruz, schiebt seine Kolben zwischen den mittleren Stängelblättern und gedeiht in vielfältigen Sorten, je nach Form und Größe des Korns. Zuckermais kommt heute in Milchreife als Gemüse, Kolben und Korn in Dosen auf den Markt, der Kochkukuruz, erfreut die Touristen Ungarns nicht nur am Balaton. Puffmais, mit hornigem und spitzen Korn, das beim Erhitzen spratzend aufspringt (Platzkukuruz), eroberte als Popkorn die Welt. Auch das Maismehl als Brei, Maisbrot und Kuchen hat als Nahrungsmittel für Mehlallergiker (Zöliakie, auch Glutenallergie) weltweit Einzug gehalten. Der Futtermais hat größere Kolben und Körner, wird als Korn oder gemahlen ans Vieh verfüttert. Neuerlich werden in den USA Maissorten in verschiedenen Farben und auch bunter Mais auf den Markt gebracht. Nicht jede Genmutation, nach jahrelanger wissenschaftlicher Erforschung gereicht zum Nachteil der Menschheit. Nur leider werden wissenschaftliche Erkenntnisse allzu oft und manchmal sofort zum Nachteil der Menschen, gar nur zu kriegerischen Zwecken missbraucht.
Der Futtermais wächst hoch und bildet kräftige Kolben aus, an manchen Pflanzen auch zwei, wenn er vereinzelt im Stiefelabstand und gleichem Zeilenabstand wächst. Der Mais gedieh in Sektschi am besten unterhalb des Jergesch zum Buzsák zu, dort waren besonders ausgedehnte Maisschläge. Im Frühjahr gesät (handgelegt), war er im Frühherbst reif. Zwischen den Kolben und Hüllblättern, den Lieschen, schiebt sich ein silbrig grüngelbes Bartbündel heraus, wird mit zunehmender Reife rötlichbraun, dann dunkelbraun und trocken. Das Korn ist im Frühstadium weich, milchig, später mit dem Fingernagel noch eindrückbar und schließlich die Oberflächenschicht hornig fest, hart, die Lieschen grauweiß.
Wochen vor der Trockenreife des Maises wurde Ausgang Sommer, zum besseren und gleichmäßigeren Ausreifen, der Stängel über dem Kolben gestutzt. Zum Maisstutzen rückte die ganze Familie aufs Feld, oft auch mit Verwandten. Die Sicheln, die bunten Kopftücher und die braunen Oberkörper blinkten und leuchteten aus vielen Ecken der Hotter bis in die Weinberge im Jergesch hinauf, oft von fröhlichem Gesang manch heller Frauenstimmen weit getragen, manchem Bass und schroffem Hü und Hott und Brr der Männer an ihre Pferde übermalt, die den noch halbgrünen Spitzmais in Garben auf die Fuhrwerke luden, auf die Hohstell abfuhren und zu Viehfutter häckselten.
Der Kolben reifte auf dem unteren Stängel noch drei, vier Wochen weiter und im Spätsommer wurde der Mais gebrochen. Auch das Kukuruzbrechen erfolgte familienkollektiv. Nur die Stimmung war herbstlicher, arbeitsgetragener. Ein Pferdewagen rollte am Feld entlang, oder durch eine vorher geschlagene Mais-Schneise, und die abgerissenen Kolben wurden im hohen Bogen auf den Wagen geworfen, von den jungen Männern und Burschen auf den Hof gefahren und zu einem pyramidenförmigen Haufen aufgetürmt. Von den staubumhüllten Fuhrwerken riefen sich die Burschen oft scherzhaft zu: „Morgen schälen wir die Ami!“, oder nur kurz: „Schälen bei Liesbeth!“ Derweil die Mädchen und jungen Frauen sich im Maisweit- und Zielhochwerfen auf den fahrenden Wagen mit erhöhtem Kasten brüsteten, wie heute stangenlange Basketballer.
An lauschigen Spätsommerabenden wurde der Mais geschält. Dazu rückten die Großfamilie, die Nachbarn und die jugendlichen Freunde der Familien an und verteilten sich um den Kolbenberg. Die schilfige Hülle (Lieschen) wurde abgestreift, kam auf einen Berg, wurde zu Viehfutter gehäckselt oder als Streu verwendet. In den aufgetürmten Lieschbergen sprangen und purzelten die kleineren Kinder gern herum. Aber auch manche Maid wurde schon mal von einem Burschen übertölpelt und im Liesch gewälzt, meist vom Gejohle der Männer und Gekreische der Überraschten begleitet. Der nackte Kolben wurde zu einem Berg getürmt oder in großen Weidenkörben aufgenommen und von den Burschen auf den Gori, ein überdachtes Lattengerüst oder eine Scheune getragen und so gestapelt, dass er weiter trocknen, vor allem aber, dass er nicht stocken konnte.
Und die Kinder durften den Schälabenden meist immer mit aufbleiben. Die größeren mussten mit helfen, es war ja Spätsommer und noch schulfrei, und sie ließen sich solche gesellige Abende auch nicht gern entgehen. Die Schälgastgeber ließen sich nicht lumpen, der Hausherr holte aus dem Keller seinen Schillerwein in Krügen herauf, die Hausfrau reichte Schmalzbrote oder Salzpogatschen, auch Naschereien. Kerzen und Öllampen spendeten schummriges Licht. Lieder wurden leise angestimmt, Mundharmonika und oder Knopfharmonika luden zum Lauschen, Singen oder launigem Mitsummen ein, deftige Witze wurden erzählt und Geschichten zum Schmunzeln, aber auch derbe Späße, Schabernack und allerlei Hallodri getrieben. Besonders gut besucht waren die Abende, wenn erwachsene Mädels im Hause waren oder aus dem Kreis der Verwandtschaft, Nachbarschaft und der Freunde zum Maisschälen kamen. Das zog die Burschen mit an und alle hatten einen schönen, geselligen Abend. Die Unterhaltung war belebt, der Geist sprühte, die Kolben flogen wie die spritzigen Bemerkungen und witzigen Einfälle der Burschen und Männer. Der Mais kam schnell unter die Gores und danach manches Mädel unter die Haube, zu seinem Burschen, die Bauersleut zum Schwiegersohn oder zur Schwiegertochter und das Dorf zu einer erneuten Feier.
Und die Lieder zogen aus den Schälhöfen, von kleineren und größeren Grüppchen getragen, durch das friedliche, nächtliche Dorf. Nur hier und da saßen noch vereinzelt ältere Paare vor dem Haus auf der Bank oder ihrem Korbflechtstuhl, die Männer meist an ihrer Pfeife hantierend, stopfend oder schmauchend, die Frauen mit einer Handarbeit im Schoß, und genossen den lauschigen Abend. Saßen zwei Frauen beieinander, munkelten sie gleich den Trupps hinterher, welcher Bursche denn wohl welche Maid heuer heimgeleiten und demnächst heimführen wird. Das Anschlagen des einen oder anderen Hundes im Dorf signalisierte ihnen den Weg und die Heimkehr der Kukuruzschälerheimgänger.
Die Jaroschquelle
Auf dem Sektschier Hotter entspringen zwei Quellen. Die Jergeschquelle und die Jaroschquelle. Die Jergeschquelle im Sektschiwald war das beliebte Ausflugsziel von Schulwanderungen im Herbst kurz vor den Herbstferien und nach der Lese. Beide Klassenräume, der mit den Erst- bis Viertklässlern und der der Fünft- bis Sechsklässlern, rückten gemeinsam aus, mit den Lehrern János Szécsei und Jozsef Kovács und Pfarrer Straner an der Spitze. Bei schönem Wetter tummelten sich die Kinder auf den sonnigen Wiesen im hinteren Jergeschtal, Spiele wurden veranstaltet, kleine Wettkämpfe ausgetragen und Fuchsjagden im Wald um die Quelle. Wenn sich die Sonne hinter die Baumspitzen des hinteren Jergeschtales senkte, wurde der Ausflug an die besonnten Südhänge des Jergesch, vor die Kellerhauszeile verlegt, die Schüler hatten Freigang und die Lehrer und der Pastor Kellergang. So ergab sich immer, dass auf dem Heimflug die Kinder vornweg tobten, auch flogen, die Lehrer und der Pastor hutschwingend und fröhlich singend hinterher torkelten. Die Kellerquellen im Jergesch waren wohl ergiebiger als die Jergeschquelle, denn erstere kamen Jahr für Jahr im Dorf an, während die Jergeschquelle manches Jahr auf ihrem Weg zum Kapos im Sande des Homokpuszta vertorkelte.
Schulausflüge im Frühjahr galten oft dem Nyáros. Die Ausflüge führten über den oberen oder unteren Hohlweg, auch mal durch die Scharad hinaus, und sie verweilten am oberen Jarosch-Brunnen auf Tiszberger Heinrich Vetters Wiese, im Schatten alter Apfel-, Pflaumen- und Nussbäume. Die Wiese war nicht sehr groß und für Spiele nicht gar so weiträumig, die Jaroschkeller nicht so sprudelnd, wie die Jergescher.
Die Jaroschquelle drang im unteren Jarosch in einer sumpfigen Wiese empor und schob sich ruhig und ohne Aufsehen durch Járos-alja, den unteren Jarosch, Jagonak und Wasserdumbwa meidend, vorwärts zur und durch die Scharad, die Csucs, durch die Dobogó, unter der Eisenbahnlinie, von Pest nach Fünfkirchen, hinweg, die Pattentesch in kleine und große teilend und im Bogen wieder auf die Bahnstrecke und das Dorf zu, unter den Bahngleisen durch, das Dorf nur tangierend und fast parallel zur Eisenbahn, dem Kapos zu eilend. Immer etwas Wasser führend in dem Grabenaufwurf in Dorfnähe und hinter dem Dorf. Nur selten schwappte er über, und immer nur wenn der Kapos und der Kaposkanal Ausgang Winter Hochwasser heranführten und in dem Sektschier Graben den Jaroschquellbach zurück stauten.
Ganz nach Heinz Erhard: „Der Bach“ im Sekscheer Dealekt:
„Immer zu macht de Bach darch tes Tal, mal iss er braat, mal iss er schmaal. Er steht ne still, aa Sunndags net. Un wenn aamol haaß de Sunn hoch steht, kann mer in sai kiehle Flude fasse. Mer kanns awwer aa bleiwe lasse.“
Awwer mer hun als Buuwe net nor rai gekriffe, sain raikange, hun Fresch un anner Krabbelzeich kfange, wollde to de Mädeche krawweln un veschrecke. Awwer nor die Buwe aus em Unnertarf, die Winneckerschs, Wecklers, Wolfe, Schneikers, Schäfers, Schilde un Gsellmanns Buwe un wie se all haase, fun ter Unnerstross hiwe un driwe. Bis ruff zu de Lemmels, Schaade un Schlitte Buuwe. Tie im Owertarf un Hinnertarf iwwer te Kerch driwwe, hun annern Schawernack getriwe.
Doch ich soll nicht schwäbeln, aber die Wahrheit aufschreiben, damit die Nachwelt weiß, wie es war und wer und wo wir waren. Auch wenn ich mit dem Graben, also dem Bach, dem Bach Hans ein kleines Denkmal setze. Im Bach und Graben hat er mit uns selten gespielt, doch in den Kanal zum Baden sind wir alle, auch die aus der Hintergasse und Obergasse mit dem Bach (Hans) über den Bach (Graben) und die Brücke über den Bach und Graben zum und in den Kanal zum Baden gegangen. Da übten sich alle vom Steg über den Kanal in den Kanal zu springen, der im Bereich des Steges einen knappen Meter hoch sein Wasser vom Mecsek her führte. Mancher versuchte auch vom aufgeschütteten Kanalrand in die kühlen Fluten zu springen, was nicht ungefährlich war, weil der Sprung zu kurz oder der Absprung zu spät erfolgen konnte - nicht unähnlich den heutigen Skiflugabsprüngen an den etwas höheren Schanzentischen - und der Badespringer zu seicht aufkam und mancher Knöchel zum Heilpraktiker ins Dorf getragen oder gar zum nächsten Arzt in Dombóvár oder Vásárosdombó gefahren werden musste. Die Schelte der Eltern und Großeltern, die wichtigere Arbeitsgänge und Pflegesorgen hatten, waren bei den mutigen Sprüngen nicht einkalkuliert. Die durch die Selbstverstümmelung bedingten Badeausfälle des Jahres schon gar nicht.
Und die Jaroschquelle war fleißig, wie seine Sektschier auch, sie arbeitete immer, Tag und Nacht und hat über den Graben den Sektschiern vielfach gedient. Vor allem in der Scharad dem emsigen Bulgaren und seinem durstigen Gemüse, das ist aber schon eine andere Geschichte. Dem ganzen Dorf diente die Quelle mit ihrem Wasser im Graben im Sommer, wenn zur Heu- und später die Grumtmahd die Familientrupps die Schwaden, wie die Zeilen im Buch, über die Wiesen legten, das Wetzen der Sensen durch die Wiesen krächzte, und die Kinder die Wein- und Wasserkrüge im Graben kühlen und herantragen mussten, um den Schnittern in weißen Hemden und dunklen Hosen den Durst zu stillen und ihnen die Schlockerfässer aufzufüllen. Auch für die Heuwendetrupps mussten die Krüge im Graben gekühlt und in die nackten, nach Heu duftenden und stachligen Wiesen barfuss getragen werden.
Ausgang Sommer diente der Graben dem Dorf, um den Hanf zu beizen, im Herbst um die Rinder auf der Weide in der Dobogó und der kleinen und der großen Pattantesch zu tränken und im Winter, um die schilfigen Aushubstellen entlang der Bahn mit Wasser zu füllen, den Kindern zur Schlitterbahn und den beiden Wirtshäusern zu Kühleisplatten zu frieren und die Eiskeller bis zur Decke zu füllen und für das ganze Jahr mit kühlen Getränken die Wirtshausgäste zu erquicken. Die Jaroschquelle war so ihren Sektschiern übers ganze Jahr zu Diensten.
Die Sarád
Die Sarád, Scharad oder Schrademühl, war die Oase Sektschis. Die Jaroschquelle hat sie dazu gemacht. Und weil der Jarosch ein Kind des auslaufenden Mecsekgebirges ist, so ist dann die Jaroschquelle ein Kindeskind des Mecsek / Metschek, besser, seiner großen Söhne Zengö und Jakab. Die Brüder haben einst, bei ihrem Aufbruch ins Karpatenbecken und Niederlassung, östlich der eine, Zengö, und westlich der andere, Jakab, die Metropole der Branau, Fünfkirchen / Pécs, in ihre Mitte genommen und von ihren hohen Thronen ihre Sippen, der größere, Zengö, nach Ost, bis in die Tolnau und kurz vor die Donau, sein Bruder, Jakob, seine mehr nach Norden, durch die Branau bis hinein in die Schomodau, ziehen lassen. Und da die Herrscher früher im Sattel ausschwärmten und Sattel auf Ungarisch nyereg heißt, wurde das letzte Tal des Auslaufs des Metscheker Jakabs, Nyerges / Jergesch genannt. Der Jarosch hätte so gut und gerne Jakab oder Jakob und das Jaroschtal so Jakobstal heißen können. Da Sektschi aber reichlich mit Jakobs gesegnet war und der erste deutsche Ortsvorsteher ein Jakob, Jakob Konrad Hecker, und Personenkult damals noch nicht „in“ war, einigten sie sich, stimmten die Deutschen dem ungarischen Nyáros zu und sagten Jarosch.
Die Jaroschquelle erreicht die Scharad über das untere Jaroschtal, das sich von den Jagonaker und Wasserdumbwaer Hängen abgestoßen fühlt, sich linkslastig weitet und durch eine breite Wiese wabert, links und rechts von bescheidenen Akazienwäldchen flankiert wird, sich aber wieder fasst und zur Scharad zu einengt. Hinter der Scharad, rechtsseitig vom Jaroschquelllauf, der sich allmählich zu einem flachen Graben eingräbt, streben Wasserdumbwaer Felder flach hinauf und linksseitig davon der Sektschier Hosszumezö, der Langacker. An der Stelle, wo der Graben von den Wasserdumbwaer Hügeln nach links zum Hosszumezö zu schwenkt, um nach kurzem Lauf sich wieder talabwärts einzugraben, da hatten vor dem Hang einst Slawen eine kleine Siedlung errichtet, mit wenigen kleinen Häusern und einer kleinen Mühle, deren Rad vom Jaroschquellwasser, von dem Bach abgezweigt und getrieben wurde. Die Siedlung verfiel, die Mühle aber wurde noch bis in die Zeit unserer Ahnen im Dorf weiterbetrieben. In der Neuzeit hatte dort ein Bulgare ein Siedlungshaus errichtet, von der einstigen Siedlung waren noch Rudimente, als Scheune und Schuppen genutzt, sichtbar. Die Fläche zwischen der einstigen Siedlung und dem eingegrabenen Bach nutzte er als weite, ebene Gemüseanbaufläche, die von Rillen durchzogen, vom Wasser aus dem Jarosch stetig bewässert wurde. Inwieweit die Jaroschquelle als alleinige Mutter den Bach säugte, oder im unteren Jaroschtal noch Jagonaker oder Wasserdumbwaer Rinnsale heimlich zuliefen, war nicht offensichtlich, der Graben um Sektschi aber trug immer Wasser. Der Paprika, die Tomaten, Zwiebel, Rüben und Kraut aller Art gediehen prächtig, waren frischer, schöner, größer und einfach schmackhafter als anderswo.
Großvater, der das Sektschier Umland kannte wie kein anderer, kehrte auch schon bei des Bulgaren Vater gerne ein und brachte oft in seinem abgewetzten Jaroscher Rucksack Kostproben seines prächtigen Gemüses, auf seinem weiteren Weg über die Csucs, die Dobogó und Nácek heim. Als die Fernverkehrsstrasse von Dombóvár nach Pécs noch nicht ausgebaut war, überspannte den Graben in der Csucs eine rumpelige Holzbohlenbrücke, die die sie querenden Eisen bereiften Pferdewagengespanne stets laut rumpelnd (dobog= dröhnen, poltern) anzeigte und der Region unterhalb der Brücke entlang des Grabens ihren Namen gab.
Vom Bau der Dobogóbrücke hinterblieb ein großes Kiesbett, das über die Jahre vom Grabenwasser schön blank gewaschen wurde. An diese blanken Kieselsteinchen erinnerten wir uns, als unsere Schild Gretel Oma Täubchenwöchnerinnensuppe kochen wollte für ihre jüngste Schwester Lies, verheiratete Fuchs, die wie sie eine geborene Gesellmann und Tochter des Schwarzgesellmann Konrads, meines Urgroßvaters war, und ein zartes Täubchen für den Wöchnerinnenschmaus brauchte. Das war ein schöner Brauch in Sektschi und bei den ungarischen Schwaben in der „Schwäbischen Türkei“, dem sich alle gern unterzogen. Neben Täubchen kamen allenfalls Rebhühner und ungünstigenfalls Kalbsfleisch in Frage. Aber Weitzel Miklós Vetter schlachtete nur mal aller zwei Wochen, und auch da nur mal Schwein, mal Rind.
In unseren Taubenschlägen waren aber keine Jungtauben vorrätig. So empfanden wir ihren Wunsch als Auftrag und zogen mit Cousin Hans Schild mit unseren Csuzli (Katapulten) bewaffnet und mit Dachsi im Schlepp und in Umkreisung durch die Tischkesch, am Graben entlang die Dobogó hinauf zum Scharader Akazienwäldchen, in dem sehr viele Wildtauben nisteten. An der Brücke beluden wir unsere Hosensäcke mit scharf geschmirgelten Kavics (Kieselsteinchen) und zogen an der grünenden Oase des Bulgaren vorbei zum nahegelegenen Akazienwäldchen. Das Gurren der Wildtaubenoase klang uns vielstimmig entgegen und zeigte uns die hohe Taubendichte an. Unsere Katapultgummis waren elastisch und gut gespannt und beschleunigten die Kiesel zielsicher, doch meist flogen die Tauben nur verschreckt auf und das Gurren verstummte für geraume Zeit. Die stark beschleunigten Kavicshagel aus unseren Csuzli wirkten wie Hasenbleischrot und es fielen in unserem Csuzliduett bald zwei Tauber von den Bäumen. Die Taubendichte war so hoch, dass unsere drei bis vier Csuzligeschosse ohne Zielen ihren Treffer machten. Wichtig war nur, dass die Csuzligummis, meist große Einweckglasgummis, elastisch und scharf genug spannten.
Unser aufmerksamer und folgsamer Dachsihund holte die Tauben heran und erledigte, was die Kavics und wir nicht vermochten. Aus Großmutters Wöchnerinnensuppe hat ihre jüngste Schwester, Lies, den Kavics der Dobogó wohl eben sowenig herausgeschmeckt, wie unsere Not, dass wir zwar eine Taube herunterschießen, aber ihr nicht den Hals umdrehen konnten.
Doch das Kaninchenschlachten, ihr Ausnehmen und für die Pfanne fertig zurechtzumachen hat nicht nur Großmutter von mir verlangt. Es war für die gesamte Familie eine Selbstverständlichkeit, dass der große, schon zwölfjährige Enkel, das besorgt.
Hanfsäcke
Von unserem Jergescher Zwischenaufenthalt in Kis Ferkó bácsis altem Haus führte unser Schulweg von der Jergescher Kreuzung weg unterhalb des Pusztahegy und Szekcsöhegy, entlang eines diagonal über die Äcker führenden Trampelweges, von links vom Akazienwald umweht und dem Benzinnebel der wenigen Autos auf der Strasse nach Dombóvár, und dem strengen Duft der Hanfstücke im späten Sommer durch das Hanffeld (Kenderföld), hinter den ersten Häusern entlang, in das Dorf. Und beim Niederschreiben dieses Weges kommt mir eine Hanfgeschichte in den Sinn, die ich meinem Enkel Niklas, anläßlich seines 14. Geburtstages erzählte, an dem wir, da er zu meinem 68. Geburtstag um die gleiche Zeit wie ich, elf Uhr zwanzig, geboren wurde, wir also an dem Tag zusammen den 96.sten Geburtstag begingen. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich mit ihm in zwei Jahren auf unseren hundertsten Geburtstag mit einem kleinen Glas „Elfuhrzwanzig“ anstoßen kann. „Elfuhrzwanzig“ wurde vor Jahren aus dem Glase gehoben, als wir zusammen mit unseren Freunden, Maria und Peter, nach der Wende im Odenwald im Juni Urlaub machten. Auf unserer ersten Wanderung kehrten wir so nach etwa zwei Stunden in einer Schenke zur Rast ein, saßen auf der Veranda, die Sonne schien so schön, und wir registrierten, dass es zum Mittagessen noch zu zeitig sei und bestellten je ein Glas Weißwein. Ein köstlich, prickelnder Genuss, eine Erbauung und Labung und Salbung zugleich, am Vormittag elf Uhr zwanzig. Am nächsten Tag eine andere Tour, das gleiche schöne Wetter und wieder mit Einkehr und wieder ein Glas Weißwein. Und wieder war es elf Uhr zwanzig. So hoben wir also „Elfuhrzwanzig“ für immer aus dem Glas.
Doch nun zur Geschichte mit und für Niklas. Das Gras um die Tanya war innerhalb von drei Wochen stark gewachsen. Niklas, schon 13, bot sich an, am Wochenende mitzukommen, gemeinsam würden wir das gut schaffen. Das Wetter war prächtig. Die Lerchen trillerten schwebend über den hohen Lärchen am Waldesrand und weder die einen mit e noch die anderen mit ä ließen sich von dem fernen Summen und die sammetweißen Streifen im Azur über ihnen stören, die die großen „Vögel“ zum Drehkreuz im Osten, über Görlitz hin, herab sandten.
Niklas lauschte ihnen verträumt nach, während wir von den zusammengeharkten, Maulwurfhauf hohen Grashalden die Leinensäcke stopften. Nach geraumer Traumzeit schaute er auf und bemerkte zur Aufschrift auf den Säcken: „Ganz schön nobel, ‚Heinrich Oppermann, Ksz’, hast du die Säcke extra anfertigen lassen?“ „Diese Antwort ist lang, da müssen wir uns an den Tisch setzen, es geht ohnehin auf Elfuhrzwanzig“. Und ich nahm einen leeren Leinensack mit an den Tisch. Niklas trabte in den Keller, sprang heran und stellte eine Flasche Bier und eine Flasche Kola auf den Tisch und meinte: „Die Pause müsste reichen, erzähle!“
„Diese Säcke stammen noch von meinem Großvater, aus seiner Heimat in Ungarn, der diese Säcke selbst gemacht hat und bei unserer Vertreibung 1948 aus Kaposszekcsö, abgekürzt Ksz, herübergerettet und wie ein Kleinod gehütet hat.“ „Das sind sehr stabile Säcke und noch so gut erhalten und die sind selbst gemacht, das gibt es doch gar nicht. Wie geht denn das?“, staunte Niklas.
„Die Bauern in der Schwäbischen Türkei, deine Urahnen, waren zum großen Teil Selbstversorger. So haben sie neben dem Acker- und Weinbau sich auch selbst ihr Tuch, ihr Leinen, hergestellt. Der Rohstoff war Hanf, den sie auf ihren Äckern zogen. Hanf ist eine Faserpflanze, die in dünnen Stängeln hoch hinauf schießt, bis zu drei Meter hoch werden kann und deren äußere Haut eine langgezogene Faserstruktur darstellt, die nach der Ernte und einer Reifezeit, die Rösten oder Beizen (Hanfreez, reezen, von recede=weichen, engl.) genannt wird, gewonnen, versponnen und schließlich auch verwebt werden kann.“
„Aber Hanf ist doch ein Rauschmittel und sein Anbau verboten, galt das denn damals noch nicht?“, warf Niklas ein. „Hanf ist eine Cannabispflanze und in ihm ist das Rauschmittel Tetrahydrocannabiol (THC), das zu Haschisch und Marihuana verarbeitet werden kann, enthalten, das wirst du bald in Chemie lernen. Aber in den unterschiedlichsten Hanfsorten ist THC in unterschiedlich hoher Konzentration vorhanden. Und es gibt hunderterlei Sorten. In Faserhanf, der zu Hanfwerkstoffen verarbeitet wird, ist der Faseranteil besonders hoch und die THC-Rauschchemikalie nur zu weniger als 0,2 % vorhanden, ihn dafür zu verarbeiten, ist unökonomisch, sich damit zu berauschen, also nicht möglich.“ „Und wie kommt man dann zum Hanfsack?“, wollte er aber wissen.
„In einer langen Prozedur.“ Hanf wurde in Sektschi immer, oder meist, unterhalb des Jergesch, auf dem Hotter Hanffeld (Kender-föld) angebaut. Der Boden war da für Hanfanbau offensichtlich besonders geeignet.
Der Hanfsamen (das waren Körnchen von wenigen mm Durchmesser), wurde Anfang Mai auf nicht zu trockenen Äckern dicht ausgesät und der Hanf wuchs in dünnen Pflanzen hoch und war nach vier Monaten reif. Die handförmig zusammengesetzten und am Rande gezackten Blätter, mit mehreren Blättchen an einem Blatt, wachsen wechselständig und gegenständig am Haupttrieb, die Blüten als Rispen oder Trauben zwischen den Blättern und Stängel heraus. Der übermannshohe, dünnstänglige Hanf wurde mit seinen Wurzeln gezogen oder mit Sicheln bodennah abgeschnitten und in armstarken Bündeln gefasst, kurzzeitig auf dem Feld gelagert, Samenkörner herausgeschüttelt und danach im Graben, der westlich vom Dorf, im Nyáros entsprang, das Dorf durch die Wiesen südlich und östlich halbkreisförmig umzog, und nördlich zum Kapos entwich, gewässert. Der Bauer legte, im Wasser stehend, Bündel für Bündel in Fließrichtung in das Bachbett, befestigte und beschwerte sie leicht, dass alle Bündel von Wasser umspült waren und nicht davon getragen wurden. Jeder Bauer hatte sein abgestecktes Bachstück. Im Bedarfsfalle wurde der Bach angestaut.
Nach etwa zwei bis drei Wochen, je nach Temperaturlage, stieg der Bauer wieder in den kalten Graben, schlug von den grauweißen, vergilbten Bündeln, durch Aufschlagen im Wasser, das Blattwerk ab und reichte die„nackten“, blattfreien Bündel der Bäuerin und den Kindern an den Bachrand, die sie zum Trocknen zu Puppen aufstellten. Das Blattwerk blieb dem Graben zur weiteren Verdauung überlassen. Die im Spätsommer von grauweißen Puppen überstickten Wiesen schienen kurzzeitig, wie von zum Tanz schwebenden weitröckigen Feen übersprenkelt.
An Altweibersonnentagen klapperten gleich auf mehreren Höfen die Hanfbrechen, wurden die grauweißen Hanfstängel in dünneren Bündeln durch die Breche geschlagen, die weißen Stängel in Abständen von wenigen Zentimetern gebrochen. Die Breche war ein Gestell aus zwei Holzfüßen mit zwei Querstandfüßen, zwischen denen zwei Bretter, oder drei bei der Doppelbreche, von einem knappen Meter Länge, im Abstand von zwei bis drei Zentimeter gespannt waren, zwischen die ein am linken Fuß mit Bolzen befestigter, nach unten zu leicht konisch verlaufender Bretthebel, oder Doppelbretthebel, mit Griff, mit der rechten Hand geschlagen wurde und so die röhrenförmigen, weißen Hanfstiele, mit der linken Hand geführt, gebrochen, durch die Breche nach unten fielen oder nach oben spratzten, je nach Brechtakt und Brechkraft. Die Hanfbündel wurden so zentimeterweise aus der Breche gezogen, oft auch ein zweites Mal, und zu dickeren Strähnen abgelegt. Die Strähnenbündel wurden danach mehrfach über eine Hechel, ein dicht bestücktes Nagelbrett, gezogen und so die Hanffaser frei von Schäben, d.h. frei von den holzigen Stängeln und seinen Resten und Splittern gemacht. Die Hanfbündel wurden zum Zopf geflochten, mehrere Zöpfe zu einem Bündel auf Holzstielen aufgewickelt und so das Werg, die Hanfbündel, zum Verspinnen gelagert.
An Winterabenden wurde das Hanfwerg von den Frauen versponnen, sehr oft in geselligen und fröhlichen Winterabendspinnstuben in größeren oder kleineren Runden. Die Hanffäden, aus dem Werg gezupft, liefen in gedrillten dünnen Fäden, die Fadenstärke von den Fingern der Spinnerin gesteuert und bestimmt, auf eine Spule im oberen Teil des fußgetretenen Spinnrades. Von den vollen, etwa 8 -10 cm breiten Holzspulen, wurde das Hanfgarn zu dicken Knäueln gewickelt. Ein Teil der Hanffaser wurde für Stricke und Seile verarbeitet, ein Teil diente als Nähgarn, der größte Teil wurde zu Leinentuch verarbeitet, verwebt.“
„Und meine Urahnen haben noch selbst gewebt?“, staunte Niklas.
„Ja, der Webstuhl stand mitten in der Stube. Bei den Handwebstühlen erfolgten alle Arbeitsgänge von Hand oder mit den Füßen. Das Garn wurde als Schussgarn auf Schussspulen und als Kettgarn auf Kreuzspulen umgespult, der Webvorgang verläuft ja über Kreuz. Ein Teil der vielzähligen Fäden (das Kettgarn) war längs in zwei Ebenen gespannt, durch die die Kreuzspulen (Schiffchen, Schussgarn) geschossen wurden und so durch abwechselndes Heben und Senken der Kettfäden und Querschüsse das gebildete Webgut sich vorwärts schob. Es war ein langwieriger, aufwendiger, Ausdauer und Geduld, natürlich auch Fertigkeiten erfordernder Handarbeitsprozess. Dichte und Stärke des Webgutes, des Leinens, wurde durch die Garnstärke und die Fadendichte bestimmt.“
Niklas, der aufmerksam zuhörte und immer mehr staunte, fragte: „Hast du das alles noch mitgemacht, und hast du gar auch noch gewebt?“ „Alle Arbeitsgänge, bis auf das Weben, habe ich noch erlebt und zum Teil mitgemacht. Das Weben habe ich nur bei der Schwester meines Großvaters gesehen und erlebt, ihren flinken Händen und den fliegenden Schiffchen, dem Auf und Ab der Fäden, Spulen und Hebeln gespannt zugesehen und dem gleichmäßigen Rattern, Klappern und Surren des Webstuhles und des Webvorganges gelauscht. Der Familienwebstuhl war beim Bau unseres neuen Hauses, 1926, ich lebte da ja noch gar nicht, Großvaters Schwester, Eva, und seinem Schwager, Johann Beck, übergeben worden. Aber die vielerlei Webprodukte, das Leinen in seiner vielfältigen Verwendung habe ich noch erlebt, damit und darin gelebt. Das Leinen und die Leinenprodukte in all ihrer Anwendungs- und Verwendungsvielfalt sind erst kurz vor dem zweiten Weltkrieg ins Hintertreffen geraten und durch die moderneren und „schickereren“, auch in Ungarn und seinen dörflichen Regionen zugänglichen Stoffe abgelöst, ja geradezu verdrängt worden.“
Niklas: „Und erzähle mal, was gab es da noch alles außer Hanfsäcken, und waren die Webstücke alle gleich und alle auch gleich so verwendbar?“