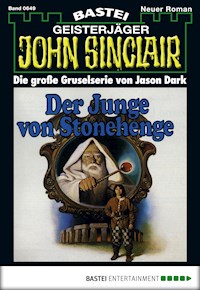4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Dieser Sammelband enthält die Folgen:
Folge 657: Angst vor dem roten Phantom
Folge 658: Was Turro mit den Mädchen machte
Folge 659: Die indische Rache
Folge 660: Die Totenstadt
Folge 661: Dämonische Kreuzfahrt I
Folge 662: Sturm auf den Todestempel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Angst vor dem roten Phantom
Was Turro mit den Mädchen machte
Die indische Rache
Die Totenstadt
Dämonische Kreuzfahrt
Sturm auf den Todestempel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Vicente Ballestar – Norma
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-8387-0290-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Angst vor dem roten Phantom
Es war dunkel und tiefe Nacht. Die beiden Männer in dem blauen Mazda dachten an Mord, denn Töten war ihr Job.
Eigentlich lag ihrer Meinung nach keine große Sache vor ihnen. Es galt, einen Zeugen zu beseitigen. Dieser Mann lebte abseits von London, stammte aus Irland, gehörte zu den Dickköpfen und gleichzeitig zu den Typen, die glaubten, daß es noch so etwas wie Gerechtigkeit gab. Der Zahn sollte ihm gezogen werden …
Gegen ein Uhr würden die beiden Killer das Ziel erreicht haben. Spätestens eine halbe Stunde danach konnten sie sich schon wieder auf die Rückfahrt machen.
Der Fahrer hieß Felix Picarotta und machte eigentlich einen gemütlichen Eindruck, was spätestens aufhörte, wenn er einen Schalldämpfer auf den Lauf des Revolvers schraubte. Dann verlor sein rundes Gesicht jeglichen Ausdruck und wurde zu einer kalten Grimasse.
Neben ihm saß Dino Romero. Er wurde auch die Schlange genannt, weil er ebenso schnell und wendig war. Dabei konnte er blitzschnell zustoßen, das tat er meistens mit einem Stilett. Er war aus den Staaten geflohen, weil ihm der FBI zu dicht auf den Fersen gewesen war. London betrachtete er als Übergangsstation. Er wollte weiter nach Rom, wo eine große »Familie« auf ihn wartete.
In zwei Tagen würde er bereits im Flieger sitzen. Daß der große Logan Costello, Mafiachef in London, ihm Schutz gewährt hatte, dafür war er dem Capo Dank schuldig. Deshalb hatte er sich auch für den Job gemeldet und Felix gebeten, ihm die Aufgabe zu überlassen.
Sie hatten den Motorway verlassen und hatten es nicht mehr weit.
Picarotta fluchte, als die Scheinwerferkegel von den grauweißen Nebelwänden verschluckt wurden.
»Ihr habt doch immer Nebel«, meinte Romero gelassen. »Ich würde mich da gar nicht aufregen.«
»Trotzdem hasse ich ihn.« Felix Picarotta senkte das Tempo. Man wußte nie, ob noch irgendwelche Hindernisse in der Brühe lauerten, die ein menschliches Auge zu spät wahrnahm.
Dann tauchten sie ein.
Unwillkürlich hatten sich die beiden Männer nach vorn gebeugt. Jeder wollte so viel sehen wie möglich, doch sie bekamen kaum etwas zu Gesicht.
Bald kam ihnen noch ein Wagen entgegen. Seine Scheinwerfer blendeten trotz des Nebels. Die Lichter zerflossen zu gleißenden Seen.
An der linken Seite war vom Bewuchs der Umgebung nichts zu sehen. Nur langgezogene, dunkle Schatten, die sie wie eine nicht endenwollende Bahn begleiteten.
»Hoffentlich zieht sich das nicht hin«, murmelte Romero, als er zu seinen Zigaretten griff. Er klaubte ein Stäbchen aus der starren Packung und erntete von Felix einen wütenden Blick.
»Mußt du jetzt qualmen?«
»Ja.« Gelassen zündete Romero das Stäbchen an. »Dafür saufe ich nicht. Und die Weiber können mir auch gestohlen bleiben.«
Picarotta lachte wie ein Teenie. »Wieso – bist du schwul?«
»Das nicht, aber du kannst dich auf die Weiber nicht verlassen. Einmal habe ich es getan. Das war in L.A.«
»Und?«
»Es ging schief. Die Kleine hat mich verraten. Sie wollte Stoff. Sie wußte, daß ich einem Dealer aus Mexiko mein Messer zu schmecken gegeben hatte. Da wollte sie mich erpressen. Ich besorgte ihr Stoff, dann verriet sie mich zum Dank an igrendeinen Sozialen, der Süchtige auf den rechten Pfad bringen wollte.« Romero lachte scharf in der Erinnerung an die Sache damals. »Dem habe ich es aber gegeben.«
»Und was war mit der Kleinen?«
»Sie lebt noch. Nur erkennt sie sich nicht mehr, wenn sie in den Spiegel schaut. Sie hat sich um den Verstand gekifft.«
»Hast du recht.«
Dino blies den Rauch gegen die Scheibe und vernebelte den Wagen auch von innen. Sie steckten noch immer in der Suppe. Ein Ende war nicht abzusehen.
»Manchmal kommt es eben knüppeldick«, sagte Felix. »Mich hat noch kein Weib verraten.«
»Warum nicht?«
»Im Gegensatz zu dir bin ich seriös.«
Romero lachte glucksend. »Sag nur, du bist verheiratet.«
»Genau, und das seit zehn Jahren. Die Familie sorgt für unseren Schutz. Als ich mal saß, brauchte niemand zu hungern. Meine Frau nicht und meine beiden Kinder nicht.«
»Magst du Kinder?«
»Sicher. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Die kleine ist mir besonders ans Herz gewachsen. Sie ist ein richtiges Goldkind und wickelt mich um den Finger. Ich bin der Meinung, daß man in unserem Job verheiratet sein sollte. So geht alles seinen normalen Weg.«
Romero schüttelte den Kopf, während er die Zigarette ausdrückte. »Das begreife ich nicht. Wie kann man nur so reden und dann einen Job ausführen wie wir.«
»Alles muß seine Ordnung haben.«
»Klar, bis auf den Nebel.« Romero rieb seine Hände, als würde er frieren. »Bin ich froh, wenn ich in Italien sitze. Dort ist es warm, da lasse ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen …«
»Und die Arbeit …?«
»Ich steige in der Familie hoch, hat man mir versprochen. Die Feuertaufe in den Staaten liegt hinter mir. Ich bin gerüstet für Bella Italia. Ein tolles Gefühl, sage ich dir.«
»Kann ich mir denken.«
»Aber du bleibst, nicht?«
»Hör mal«, beschwerte sich Picarotta. »Ich bin hier aufgewachsen. London ist meine Heimat, nicht Roma oder Napoli. Obwohl ich einmal im Jahr in Stresa bin.«
»Das ist weit im Norden.«
»Ja, am Lago Maggiore. Da stamme ich her.« Felix reckte sich. »Der Nebel wird lichter. Wir lassen ihn gleich hinter uns.« Er gab wieder etwas mehr Gas. »Ich habe über deine Rückkehr nachgedacht und glaube nicht, daß du nur in der Sonne liegen wirst.«
»Was glaubst du dann?«
»Dich wird der Job fressen, den die Familie für dich bereithält. Was ist es denn?«
»Etwas Neues.«
»Hm.« Felix Picarotta überlegte. »Ich hörte, daß du ein intelligenter Typ sein sollst. Hast sogar studiert. Irgend etwas in naturwissenschaftlicher Richtung.«
»Das stimmt. Biologie.«
»Was über Pflanzen?«
Dino lachte. »So ähnlich, wenn du sie zerlegst und dir gewisse Dinge unter einem Elektronenmikroskop ansiehst. Es gibt da ganz neue Möglichkeiten, verstehst du?«
»Sicher. Ich verstehe, aber ich begreife nicht. Das ist der große Unterschied.« Felix starrte nach vorn. Der Nebel war zwar dünner geworden, leider begleitete er sie weiterhin. »Darf ein Mann mit normaler Bildung oder Nichtbildung dich etwas fragen, Dino?«
»Immer.«
Felix setzte zweimal an. »Hast du etwas mit den oft zitierten Genen zu tun?«
Romero antwortete zunächst nichts. Er pfiff leise.
»Das reicht mir«, sagte Felix.
»Die Organisation muß eben neue Gebiete erschließen.«
Picarotta schlug mit der flachen Hand auf den Lenkradring. »Das ist pervers, das ist so verdammt pervers. Dafür finde ich einfach keinen Ausdruck mehr.«
Romero streckte die Beine aus und zog sie wieder an. Das tat er mehrere Male hintereinander.
»Die Antwort hat dir wohl nicht gepaßt.«
»Spielt keine Rolle. Ich wundere mich nur darüber, daß du sie ausgesprochen hast. Du bist ein Killer, Felix. Wie viele Menschen hast du schon umgelegt?«
»Nicht mehr als fünf.«
»Das sind fünf zuviel, wenn man die Moralvorstellungen als Basis nimmt. Du hast sogar Familie, sorgst für zwei Kinder, nennst die Aussichten der Zukunft pervers. Das darf sich doch einer wie du überhaupt nicht erlauben.«
»Wenn ich abdrücke, ist das zwar auch nicht gerade moralisch, aber nicht so heimtückisch wie Viren oder was man sonst noch unter diesem Gebiet versteht. Da kannst du Völker ausrotten. Ich kann mir denken, daß die Familie ihr Know-how verkaufen will.«
»Wenn ja, sind es nicht deine Sorgen, Felix. Laß dir eines gesagt sein, Freund. In der Zukunft kann man nicht nur durch eine schnelle Kugel oder einen Messerwurf vorankommen. Man muß versuchen, auch in andere Regionen vorzustoßen.«
»Gut, das Thema ist …«
Genau in dem Augenblick passierte es. Der Junge tauchte plötzlich auf wie ein Phantom. Irgendwo am linken Straßenrand erschien er und lief auf die Fahrbahn.
Aber er war kein Phantom, er war real.
Und die Kühlerschnauze des Mazda erwischte ihn!
***
Es war furchtbar, und der Anblick fraß sich tief in die Erinnerung des Killers und Familienvaters. Nach dem harten Aufprall war der schmale Körper durch die Luft gewirbelt worden.
Dino Romero stieß einen Fluch aus, der Fahrer aber war nur entsetzt und merkte kaum, daß er bremste. Er hatte nur Augen für den Körper, der in ungewöhnlich grotesken Bewegungen durch die Luft wirbelte, als hätte er sich in eine Puppe verwandelt, dann steinhart zu Boden schlug, aufprallte, auf dem feuchten Untergrund noch quer über die Fahrbahn rutschte und an der rechten Seite liegenblieb, dicht am Straßengraben, als wollte er dort noch mit einer verzweifelten Bewegung hineinkriechen.
Der Mazda stand!
Bei ihm war nur die Stoßstange leicht verbogen, ansonsten hatte sich nichts getan.
Dino Romero fluchte. Er tat es leise, aber voller Wut. Sie standen in der Finsternis, als hätte jemand einen Sack mit schwarzer Watte über ihre Köpfe gestülpt.
Felix Picarotta bewegte sich nicht. Er hatte die Hände vor sein Gesicht geschlagen, aber eine Lücke zwischen den kleinen Fingern gelassen, durch die seine Worte drangen.
»Ein Kind!« flüsterte er, »verdammt noch mal, ich habe ein Kind überfahren …« Er schluchzte auf und schüttelte den Kopf, ohne die Hände vom Gesicht wegzunehmen.
»Sei ruhig, Memme!«
»Nein, Dino, das kannst du nicht verstehen. Wir haben ein Kind überfahren. Ich saß am Steuer, ich bin der Schuldige! Ebensogut hätte es meine Tochter sein können.«
»War es aber nicht.« Romero schüttelte den Partner. »Komm wieder zu dir. Wir haben einen Job zu erledigen.«
Felix ließ die Hände langsam sinken. Dino sah, daß er tatsächlich geweint hatte. Seine Augen waren rot und angeschwollen. Er schien mit seinen Nerven am Ende zu sein.
Romero schaltete sein Gehirn ein. Es war wichtig, daß er gewisse Dinge übernahm. »Also gut«, sagte er, »wenn es dich beruhigt, werde ich aussteigen und nachsehen. Vielleicht haben wir ja Glück, daß der Junge noch lebt.«
»Nein, Dino, nein. Ich habe gesehen, wie er durch die Luft wirbelte. So sieht kein Mensch mehr aus, der lebt. Das kann ich dir versprechen. Ich kenne mich aus.«
Dino Romero gab keine Antwort mehr. Es hatte keinen Sinn, mit Felix reden zu wollen. Er mußte die Dinge jetzt in die Hand nehmen, öffnete den Wagenschlag und stieg aus.
Picarotta schaute gar nicht erst hin. Er hätte sich am liebsten in ein sehr großes Loch verkrochen. Sein Blick glitt über die Fahrbahn. Wie leergefegt lag sie vor ihm. Kein Fahrzeug fuhr ihnen entgegen, und das war gut so.
Seine Gedanken arbeiteten wieder normaler. Er fragte sich, woher der Junge wohl so plötzlich gekommen war. Wie aus dem Nichts war er erschienen, urplötzlich.
Es gab kein Haus, keinen Ort in sichtbarer Nähe. Er war plötzlich da und vorbei.
Durch die Nase holte er Luft und schüttelte den Kopf. Zu seinem Kumpan schaute er nicht hin, der hatte mittlerweile die schmale Gestalt des Jungen erreicht und sich über sie gebeugt. Da der Junge auf dem Bauch lag, konnte er nicht feststellen, ob er noch lebte. Er drehte ihn vorsichtig auf den Rücken.
Licht brauchte er keines. Der Blick in das Gesicht mit dem entsprechenden Ausdruck in den Augen sagte ihm genug. Der Junge lebte nicht mehr. Es hatte ihn tödlich erwischt.
Vom Aussehen her konnte er auch ein Italiener sein. Das dunkle Haar, der ebenfalls etwas dunklere Teint, die ebenfalls dunklen Pupillen, das paßte auf einen Südländer.
Eine Verletzung war nicht zu sehen, auch kein Blut. Der Junge mußte an inneren Verletzungen zu Tode gekommen sein.
»Mist, verdammt!« Er schickte noch einen leisen Fluch hinterher. »Das ist großer Mist gewesen.« Wütend schüttelte er den Kopf. Erst jetzt rann ihm ein Schauer über den Rücken. Seine Hand kroch zur Waffe, weil er sich plötzlich beobachtet fühlte. Irgend etwas stimmte nicht mehr. Er konnte zwar nichts erkennen, es war auch nach wie vor ruhig in der unmittelbaren Umgebung, aber er wurde trotzdem den Eindruck nicht los, daß jemand auf der Lauer lag.
Auch konnte der Junge nicht vom Himmel gefallen sein. Da war etwas, mit dem er nicht zurechtkam.
Mit schlurfenden und müde wirkenden Schritten ging er zurück zum Wagen, blieb an der offenen Tür stehen und schaute gebückt hinein. Felix hatte den Kopf gedreht.
Dino nickte nur.
»Er ist also tot?« Picarotta wollte es genau wissen.
»Ja.«
Felix sagte nichts. Er saß da, schluckte, ballte die Hände zu Fäusten und atmete hektisch.
»Hast du einen Vorschlag, Felix?«
»Nein, den habe ich nicht.«
»Gut, dann werden wir fahren. Wir können nichts mehr tun. Tut mir ja auch leid die Sache …«
»Hör auf, Dino. Hör endlich auf!«
Romero stieg ein. Dabei bewegte er sich wie ein Greis, holte tief Luft, kam aber nicht dazu, etwas zu sagen, denn zu beiden Seiten der Straße sahen die beiden Männer die Bewegungen. Aus den Büschen schälten sich plötzlich die Gestalten hervor.
Sie kamen, und sie brachten die Furcht mit. Es waren Männer und Frauen, ungewöhnlich gekleidet. Sie hatten maskenhafte Gesichter.
Sie kamen wie Zombies. Ihre Bewegungen wirkten wie eingefroren, und sie bauten sich vor dem Fahrzeug in einer Reihe auf. Manche von ihnen schlugen die Schöße ihrer Jacken zurück, damit die Waffen sichtbar wurden, die sie trugen.
»Verdammt, was sind das …?« flüsterte Dino.
»Keine Ahnung.«
Romero zog seine Waffe. Er legte sie für die Fremden nicht sichtbar auf seinen Schoß. »Wenn die Ärger machen wollen, fahr an. Fahr sie einfach über den Haufen!«
Picarotta tat nichts. Er saß da und schluckte. »Sie gehören zu dem Jungen, sage ich dir. Es sind Leute aus seiner Familie, das spüre ich.«
»Na und?«
»Zigeuner«, flüsterte Felix. »Jetzt habe ich es. Das sind Zigeuner. Sinti oder Roma …«
»Ach ja?«
»Ich weiß es. Wir haben einen Zigeuner-Jungen überfahren. Weißt du, was das bedeutet, Dino?«
»Nein, es ist mir auch egal. Ich will hier weg. Wir müssen noch jemanden erledigen.«
»Die lassen uns nicht weg.«
»Dann fahre ich, verdammt!«
Felix schüttelte den Kopf. Jetzt bewegte er die Lippen, ohne etwas zu sagen. Im weichen Dunst der Schwaden hatten sich die Menschen vor dem Wagen aufgebaut. Sie wirkten wie tiefgefrorene Gespenster, die jeden Augenblick zu einem schrecklichen Dasein erwachen konnten.
»Soll ich uns den Weg freischießen?« zischte Romero wütend.
»Das wird uns nichts helfen.«
»Du Idiot, du …« Er sprach nicht weiter, weil sich ein Mann aus der Mitte der Reihe bewegt hatte und mit langsamen Schritten auf den Wagen zukam.
Er blieb dicht vor dem Mazda stehen und schlug mit der flachen Hand auf die Motorhaube. Beide Männer zuckten zusammen, taten allerdings nichts.
Weil die Fenster offenstanden, waren die Worte des Mannes gut zu hören. Sie erinnerten an einen alten Richterspruch, an Worte der Strafe und Vergeltung.
»Ihr habt getötet, ihr habt ein Kind überfahren. Ihr habt keine Rücksicht auf Leben genommen. Diejenigen, die auf das Leben keine Rücksicht nehmen, wird das Leben auch bestrafen. Wir werden es euch nehmen. Wir werden euch das Leben nehmen und euch in die finsteren Gefilde des Todes schicken. Es wird ein Rutsch in die Hölle werden, in die tiefe Hölle, wo Elend und Grauen über euch kommen werden, um euch zu vernichten. Ihr entgeht der Rache des Phantoms nicht.«
Dino Romero schaffte ein kratziges Lachen. »Wovon hat der Alte geredet? Von einem Phantom?«
Picarotta gab keine Antwort. Er schaute auf den Alten und wußte, daß dieser Mann keine Sprüche von sich gab. Er war zwar außergewöhnlich gekleidet, was dem Ernst seines Auftretens aber nichts tat. Sein Mantel stand weit offen und hing wie ein dunkelroter Umhang über seinen Schultern. Er trug ein helles Hemd, eine Weste. Die Hosenbeine verschwanden in Stiefelmanschetten.
Sein Gesicht wirkte wie eine Landschaft, die das Leben gezeichnet hatte. Die Augen strahlten ein Versprechen aus. Sie sagten ebensoviel wie seine Worte.
»Der hat recht!« keuchte Felix. »Der hat so verflucht recht. Wir werden nicht entkommen.«
»Wenn du noch einmal ein derartig dummes Zeug erzählst, schieße ich durch die Scheibe in den Schädel des Alten!«
»Tu es nicht – bitte!«
»Dann fahr endlich weiter! Ich will hier nicht festbacken, hast du gehört?«
»Ja, schon gut!«
»Das rote Phantom wird euch erwischen, ihr Mörder. Ihr könnt euch nirgendwo auf der Welt vor ihm verstecken, das schwöre ich euch. Es gibt keine Chance.«
»Fahr an!« Dino wurde ebenfalls nervös. Er wollte es nicht zugeben, aber die Worte des Alten waren ihm tief unter die Haut gegangen. Das war wie ein Horror.
Endlich drehte Felix den Zündschlüssel. Der noch warme Motor kam sofort.
»Und sofort das Gas!«
Das tat Felix nicht. Er fuhr langsam an. Er wollte nicht noch einen Toten oder Verletzten. Der Junge hatte ihm gereicht, und er wußte auch, daß ihm diese Szene sein Leben lang nachlaufen würde. Sie war nicht mehr aus seinem Gedächtnis zu löschen.
Gingen sie zur Seite?
Ja, sie gingen, denn Dino hielt seinen Revolver so, daß alle die Waffe sehen konnten.
Und sie wichen zurück.
Innerhalb der dünnen Dunstschwaden sahen ihre Bewegungen aus, als würden die Gestalten über dem Boden schweben. Alles wirkte so leicht und fließend. Wenn überhaupt Laute zu hören waren, dann verschluckte der Dunst sie.
Die Gestalten glitten vorbei und verschwanden hinter ihnen in den dünnen Schleiern. Dort sahen sie noch aus, als würden sie sich allmählich auflösen.
Dino Romero lachte und steckte die Waffe weg. »Zigeuner!« keuchte er, »ausgerechnet. Die haben mir mit ihren verdammten Sprüchen noch gefehlt, ausgerechnet die!«
»Es sind keine Sprüche.«
»Das weißt du aber verdammt gut.«
»Ja.«
»Und woher?«
»In meiner Nähe haben mal Zigeuner gewohnt. Sie kamen aus Jugoslawien. Wir haben uns mit ihnen ganz gut verstanden. Ich habe einiges gelernt, und ich weiß auch, daß sie gewisse Mythen mitgebracht haben, die nicht aus dem europäischen Raum stammen.«
»Ach ja? Woher denn?«
»Aus Asien. Indien, um genau zu sein. Die Heimat der Zigeuner ist Indien.«
Romero hob die Schultern. »Es ist mir egal, woher sie kommen. Nur wundert es mich, daß du so ein Theater um diese Typen machst. Ich sehe das lockerer, obwohl ich zugeben muß, daß es mir nicht gefallen würde, wenn sie sich an die Bullen wenden.« Von der Seite her sah Romero, wie sein Partner die Stirn krauste. »Hast du was?«
»Sie werden sich nicht an die Bullen wenden!«
»Okay, an wen dann?«
»Du hast gehört, wie sie von dem roten Phantom sprechen.«
Dino Romero riß den Mund auf, weil er schrill und kichernd lachen mußte. »Glaubst du etwa daran?«
»Sehr sogar.«
Romero überlegte. »Dann rechnest du damit, daß dieses komische rote Phantom den Tod des Jungen rächen will. Oder sehe ich das falsch?«
»Nein.«
»Interessant. Und was kann das Phantom sein? Ein Geist? Ein killender Geist?«
»In diese Richtung geht es.«
»Mann!« keuchte Romero. »Was habe ich mir mit dir nur angetan? Bist du eigentlich verrückt?«
»Ich wollte, ich wäre es.«
»Na ja!« Romero lachte. »Gesetzt den Fall, es stimmt. Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Ich bin bald verschwunden. Ich reise nach Rom, das solltest du nicht vergessen.«
Felix Picarotta wiegte den Kopf. »Ich will dir keine Angst einflößen, Dino, aber rechne nicht damit, daß du so schnell fliehen kannst. Die holen dich überall ein.«
»Rom ist weit.«
»Es braucht nicht Rom zu sein.«
»Also hier?«
»Natürlich.«
Felix hatte die Antwort mit einem derartigen Ernst in der Stimme gegeben, daß Dino nachdenklich wurde. Er sagte nichts mehr, schaute nach vorn auf die Straße, wo sich die Schleier fast aufgelöst hatten. Sie krochen nur mehr wie dünne Spinnenfinger über den Asphalt und verschwanden zu beiden Seiten in den Gräben.
Irgendwo fühlte er sich nicht mehr wohl. Seine Überheblichkeit war verschwunden. »Kennst du dich so gut aus, Felix?«
»Sicher. Ich erzählte dir doch, daß wir vor Jahren Kontakt zu einer Zigeunerfamilie hatten.
Dino Romero klopfte dorthin, wo sich seine Waffe befand. »Die Kanone müssen sie erst einmal überwinden, verstehst du? So leicht bin ich nicht ins Jenseits zu schicken.«
»Von einem Killer nicht.«
»Aber von einem Phantom, wie?« fragte Dino lachend.
»So ist es«, erwiderte Felix Picarotta mit ernster Stimme. »Ich hoffe nur, daß ich meine Familie noch einmal wiedersehe. Gnade können wir von denen nicht erwarten.«
Romero erwiderte nichts, mußte aber zugeben, daß ihm äußerst unwohl geworden war. Er wünschte sich, schon jetzt im Clipper nach Rom zu sitzen. Statt dessen hatte er noch einen tödlichen Job zu erledigen …
***
Es war ein Bild wie geschaffen für den Fotografen!
Die Frau stand einfach nur da. Den leichten, langen Wollmantel ebenso offen wie das schwarze Lackhaar, das zu Locken gedreht war und doch bis zu den Schultern reichte. Sie trug unter dem grauen Mantel eine schlichte weiße Bluse, sehr weit offen, mindestens zwei Knöpfe zuviel, und sie war einfach nicht zu übersehen.
Ich sah sie da stehen.
Keinen Schritt ging ich mehr weiter, denn ich dachte nach, um wen es sich handeln konnte. Ein leichtes Mädchen sicherlich nicht, auch kein Callgirl der Extraklasse, das sagte mir mein Gefühl. Die Frau war etwas Besonderes.
Ich war an diesem Abend noch kurz vor die Tür gegangen, weil ich mir ein Bier gönnen wollte. Zu Hause fiel mir die Decke auf den Kopf, da war der Pub ein richtiger Ort. Die Sache in Lissabon hatten Suko und ich gemeinsam geschafft, und so fremd und schön die Stadt auch gewesen sein mochte, der Pub lockte mich doch, auch wenn es dort nicht so feurig herging wie in den Lokalen der Lissaboner Altstadt.
Sie war einfach nicht zu übersehen, obwohl die Hälfte ihres Körpers im Schatten lag.
Außerdem hatte ich den Eindruck, als hätte sie auf mich gewartet, und von ihr strahlte ein Zauber ab, den ich als fremdländisch einstufte. Ich hatte eigentlich vorgehabt, nach rechts zu gehen. Jetzt ließ mich ihre Anwesenheit zögern.
Das merkte sie auch und fragte mit leiser Stimme: »Sind Sie Mr. John Sinclair?«
Ich lächelte schmal. »Möglich. Kommt ganz darauf an.«
Sie nickte und bewegte ihren Körper nicht. »Ich möchte mit einem gewissen John Sinclair reden.«
»All right, dann sind Sie richtig.«
»Danke.« Sie kam näher.
»Wollen wir hier reden oder in meiner Wohnung …?«
»Sie waren auf dem Weg, nicht?«
»Ja, ich wollte ein oder zwei Bierchen trinken. Mal richtig ausspannen.«
»Das tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe.«
»Überhaupt nicht. Ich habe einen Vorschlag. Kommen Sie doch einfach mit, Madam.«
»Das wäre wohl am besten.« Sie war jetzt so nahe herangekommen, daß ich sie genau erkennen konnte. Mich interessierte besonders ihr Gesicht. Wie sollte ich die Züge beschreiben? Es besaß einen aparten Ausdruck, war schmal geschnitten und ließ dennoch den Zug einer gewissen Exotik hindurchschimmern.
Es lag möglicherweise an den dunklen Augen, den hochstehenden Wangenknochen und dem dunklen Teint. Ich konnte mir vorstellen, daß sie aus den südlichen Gefilden Europas stammte.
»Meinen Namen kennen Sie. Darf ich dann um den Ihren bitten?«
»Ivana.«
»Hört sich gut an.« Ich räusperte mich. »Und wie weiter?«
Sie schaute auf die Spitzen ihrer Stiefeletten. »Ivana reicht, John. Okay?«
»Wie Sie wollen.«
Sie warf mit einer Bewegung das Haar zurück. »In welche Richtung müssen wir gehen?«
»Kommen Sie!«
Nebeneinander schritten wir her. Ivana hatte die Hände in den Taschen des Mantels vergraben. Das Kleidungsstück war weit und glockenförmig geschnitten. Bei jedem Schritt schwang der untere Teil von einer Stelle zur anderen.
»Sie denken über mich nach?« fragte sie nach einer Weile.
»Ist das ein Wunder? Wenn man von einer sehr attraktiven Frau angesprochen wird, muß man einfach nachdenken. Über den Grund des Ansprechens, über sie persönlich …«
»Halt, John, halt. Der Grund ist nicht der, den sich viele Männer vielleicht eingebildet hätten.«
»Das kann ich mir denken. Sie sind nicht eine solche Person, Ivana.«
»Danke.«
»Wer sind Sie dann?«
Bevor sie antwortete, lauschten wir beide dem Klang unserer Schritte nach. »Haben Sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht? Als Polizist sind Sie das gewohnt.«
»Stimmt, ich habe nachgedacht.«
»Was ist dabei herausgekommen?«
»Ich weiß es nicht – sorry.«
Zum erstenmal hörte ich sie lachen. »Ehrlich gesagt, das ist kein Kompliment für mich.«
»Kann sein.«
»Also, wie schätzen Sie mich ein?«
»Ich werde Ihnen später Rede und Antwort stehen, denn ich nehme an, daß Sie etwas auf dem Herzen haben, was Sie mir mitteilen wollen. Jedenfalls rechne ich stark damit.«
Sie nickte beim Gehen. »Da haben Sie nicht unrecht. Dieser Besuch ist nicht rein privat.« Sie schaute gegen den Himmel. Über London war er ein dunkles Tuch, durch dessen Löcher Sterne blinkten.
Ein wunderschöner Altweibersommertag lag hinter uns. Wir hatten September, die Sonne stand schon tiefer. Es wurde früher dunkler, in den Nächten kühlte es sich stark ab, auch wenn tagsüber die Sonne geschienen hatte.
Jedenfalls war die große Hitze vorbei.
Ivana hob den Arm und deutete schräg nach vorn, wo die Reklame des Pubs leuchtete. »Ist das unser Ziel?«
»Ja.«
»Sieht nett aus.«
Ich hob die Schultern. »Wenn man will, kann man dort seine Ruhe haben. Wir werden uns eine Ecke aussuchen, wo wir miteinander reden können, ohne Zuhörer zu haben.«
»Das wäre gut.«
Zwei junge Männer verließen den Pub, sahen Ivana und fingen an zu pfeifen. Mehr taten sie nicht. Dafür gingen sie Arm in Arm weiter, stützten sich gegenseitig.
Natürlich hatte ich mir meine Gedanken gemacht. Ich war gespannt, was Ivana von mir wollte. Bisher hatte sie mit keinem Wort das Thema angedeutet.
Ich hielt ihr die grünlackierte Tür auf, und wir betraten die Welt aus Rauch, Bier und Whisky.
Kein reines Männerreich mehr wie früher, aber eine Frau wie Ivana fiel auch jetzt noch auf. Zahlreiche Köpfe drehten sich nach uns um und musterten uns.
Ich grüßte in die Runde und deutete nach rechts, wo sich eine Nische befand, in der ein schmaler Tisch und zwei Stühle standen. Über dem Tisch leuchtete eine Messinglampe.
»Gefällt es Ihnen hier?«
Sie nickte nur und ließ sich von mir aus dem Mantel helfen. Zur weißen Bluse trug sie einen schlichten schwarzen Rock. Ihr Alter schätzte ich auf ungefähr dreißig Jahre.
Ivana traf keine Anstalten, die oberen Knöpfe der Bluse zu schließen. Sie setzte sich hin und bat um eine Zigarette, die sie auch bekam. Gleichzeitig erkundigte ich mich, was ich zu trinken bestellen sollte.
»Sie nehmen Bier?«
»Ja.«
»Das probiere ich auch.«
Der Wirt erschien und nickte uns grüßend zu.
»Zwei Bitter.«
»Groß oder klein?«
»Ich nehme ein kleines«, sagte Ivana.
»Bringen Sie mir das große.«
»Wird erledigt.«
Ich setzte mich, beugte den Oberkörper etwas vor und lächelte Ivana über den Tisch hinweg an. »So, jetzt sitzen wir hier und können reden. Weshalb wollten Sie mich sprechen?«
Sie schaute mich aus ihren unergründlichen Augen an. »Wie schätzen Sie mich ein?«
»Ich weiß nicht so recht. Kann es sein, daß Sie aus Südeuropa stammen?«
»Stimmt. Aus Jugoslawien.«
»Das dachte ich mir. Und weiter?«
»Ich gehöre einem Volk an, das in allen Ländern unseres tollen Europas nicht gelitten ist.« Sie sagte es mit Bitterkeit in der Stimme. »Wir werden überall davongejagt!«
»Sinti?« fragte ich. »Oder Roma?«
Ivana nickte. »Sie können auch gleich Zigeuner zu uns sagen, John.«
»Warum?« Ich lehnte mich zurück und schaute sie durch eine Qualmwolke hinweg an. Dahinter wirkte ihr Gesicht seltsam weich und verschwommen. »Wissen Sie, Ivana, ich stehe Ihrem Volk neutral gegenüber. Ich behandle einen Sinti oder Roma ebenso normal wie einen Briten. Kein Volk ist besser oder schlechter. Es gibt bei beiden solche und solche. Sie werden mir sicherlich zustimmen, daß es auch bei Ihrem Volk so ist. Soweit meine Ansicht über Ihr Volk.«
Der Wirt brachte unser Bier. Dadurch bekam Ivana Zeit, über eine Antwort nachzudenken. Sie nahm einen Schluck, und auch ich trank. »Wenn es tatsächlich Ihre Meinung ist, John, dann finde ich das okay.«
»Ja.«
Sie schaute in ihr Bier. Das Licht fiel gegen die weiße Bluse und machte den Stoff durchscheinend. »Es wird Ärger geben«, erklärte sie.
»Für wen?«
»Für Sie möglicherweise, John. Aber Sie können diesem Ärger entgehen, wie ich meine. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Ich möchte mit Ihnen vorher über gewisse Dinge reden.«
»Bisher haben Sie sich nicht gerade offenbart. Ich blicke auch jetzt nicht durch.«
»Das wird sich ändern.«
»Darauf warte ich.«
»Ich kann nicht voraussetzen, John, daß Sie sich in der Geschichte unseres Volkes genau auskennen, aber ich möchte Ihnen sagen, daß wir eine lange Geschichte und tiefe Tradition besitzen. Das müssen Sie mir glauben.«
»Sicher.«
»Wir sind ein Wandervolk, und wir haben damit angefangen, über unsere Wurzeln nachzudenken. Wir fanden sie in Asien.«
»Indien.«
»Gut, John. Sie wissen etwas.«
»Das bleibt in meinem Beruf nicht aus.«
Ivana trank einen Schluck Bier. »Von unseren langen Reisen durch die Welt und die Jahrhundertwende ist immer etwas zurückgeblieben. Wir kamen mit fremden Völkern und anderen Kulturen in Berührung. Wir haben immer etwas aufgefangen, das sich in unsere Mythologie hineinmischte. So kam es zu außergewöhnlichen Wissensgebieten.«
»Sprechen Sie von Ritualen?«
Ivanas Augen nahmen den Glanz der Lampe an, als sie mich anschaute. »Nicht nur das. Ich fasse es in einem Begriff zusammen. Magie! Es ist die Magie, John.«
»Wobei Sie bei mir an der richtigen Stelle sind.«
»Das habe ich stark gehofft.«
»Und weiter …?«
Ivana nickte. »Wie ich weiß, werden Sie immer dort eingesetzt, wo andere nicht weiterwissen …«
»Moment, so kann man das nicht sehen.« Ich lachte leise. »Diese Überheblichkeit liegt mir fern. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Suko eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, das ist alles. Ich nehme mich der Fälle an, die ins Okkulte hineingleiten. Wir wissen, daß es Wesen gibt, die aus anderen Welten stammen, so müssen Sie das sehen, Ivana. Dabei gehen wir natürlich global vor und beschränken uns nicht auf Werwölfe oder Vampire.«
Sie hatte in meine letzten Worte hineingenickt. Ein seufzend klingender Atemzug drang über ihre Lippen. »Weil dem so ist, habe ich mich an Sie gewendet. Und zwar mit einer Warnung.«
»Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wovor wollen Sie mich denn warnen?«
»Vor einem Fall, der eintreten wird.«
»Moment«, sagte ich und räusperte mich. »Wir haben uns richtig verstanden. Sie sprechen von einem Fall, der erst noch eintreten und zu dem man mich rufen wird.«
»So ist es, denn es bleibt den Leuten nichts anderes übrig. Ich möchte Sie davor warnen, in diesen Fall einzusteigen. Lassen Sie einmal die Finger davon. Es ist eine Sache, die Sie zwar beruflich etwas angeht, die Sie aber dennoch hinten anstellen sollen. Kümmern Sie sich nicht darum.«
»Worum wird es denn gehen?«
»Um Rache!«
Ich hob die Schultern. »Es berührt mich schon seltsam, diese Antwort aus Ihrem Munde zu hören, Ivana. Sie wollen sich also rächen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.«
»Ja, das ist unsere Sache. Das müssen wir einfach, Mr. Sinclair. Tut mir leid.«
»Darf ich fragen, an wem Sie sich rächen wollen?«
Die dunkelhaarige Frau schaute in ihr Glas. »Ich werde Ihnen eine indirekte Antwort geben. Wir rächen uns an zwei Menschen, die Sie ebenfalls als Verbrecher bezeichnen würden. Ich sage, daß es um diese beiden nicht schade ist.«
»Tut mir leid, Ivana, diese Moral kann ich leider nicht unterschreiben.«
»Das habe ich befürchtet. Aber glauben Sie mir. Wir müssen durchziehen. Es ist einfach zu schlimm.«
Ich zündete mir ebenfalls eine Zigarette an. »Wollen Sie mir nicht sagen, um was es geht?«
»Nein. Ich kann nicht als Verräterin dastehen. Aber ich rechne damit, daß Sie in den Fall hineinsteigen, denn es hat mit den alten Ritualen zu tun.«
»Mit Magie?« hakte ich nach.
»Sicher.«
Ich kam mir vor wie auf einer Insel sitzend. Nur die Frau und ich, sonst niemand. Die Stimmen der anderen Gäste waren zu einem Murmeln geworden, das aus irgendeiner unbestimmten Ferne kam und den kleinen Pub durchschwang.
Ivanas schwingendes Lachen riß mich aus dieser Traumwelt wieder zurück in die Wirklichkeit. »Ich kann mir vorstellen, wie Sie nachdenken, John. Aber denken Sie daran, es hat keinen Sinn. Fahren Sie für einige Tage weg …«
»Wen wollen Sie töten?«
»Verbrecher, Mörder!«
»Nur in ihrem Sinne?«
»Nein, John, allgemein. Die Leute, von denen ich spreche, sind Verbrecher, denen ein Menschenleben nichts wert ist.«
»Nun sind Sie persönlich betroffen, wie ich denke.«
»Ja, unsere Sippe.«
»Man hat also einen Menschen aus Ihrer Sippe getötet, und Sie wissen alle, wer es tat.«
»Genau kombiniert.«
»Dann sollten Sie sich an die Polizei wenden, was Sie auch getan haben. Wenn Ihre Anschuldigungen stimmen, wird der Täter vor Gericht gestellt und abgeurteilt.«
»Das sagen Sie, John!«
»Weil es stimmt.«
Ivana winkte mit beiden Händen ab. »Da können Sie recht haben, wenn Sie den Mord an einem Kollegen aufklären wollen. Aber nicht an einem Zigeuner. Da gelten andere Gesetze. Das sage ich nicht nur so, das habe ich schon erlebt. Ich spreche aus Erfahrung. Wir haben uns lange genug ducken müssen, einmal ist Schluß. Ein jeder von uns ist davon überzeugt, daß mit zweierlei Maß gemessen wird …«
»Nicht bei mir.«
Sie blickte mir scharf ins Gesicht. »Ist es denn Ihre Aufgabe, normale Mörder zu jagen?«
»Nein, das überlasse ich den Kollegen.«
»Da haben wir es schon. Mit deren Hilfe kann ich nicht rechnen. Aber Sie würden mit dem Fall betreut, John, deshalb meine Warnung. Ich möchte nicht, daß wir gegen Sie sein müßten und Sie sterben.«
»Wie großzügig.«
»Lassen Sie den Spott, wenn es um Menschenleben geht. Wir finden Ihre Aufgabe gut, John. Bitte, denken Sie immer daran, daß Sie noch vieles vor sich haben. Wir haben auch etwas vor uns, und es wird der Gesellschaft nicht schaden, wenn jemand stirbt.«
»Ich kann keinen Mord dulden. Egal, ob die Tat in mein Ressort fällt oder nicht.«
Ivana nahm das Glas und drehte es. Auch das Bier geriet in kreisende Bewegungen. »Ich habe fast befürchtet, daß Sie so uneinsichtig sein werden, John.«
»Dann hätten Sie nicht zu kommen brauchen.«
»Das stimmt schon. Ich wollte Ihnen eine Chance geben. Vielleicht überlegen Sie es sich noch. Lassen Sie es bitte nicht bis zum Letzten kommen, John. Wie gesagt, es wäre schade um Sie, denn Ihre Aufgabe ist gewaltig.«
Ich war zwar nicht gerade von den Socken, aber eine derartige Warnung hatte mir noch niemand zukommen lassen.
Ich erhob mich, als Ivana aufstand und nach ihrem Mantel griff, der über der Lehne hing.
»Danke, bemühen Sie sich nicht.« Sie schlang den weit geschnittenen Mantel um sich. Noch einmal schaute sie mich warnend an, und ich hatte dabei den Eindruck, als würde in ihren Augen ein kaltes Feuer leuchten. Dann ging sie weg.
Nicht nur ich schaute ihr nach, als sie mit langen Schritten durch den Pub ging und aus dem Lokal rauschte.
Tief atmete ich durch. Der Wirt kam und räumte die leeren Gläser weg. »Das war ja ein Feger«, sagte er.
»Sicher …«
»Wollen Sie noch ein Glas?«
Ich wischte über meine Stirn. Es hatte wohl keinen Sinn, die Verfolgung aufzunehmen. »Ein kleines Bitter noch.«
»Geht in Ordnung, Mr. Sinclair.« Man kannte mich hier namentlich, denn ich hatte schon öfter meinen Schlaftrunk in diesem Pub eingenommen. An die Theke ging ich nicht, nahm wieder Platz und dachte über die ungewöhnliche Frau nach.
Völlig emotionslos hatte sie von einem Mord gesprochen, der noch begangen werden sollte und der gleichzeitig in mein Ressort fiel. Das wollte mir eigentlich nicht in den Sinn. Es erschien mir nicht logisch. Wenn ich jemand umbringen wollte, warnte ich nicht vor der Tat die Person, die sie aufklären würde.
Etwas stimmte da nicht. Oder sollte es tatsächlich Berechnung sein? Wollte Ivana und die Personen, die hinter ihr standen, nicht, daß ich gegen Sie anging, weil ich mich dann in Lebensgefahr begab?
Es war schon mehr als schwierig, auf diese Frage eine Antwort zu finden.
Als der Wirt mein nächstes Bitter brachte, hielt ich ihn am Arm fest. »Sagen Sie mal, kannten Sie die Frau?«
Er mußte lachen. »Die hätte ich zwar gern kennengelernt, aber ich sah sie leider zum erstenmal. Ein tolles Weib, wirklich. Damit kann man sich schon sehen lassen.«
»Richtig.«
»So eine fällt auf, Mr. Sinclair. Ich muß Ihnen sagen, daß ich Sie zuvor nicht gesehen habe.«
»Ich habe verstanden.«
»Kann man sagen, daß Sie diese Person ebenfalls erst seit kurzem kennen?«
»Seit heute.«
Der Wirt pfiff. »Die würde ich nicht laufenlassen, die Kleine. Die ist ein Ereignis.«
»Kann man wohl sagen. Da Sie gerade hier sind, ich möchte zahlen.« Die Rechnung hatte er im Kopf. Ich beglich sie und legte noch ein kleines Trinkgeld hinzu.
Als der Wirt gegangen war, nuckelte ich an meinem Bitter. Sosehr ich über den Fall auch nachdachte, ich kam mit ihm nicht zurecht. Fest stand, daß ein Verbrecher umgebracht werden sollte. Das engte den Kreis der Personen zwar ein, brachte aber nicht viel.
Logan Costello!
Er, der Mafioso, war der große Chef der Londoner Unterwelt. Er kommandierte, er hatte seine Finger in allen Geschäften, er zog die Fäden in die hintersten Winkel und Ecken, und auf sein Kommando gehorchten zahlreiche Killer.
Sollte Costello indirekt damit zu tun haben?
Wenn das zutraf, konnten sich einige aus der Zigeunersippe sehr warm anziehen, denn gegen die geballte Macht der Mafia anzukommen, war so gut wie unmöglich.
Es waren alles Spekulationen. Aus Spaß hatte mich Ivana sicherlich nicht getroffen. Da steckte schon eine verdammt ernste Sache dahinter.
Ich hätte sie nicht gehen lassen sollen. Es gab auch keinen Grund, sie aufzuhalten. Die Dinge waren eben sehr verzwickt.
Das Glas trank ich nicht mehr ganz leer. Ich ging vorher. Der Wirt winkte mir von der Theke her zu.
Draußen holte ich einige Male tief Luft, das tat gut nach dem Kneipenmief.
Im Licht der Pubreklame blieb ich stehen. Falls Ivana sich noch in der Nähe aufhielt, so sollte sie mich sehen. Dann konnte sie mich noch einmal ansprechen.
Das tat sie nicht mehr.
Ich sah zwar eine Frau über die Straße gehen, aber es war nicht Ivana, die Zigeunerin.
Falls es zu einer Tat kommen würde, war es schwer für mich, diese zu verhindern. Es gab nur eine Möglichkeit, die mir eine Chance bot. Ich mußte Ivana finden.
Wo konnte sie sich aufhalten? Bei ihrer Sippe. Soweit ich wußte, gab es rund um London und auch innerhalb der Stadt einige Plätze, die ihnen zugewiesen worden waren. Aber darüber wußten andere Kollegen besser Bescheid.
Leider hatte ich schon zuviel getrunken, um selbst zum Yard fahren zu können. Bevor ich Suko weckte, wollte ich es per Telefon versuchen. Unter Umständen klappte es.
Ich wohne zwar am Rande von Soho, aber nicht in einem Gebiet, wo sich Touristen tummeln. In der Nacht und auch schon am Abend war hier der Hund begraben.
Auf dem Weg zum Haus traf ich nur zweimal Menschen. Ansonsten war die gesamte Umgebung von der Dunkelheit begraben. Nur an den beiden hohen Häusern – in einem von ihnen wohnte ich – waren die meisten Fenster erleuchtet. Sie kamen mir vor wie zwei kantige Raumschiffe, bei denen Positionsleuchten schimmerten.
Um die Häuser herum lagen die Außenparkplätze inmitten einiger Grünflächen. Manchmal ein idealer Ort für Liebespaare, weil sie ein gutes Versteck boten.
Ich mußte dicht an den Buschinseln vorbei – und erlebte, wie gut man sich dort verstecken konnte, denn aus einem der Büsche huschte das personifizierte Grauen hervor …
***
Ich hatte den Eindruck, eine Zeitlupenszene zu erleben, so sehr stand ich unter Schock. Die Zweige des Gebüschs bogen sich nach rechts und links zur Seite wie Gummipflanzen, dann sprang mich das verfluchte Wesen direkt an.
Ausweichen konnte ich nicht, nach meiner Waffe zu greifen, schaffte ich auch nicht, ich riß nur mehr die Arme hoch, bevor mich der Körper unter sich begrub und mich dabei zu Boden schleuderte.
Ich prallte zwar auf den Rücken, rollte mich aber ab, so daß der Hinterkopf nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Arme umschlangen mich wie mächtige Tentakel. Der Körper, größer als ich, drückte mich hart auf den Boden.
Ich hatte die Augen weit aufgerissen, das gehörte einfach dazu. Ich tat es automatisch und wollte die verdammte Bestie aus der Nähe sehen. Sie erinnerte mich an eine Mumie, nur war diese Gestalt mit dunkelroten Binden umwickelt. Jedenfalls konnte ich das verhüllte Gesicht nicht erkennen.
Die Bestie trug einen langen Mantel mit hohem Schalkragen, und ihre Hände steckten in ebenfalls roten Handschuhen. Zielsicher fanden sie meinen Hals, während ein Knie sich grausam hart an meinen Magen preßte. Der verbundene Kopf schwebte dicht über mir. Aus den alten Lappen strömte mir ein widerlicher Geruch entgegen. Es stank nach Teer und Rauch, aber auch nach Moder.
Ich lag still, denn ich merkte, daß die Gestalt nicht zudrückte. Die Klauen ließen mir gerade genug Luft, um atmen zu können. Und ich hörte sie sprechen.
Nein, das waren keine richtigen Worte. Unter dem Verband vernahm ich ein dumpfes Gurgeln, und ich mußte mir die Worte erst zusammenreimen, um verstehen zu können, was diese Person sprach.
»Letzte Warnung. Weg von den Morden! Es ist nicht deine Sache, hörst du? Nicht deine …«
Eine Antwort konnte ich nicht geben. Mein Mund bildete ein verzerrtes Etwas. Ich dachte zudem nicht im Traum daran, aufzugeben, wollte mich drehen und ihn von mir stoßen, aber er war eisern und hielt mich fest. Auch sein Knie gab nicht nach, es nagelte mich am Boden fest.
Dann riß die Gestalt meinen Kopf hoch und schlug ihn augenblicklich wieder nach unten.
Die berühmten Sterne platzten vor meinen Augen auf. Ein stechender Schmerz raste vom Hinterkopf bis in die Stirn, der mir sogar Tränen in die Augen trieb und ich auch den Eindruck bekam, einfach wegzuschwimmen. Das aber legte sich. Ich sah wieder klarer, die Kopfschmerzen blieben, und der unheimliche Angreifer war verschwunden.
Einfach weg …
Ich richtete mich auf, hielt mir den Kopf. Noch drehte sich die Welt in meiner unmittelbaren Nähe. Die Büsche vor mir fingen an zu tanzen. Sie inszenierten einen gespenstischen Reigen für mich, der sich auch weiterbewegte, als ich mich auf die Füße gequält hatte. Ich blieb stehen, bog den Rücken durch, holte tief Luft, wischte mir anschließend das Tränenwasser aus den Augen und nahm die Verfolgung auf. Zumindest sollte es so etwas sein.
Es war unmöglich, noch Spuren dieser unheimlichen Gestalt zu finden. Sie war wie ein rotes Phantom gekommen und ebenso wieder verschwunden.
Eine letzte Warnung hatte es mir mit auf den Weg gegeben. Daran erinnerte ich mich sehr deutlich.
Im Licht meiner kleinen Lampe suchte ich dort nach Spuren, wo der Unheimliche aus dem Gebüsch gebrochen war. Zu finden war nichts. Statt dessen störte ich ein Liebespaar. Der junge Mann beschwerte sich. Halbangezogen riß er die Tür auf und wurde erst ruhig, als ich direkt in sein Gesicht strahlte. Hinter ihm zeichnete sich das erschreckte Gesicht seiner Begleiterin ab.
Er rammte die Tür wieder zu. Beide fuhren weg. Bestimmt hielten sie mich für einen betrunkenen Spanner.
In Form war ich noch immer nicht. Ich konnte auch nicht hier Stunden herumstehen und mich erholen. Ziemlich wacklig ging ich auf das Hochhaus zu und lief durch die helle Lichtflut des Eingangs. So wie an diesem späten Abend betrat ich das Haus auch selten, und der Nachtportier bekam mehr als große Augen, als er mich sah. Meine Kleidung war leicht angeschmutzt, im Gesicht hatte ich Schrammen.
»Mr. Sinclair, was ist denn mit Ihnen los?«
»Ich habe den Boden geküßt.«
Er schnüffelte. »Sie … Sie sind doch nicht so betrunken, daß Sie hinfielen – oder?«
»Nein, ich habe nur zwei Bierchen getrunken, mehr auch nicht. Es gab da jemand, der etwas gegen mich hatte.«
»Ein Überfall?«
»Ja.«
»Wo denn?«
»Die Außenparkplätze liegen einsam genug.« Ich grinste und rieb meinen Hinterkopf. »Da kann schon mal etwas passieren, wie ich meine. Finden Sie nicht auch?«
»Nun ja, ich …«
»Sie haben keinen Fremden gesehen?«
Der Nacht-Hausmeister hob die Schultern. »Nicht daß ich wüßte, Mr. Sinclair. Wie hat er denn ausgesehen?«
»Er trug dunkelrote Kleidung.«
Der Mann vor mir schrak zusammen. »Wie bitte? Dunkelrote Kleidung hat er angehabt?«
»Ja, einen ziemlich dunklen Mantel, der noch einen altertümlichen Schalkragen besaß.«
»Nein, Sir, nein. So einer ist mir nicht über den Weg gelaufen, das kann ich beschwören.«
»War auch nur eine Frage, Meister.« Ich winkte ihm beim Weggehen zu. »Trotzdem, eine schöne Nacht noch.«
»Die werde ich jetzt wohl kaum haben. Mit der Ruhe ist es vorbei. Ich könnte mal nachschauen.«
Vom Fahrstuhl her rief ich: »Lassen Sie das. Es lohnt sich nicht, wirklich nicht.«
Im Lift lehnte ich mich gegen die Wand und betastete meinen Hinterkopf. Wenn mich nicht alles täuschte, wuchs unter dem Haar eine kleine Beule. Dabei hatte ich Glück gehabt. Diese verdammte Gestalt hätte mich auch umbringen können. Anscheinend mochten mich gewisse Leute trotz dieses Überfalls gut leiden.
Minuten später befand sich Suko bei mir, der mir die Beule verpflastern wollte.
»Nein, hör auf.«
»Dann eben nicht. Und wem hast du sie zu verdanken?«
»Einem roten Phantom.«
Suko starrte mich an und rieb mit beiden Handflächen über den Stoff seiner Trainingshose. »Du hast doch wirklich nicht zuviel geschluckt? Du kommst aus der Kneipe, dann erscheint ein Phantom?«
»Richtig. Zuvor hat mich eine schöne, unbekannte Frau noch davor gewarnt.«
»Auch das noch. Jetzt kannst du Hollywood Bescheid sagen. Die drehen sicherlich einen Film über dich.«
»Die Realität übertrifft den Film oft noch.« Ich fing an, Suko alles zu erzählen. Dabei trank ich einen Schluck Mineralwasser und sah Suko, wie er den Kopf schüttelte.
»Ehrlich gesagt, John, hätte mir das ein anderer erzählt, hätte ich ihn für irre gehalten.«
»Es stimmt aber.«
»Und es steckt etwas dahinter.«
»Richtig.« Ich griff bereits zum Telefon.
»Wen willst du anrufen?«
»Keine Ahnung. Erst einmal beim Yard. Es muß doch jemand geben, der über das Fahrende Volk informiert ist. Unsere Spitzel haben ihre Augen schließlich überall.«
»Das könnte eine Chance sein.« Er murmelte noch etwas von Nichtverstehen, nur hörte ich nicht hin, weil ich bereits mit dem Kollegen in der Zentrale sprach.
»Sie haben Wünsche, Mr. Sinclair.«
»Weiß ich. Wer kennt sich denn aus?«
»Ich gebe Ihnen mal den Kollegen Farad.«
»Kenne ich nicht.«
»Sie müssen ihn zu Hause anrufen. Er ist ein halber Roma oder Sinti. Wenigstens sein Vater war es. Wenn es Probleme mit den Leuten gibt, wird er eingesetzt.«
»Danke.« Ich notierte mir die Nummer und hielt den Zettel triumphierend hoch. »Jetzt kommen wir weiter, Suko.«
»Bist du sicher?«
»Bestimmt.«
Ich rief bei Farad an und hatte Pech, denn er war nicht da. Dafür hörte ich im Hintergrund laute Musik. Da feierte man eine Party.
»Wann kommt er wieder?«
»Weiß ich nicht«, sagte die Frauenstimme. »Er ist mit einem Kollegen dienstlich unterwegs.«
»Sie sind aber seine Frau.«
»Schon.«
»Sagen Sie ihm, daß er mich die Nacht über anrufen kann. Oder Morgen im Büro.«
»Gut, Mr. Sinclair.«
»Tote Hose?« fragte Suko, als ich auflegte und er mein langes Gesicht sah.
»Leider.«
»Was willst du tun?«
»In dieser Nacht nichts mehr. Gleich morgen früh werden wir uns die Plätze in und um London ansehen, wo Sinti und Roma ihr Lager aufgeschlagen haben.«
»Das sind einige.«
»Weiß ich auch. Aber ich muß die Frau finden, Suko. Vielleicht habe ich sie im Pub nicht allzu ernst genommen. Jetzt weiß ich besser Bescheid.«
»Aber noch immer nicht, wer das oder die Opfer sind. Und weshalb sie umgebracht werden sollen.«
»Ein Motiv muß es geben.«
Ich breitete die Arme aus. »Können wir das denn nicht herausfinden, Suko?«
»Ist die Frage. Wo ist was passiert, was mit Zigeunern zusammenhängt? Ein Verbrechen oder so?«
»Das müßte ja gemeldet sein.«
»Eben.«
Ich warf Suko das Telefon zu. Er fing den Apparat geschickt auf. »Laß deine Finger wirbeln und die Beziehungen spielen. Vielleicht bekommst du die richtige Antwort.«
Suko »störte« die Kollegen in der Verbrechenserfassung. Dort wurde zum Glück auch in der Nacht gearbeitet. Man gab sich auch richtig Mühe, nur fanden wir keine Spur.
In den letzten Stunden gab es keine Tat, die mit den Zigeunern in Verbindung gebracht werden konnte.
»Wo liegt dann das Motiv der Rache?« fragte mich der Inspektor.
»Ich weiß es nicht, Suko, ich weiß es nicht …«
***
Auf großes Gepäck hatte Dino Romero nie viel Wert gelegt. Seine persönlichen Dinge paßten in einen Koffer. Die Waffe hatte er abgegeben und nicht einmal sein Messer behalten. Er wollte auf keinen Fall bei der Kontrolle am Airport auffallen.
Die Familie hatte auch in der Londoner Zeit für eine Unterkunft gesorgt. Er wohnte bei einem absolut vertrauenswürdigen Mann, der einmal dazugehört hatte. Jetzt war er sechzig, besaß nur noch ein Bein, das linke war ihm von Gegnern weggesprengt worden, und betrieb mit seiner Frau die Herberge.
Der Mann war schon auf, als Romero die Treppe runterkam. Draußen wartete das Taxi.
»Dann wünsche ich dir eine gute Reise, Freund. Und grüße die Heimat von mir.«
»Mach ich doch glatt. Wann warst du zum letzten Mal dort?«
»Ist schon lange her. Mit einem Bein kann man nicht viel anstellen. Aber ich fahre mal wieder hin.«
»Vielleicht sehen wir uns.«
»Ja – möglich.«
Die beiden Männer umarmten sich noch, dann verließ Romero die kleine Pension.
Er war vorsichtig, als er in die Düsternis hinaustrat. Obwohl er nicht daran glaubte, hatte er die Warnung des alten Zigeuners nicht vergessen. Bisher war nichts passiert. Richtig aufatmen aber würde er erst, wenn der Clipper in Rom gelandet war.
Der Fahrer gähnte, als Dino einstieg. »Wohin?«
»Heathrow, Airport.«
»Geht klar.«
Dino Romero schaute aus dem Fenster. Der Druck in seiner Brust verflüchtigte sich allmählich. Er war heilfroh, London wieder verlassen zu können.
Den Job hatten er und Felix hinter sich gebracht. Das heißt, Romero hatte geschossen, Felix war nicht in der Lage dazu gewesen. Er glich einem nervlichen Wrack. Daß er ein Kind überfahren hatte, konnte selbst er, ein Mörder, nicht verkraften.
Romero dachte nach. Hätte er noch länger mit Felix zusammegearbeitet, hätte er etwas sagen müssen. Jemanden mit derart schwachen Nerven konnte die Organisation einfach nicht gebrauchen. Aber das war nicht sein Bier, sollten sich andere darum kümmern.
London war bereits erwacht, obwohl die Helligkeit des Tages noch nicht über der Stadt lag. Doch es gab genügend Verkehr, um erste Staus herbeizuführen.
Der Fahrer nahm den Motorway in Richtung Airport und hatte das Radio eingeschaltet. Nachrichten wechselten sich mit Musik und Kommentaren ab.
Dino hörte kaum hin. Hin und wieder drehte er sich um, weil er immer mit Verfolgern rechnete. Doch innerhalb des Lichterreigens war kein bestimmtes Scheinwerferpaar auszumachen.
Da Romero keine bestimmte Zeit angegeben hatte, hielt sich der Fahrer an die allgemeinen Verkehrsbedingungen und rollte auf der mittleren Spur dahin.
Rechts überholten die anderen Autos, deren Fahrer es eiliger hatten.
Dino Romero saß schräg im Fond. So konnte er am besten die Beine ausstrecken.
Auch wenn er aus dem Fenster schaute, mit seinen Gedanken war er längst in Italien. Herrlich, dieses Rom. Dort würde er in den nächsten Jahren arbeiten und einen Job übernehmen, der seiner Intelligenz entsprach. Den Fußtruppen der Organisation war er mittlerweile entwachsen. Er wollte in die Spitze, und dieser Weg war genau vorgezeichnet.
Wieder schob sich ein Fahrzeug heran, um das Taxi zu überholen. Während es draußen dämmerte und im Osten die erste Lichtflut über den Himmel strich, schaute Romero auf den hellen Scheinwerferteppich, den der überholende Wagen vor sich herschob.
Nichts Ungewöhnliches, das hatte es auf der Fahrt bisher schon oft genug gegeben.
Nur diesmal mit einem Unterschied. Der blasse Fleck wanderte weiter.
Dino schreckte hoch. Etwas Dunkles schob sich heran. Im gleichen Augenblick fuhren beide Wagen auf einer Höhe, und sie blieben es auch. Aus dem zweiten Fahrzeug schauten Gesichter in das erste. Hinter der leicht beschlagenen Scheibe wirkten sie wie rasch dahingestrichen.
Zwei Gesichter.
Eine Frau und ein Mann.
Beide Gesichter waren zu einem Lächeln verzogen, das konnte Romero noch erkennen. Tiefer im Hintergrund saß die Frau. Die interessierte ihn nicht, es war das Gesicht des Mannes, das er kannte.
In der Dunkelheit auf einer einsamen Straße hatte er es schon gesehen. Es war der alte Mann, der ihn gewarnt hatte. Und auch jetzt warnte er ihn, nicht mit Worten, nur durch Gesten.
Er hob die Hände an, streckte die Finger aus und ballte die Hände zu Fäusten, wobei er Drehbewegungen machte, als wollte er jemandem die Kehle zudrücken.
Dino Romero schluckte. Ohne es zu wollen, faßte er sich selbst an die Kehle. Er sah das Grinsen des anderen, dann gab der Fahrer des Wagens Gas – und rauschte vorbei.
Romero hatte nicht einmal die Automarke erkennen können, so schnell war alles passiert.
Schnaufend sank er zurück in den Sitz. In seinem Hirn jagten sich die Gedanken. Plötzlich fühlte er sich wie in einer Zelle und von Unsichtbaren belauert.
Sein Ziel Rom war auf einmal so unendlich weit entfernt. Die Begegnung hatte ihm klargemacht, daß die andere Seite nicht daran dachte, aufzugeben.
»Verdammt!« ächzte er, lockerte seine Krawatte und wischte mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. »Das kann ins Auge gehen. Das kann noch ins Auge gehen …«
»Sagten Sie etwas, Sir?«
»Nein!« blaffte Romero nach vorn. »Fahren Sie.«
»Wie Sie meinen, Sir.«
Es hatte für Romero keinen Sinn, sich an den Fahrer zu wenden. Ihm war bestimmt nichts aufgefallen. Für den Mann mußte es ein Wagen wie jeder andere gewesen sein.
Es würde noch dauern, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Romero war nicht der einzige Passagier, der eine der Frühmaschinen pünktlich erreichen wollte.
Zu den Hauptflugzeiten war es noch schlimmer. Da gab es fast nur Staus.
Dino setzte sich wieder aufrecht hin. Er wollte herausfinden, ob sich das andere Fahrzeug noch in der Nähe aufhielt. Vielleicht war es an seinem Fahrverhalten zu erkennen.
Nein, das brachte nichts. Dennoch erlebte er einen Schimmer der Hoffnung, denn aus der Ferne grüßten bereits die Lichter des gewaltigen Airports Heathrow, schon eine Stadt für sich. In der Dämmerung wuchs sie hervor wie eine lichtdurchflutete Glocke, die die Schatten der Nacht endlich vertreiben wollte.
Der Driver wollte etwas Freundliches sagen und winkte dabei nach hinten. »Wir werden ohne Schwierigkeiten durchkommen, Sir.«
»Schon gut.« Dino wollte keine Unterhaltung. Er wunderte sich über sich selbst. Er, der stets so eiskalt gewesen war, zeigte plötzlich Nerven. Diese Zigeuner mußten mehr Macht und Einfluß besitzen, als ihm überhaupt lieb sein konnte.
War es Angst, die in ihm hochkroch?
So genau wußte er es nicht. Jedenfalls ein Gefühl der Unsicherheit. Und das hatte er seit Jahren nicht mehr erlebt. Hier braute sich etwas zusammen. Fünf Jahre seines Lebens hätte er dafür gegeben, jetzt schon im Clipper zu sitzen.
Statt dessen hockte er im Taxi, das den Motorway bereits über die Abfahrt verlassen hatte und auf den gewaltigen Komplex des Flughafens direkt zurollte.
Noch zwei weitere Taxen rollten mit ihnen und erreichten schließlich den großen Bereich des Abflugs.
Dino würde mit British Airways fliegen, und genau vor dem Eingang stoppte der Fahrer.
»Wieviel habe ich zu zahlen?«
Die Summe, die er genannt bekam, war okay. Er legte noch ein Trinkgeld zu, nahm den Koffer an sich und ging rasch aus dem Licht der Leuchtstoffreklame. Im Schutze der Dunkelheit blieb er stehen, dabei den Heckleuchten des abfahrenden Wagens mit den Blicken folgend. Schließlich hatte die Finsternis sie aufgesaugt.
Tief atmete er durch. Die Hektik in dieser Umgebung nahm ihn gefangen. Sie vertrieb seine düsteren Gedanken, und er fragte sich, ob es alles tatsächlich gestimmt hatte, was ihm so untergekommen war. War er tatsächlich von einem Wagen überholt worden, in dem der alte Zigeuner gesessen hatte? Oder war dies nur Einbildung gewesen?
Er fluchte, weil er nur noch eine Zigarette in der Schachtel fand. An diesem verfluchten Morgen ging eben alles schief.
Die meisten Fahrzeuge, die anfuhren und hielten, gehörten zu den dunklen Taxen. Nur wenige Passagiere wurden von Freunden oder Bekannten hergebracht. Diejenigen, auf die es ankam, sah er nicht unter den Aussteigenden.
Er trat die Zigarette aus und betrat mit raschen Schritten die Halle. Seinen Koffer hielt er fest, als wäre er das Wertvollste überhaupt in seinem Leben.
An einem Kiosk erwarb er gleich drei Schachteln Zigaretten. Die Verkäuferin hatte noch müde Augen und war schlecht geschminkt. Dementsprechend brummig bediente sie auch.
Anders sah die Person aus, die dicht hinter Dino stand. Er sah sie, als er sich drehte.
Ein tolles Gesicht, mit großen, dunklen Augen. Schwarzes Lockenhaar, perfekt geschminkt.
Die Frau trug einen vorn offenstehenden grauen Mantel in der modernen Glockenform. Der Rock war ziemlich kurz. Der Saum ihrer Kostümjacke erreichte ihn fast.
Sie lächelte knapp, doch ihre Augen lächelten nicht mit. Sie blieben eisig und ihm auch in der Erinnerung.
»Pardon«, sagte sie und schob sich an ihm vorbei. Er roch ihr schweres Parfüm. Irgend etwas aus Frankreich, sehr sinnlich, fast schon betäubend. Er hatte den Eindruck, daß diese Frau eigentlich das falsche Parfüm nahm.
Wie betäubt ging er zur Seite und blieb an einer Säule stehen. Die Frau kaufte ebenfalls eine Schachtel Zigaretten. Dinos Blick brannte auf ihren Rücken.
Beim Bezahlen drehte sie sich um, als hätte sie diesen intensiven Blick gespürt.
Dino schaute rasch zur Seite. Er wollte nicht, daß die Person auf ihn aufmerksam wurde.
Ihm fiel auf, daß die Unbekannte ohne Gepäck reiste. Nicht einmal eine Handtasche trug sie bei sich. Sie öffnete die Packung, holte ein Stäbchen hervor und kam zu Dino.
»Haben Sie bitte Feuer?«
»J … ja«, stotterte er. »Selbstverständlich habe ich Feuer.« Er kramte in der rechten Tasche.
Über die Flamme hinweg schaute sie ihn an. Dino sah nur die Augen, die ihn in ihren Bann schlugen.
Er war plötzlich eine andere Person. Niemals zuvor hatte er sich in der Nähe einer Frau hilflos gefühlt, jetzt passierte ihm dies. Die Person vor ihm bekam eine gewisse Kontrolle über ihn. Er dachte plötzlich an das Phantom, vor dem der Alte gewarnt hatte. Von einem schrecklichen Rächer, aber damit konnte die Frau nichts zu tun haben. So sah wirklich kein Phantom aus.
Gleichzeitig kam er sich wie eine Katze vor, die von Jägern in die Enge getrieben worden war. Nur konnte das Tier die Krallen zeigen, das gelang ihm nicht.
Sie sprach ihn an. »Sie wollen wegfliegen, nicht wahr?«
Dumme Frage, dachte er. Weshalb steht man sonst auf dem Airport? »Ja, sehr früh schon.«
Die Frau rauchte gelassen. Der Qualm strömte aus Mund und Nase. »Darf man fragen, was das Ziel Ihrer Reise ist?«
»Rom.« Er wunderte sich selbst darüber, daß er dieser fremden, wenn auch attraktiven Person die Wahrheit sagte. Sonst war er nie so vertrauensselig. Hier aber konnte er nicht anders.
»Sind Sie davon überzeugt, daß Sie dort auch sicher ankommen werden? Landen, meine ich?«
Dino Romero schluckte, bevor er sprach. »Wie haben Sie das denn gemeint, Madam?«
»Man hört und liest soviel von Flugzeugunglücken.«
»Schon, aber fliegen ist immer noch ziemlich sicher.«
Sie hob die Schultern. In der Nähe stand ein Aschenbecher. Dort drückte sie die Kippe aus.
Der Bann löste sich, und Romero wollte zur Seite gehen, dagegen hatte die Frau etwas. »Bleiben Sie doch Mister. Ich möchte noch ein wenig mit Ihnen plaudern.«
»Sorry, aber …«
»Stimmt, Sie müssen einchecken.«
»Ich habe mein Ticket.«
Sie lächelte ihn an. »Dann gute Reise. Vielen Dank für das Feuer, Mister.« Ohne noch eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich auf der Stelle um und ging.
Dino Romero starrte der Person nach, als wäre diese ein Traumwesen, das aus einer anderen Welt gestiegen war. Er ärgerte sich über den kalten Schweiß auf seiner Haut. In der Kehle spürte er das Kratzen.
Ein paarmal zwinkerte er mit den Augen. War die Person ein Traum gewesen?
Als er durch die Halle schaute, war sie nicht mehr zu sehen. Sie schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Dino schüttelte den Kopf. Eine derart ungewöhnliche Begegnung hatte er noch nie erlebt. Bisher war er stets der Stärkere gewesen, hier aber hatte er gemerkt, daß es Menschen gab, die ihm über waren.
Was hatte die Frau von ihm gewollt? Romero überlegte hin und her. Er kam zu keinem Resultat. Sie war bei ihm erschienen und hatte ihn sehr genau angeschaut. Nein, ein Zufall konnte das nicht gewesen sein. Als der fremde Wagen mit dem Taxi auf einer Höhe gefahren war, hatte er in dem anderen Fahrzeug nicht nur den Mann, sondern auch die Frau gesehen. Einen nur schwachen Gesichtsumriß, die Scheiben waren ja beschlagen gewesen. Ob das die gleiche Person gewesen war? Er konnte sich nicht erinnern, daß auch die Frau im Fahrzeug dunkles Haar besessen hatte.
Romero schaute auf die Uhr. Er hatte noch Zeit, und er brauchte jetzt etwas zu trinken. Einen Kaffee, sogar einen Grappa hätte er vertragen können. Nur essen wollte er nichts. Das wäre ihm sofort wieder hochgekommen.
Es gab zwei Stände in der Halle, vor denen standen Hocker.
Bei einem war man noch dabei, ihn zu öffnen. Am zweiten dampfte bereits die Espresso-Maschine. In ihrer Nähe nahm er Platz, bestellte einen Kaffee, einen Grappa und ein Schinken-Sandwich.
Obwohl er keinen Hunger hatte, mußte er etwas essen. Er brauchte was in seinen Magen.