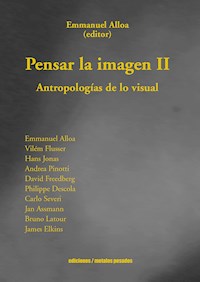9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die Texte dieses Bandes machen mit einem Aspekt Vilém Flussers vertraut, der in seinen medien- und kommunikationstheoretischen Schriften selten thematisiert wird, aber immer mitschwingt. Als jüdischer Denker wollte Flusser nie verstanden werden, dennoch ist es aufregend zu sehen, mit welcher Beharrlichkeit er immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommt.Aufgrund des autobiografischen Charakters kann dieses Buch vielleicht sein persönlichstes genannt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Ähnliche
VILEM FLUSSER
Jude sein
Essays, Briefe, Fiktionen
Herausgegeben vonStefan Bollmannund Edith Flusser
Mit einem Nachwortvon David Flusser
Edith Flusser übertrug die Texte 6, 7, 10-15, 24 und 25 aus dem Portugiesischen. Der Text »Die Brücke« wurde von Ines Karin Böhner aus dem Englischen übersetzt.Die Fußnoten stammen von den Herausgebern.
© E-book-Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2020
© Copyright 2000 Philo Verlagsgesellschaft mbH, Berlin Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: nach Entwürfen von MetaDesign
eISBN 978-3-86393-559-7
Auch als gedrucktes Buch erhältlich, ISBN 978-3-86393-055-4
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie imInternet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de
INHALT
1. TeilSTATIONEN
1Die Brücke
2Brief an Dr. Joseph Fränkl, 16. Mai 1976
3Vater
4Romy Fink
5Brief an David Flusser, 14. März 1973
6Die Enttäuschung
7Eine Frage von Modellen
8Brief an David Flusser, 4. Februar 1990
9Kann man sein eigenes Judentum überholen?
2. TeilJUDE SEIN
10Jude sein (1) – existentieller Aspekt
11Jude sein (2) – kultureller Aspekt
12Judentum als Quelle des Westens
13Jude sein (3) – religiöser Aspekt
14Judentum als Ritualisierung
15Vom jüdischen Ritus
3. TeilODI ET AMO
16Vom Fremden
17»Dostojewskij und das Judentum«
18Selbstauslöser
19Odi et amo
20Judenstaat ’91
4. TeilEINE JUDISCHE LITERATUR?
21Juden und Sprache
22Pilpul (1)
23Pilpul (2)
24Agnon oder das Engagement für den Ritus
25Warten auf Kafka
NACHWORT
von David Flusser
NACHWEISE
1. Teil
1
DIE BRÜCKE
MEIN GROSSVATER hatte eine Fabrik für Anilinfarben für Lebensmittel wie zum Beispiel Würste und Eiscreme. Tatsächlich aber war es eher ein Ort, an dem verschiedene Pulver je nach den Wünschen der Kunden gemischt wurden. Die Farben waren in Form von Zuckersternen auf einem Pappkarton ausgestellt, und meine Schwester und ich haben die Sterne gewöhnlich gegessen, wenn mein Großvater nicht hinschaute. Die Fabrik mit dem französischen Schriftzug »Fabrique des colorants inoffensifs« (etwas unglaublich Elegantes im Prag zwischen den Kriegen) befand sich hinter dem Gebäude, in dem ich geboren wurde. Es war ein dreistöckiges Art nouveau-Gebäude, von dem meine Großeltern das erste Obergeschoß bewohnten, ein deutscher Richter mit dem tschechischen Namen Lastovicka das zweite und meine Eltern das dritte, wobei mein eigenes Zimmer auf die Fabrik und den Hinterhof hinaussah. Im Erdgeschoß gab es einen Barbier, und dieser kam jeden Morgen zu meinem Großvater, um ihn zu rasieren und ihm den Schnurrbart zu adjustieren. Doch die allerwichtigste Sache war die: Da gab es eine Brücke, die die Küche meiner Großeltern mit dem Dach der Fabrik verband, und das Dach war ein Garten! Ein Dachgarten gerade wie Semiramis Hängende Gärten. Das Dach war natürlich zementiert, doch es gab dort Blumenbeete, eine Schaukel für uns Kinder und mehr oder weniger eine Sommerlaube, in der meine Großeltern während des »Sukkoth« (des jüdischen Laubhüttenfestes) lebten – natürlich taten sie das nur symbolisch, da meine Großmutter Angst hatte, sich in den Nächten zu erkälten. Vom Garten aus führte eine Art Leiter in den Hof der Fabrik, doch diese Leiter zu benutzen, war uns Kindern verboten.
Wann immer es einen Tag gab, an dem es nicht regnete, gingen wir von der Schule nicht direkt zu unserer Wohnung, sondern stattdessen zu der unserer Großeltern, geradewegs in die Küche und von dort über die Brücke in »unseren« Garten. Auf dem Weg durch die Küche stahlen wir uns gewöhnlich etwas zu essen, wenn wir uns von dem Dienstmädchen unbeobachtet glaubten. Erwischte sie uns dennoch, waren wir jedesmal wieder von dem Tropfen fasziniert, der immer von ihrer Nase hing, wenn sie uns in ihrem analphabetenhaften Prager Slang ausschimpfte. (Tschechisch durchsetzt mit vielen deutschen Wörtern und fast ohne erkennbare Grammatik.)
Von der Küche aus gingen wir in den Garten, der auf die Balkone der anderen bürgerlichen Gebäude in der Nachbarschaft blickte. Diese Balkone wurden »pavlače« genannt, und Teppiche hingen zum Reinigen von ihnen herab. Doch das interessierte uns nicht. Wir starrten von der Brücke in den Hof, wo die Arbeiter meines Großvaters (ungefähr 15 an der Zahl) gerade Fußball spielten oder ihre Würste aßen und Bier dazu tranken. Im Hof gab es einen enorm großen Bernhardiner, der natürlich auf den Namen »Barry« hörte. Manchmal kam er in den Garten, und wir ritten auf seinem Rücken. Er war sehr gut zu uns Kindern.
Eines Tages spielte einer der Arbeiter mit ihm, während wir von der Brücke zusahen. Urplötzlich drehte der Hund durch. Er fiel den Arbeiter an und biß sein rechtes Bein oberhalb des Knies ab. Ein Schwall Blut kam aus der Wunde geschossen, der Arbeiter lag am Boden, das Bein steckte noch im Maul des Hundes, und wir Kinder standen auf der Brücke und sahen dem allen zu.
2
BRIEF AN DR. JOSEPH FRÄNKL
16. Mai 1976
LIEBER HERR DOKTOR,
danke für das mit Ihnen geführte freundschaftliche Gespräch, und, eben von der Reise zurückgekehrt, gebe ich Ihnen, wie vereinbart, ein Resümee meiner Familiengeschichte, so wie sie durch Dichtung und Wahrheit auf mich gekommen ist:
Väterlicherseits stamme ich von einer seit Menschengedenken in Rakovník ansässigen Judenfamilie. In der Judengasse Rakovniks gibt es ein kleines gotisches Haus, das in unserem Familienbesitz war, in dem vor ’39 eine Großtante und ihre beiden unverheirateten Töchter eine Tabaktrafik führten (aus ersichtlichen Gründen genannt »u tři hub«*) und in dem jährliche Zusammenkünfte unserer Familie stattfanden. Die Familie Flusser war mit der anderen Judenfamilie in Rakovník durch ständig gekreuzte Inzucht verschwägert, und angeblich bedeutet »Flusser« den Herauszieher von Kieseln aus Flüssen für Glasfabrikation. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen sowohl die Glasers (jene andere Rakovniker Familie) als auch die Flussers auszusterben. Die Glasers degenerierten in Idiotie und Kleinverbrechen, und ich glaube nicht, daß jemand von ihnen den Nazismus erlebt hat. Die Flussers hingegen mündeten in einem einzigen Stammhalter, meinem Großvater Leopold, und, soviel ich weiß, sind alle übrigen Flussers auf der Welt (zum Beispiel in Budapest und New York vor ’39) ganz entfernt von unserem Zweig, und wahrscheinlich in den napoleonischen Kriegen ausgewandert. Mein Großvater Leopold war ein »Aufklärer«, schon vor 1870 marxistischer »Wahlmann«, was ihn aber nicht hinderte, als eine Art noblerer Hausierer mit Kutsche und Kutscher Heiligenbilder in der Hopfengegend zu verkaufen und zugleich das jüdische Brauchtum, wenn auch unorthodox, zu befolgen. Meine Großmutter Regina hatte einen Ausschank, wo sie »jednu za dvě« verkaufte, was, wie ich glaube, slivovice bedeutet. Diese meine Großeltern hatten zwei Söhne, meinen Onkel Karl und meinen um ein Jahr jüngeren Vater Gustav. Sie wurden 1884 und ’85 geboren, und, nach Absolvierung der Rakovniker Realschule, studierten beide, ganz typischerweise für das aufgeklärte Landjudentum, an der Wiener Universität. Mein Onkel wurde Bauingenieur, kam zur Bahn, baute Brücken, wurde etwa 1930 Streckenchef der Strecke Prag – Podmoklí, lebte in Ústí n/L, und man sprach davon, daß er Verkehrsminister werden solle. Er hatte zwei Söhne: Gustav und Otto. Im Krieg wurden er und meine Tante Berta selbstredend verschickt, aber beide überlebten. Sie starben in Israel in den 50er Jahren. Mein Cousin Gustav (jetzt David Flusser) ist Professor für Frühchristentum an der Hebräischen Universität Jerusalem und wurde durch seine Arbeiten über die Rollen des Toten Meeres und seine Jesusbiographie weit bekannt. Mein Cousin Otto lebt in Jerusalem und ist Postbeamter. Beide haben Kinder.
Mein Vater Gustav studierte Mathematik und Physik in Wien, dann in Prag (unter anderem bei Einstein) und selbstredend auch Philosophie (was ja das Fach mit sich bringt). So kam er mit T. G. Masaryk in Verbindung, und war einer jener »Pátečníci«*, welche auf die CSR einen entscheidenden Einfluß ausübten. Er dürfte um das Jahr 1908 promoviert haben und wurde Privatdozent für »politische Arithmetik« (eine Vorstufe der Mengenlehre). Da dies aber wahrscheinlich kein Geld einbrachte und da mein Großvater, der inzwischen sehr wohlhabend geworden war, aber geizig blieb, wenig beisteuerte, unterrichtete mein Vater auch Mathematik an der Deutschen Handelsakademie am Prager Fleischmarkt. Zugleich verfolgte er seine philosophischen Interessen, war von Mach und Avenarius beeinflußt und neigte zum Marxismus. Einige Bücher Masaryks, darunter »Selbstmord«, übersetzte er ins Deutsche. Als der erste Krieg ausbrach, engagierte sich mein Vater, auch unter Einfluß von Beneš und Čapek, an der Revolutionsbewegung. So kam er im Jahr 1918 als sozialdemokratischer Abgeordneter ins Parlament, wo er aber nur bis etwa 1924 blieb. Aus mir unbekannten Gründen (wahrscheinlich mit Antisemitismus verbunden) verließ er dann die aktive Politik. Er widmete sich seiner Wissenschaft (veröffentlichte einige Bücher, die mir unzugänglich sind), war Dozent sowohl an der deutschen als auch der tschechischen Universität und seit etwa 1928 Direktor der Deutschen Handelsakademie (eine Art geldeinbringende Sinecura); aber es gelang ihm, aus dieser Akademie, mittels Anschlusses eines »Abiturientenkurses« (heute würde man Postgraduation sagen), ein wissenschaftliches Institut zu schaffen. Völlig agnostisch, war er doch am Judentum aktiv interessiert, wurde Großpräsident der B’nai B’rith*, leitete verschiedene jüdische Organisationen und ließ zu, daß ich Bar Mizwa machte. Sein Antizionismus war sehr virulent (erst heute verstehe ich seine Gründe dafür), und er lehnte ein im Jahr 1938 erteiltes »Ehrenzertifikat« nach Palästina ab, das mit einem Jerusalemer Lehrstuhl verbunden war und ihm das Leben gerettet hätte. Er wurde am Tag der Besetzung Prags von der Gestapo (darunter zwei seiner Schüler aus der deutschen Universität) verhaftet, nach Folterung freigelassen, dann wieder verhaftet und am 18. Juni 1940 in Buchenwald ermordet. Er hatte ein volles Leben geführt, war geistig immer tätig gewesen, war wohlhabend (einige Häuser brachten Mieten, und seine Schwiegereltern waren reich) und ist innerhalb seiner Überzeugung, also würdig, gestorben. Sichranah lebrachah*.
Im Jahr 1919 heiratete er Melitta Basch, meine Mutter. Diese war viel jünger als er (geboren 30.11.1897 in Prag) und kam aus ganz anderen sozialen Schichten als er. Die Familie Basch sind uralte Juden, wahrscheinlich sephardischen Ursprungs, und ein Ahne war angeblich jener Cordobeser Bassevi, welcher im Jahre 1492 mit den Führern des spanischen Judentums ausgezogen war, um einen Judenstaat zu gründen. Jedenfalls wurde die Familie irgendwann im 19. Jahrhundert geadelt, und ein Baron Basch (Onkel meines Großvaters) war der Leibarzt Maximilians von Mexiko und wurde mit diesem beim Indianeraufstand Juárez hingerichtet. Ein Bruder meines Großvaters war Präsident der Wiener Börse. Mein Großvater selbst, Julius, der laut des Papiers, das Sie mir sandten, am 23.1.1865 geboren wurde, studierte in Deutschland Chemie und arbeitete als Ingenieur bei I. G. Farben. Dort gelang es ihm, ein Verfahren für die Erzeugung von Indanthrenfarben für Lebensmittel auszuarbeiten und zu patentieren. Damit gründete er, zuerst bescheiden, dann in wachsendem Ausmaß, eine Erzeugung in Prag (Julius Basch, Fabrik für Giftfreie Farbstoffe) etwa um 1890, und diese Fabrik war angeblich die einzige ihrer Art in Mitteleuropa. Jedenfalls hatte sie Niederlassungen in vielen Ländern (ich erinnere mich an Japan, Türkei, Holland und Südafrika) und war hochautomatisch (Mischapparate, ein für die erste Hälfte des Jahrhunderts seltener Umstand). Diese Fabrik baute mein Großvater in Dejvice, Bubenečská 5, und vor das Fabrikgebäude baute er ein Bürgerhaus, in dem sowohl meine Mutter als auch meine Schwester und ich geboren wurden und bis 1939 wohnten. Meine Großeltern Basch (Julius und Olga) waren typische Prager Großbürger, kultiviert und beschränkt, jüdisch »ohne Übertreibung« (das heißt: Kiddusch* und kein Schinken, aber nicht koscher) und reich, ohne es zu zeigen, das heißt Aktien, Häuser, Gold, aber was man damals wohl »bescheidene Lebensführung« nannte, also keine Villas und großen Autos.
Meine Großeltern hatten drei Kinder. Wilhelm (nach dem ich heiße), Ludowika (nach der meine Schwester hieß) und meine Mutter Melitta. (Diese Namen allein sind Hinweise auf den viktorianischen Kulturkreis.) Mein Onkel Wilhelm war Violinist und lebte in London. Auf ausdrücklichen Wunsch meines Großvaters kehrte er im September 1914 nach Prag zurück, rückte ein, und fiel beinahe sofort bei Nisch in Serbien. Er starb unverheiratet, und mein Großvater hat seinen Tod nie überwunden. Meine Tante Ludowika (angeblich ein Untam**) war selbstverständlich gut österreichische Krankenschwester im Krieg, und starb, unverheiratet, am 18. Oktober 1918, am Tag der Revolution, an spanischer Grippe. Als also mein Vater meine Mutter heiratete, war sie die einzige Tochter und Erbin. Man kann sich den Skandal vorstellen, ein linker Intellektueller heiratet Fräulein Basch und will seine Ideen nicht aufgeben, obwohl mein Großvater Basch meinen Vater sofort zum »stillen Teilhaber« seiner Fabrik machte und ihn wahrscheinlich auch anderswie »bestechen« wollte. Ich glaube, das war die stumme Tragödie der Ehe meiner Eltern: der hochmütige »Geistige« und die viel jüngere, kultivierte und zurückhaltende »fille rangée«. Ich glaube jedoch auch, daß es eine gute Ehe war: Mein Vater »unterrichtete« meine Mutter, und diese »kultivierte« meinen Vater.
Aus dieser Ehe entstammten ich und meine Schwester Ludvika. Ich wurde am 12. 5. 20 und meine Schwester am 21. 12. 22 geboren. Da ich der einzige Erbe meines Großvaters war, wollte er, ich möge Basch-Flusser genannt werden, wogegen sich mein Vater stellte (wohl wegen der aristokratischen Konnotationen des Hyphen). Den Siegelring mit der Baronenkrone (nebbich!) trage ich allerdings noch immer. (Übrigens hat meine Frau vor einigen Jahren zufällig das Wappen der Baschens gefunden, aber dann wieder verloren.) Wir führten (meine Großeltern Basch, meine Eltern, meine Schwester und ich) ein gutbürgerliches Leben in dem Bubencer Haus und in dem Landhaus, das mein Vater bei der Moldaumündung kaufte. Im Jahre 1942 (also zwei Jahre nach der Ermordung meines Vaters) wurden alle (meine Großeltern, meine Mutter und meine Schwester) verschleppt, nachdem man sie (laut des mir von Ihnen gesandten Papiers) in die Dlouhá und auf den Zboŕenec umgesiedelt hatte. Vorher wohl noch hatte mein Großvater die Fabrik an einen Strohmann, seine langjährige Buchhalterin Frau Müller, zum Schein verkauft, in der verlorenen Hoffnung, sie für mich zu retten (sein Lebenswerk, und ich sein Stolz, denn jedes jüdische Enkelkind ist bekanntlich genial). Alle sind, zu mir Gott sei Dank unbekannten Daten, umgebracht worden, und ihr sinnloser Tod ist das Zeichen, unter dem ich zu leben habe.
Ich besuchte die tschechische und deutsche Volksschule, das deutsche Realgymnasium in Smíchov, machte auch eine tschechische Matura und immatrikulierte an der tschechischen juristischen Fakultät im Jahr ’38. Dank der Hilfe meines späteren Schwiegervaters Barth floh ich im März ’39 (etwa den 20.) nach England, von dort nach Brasilien, wo ich Hochschullehrer wurde. Ich bin mit Edith Barth verheiratet, habe drei Kinder, und schreibe Essays und Bücher. Aber das ist jüngste Geschichte, und für Sie wohl ohne Interesse. Was Sie interessiert, endet im Jahre 1944, dem Jahr der Ausrottung meiner Familie…
* Zu den drei Mäulern
* »Pátečnici« (von pátek: Freitag) wurden die Intellektuellen genannt, die sich freitags bei Tomáš Garrigue Masaryk versammelten.
* Die weltweit hochangesehene Independent Order of B’nai B’rith (Söhne des Bundes) wurde 1843 in New York als jüdischer brüderlicher Orden von deutschstämmigen Juden gegründet; Tätigkeiten vor allem auf dem Gebiet der allg. Wohlfahrt und des Sozialdienstes.
* hebräischer Segensspruch; etwa: Die Erinnerung soll zum Guten gereichen.
* hebräisch »Heiligung«: Segensspruch bei einem Becher Wein.
** jiddisch für Tollpatsch
3
VATER
DAS VIERTEL BOM RETIRO (gute Zuflucht) der Stadt São Paulo war noch vor wenigen Jahren ein Gewirr von Judengassen. Das geschäftige Gedränge war bunt, portugiesische und jiddische Rufe verbanden die Gehsteige, Kaftan-bekleidete und Schläfenlocken-tragende Verkäufer priesen Bluejeans an, halbnackte Frauen vor vergitterten Fenstern priesen sich selbst an, und Volkswagen versuchten hupend, sich einen Weg zu bahnen. Damals ging ich des öfteren hin, angeblich nicht, um die halbnackten Frauen und die ausgestellten Kleidungsstücke zu besichtigen (die allerdings beide von minderwertiger Qualität waren), sondern um eine Art von ethnischem Puzzle zu spielen. Ich suchte mir einen beliebigen Menschen aus der Menge aus, versuchte seine Herkunft zu erraten, befragte ihn dann danach und gab mir selbst Punkte. Es war mir ein Leichtes, zwischen den sephardischen und aschkenasischen Juden zu unterscheiden, schwieriger war es, unter den sephardischen etwa ungarische von türkischen und unter den aschkenasischen etwa russische und deutsche zu unterscheiden, und das Spiel wurde spannend, wenn es galt, etwa zwischen einem Konstantinopler und einem Smirnaer, oder zwischen einem Frankfurter und einem Mannheimer unterscheiden zu wollen. Doch einmal erlebte ich eine Überraschung:
Ein alter Herr, mit Vollbart, aber ohne Schläfenlokken, mit einem Gebetsmantel ähnlichen Gewand, aber ohne Kapperl, und in Sandalen, ging langsam über die Gasse, und ich war unfähig, ihn unter die Hauptkategorien »Aschkenas-Sepharad« einzuordnen. Ich sprach ihn also an (portugiesisch und in gebrochenem Jiddisch), aber er verstand mich nicht und antwortete höflich in einer mir fremden Sprache. Ich bin zwar in semitischen Sprachen sehr wenig bewandert, habe aber ein gutes Sprachgefühl, und die Sprache des alten Herrn klang in meinem Ohr wie ein sehr altertümliches Hebräisch – als ob der Herr lateinisch statt portugiesisch gesprochen hätte. Ich unterdrückte jedoch sofort das leichte Gruseln: Wahrscheinlich war der alte Herr ein jemenitischer Jude, sprach einen mit Hebräisch durchsetzten südarabischen Dialekt und war erst jüngst nach Brasilien gekommen. Er war sichtlich im neuen Land desorientiert, und ich mußte ihm beistehen. Um dies tun zu können, mußte ich aber seine Sprache verstehen. Ich hielt daher ein Taxi an, bat den alten Herrn einzusteigen (er tat es mit höflicher Verbeugung), und sagte dem Lenker, er möge uns zur Stadtbibliothek bringen. Sicher sind dort jemenitische Wörterbücher zu finden.
Sie sind tatsächlich dort, und (wie uneingestandener-weise erwartet) entsprechen sie nicht der Sprache des alten Herrn. Ich bitte daher die Bibliothekarin, nach einem chaldäischen Wörterbuch zu suchen. Während sie damit beschäftigt ist, sitze ich dem lächelnden alten Herrn im großen, verlassenen Lesesaal gegenüber und versuche fieberhaft, die armseligen mir verfügbaren Daten betreffs »Chaldäa« aus dem Gedächtnis zusammenzukratzen. Ich finde dort zwei Brocken: »Ur in Chaldäa« (Abrahams Heimat) und »Chaldäer« als klassische Bezeichnung für Magier und Astrologen. Dabei hat »Ur« für mich einen deutschen Beigeschmack, wiewohl ich mir der falschen Etymologie bewußt bin, und bei »Chaldäer« muß ich auch an die Sprache einer orientalischen Kirche denken. Diese beiden Brocken scheinen keinen Zusammenhang zu haben. Ich muß weiter im Gedächtnis suchen, mich an meine Schulzeit erinnern.
Ein Volk im Zweistromland (Kaldi, Kasdîm, Kar-Dunjasch), älter als das babylonische, zweifellos semitisch, aber mit den nicht-semitischen Sumerern in Wechselbeziehung. Einige babylonische Könige (Nabupolassar und seine Nachfolger) sind Chaldäer gewesen. Die babylonische Priesterkaste war vorwiegend chaldäisch. Abraham, soweit er historisch überhaupt faßbar ist, entstammt einer chaldäischen Mittelperiode (etwa Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr.). Die klassische Bedeutung von »Chaldäer« ist auf Daniel (etwa fünftes Jahrhundert v. Chr.) zurückzuführen. Noch später wurde die chaldäische Sprache mit der babylonischen und sogar der aramäischen verwechselt. Und jetzt kommt die Bibliothekarin strahlend zurück: Sie hat ein chaldäisch-englisches Wörterbuch gefunden. Ich flüstere ihr zu, damit der alte Herr es nicht hört (lächerlich, er versteht kein Wort portugiesisch), sie möchte mir alles unter dem Stichwort »Abraham« Verfügbare bringen.
Ich schlage das Wörterbuch auf, der alte Herr blinzelt vergnüglich. Ich lese fragend: »Abi-ram?, Ab-hamon?, Ab-rucham?, Ab-ram?, Sarai?, Sara?« Er antwortet lachend »Abi«. Trotz des Lachens ist ein Unterton von Autorität herauszuhören. Denn ich verstehe, was er sagt: »Ich bin dein Vater, du mein Sohn, und es ist gleichgültig, welchen meiner Beinamen du vorziehst.« Ich blättere nach und frage: »Vater der Gläubigen? Vater des Glaubens?« Er gibt eine sichtlich lustige Antwort. Laut Wörterbuch: »Vater des Sandes am Meer, der zerstreut wurde, um alle Räderwerke kaputt zu machen.« Ich kann nicht mitlachen, denn es läßt mich stutzen. Hat es etwa zu seiner Zeit in Ur Räderwerke gegeben? Er merkt das, nimmt mir das Wörterbuch aus der Hand, und von nun ab ist er es, der das Gespräch leitet. Er weist bei seiner Rede auf die entsprechenden englischen Worte, und ich verfahre entsprechend.
Er beginnt mit der folgenden Aussage: »Ich bin hergekommen, um Fragen zu stellen, nicht, um ausgefragt zu werden. Ich bitte dich höflich, aber dringend, unsere beiden Rollen nicht zu vertauschen.« Gedemütigt kann ich nicht anders, als auf »okay« zu weisen. Aber da kommt die Bibliothekarin mit einem Berg von Büchern. Abraham versteht, worum es geht, und zeigt mit lächelnder Geste, ich könne ruhig über ihn nachschlagen, er könne warten. Es liest sich wie ein Polizeibericht: Landflucht, Prostituierung der eigenen Frau, gegenseitige Betrügereien mit seinem Geschäftspartner, versuchter Mord am eigenen Sohn, widerrechtliche Enterbung aller anderen Söhne, Schacher mit Konkurrenten und sogar mit Gott. Warum schmunzelt der alte Herr, während ich das lese? Ich sehe plötzlich den Grund ein: Er hält die Lektüre für pädagogisch. Ich soll den Unterschied zwischen Verbrechen und Sünde lernen. Alles, was Abraham verbrach, tat er guten Glaubens, und dieser gute Glaube war das Motiv aller seiner Taten. Ich lerne Gutgläubigkeit als Verschmitztheit, als Strategie kennen. Abraham rückt dabei in die Nähe des Ulysses. In dieser guten Laune beginnt das eigentliche Gespräch mit dem Vater.
»Hat Gott eigentlich sein Versprechen gehalten?« Ich glaube, er meint das Versprechen vom Sand am Meere. »Es gibt etwa 16 Millionen Juden (Kinder deines Enkels Jakob), aber weit über vier Milliarden andere Leute.« So war das aber nicht gemeint: Abraham hat kein Interesse an Statistiken und an Juden. »Keine Ausreden bitte. Hat Gott es später besser gemacht als damals mit der Sara?« Ich habe ihn jetzt verstanden und kann auf ihn eingehen.
»Er hat, soviel ich weiß, den Versuch einige Male wiederholt, und drei dieser Versuche, mit der Rachel, mit einer gewissen Maria und mit einem Araber namens Mohammed, sind relativ erfolgreich gewesen.« »Von der Rachel weiß ich, erzähl mir von dieser Maria.« »Er hat sie durch Gabriel geschwängert, es ist ein Rabbiner namens Jesus daraus geworden, und der hat die Sünden aller Leute auf sich genommen.« »Ist damit die Sünde aus der Welt geschafft worden?« »Nein, denn dieser Jesus hat seine Botschaft ins Unglaubwürdige vertuscht und nur jene von der Sünde erlöst, die trotzdem daran glaubten.« »Warum tat er dies?« »Um den Leuten die Entscheidungsfreiheit nicht zu nehmen.« »Nicht schlecht gedacht, aber wahrscheinlich nicht sehr wirksam?« »Du hast recht: Die meisten Leute haben nämlich nicht wirklich geglaubt, sondern dies nur vorgetäuscht, und damit ist die Sache mit dem Sündigen noch ärger geworden als zu deinen Zeiten.« »Aha, und darum wohl der neuerliche Versuch mit diesem Mohammed?« »Ja, und in diesem Fall hat Gabriel die göttliche Botschaft in die Feder diktiert, um Irrtümer zu vermeiden.« »Es ist ein Buch daraus geworden?« »Ja, der Koran, als zweite, verbesserte Ausgabe von Jesus.« Er lacht schallend: »Ein Buch statt eines Menschensohns, auf so was muß man kommen. Und was ist daraus geworden?« »Es kommt darauf an, wie du es ansiehst. Viele Leute benützen das Buch, um andere damit zu bekämpfen.« Neues Gelächter: »Das gönn ich Ihm. Er hat schon immer eine zu gute Meinung gehabt in Bezug auf Seine am sechsten Tag vollbrachte Leistung.«
»Und was haben die Leute sonst für Unfug getrieben, seit ich weg bin?« Soll ich ihm etwa die Geschichte der letzten dreieinhalbtausend Jahre erzählen? »Sie haben die Welt immer besser verstanden und dadurch die Welt und sich selbst ziemlich verändert. Das wirst du ja bemerkt haben, seit du zurück bist.« »Haben sie die Welt zu verstehen versucht, um sich selbst zu verändern?« »Viele versuchten, die Welt zu verstehen, ganz einfach, weil sie so interessant ist.« »Bitte schweige davon, wegen solcher Leute habe ich ja Ur verlassen. Erzähl mir lieber von den anderen Leuten.« »Viele haben versucht, die Welt und sich selbst zu verändern, weil sie der Meinung waren, daß nicht alles so ist, wie es eigentlich sein sollte.« »Das ist eine vernünftige Meinung. Also die Leute haben versucht, die Welt zu verstehen, um Seine Fehler korrigieren zu können?« »So kann man es auch sagen. Aber eigentlich ist es angebrachter, statt dessen zu sagen, daß die Leute etwas besser leben wollten.« »Und ist ihnen das gelungen?« »Nun ja, sie leben jetzt länger, leiden weniger an Schmerzen, haben mehr Erlebnisse und haben mehr Dinge zu ihrer Verfügung.« »Du Trottel, das nennst du besser leben?«
Ich bin beleidigt. »Entschuldige, und was nennst denn du besser leben?« »Ich verbitte mir deine Arroganz. Antworte auf meine Frage.«
»Ich nenne ›besser leben‹ (mit einigen Vorbehalten), wenn man mehr lebt.« Er krümmt sich vor Lachen: »Du hältst das Leben für Selbstzweck? Du fragst mich, wozu man lebt?« »Es gibt Leute, die das fragen, aber die Antworten sind so dürftig, daß ich mich schäme, sie dir zu erzählen.« »Nur Mut, liebes Söhnchen, leg los mit der Sache.« »Einige Leute sagen, daß wir zum Tod leben, die meisten glauben das, ohne es laut einzugestehen. Andere sagen, daß man für andere Leute leben solle, aber wenn man sie fragt, wozu diese anderen leben sollen, werden sie böse. Manche andere sagen, man lebe für seine Enkel, welche ihrerseits wieder für ihre Enkel leben. Manche sagen, man lebe, um in den Himmel zu kommen, aber du weißt wahrscheinlich besser als sie, wie es dort aussieht. Ich selbst glaube, man lebt, um so viel wie möglich zu lernen, zu genießen und mit anderen Leuten zu reden, aber das nennst du vertrottelt.«
»Vielleicht war ich ein wenig zu streng mit diesem deinem Lernen. Was hast du eigentlich gelernt?« »Ich will dir ein Beispiel geben: Ich weiß jetzt, daß die Welt viel größer und älter ist, als du glaubst, du mit deinen sechs Tagen.« Er wird zornig: »Schwafel nicht. Was heißt größer und älter?« »Ich kann dir gar nicht sagen, wie alt und wie groß sie ist, du würdest diese Größenordnungen nicht verstehen.« »Aber du selbst verstehst sie?« Ich stottere: »Ich auch nicht.« Er verschluckt sich vor Lachen: »Und so einen Blödsinn hast du gelernt?« »So blöd, wie du meinst, ist das nicht: Man kann einiges damit machen.« »Was zum Beispiel? Besseren Ziegenkäse?« »Mach dich nicht lustig über deine Kinder. Und verachte den Ziegenkäse nicht: du selbst hast dich mit Lot deswegen herumgestritten.« »Ich bin meinem Alter ein würdiges Verhalten schuldig, sonst hättest du eine sitzen. Red nicht über Lot und über Dinge, die du nicht verstehst, sondern erzähl mir, was ihr mit diesem Erlernten gemacht habt.« »Tatsächlich besseren Ziegenkäse, und auch solche Taxis wie das, welches dich hergebracht hat.« »Dieses lächerliche stinkende Wakkelzeug, das sich zwischen die Leute zwängt, um sie zu zerquetschen?« »Das Zeug hat auch eine andere Seite: es macht die Leute freier, sich schnell von einem Ort zu einem anderen zu begeben, zum Beispiel von Ur nach Ägypten.« (Das konnte ich mir nicht verbeißen.)
Er erhebt sich, streckt beide Arme aus und schreit: »Du glaubst, ich bin weg von Ur, um derart frei zu werden? Ich verfluche meinen Samen.« Ich stürze zu seinen Füßen und berge mein Haupt in seinem Schoße. »Lehre mich, Vater, wozu man lebt, lehre mich wahre Freiheit.« Sein Zorn ist in Lachen umgeschlagen. »Der Fluch hat also gewirkt. Das muß ich Ihm erzählen.« »Darf ich dir jetzt auch eine Frage stellen? Worüber lachst du?« »Du hast keinen Sinn für Humor, und Witze kann man nicht erklären.«
4
ROMY FINK
DAS SOGENANNTE »KENNENLERNEN