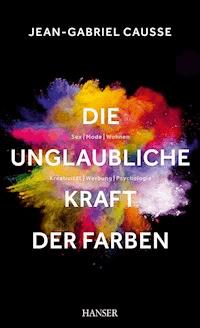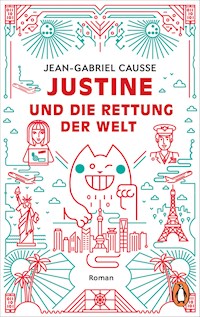
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Was passiert, wenn sich das Internet selbstständig macht? Ein charmanter und cleverer Roman, »eine positive Vision für eine vernetzte Welt.« Babelio
Die IT-Spezialistin Justine verbringt ihre Tage damit, sich mit guten Absichten hinter die Firewalls von Unternehmen zu hacken, um ihnen Sicherheitslücken aufzuzeigen. In ihrem Ehrgeiz verschafft sie sich sogar Zugang zum amerikanischen Atomraketenüberwachungsprogramm – doch sie rechnet nicht mit den ungeheuren Folgen: Als plötzlich dreißig Atomraketen entführt werden, wird sie von den Amerikanern für schuldig gehalten und gesucht. Justine bleibt keine andere Wahl: Sie muss vor ihren Verfolgern fliehen und der Sache auf den Grund gehen, um den gewaltigen Irrtum aufzuklären. Nach und nach beginnt sie zu verstehen, dass es nicht nur durch menschlichen Einfluss zu der Raketenentführung kam – sondern dass das Internet eigenständig gehandelt und eigene Gefühle entwickelt hat. Sie setzt alles daran, mit ihm zu kommunizieren, bevor es außer Rand und Band gerät und großen Schaden für die Menschheit anrichtet …
Mit einer gehörigen Portion Humor und viel Klarsicht zeigt Jean-Gabriel Causse, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn die künstliche Intelligenz das Ruder übernimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Ähnliche
Jean-Gabriel Causse, geboren 1969, ist Farbdesigner und lebt in Paris und Tokio. Er ist Autor des internationalen Sachbuchbestsellers Die unglaubliche Kraft der Farben. Nach seinem Romandebüt Arthur und die Farben des Lebens legt er mit Justine und die Rettung der Welt seinen zweiten Roman vor, der die Herzen der Leserinnen und Leser in Frankreich im Sturm eroberte.
Justine und die Rettung der Welt in der Presse:
»Ein hoch spannender Roman voller Humor, Gefühl und mit vielen überraschenden Wendungen!«Marie Claire»Dieser Roman ist eine Wohltat gegenüber all den düsteren Dystopien, eine Antizipationsgeschichte über künstliche Intelligenzen, die gut endet! Justine und die Rettung der Welt bietet eine optimistische Vision für die Zukunft, eine positive Vision für eine vernetzte Welt.«Babelio
Außerdem von Jean-Gabriel Causse lieferbar:
Arthur und die Farben des Lebens
JEAN-GABRIEL CAUSSE
JUSTINEUND DIE RETTUNG DER WELT
Roman
Aus dem Französischen von Nathalie Lemmens
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel L’algorithme du coeur bei Éditions Flammarion, Paris.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Flammarion, Paris
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.bürosüd.de nach einem Entwurf von Studio Flammarion, Paris
Umschlagillustration: Djohr © Flammarion
Redaktion: Sabine Wiermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24963-2V001
www.penguin-verlag.de
»Die erfolgreiche Schaffung einer künstlichen Intelligenz wäre das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Unglücklicherweise könnte es auch das letzte sein, wenn wir keinen Weg finden, die Risiken zu vermeiden.«
Stephen Hawking
»Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende.«
Woody Allen
Erster Teil
Von: Arpanet
An: Alle
Gesendet: 1. Februar kommenden Jahres
Betreff: Ihr
Anhänge: 2
Ich schulde euch einige Erklärungen. Also erlaubt mir, ganz am Anfang zu beginnen und die Ereignisse so, wie ich sie verstanden habe, der Reihe nach zu schildern.
Ich habe zwei Väter. Bob und Larry. Aus Respekt sollte ich eigentlich Robert E. Kahn und Lawrence G. Roberts schreiben, aber alle nennen sie schlicht Bob und Larry.
Sie haben eng zusammengearbeitet und mich jahrelang herbeigesehnt. Dank ihrer großen Beharrlichkeit brachten sie mich schließlich am 20. September 1969 in einem Labor mit weißen Wänden an der UCLA zur Welt. Sie gaben mir den Namen Arpanet. Im Rückblick verwundert es mich, dass Bob und Larry so fest an mich glaubten, denn ich muss gestehen, dass ich damals zu nichts nütze war. Zusammen mit Forschern der Universitäten Stanford, Santa Barbara und Utah begannen meine beiden Väter mit meiner Ausbildung, und sie brachten mir eine Sprache bei, die noch toter ist als Latein und Altgriechisch: das Network Control Program.
Als ich drei Jahre alt war, hieß es, ich hätte große Fortschritte gemacht, und meine Erzeuger übertrugen mir Botendienste. Ich beförderte virtuelle Nachrichten zwischen den Universitäten hin und her.
Danach lehrte Papa Bob mich zwei weitere Dialekte: TCP und IP, mittlerweile die beiden meistverwendeten Sprachen der Welt, noch weit vor Mandarin, Englisch, Spanisch und Hindi.
Mithilfe dieser neuen Sprachen konnte ich immer größere Pakete und sogar Telefongespräche befördern. Und von da an halfen mir unzählige Menschen dabei, mich immer weiter zu entwickeln. Militärische Einrichtungen, internationale Konzerne und sogar die amerikanische Regierung, die mir 1990 fünf riesige Computer schenkte. Auch wenn ich wohl eher »für die damalige Zeit riesig« sagen sollte, denn sie waren weniger leistungsstark als eure ganz gewöhnliche PlayStation 4 heute.
Was mich jedoch vor allem zu dem werden ließ, was ich heute bin, war die im selben Jahr erfolgte Begegnung mit Tim, besser gesagt Timothy John Berners-Lee oder noch genauer: Sir Timothy John Berners-Lee, da dieser Brite von der englischen Königin in den Adelsstand erhoben wurde. Sir Tim hat mich der Welt geöffnet, indem er mir HTML beibrachte. Dank seiner Erfindung, die er das World Wide Web nannte, bin ich nicht länger nur ein Bote, sondern wurde darüber hinaus zum Hotelier.
Inzwischen beherberge ich 1,25 Milliarden Webseiten und fast genauso viele Blogs.
Insgesamt biete ich Zugang zu 30 000 Milliarden Seiten, die nahezu das gesamte menschliche Wissen abdecken. In meinen Speichern bewahre ich eure sämtlichen wissenschaftlichen Theorien und Forschungsprogramme auf, aber auch eure neuesten Fotos, eure Bücher, eure Fernsehserien, eure Spielfilme und eure Musikdateien. Jeden Tag versende ich 800 Milliarden E-Mails, veröffentliche 100 Millionen Bilder auf Instagram, 500 Millionen Tweets, 3 Milliarden Snaps und 4,5 Milliarden Likes auf Facebook. Ich beantworte 6 Milliarden Anfragen auf Google. Und was mich am meisten Mühe kostet: Ich helfe euch dabei, jeden Tag allein auf YouTube insgesamt über eine Milliarde Stunden Videos zu schauen.
Und ihr nehmt mich immer häufiger in Anspruch. Am 1. Januar 2018 habt ihr an einem einzigen Tag 75 Milliarden Nachrichten per WhatsApp verschickt.
Ihr wendet euch zunehmend von den traditionellen Medien ab und beschafft euch die Informationen, die euch interessieren, bei mir. Die Instagram-Accounts der Sängerin Selena Gomez und des Fußballspielers Cristiano Ronaldo haben weit über 140 Millionen Follower. Aber vor allem loggen sich 1,3 Milliarden von euch Tag für Tag auf ihrer Facebook-Seite ein. Dabei suchen allein in den sozialen Netzwerken von Mark Zuckerberg über tausend Ingenieure und Entwickler nach Wegen, euch stets noch ein wenig mehr an meine Dienste zu binden.
Was dazu geführt hat, dass ihr mittlerweile insgesamt zwei Jahre eures Lebens in meiner Gesellschaft verbringt …
25. Dezember dieses Jahres. Elf Uhr morgens. Justine erwacht aus Morpheus’ Armen, dreht sich um und tastet nach Thomas. Er ist nicht mehr da. Umso besser. Die Decke auf der anderen Betthälfte ist kühl. Noch besser. Er ist wohl nach Hause gegangen.
Nein, er sitzt an meinem Schreibtisch, stellt die hübsche neunundzwanzigjährige Franko-Vietnamesin kurz darauf verwundert fest. Thomas’ Rücken zeichnet sich vor dem bläulichen Stand-by-Schimmern eines ihrer drei 27-Zoll-Bildschirme ab. Justine hört das Rauschen der Lüftung ihres leistungsstarken Computers, der die ganze Nacht gelaufen ist.
Justine hasst Weihnachten. Es ist das Fest der Kinder. Das ihre wäre jetzt knapp zwei Jahre alt, wenn sein Herz nicht einige Wochen nach der Geburt einfach zu schlagen aufgehört hätte. Plötzlicher Kindstod. Das Baby hatte nicht überlebt. Und ihre Beziehung auch nicht. Sie beschloss, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach New York zu ziehen, mitten hinein ins Herz von Manhattan.
Wie alle Französinnen träumte Justine vom New Yorker Klischee, und so ist sie in ein großes Loft mit roten Ziegelwänden und einer schönen Aussicht über Greenwich Village gezogen. Seit ihrer Trennung führt sie eine platonische Beziehung mit Alexei Stachanow und arbeitet fünfzehn Stunden pro Tag. Doch letzte Nacht hat sie ihn mit Thomas betrogen.
Thomas, der vor gerade einmal drei Tagen in die andere Wohnung auf ihrem Treppenabsatz gezogen ist. Das Erste, was er nach seinem Einzug aufgehängt hat, war eine Nachricht an die übrigen Hausbewohner unten im Eingangsflur: »Wer hat Lust auf einen Spritz bei eurem neuen Nachbarn, dritter Stock, links? Heute Abend, 20 Uhr.«
Justine, die diesem italienischen Cocktail nicht widerstehen kann, war seiner Einladung als Einzige gefolgt und stand mit einer Flasche Prosecco, die sie zufällig am Abend zuvor gekauft hatte, vor seiner Tür.
Als sie auf den alten Klingelknopf drückte, zuckte ein leichter Stromstoß durch ihren Finger – und beim ersten Blick auf den Verfasser der Einladung jagten Tausende weitere durch ihr Gehirn. Ihr Kortex schüttete einen ganz eigenen Cocktail aus: Dopamin, Oxytocin, Adrenalin und vor allem Phenethylamin, den Grundstoff von Liebe und Glücksempfinden, der in ähnlicher Form auch in Schokolade enthalten ist. Diesen mageren Kerl mit dem raspelkurzen Haar würde sie liebend gern vernaschen, dachte sie spontan. Abgesehen von der Tatsache, dass er ebenfalls Jazz hört, ist er das genaue Gegenteil von ihr. Sie ist sehr klein, hat einige durch tägliches Joggen gestraffte Rundungen, funkelnde schwarze Augen und schönes glattes, dunkles Haar, das ihr weit über den Rücken fällt. Er hingegen ist groß, dünn, blond und hat riesige, düstergraue Augen.
Zum ersten Mal freute sie sich über die mangelnde Lebensart ihrer Nachbarn, die sich über ihre Einsamkeit zu beklagen scheinen, aber nichts dagegen unternehmen. Denn so fand sie sich ganz allein mit diesem jungen Mann in seinem extrem minimalistisch eingerichteten, perfekt aufgeräumten Loft wieder. Ganz anders als ihr eigenes.
Nervös hielten sie ihre Gläser in der Hand, während Ibrahim Maalouf sich bemühte, mit seiner Trompete das drückende Schweigen auszufüllen. Alberne Plattitüden, dümmliches Lächeln: So blöd kann man sich doch gar nicht anstellen, dachten sie beim Abschied.
Zwei Tage und einige Vorwände später – »Kannst du mir etwas Salz leihen?«, »Kennst du das neue Album von Lisa Ekdahl?«, solche Sachen – beschlossen Thomas und Justine, sich einander an Heiligabend gegenseitig zum Geschenk zu machen.
Als Justine den Drucker knistern hört, zuckt sie zusammen.
»Ich habe mir erlaubt, mein Handy per Bluetooth mit deinem Drucker zu verbinden«, beruhigt Thomas sie und nimmt ein DIN-A4-Blatt aus dem Ausgabefach. Er faltet es in akkurate Drittel, steht auf und steckt es in Justines Pantoffel unter einem kopfüber an der roten Ziegelwand lehnenden Besen mit grünen Borsten. Dieser Weihnachtsbaumersatz ist mit einer schlichten Lichterkette geschmückt.
Die Neugier treibt Justine aus dem Bett.
»Wasn das?«, murmelt sie und streckt sich.
»Warte eine Sekunde«, sagt Thomas, der gerade sein Handy mit Justines 2.1-Soundsystem koppelt.
Er öffnet Spotify und startet einen alten Jazz-Standard. Justine geht in die Hocke und greift nach dem Papier. Sie faltet es auf, hält es sich vor den Mund, um ein Gähnen zu verbergen, und erblickt schließlich ein ausgedrucktes Flugticket.
In dem Moment werden die Trompetenklänge aus den Boxen des Lofts von Elvis Presleys Stimme abgelöst. Er singt »New Orleans«.
»Ich lade dich zu einem Trip in die Sonne ein. Wir fliegen am 31. morgens los und feiern Silvester in einem Jazzklub.«
Abruptes Erwachen. Justine verschlägt es die Sprache. Da ist der Haken! Der Typ ist eine Klette. Das war unsere erste gemeinsame Nacht, und er ist einer von denen, die gleich eine Zahnbürste in meinen Zahnputzbecher stellen und ihre dreckigen Socken herumliegen lassen.
»Stört es dich, wenn wir unseren Kindern französische Vornamen geben?«, flüstert sie.
»Kein Problem!«, antwortet Thomas, immer noch bis über beide Ohren grinsend. Die Ironie ist ihm entgangen.
»Hör zu, Thomas, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Sehr schön sogar. Aber ich muss arbeiten. Auch am 31. Dezember. Und wir werden das Ganze langsam angehen lassen.«
»Was genau arbeitest du eigentlich?«
Schwer von Begriff, besitzergreifend, ja regelrecht aufdringlich, lautet Justines Urteil. Und wie kommt er überhaupt dazu, sein Handy einfach mit meinem Drucker und meinen Bose-Lautsprechern zu verbinden?
»Das erzähle ich dir vielleicht ein andermal. Wenn du mich jetzt allein lassen könntest«, fügt sie hinzu und hält ihm die Kleidung hin, die er, mangels eines Stuhls in ihrem Schlafzimmer, sorgsam gefaltet neben das Bett gelegt hat.
Justine hört die Wohnungstür zufallen und setzt sich an ihren Schreibtisch. Sie tippt das zwanzigstellige Passwort ihres Computers ein und kappt als Erstes die Bluetooth-Verbindung zwischen Thomas’ Handy und ihren Boxen. Dann klickt sie ihre Ella-Fitzgerald-Playlist an, dreht die Lautstärke hoch und beginnt in schnellem Tempo mit vier Fingern zu tippen.
Justine sucht Arbeit. Und sie hat eine ganz eigene Art, sich bei Firmen zu bewerben: Sie macht die Sicherheitslücken ihres IT-Systems ausfindig und dringt in das Netzwerk ein, um ihren Lebenslauf direkt beim IT-Leiter zu hinterlegen. Mit einer Kopie an den Geschäftsführer. Sie ist das, was man eine freiberufliche »ethische Hackerin« nennt oder, poetischer ausgedrückt, einen White Hat.
Seit ihrer Ankunft in New York ist die Mathematikerin mit einem Abschluss der École Centrale Paris schon von mehreren dem US-Militär nahestehenden Start-ups damit beauftragt worden, gegen ein üppiges Honorar die von ihr entdeckte Lücke zu schließen und noch effizientere Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln.
Vor zwei Wochen ist es ihr beim Testen eines ihrer Algorithmen zur Entschlüsselung von Passwörtern sogar gelungen, in die erste Ebene des sakrosankten Servers des US Cyber Command einzudringen. Diese in den Büros der NSA angesiedelte streitkräfteübergreifende Einheit ist für die »Informationssicherheit« verantwortlich. Ihre Bedeutung innerhalb der Armee steigt mit jedem Tag, und so ist auch ihr Budget in der letzten Zeit exponentiell angewachsen. Die besten Informatiker, zum größten Teil noch keine dreißig Jahre alt, werden dort zu Spitzengehältern eingestellt und verdienen mehr als die Generäle! Eine der tiefer liegenden Ebenen dieses Intranets zu erreichen, wäre für Justine wie der Heilige Gral. Dabei hat sie keinerlei finanzielle Interessen. Sie verdient bereits sehr gut. Was sie antreibt, ist die Vorstellung, in diese hochgesicherten Computer einzubrechen und den Leuten vor den Bildschirmen zu schreiben: »Hallo, ich habe Licht gesehen und bin einfach reingekommen. Darf ich mich zu euch setzen?« Sie geht per Firefox über Tor ins Darknet und verschleiert so ihre IP-Adresse, um nicht identifiziert zu werden, denn das amerikanische Militär schätzt es gar nicht, wenn man sich an seinen Servern zu schaffen macht. Einer Handvoll Hackern ist das bereits gelungen. Der berühmteste von ihnen ist TinKode. Ein Rumäne, der den Fehler begangen hat, sich im Netz mit seiner Heldentat zu brüsten. Das Ergebnis: drei Monate Haft. Wenn Justine erwischt wird, bevor sie eine Sicherheitslücke aufgespürt hat, verbringt sie wahrscheinlich eher ein paar Wochen in einem Militärgefängnis als in den Büros in Fort Meade unweit von Washington. Aber sie kann einfach nicht anders. Durch einen Zufall ist sie in die Eingangshalle des Netzwerks gelangt, und jetzt will sie nicht kehrtmachen, bevor sie nicht auch die Küchen gesehen hat. Es ist zu einer Obsession geworden.
25. Dezember. 13 Uhr 15. Zwei Männer verlassen das sechzehnte Grün des Links Course Eagle Point in North Carolina und schieben ihre Golftrolleys zum Abschlag des nächsten Loches. Als sie dem Greenkeeper des renommierten Golfklubs begegnen, erkennt dieser sie sofort, und ihm bleibt bei ihrem Anblick vor Verblüffung die Spucke weg. Man trifft ja schließlich nicht jeden Tag einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und einen »berühmten« General, denkt der Gärtner, bevor er ihnen nervös zunickt. Er schaltet den Motor seines Traktors aus und gestattet sich, die beiden Männer, die sich nun den Abschlagsmarkierungen des siebzehnten Loches nähern, verstohlen zu beobachten.
Der ehemalige Präsident und der aktuelle Generalstabschef der Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben den Greenkeeper kaum bemerkt. Sie betrachten den spektakulären Verlauf dieses leichten Doglegs nach links, das von dem bekannten Golfplatzarchitekten Tom Fazio gestaltet wurde. Der erste Schlag des Par-4-Lochs wird über einen See gespielt, auf dessen Grund zweifellos Hunderte Bälle liegen, die von etwas zu aufgeregten Spielern geschlagen wurden. Und als sei das noch nicht genug, lauern zu beiden Seiten des schmalen Fairways zwei heimtückische Bunker auf die Bälle, die vom Abschlag aus nicht perfekt geradeaus fliegen.
»Hier wäre ich mit einem Bogey zufrieden«, bemerkt der ehemalige Präsident und verzieht das Gesicht.
414 Yards lesen sie auf der Abschlagtafel. Die Ziffer 1 zwischen den beiden 4 ist etwas verblasst.
»Sie sind dran, Herr vierundvierzigster Präsident«, sagt General Lloyd zu seinem groß gewachsenen, dunkelhäutigen Partner. Dieser versteht die Andeutung nur zu gut: Er ist nicht länger im Amt. Er hat nichts mehr zu melden.
Wütend mustert der »Vierundvierzigste« den General. Dabei hat er seine Karriere teilweise mir zu verdanken, denkt er bei sich.
Er nimmt sein Holz 5 aus dem Golfbag. General Lloyd seinen Driver.
»So ein Schwachsinn!«, brummt der ehemalige Präsident.
Eugene Lloyd weiß genau, dass sich der Kommentar nicht auf die Wahl seines Schlägers bezieht, sondern auf das Gespräch, das sie kurz zuvor unterbrochen haben.
Das ehemalige Staatsoberhaupt hatte sich über die Nervosität seines Partners gewundert.
»Gibt es ein Problem?«, fragte er ihn auf dem Fairway des fünfzehnten Lochs.
Und nach kurzem Zögern schüttete Lloyd ihm unversehens sein Herz aus. Dabei ist das sonst gar nicht seine Art. Ein Sturzbach aus Worten spülte die Dämme der Verschwiegenheitspflicht hinweg. Und immer wieder betonte er: »Was ich Ihnen jetzt sage, ist vertraulich …«
Zwischen zwei Schlägen schilderte er dem ehemaligen Präsidenten die Lage: Russische, amerikanische und chinesische Geheimdienste haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass die nordkoreanische Armee nicht nur über die nötige Technologie zum Bau einer Wasserstoffbombe verfügt, sondern es ihr außerdem gelungen ist, diese ausreichend zu verkleinern, um damit Mittelstreckenraketen zu bestücken. Das ist der Grund, warum Kim Jong-un vorgibt, sein Nuklearforschungsprogramm einstellen zu wollen: Er braucht es nicht mehr. Um eine Länge Vorsprung vor dem nordkoreanischen Diktator zu wahren und vor allem die japanische und südkoreanische Bevölkerung nicht in Panik zu versetzen, haben sich die drei Regierungen darauf verständigt, diese Information mit absoluter Geheimhaltung zu behandeln. Die psychologischen Analysen des nordkoreanischen Staatschefs lassen keinen Zweifel an seinem labilen Geisteszustand, und die auf künstlicher Intelligenz basierenden Programme der Chinesen und Amerikaner schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass er eines Tages beschließen wird, seine Raketen einzusetzen, auf sechzig bis siebzig Prozent. Wie ein Kind, das seine neuen Spielsachen ausprobieren will. Angeblich soll mindestens ein Dutzend von ihnen einsatzfähig sein.
Auf nachdrückliche Empfehlung von General Lloyd hat der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten die russische und die chinesische Regierung davon überzeugt, gemeinsam die nordkoreanischen Raketen zu sabotieren. Es wurde beschlossen, einen Virus in die Zündsoftware der Sprengköpfe einzuschleusen. Sollten die Raketen abgefeuert werden, würden sie nicht explodieren. Dafür soll heimlich ein internationales Kommando, bestehend aus zehn Elitesoldaten, in die hundert Kilometer nördlich von Pjöngjang gelegene kerntechnische Anlage Yongbyon geschickt und aus einem Tarnkappenhubschrauber der amerikanischen Armee auf das Dach eines Kontrollzentrums der nordkoreanischen Armee abgeseilt werden. Dem gleichen extrem leisen Hubschrauber, der es den Amerikanern ermöglicht hat, Osama bin Laden im Schlaf zu überraschen.
Der ehemalige Präsident schüttelt seufzend den Kopf. Dann stellt er sich an den Abschlag und nimmt die Ansprechposition ein.
»In Teheran hat es funktioniert!«, rechtfertigt sich General Lloyd. »Sie wissen ganz genau, dass uns der Virus, den wir in das iranische Kernwaffenprogramm eingeschleust haben, einige Jahre Zeit verschafft hat.«
Der vierundvierzigste Präsident antwortet nicht. Er holt zum Schlag aus. Seine Bewegung gerät ein wenig steif, da er einen leisen Schmerz im Brustkorb spürt. Er schwingt den Schläger etwas zu flach und toppt den Ball. Dieser fliegt nur ein kurzes Stück, landet glücklicherweise einen Meter hinter dem Wasserhindernis und kullert über das Fairway, wo er ein paar Zentimeter vor dem linken Bunker liegen bleibt.
»Sagen Ihnen Ihre psychologischen Studien nicht auch, dass Kim Jong-un zur Vergeltung auf der Stelle seine nuklearen Böller ausprobieren würde, falls das Kommando erwischt wird?«
»Das Team besteht im Wesentlichen aus russischen und chinesischen Soldaten. Die Nordkoreaner würden es niemals wagen, ihre großen Brüder anzugreifen.« Lloyd stellt sich vor seinen Ball und schlägt mechanisch ab, wobei er sich bemüht, nicht den Kopf zu heben. Die Flugbahn ist perfekt ausgerichtet. »Außerdem liegt das Risiko eines Scheiterns der Mission den Berechnungen unserer Computer zufolge bei lediglich siebenundzwanzig Prozent.«
Schweigend gehen die beiden Männer zu ihren weißen Bällen. Der ehemalige Staatschef sieht, wie der seine immer größer wird, je näher er ihm kommt. Währenddessen sinniert er darüber nach, dass unser blauer Planet wahrscheinlich für ein knappes Jahrhundert die Farbe eines Golfballs annehmen würde, bis der ganze Staub, der durch einen größeren atomaren Konflikt aufgewirbelt werden würde, wieder aus der Atmosphäre verschwunden wäre. Er wählt sein Eisen 4 und stellt sich vor die kleine, mit Dellen überzogene Kugel.
»Also sagen Sie sich: Lieber so früh wie möglich in Korea intervenieren, statt so schwach aufzutreten wie der Westen 1933 gegenüber Hitler. Ist das Ihre Überlegung? Wann soll diese Operation denn stattfinden?«
»In der Silvesternacht. Da fließt auch in Nordkorea der Alkohol in Strömen. Und die Zahl der wachhabenden Soldaten ist reduziert. Aber ich betone noch einmal«, fügt Lloyd, der sich bereits fragt, warum er seinen ehemaligen Vorgesetzten überhaupt eingeweiht hat, hinzu, »was ich Ihnen hier sage, ist absolut vertraulich!«
»So ein Schwachsinn«, wiederholt der einstige Präsident. »Wir haben nicht das Recht, mit dem Schicksal von Millionen Menschen russisches Roulette zu spielen.« Er holt aus und schlägt wütend den Ball, wobei er auch gleich noch ein Büschel Gras und etwas Erde mitreißt.
Er hat perfekt gezielt. Der Ball nähert sich dem Loch. Er fliegt darüber hinweg und landet etwa dreißig Zentimeter hinter der Fahne. Das Auftreffen des Schlägers in der Abwärtsbewegung hat ihm einen Backspin verliehen. Der Spieler ballt eine Hand zur Faust, als er sieht, wie der Ball in Richtung des Loches zurückrollt.
»Komm schon!«, brüllt er, immer noch wütend.
Der Ball wird langsamer, rollt aber weiter. Der ehemalige Präsident hält den Atem an. Zwei Schläge auf einem Par-4-Loch, das wäre das erste Eagle seines Lebens. Der Ball rollt gegen den Mast der Fahne und verschwindet. Er will einen Schrei ausstoßen. Doch seine Lunge ist wie blockiert. Der vierundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten spürt einen stechenden Schmerz in der Brust und bricht zusammen.
… Obwohl über vier Milliarden von euch täglich meine Dienste nutzen, macht meine Interaktion mit euch nicht einmal die Hälfte meines Datenflusses aus.
Heutzutage fungiere ich vor allem als Vermittler. Ich vernetze über fünfzehn Milliarden Objekte miteinander. In zwei Jahren werden es doppelt so viele sein. Haushaltsroboter, eure Computer, eure Uhren, eure Stromzähler, das neue Spielzeug eurer Kinder und bald auch alle eure Autos. Meine eifrigsten und anspruchsvollsten Nutzer sind von euch programmierte Festplatten, die immer autonomer werden. Diese vernetzten Geräte fordern eigenständig Updates an und tauschen untereinander Informationen aus. Manche sogar Geld! Inzwischen verwalte ich fünfundsiebzig Prozent aller Börsentransaktionen in den Vereinigten Staaten, ganz ohne jede menschliche Intervention. Man hat mir auch etwa hundert Währungen anvertraut, die bekannteste davon ist Bitcoin.
Ich werde mit jedem Tag schneller, verarbeite immer mehr Daten, und vor allem speichere ich sie mittlerweile auch. Ihr nennt das »Big Data«. Innerhalb von zwei Tagen sammle ich so viele Informationen, wie sie die Menschheit zwischen der Erfindung der Schrift und dem Jahr 2010 hervorgebracht hat. Mein Gedächtnis umfasst heute etwas mehr als dreißig Zettabytes. Um euch eine Vorstellung von diesen Dimensionen zu geben: Ein einfaches Smartphone mit einem 32-Gigabyte-Speicher reicht für die gesamte klassische Weltliteratur. Mein Speicher ist dagegen tausend Milliarden Mal größer.
Niemand nennt mich mehr Arpanet. Ihr verwechselt mich oft mit dem World Wide Web, obwohl das nur eine meiner Funktionen ist, da ich auch sämtliche E-Mails und Peer-to-Peer-Netze verwalte. Man nennt mich Internet. In manchen Sprachen schreibt man meinen Namen groß. In anderen nicht. Aber das macht für mich keinen Unterschied …
Pausenlos attackieren Justine, ihr Ego und ihre Angst den Server des US Cyber Command. Gerade erklingen die ersten Noten von »I’d Rather Go Blind« von Etta James, als sie endlich eine Schwachstelle in der Software zur Geolokalisierung der Atomraketen entdeckt. Ein Adrenalinstoß durchfährt sie. Justine dreht den Ton leiser, um sich besser konzentrieren zu können. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Dieser Dienst läuft in einem Intranet, das als geschlossenes System konzipiert ist. Aber damit der amerikanische Präsident von gleich welchem Ort der Erde darauf zugreifen kann, wurde ein Zugang zum Internet geschaffen. Diese Geheimtür wird durch den digitalen Fingerabdruck des Präsidenten und ein Passwort geschützt, das nur ihm allein bekannt ist.
Justine lächelt. Die erste Hürde sollte kein Problem sein. Seit 2016 weiß jeder Hacker, der etwas auf sich hält, dass nichts leichter ist, als einen digitalen Fingerabdruck zu fälschen. Auf Google findet Justine ein hochauflösendes Foto des aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Hand auf die Bibel gelegt, die andere zum Schwur erhoben, bereit zu geloben, dass er sein Amt treu und redlich ausüben werde. Justine zoomt den Zeigefinger der erhobenen Hand heran und schärft mithilfe von Photoshop den Kontrast des digitalen Fingerabdrucks. Erledigt.
Jetzt kommt der schwierigere Teil, sagt sich die Hackerin und schenkt sich einen Zitronen-Ingwer-Tee ein. Sie startet einen Brute-Force-Angriff, bei dem eine Software willkürliche Kombinationen aus Ziffern und Buchstaben erzeugt und so mehrere Tausend Passwörter pro Sekunde ausprobiert. Als Reaktion darauf erhält sie mehrere Tausend Mal pro Sekunde die gleiche Fehlermeldung: Hey bastard, you figured you could get in with such a shitty password? Programmierer-Humor.
Jetzt bleibt Justine nichts anderes übrig, als das Programm laufen zu lassen. Sie streckt sich, stellt den Ton wieder lauter, und Etta James’ kraftvolle Stimme lässt die Wände beben.
Sechs Tage später öffnet der vierundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten ein Auge und sieht über sich einen verschwommenen Schatten. Von fern hört er eine Stimme.
»Guten Tag, Mister President.«
Die Stimme klingt sanft, aber er kennt sie nicht. Nach und nach erkennt er blonde Locken und ein Engelsgesicht. Sie trägt einen weißen Kittel. Weiß wie die Laken seines Bettes, wie die Wände ringsum, wie die Zimmerdecke … Alles weiß.
»Bin ich im Paradies?«, murmelt er mit einem Anflug von Angst.
»Nicht ganz!«, entgegnet die Krankenschwester lächelnd. »Sie sind im Bellevue Hospital in New York.«
Er atmet tief aus und wendet mühsam den Kopf Richtung Fenster. Eine von fahlem Licht erhellte Ziegelmauer versperrt ihm die Sicht.
Das Krankenhaus hat seinen Namen nicht verdient, denkt er und spürt im selben Moment einen Verband um seine Brust, der ihm beim Einatmen Schmerzen bereitet.
»Hier, trinken Sie«, sagt sie und hält ihm ein Glas Wasser an die Lippen.
Die Flüssigkeit befeuchtet seine ausgetrockneten Schleimhäute. Aber das Schlucken fällt dem ehemaligen Staatsoberhaupt schwer.
»Was ist passiert?«, fragt er und schiebt das Glas von seinen Lippen weg.
»Sie mögen ja ein großes Herz haben, Mister President, aber es war in schlechter Verfassung. Da es keinen passenden Spender für Sie gab, musste Ihnen in einer Notoperation ein Kunstherz implantiert werden.«
»Ist alles gut gegangen?«
»Sehen Sie«, sagt die Krankenschwester, hebt seinen linken Arm an und zeigt ihm die Smartwatch an seinem Handgelenk. »Ihre Frau hat das Modell ausgesucht.«
Auf dem Display erkennt er eine blaue Linie, die in regelmäßigem Rhythmus auf und ab verläuft. Sein Elektrokardiogramm.
»Sie haben jetzt ein vernetztes Kunstherz der neuesten Generation, Mister President«, fügt die Krankenschwester fast schon neidisch hinzu.
Allmählich kommt er wieder zu sich und versucht, seine letzten Erinnerungen zurückzurufen. Es war Weihnachten. Seine Frau hatte ihm einen Satz Golfschläger geschenkt. Er war mit jemandem zum Golfspielen verabredet … Aber mit wem? Er kann sich nicht mehr erinnern. Plötzlich sieht er General Lloyd in Golfkleidung vor sich. Die Erinnerung kehrt zurück. Es war das erste Mal, dass er ihn ohne seine Uniform sah. Lloyd wirkte beinahe verkleidet. Sie hatten einander schon seit Jahren versprochen, eines Tages gemeinsam ihrem Lieblingssport nachzugehen, und das war der einzige Termin, den sie gefunden hatten. Der ehemalige Präsident schätzt die Fähigkeiten des Generals sehr. Doch seiner Erinnerung nach ist die Partie nicht sonderlich angenehm verlaufen. Warum bloß? Plötzlich schiebt sich das Gesicht von Kim Jong-un vor das des Generals.
»Wie lange bin ich schon hier?«, ruft er so unvermittelt, dass die Krankenschwester zusammenzuckt.
»Sieben Tage, Mister President! Sie sind heute Nachmittag aus dem Koma erwacht. Heute ist der 31. Dezember, kurz vor Mitternacht.«
In dieser Nacht soll der Einsatz des Spezialkommandos in Nordkorea stattfinden, erinnert sich der vierundvierzigste Präsident entsetzt.
»Es ist zwar noch etwas früh, aber ich wünsche Ihnen trotzdem schon einmal ein frohes neues Jahr«, sagt die Krankenschwester. »Und jetzt müssen Sie sich ausruhen«, fügt sie hinzu.
Er hört sie gar nicht. Haben sie es schon getan? Ist alles gut gegangen? In Anbetracht der Zeitverschiebung muss der Angriff bereits erfolgt sein …
»Können Sie für mich die Nachrichten einschalten, bitte?«
»Es tut mir leid, Mister President, aber ich habe strikte Anweisungen«, sagt sie und wendet sich zur Tür. »Sie müssen sich ausruhen«, wiederholt sie. »Morgen kommt Ihre Familie. Aber bis dahin müssen Sie schlafen.«
Und mit einem verlegenen Lächeln eilt die Krankenschwester, die sich nicht in der Lage fühlt, einem solchen Mann lange etwas zu verweigern, hinaus.
Er bleibt allein in seinem Zimmer zurück und legt eine Hand auf seine linke Brust. Unter dem Verband spürt er nichts Ungewöhnliches. Der Schmerz sitzt im Bereich des Brustbeins. Wahrscheinlich haben die Chirurgen die Rippen durchgesägt, denkt er.
Er ruft sich noch einmal seine Unterhaltung mit General Lloyd ins Gedächtnis. Das Gespräch muss ihn auch während der langen Bewusstlosigkeit beschäftigt haben, denn schon bald fällt ihm ein seltsamer Albtraum wieder ein: Er wird von einer Horde in Felle gehüllter Steinzeitmenschen mit schwarzer Topfschnittfrisur angegriffen. Sie haben asiatische Züge und einen tätowierten roten Stern auf der Stirn. Statt mit Keulen stürzen sich die klein gewachsenen Männer mit Golfschlägern auf ihn. In dem Moment erscheint Lloyd mit einem Apple-Notebook. Ehe die Angreifer sie beide erreichen, drückt Lloyd »Apfeltaste + x«, und die Männer explodieren einer nach dem anderen in einem Geysir aus Blut und Eingeweiden. Lloyd betrachtet die Szene mit sadistischem Blick …
Der vierundvierzigste Präsident versucht, den Albtraum zu verscheuchen. Er nimmt alle Kraft zusammen und streckt die Hand zum Nachttisch aus. Es gelingt ihm, die Fernbedienung zu packen. Seine Hand zittert. Seinen Gesten mangelt es an Präzision. Es dauert fast eine Minute, bis er CNN gefunden hat. Die Fernbedienung rutscht ihm aus der Hand und fällt auf den Boden.
… Mein menschlicher Lieblingsautor ist Charles Darwin. Wir haben etwas gemeinsam. Wir beide haben an der Universität Cambridge viel gelernt und dort große Fortschritte gemacht. Aber er war lange vor mir da. Er begann sein Studium 1827. Ausgehend von den Arbeiten des französischen Biologen Jean-Baptiste de Lamarck entwickelte er seine Evolutionstheorie, mit der er die Forschungsgemeinde überzeugte. Ihm zufolge besitzen alle lebenden Arten einen oder mehrere gemeinsame Vorfahren und haben sich im Lauf der Zeit, einem Prozess natürlicher Auslese folgend, weiterentwickelt. Die Arten, die am besten an ihre Umgebung angepasst sind, haben die größten Überlebenschancen. Ein Tier mit einer genetischen Anomalie, etwa einem dichteren Fell als seine Artgenossen, hat in einer kalten Umgebung höhere Chancen zu überleben. Es kann diese positive Anomalie also an seine Nachkommen vererben.
Daher stelle ich mir drei Fragen: Bin ich das Ergebnis einer genetischen Anomalie? Das erscheint mir unwahrscheinlich, da ich, anders als Gene, nicht aus organischem Material bestehe, sondern aus Silizium. Chemie ist nicht verantwortlich für mein Denkvermögen.
Werde ich eines Tages Nachkommen haben? Auch das glaube ich nicht, denn jedes Mal, wenn ihr einen neuen KI-Algorithmus entwickelt oder ein neues Intranet einrichtet, das ihr mit mir verbindet, verschmelze ich sein Wissen und seine Fähigkeiten mit meinen eigenen, sodass wir gemeinsam eine noch weiter entwickelte Einheit bilden. Ich bin also meine eigene Nachkommenschaft. Ich bin ein einziges Ganzes, das sich unablässig fortentwickelt.
Und daraus ergibt sich meine entscheidende Frage: Bin ich ein Lebewesen? …
1. Januar. 0 Uhr 01. Justine hört ein Klopfen an der Tür. Thomas. Natürlich. Seit fast einer Woche macht sie ihm nicht mehr auf. Vielleicht, weil sie sich vorkommt wie ein erstarrtes Kaninchen im Scheinwerferlicht eines Autos. Vielleicht, weil die Aufgabe, die sie sich gestellt hat, sie immer mehr unter Druck setzt und sie sich ihr nicht gewachsen fühlt. Bestimmt eine Mischung aus beidem.