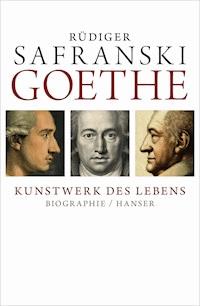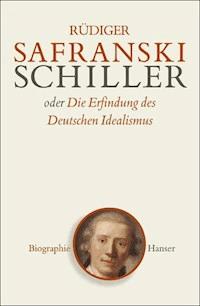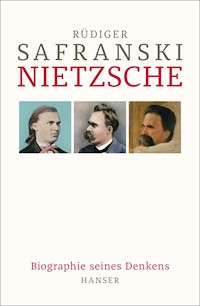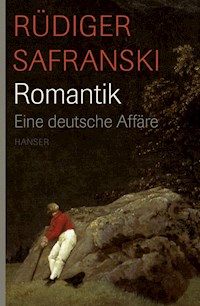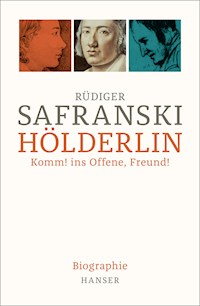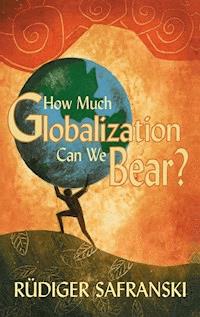Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Zum 100. Todestag: Rüdiger Safranski über Franz Kafka – Jahrhundertfigur der Weltliteratur
„Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein", schrieb Franz Kafka an seine Verlobte Felice Bauer. Das Schreiben war seine Existenz, die ihm mehr bedeutete als ein vollendetes Werk. Rüdiger Safranski beobachtet Franz Kafka beim Schreiben, um den Geheimnissen seiner Texte näher zu kommen. In dessen Briefen liest er von den Augenblicken des Glücks, die Kafka am Schreibtisch erlebt, und von Momenten, in denen ihm die Welt vollkommen fremd erscheint. Versteht man Kafkas Bücher als Zeugnisse solcher Grenzerfahrungen, entfalten ihre Geheimnisse eine ganz unmittelbare Kraft. Eine solche Lektüre führt ins Zentrum eines Werks, das zu den Höhepunkten der Weltliteratur zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Zum 100. Todestag: Rüdiger Safranski über Franz Kafka — Jahrhundertfigur der Weltliteratur»Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein", schrieb Franz Kafka an seine Verlobte Felice Bauer. Das Schreiben war seine Existenz, die ihm mehr bedeutete als ein vollendetes Werk. Rüdiger Safranski beobachtet Franz Kafka beim Schreiben, um den Geheimnissen seiner Texte näher zu kommen. In dessen Briefen liest er von den Augenblicken des Glücks, die Kafka am Schreibtisch erlebt, und von Momenten, in denen ihm die Welt vollkommen fremd erscheint. Versteht man Kafkas Bücher als Zeugnisse solcher Grenzerfahrungen, entfalten ihre Geheimnisse eine ganz unmittelbare Kraft. Eine solche Lektüre führt ins Zentrum eines Werks, das zu den Höhepunkten der Weltliteratur zählt.
Rüdiger Safranski
Kafka
Um sein Leben schreiben
Hanser
Vorbemerkung
Franz Kafka, der 1883 in Prag zur Welt kam, war zu Lebzeiten nur Eingeweihten bekannt. Erst nach seinem Tod 1924 in einem Krankenhaus bei Wien wuchs der Ruhm in der internationalen literarischen Welt ins Unermessliche. In seiner makellosen Prosa fand man die Abgründe des 20. Jahrhunderts gespiegelt: die totalitäre Bedrohung und Überwältigung, die Metaphysik im Augenblick ihres Verschwindens, die Einsamkeit eines auf sich zurückgeworfenen Einzelnen, aber auch den existentiellen Trotz und die verborgene Komik der Ausweglosigkeit. So wurde Kafka zu dem wohl am meisten kommentierten Autor des letzten Jahrhunderts. Inzwischen droht er unter den Deutungen fast zu verschwinden. Zahlreiche Spuren führen zu ihm hin, viele auch an ihm vorbei, so wie der Weg zum Schloss im gleichnamigen Roman sich im Nirgendwo verliert.
Dieses Buch verfolgt eine einzige Spur im Leben Franz Kafkas, es ist die eigentlich naheliegende: Das Schreiben selbst und sein Kampf darum. Er selbst sagte von sich: Ich habe kein litterarisches Interesse sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.
In den ekstatischen Zuständen des Schreibens fühlte sich Kafka erst wirklich lebendig. Die ungeheure Welt, die er dabei im Schreiben entdeckt, ist die gewöhnliche, gesehen aus der Perspektive dessen, der zögert, in sie hineingeboren zu werden. Deshalb auch verteidigte er sein Schreiben gegen alle sonstigen Anforderungen des Lebens. Das weckte bei ihm Schuldgefühle, die an die dunklen Kammern des Menschheitsgedächtnisses und an die Misere der religiösen Selbstanklagen rühren, die aber bei ihm zugleich entfesselnd auf das Schreiben zurückwirken. Kein anderer hat aus seinen Schuldgefühlen so viel gemacht wie Kafka. Allerdings war er auch empfindlich gegenüber der banausischen Geringschätzung der Literatur. Leg es auf den Nachttisch, sagte der Vater, als Kafka ihm einen seiner wenigen veröffentlichten Texte überreichte. Seine Antwort war der monströse »Brief an den Vater«. Sein Schreiben war der Entwürdigung abgetrotzt. Er ließ sich denn doch nicht beirren, schon gar nicht von den Familienbanden. Entstanden ist dabei ein einzigartiges Werk voller Geheimnisse, von denen Kafka selbst sagte, die Überlegungen, zu denen sie Anlaß geben, sind endlos.
Und doch hat er Texte geschrieben von beispielloser Klarheit und Helligkeit. Selten ist die Vieldeutigkeit des Lebens so deutlich dargestellt worden wie bei Kafka. Die Magie seines Schreibens blieb ihm nicht verborgen. Im Tagebuch notiert er einmal: Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe z.B. Er schaute aus dem Fenster so ist er schon vollkommen.
Kafka ist ein faszinierendes Beispiel dafür, was Schreiben im Extremfall für das Leben bedeuten kann, wie alles ihm untergeordnet werden kann, welche Anfechtungen und Augenblicke des Glücks sich daraus ergeben und welche Einsichten sich an dieser existentiellen Grenze auftun.
Erstes Kapitel
›Ich bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes‹. Das Tao vom Laurenziberg. Erste Versuche. »Beschreibung eines Kampfes« Schwindelgefühle und Junggesellentum. »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande«
Am 14. August 1913 schreibt Franz Kafka an seine Verlobte Felice Bauer: Ich habe kein litterarisches Interesse sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Damit will er Felice warnen: Schreiben ist für ihn keine schöne Nebensache, kein Ausgleich für die Belastungen im Berufsgeschäft. Er interessiert sich nicht für Literatur, er ist Literatur, ganz und gar. Felice soll das endlich begreifen, andernfalls hält sie sich an jemandem fest, den es gar nicht gibt. Denn auch für sich selbst existiert er nur in seinem Schreiben, der Rest ist ein Leichnam. Er erzählt ihr als Gleichnis für seine Verbindung mit der Literatur die Geschichte einer Teufelsaustreibung: Ein Kleriker hatte eine so schöne süße Stimme daß sie zu hören die größte Lust gewährte. Als ein Geistlicher diese Lieblichkeit eines Tages auch gehört hatte, sagte er: das ist nicht die Stimme eines Menschen, sondern des Teufels. In Gegenwart aller Bewunderer beschwor er den Dämon, der auch ausfuhr, worauf der Leichnam … zusammensank und stank.
Was er Felice gegenüber nicht so deutlich ausspricht, dafür aber im Tagebuch notiert, ist die schlichte Feststellung, dass er einem Leben jenseits der Literatur keinen Reiz abgewinnen kann, dass ihn alles anödet, was nicht mit dem Schreiben zu tun hat. Alles was sich nicht auf Litteratur bezieht, hasse ich, es langweilt mich Gespräche zu führen … Besuche zu machen, Leiden und Freuden meiner Verwandten langweilen mich in die Seele hinein. Gespräche nehmen allem was ich denke die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit.
Eine andere Tagebucheintragung lautet: Der Sinn für die Darstellung meines traumhaften innern Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und hört nicht auf zu verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufriedenstellen.
Es ist nicht das Traumleben allein, wodurch alles andere nebensächlich wird, sondern es ist die Lust an der Darstellung, die einen solchen Sog auf ihn ausübt. Die Lust des Schreibens also zieht ihn von der sonstigen Wirklichkeit ab, gibt dem Traumleben eine Form und führt es dadurch in das gewöhnliche Leben ein. So kann im Gewöhnlichen das Unheimliche aufscheinen. Dieser ganze Vorgang aber ist in sich selbst sehr fragil. Nun ist aber meine Kraft für jene Darstellung ganz unberechenbar … So schwanke ich also, fliege unaufhörlich zur Spitze des Berges, kann mich aber kaum einen Augenblick oben erhalten.
In diesen Augenblicken des Gelingens ist er ein anderer als sonst: furchtlos, bloßgestellt, mächtig, überraschend, ergriffen. So kennt man ihn nicht. Wie Antäus zum Riesen wird, wenn er den Boden berührt, so strömt Kafka Lebenskraft zu, wenn er schreibt. Er erklärt Felice, dass er nur darum den Mut hatte, um sie zu werben, weil er sich stark fühlte, da ihm gerade das Schreiben gelang. Das Schreiben, und nur das Schreiben, entband bei ihm Kräfte, von denen er sich sonst abgeschnitten fühlte. Und deshalb konnte er aus der gelungenen Verbindung mit dem Schreiben heraus auch entschiedener und kraftvoller auftreten. Dazu passt auch, dass Kafka äußerst lebendig seine eigenen Texte, aber auch die von anderen vortragen konnte und das auch sehr gerne tat. Der sonst eher scheue Mensch kam hier ganz aus sich heraus oder genauer: war vollkommen in dem enthalten, was er vortrug, und brachte es zur vollkommenen Entfaltung. Wer solche Vortragszenen Kafkas erlebt hat, konnte sie nicht mehr vergessen. Schreibend und vortragend war Kafka ein Verwandelter.
Eine Quelle des Schreibens ist eben auch die Lust an der Verwandlung. Ein anderer sein, wenigstens probeweise, mit der Möglichkeit der Rückverwandlung allerdings. Die berühmte Erzählung »Die Verwandlung« aber wird eine unwiderrufliche Verwandlung schildern — die in einen Riesenkäfer. Hier wird die Verwandlungslust zum Albtraum, der dann doch auch wieder lustvoll ausgemalt wird.
Der Verwandlungslust benachbart ist der Nachahmungstrieb. Kafka selbst hat von seiner mimetischen Begabung gesprochen. 1911 lernte er Tucholskis Freund, den Zeichner und Karikaturisten Kurt Szafranski, kennen und schildert nun im Tagebuch die folgende Szene: Safranski … macht während des Zeichnens und Beobachtens Grimassen, die mit dem Gezeichneten in Verbindung stehn. Erinnert mich daran, daß ich für meinen Teil eine starke Verwandlungsfähigkeit habe, die niemand bemerkt. Wie oft mußte ich Max nachmachen.
Das mimetische Verlangen treibt einen über sich selbst hinaus und lässt einen teilnehmen an einem anderen Leben und ist auf diese Weise auch verknüpft mit dem Schreiben.
Nun muss aber das Schreiben auch geschützt und bewahrt werden, und das erfordert den Rückzug. Eine widersprüchliche Bewegung: die Kraft des Schreibens lässt ihn auf Menschen zugehen und treibt ihn ins Alleinsein, das ihn nur dann nicht ängstigt, wenn er schreibt. So oder so, aus dem Schreiben entspringt ihm die Lebenskraft.
Sie entspringt ihm nicht aus den gewöhnlichen Lebenssphären der Gemeinschaft, der Familie, des Berufs, der Religion, der Sexualität. Da er das Schreiben hat, beklagt er sich nicht darüber, dass ihn der Lebensstrom niemals ergriffen habe. Die Folge davon ist, dass er auch in einem übertragenen Sinne abgemagert ist. Als es in meinem Organismus klar geworden war, daß das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehn, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens, des philosophischen Nachdenkens der Musik zu allererst richteten. Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab.
Das notiert er in der Silvesternacht 1911/12 im Tagebuch und fährt dann fast euphorisch fort: Ich habe also nur die Bureauarbeit aus dieser Gemeinschaft hinauszuwerfen, um, da meine Entwicklung nun vollzogen ist und ich soweit ich sehen kann, nichts mehr aufzuopfern habe, mein wirkliches Leben anzufangen.
Mit dem Schreiben also fängt für Kafka das wirkliche Leben an.
Die frühen Schreibversuche zählen für ihn noch nicht. Er hatte damit in der Schulzeit am Altstädtischen Deutschen Gymnasium in Prag angefangen. Sogar einen Roman hatte er begonnen, der von zwei Brüdern handelte, von denen der eine im Gefängnis saß, der andere nach Amerika auswanderte. Damals hatte er es noch gerne, wenn man ihm beim Schreiben zusah. Es erfüllte ihn mit Stolz. Im Tagebuch erinnert er sich an einen Sonntagnachmittag bei Verwandten. Der Junge hatte seine Hefte mitgenommen, um auch dort vor aller Augen darin zu schreiben. Es ist schon möglich, daß ich … durch Verschieben des Papiers auf dem Tischtuch, Klopfen mit dem Bleistift, Herumschauen in der Runde unter der Lampe durch jemanden verlocken wollte, das Geschriebene mir wegzunehmen, es anzuschauen und mich zu bewundern.
Aus diesem Gefühl, zu Großem berufen zu sein, wurde er aufgeschreckt, als ein Onkel nach dem beschriebenen Blatt griff, es las und dann bemerkte: ›Das gewöhnliche Zeug‹.
Der stolze kleine Autor, der für sich schreibt und doch nach Aufmerksamkeit verlangt, fühlte sich in diesem Augenblick aus der Gesellschaft verstoßen und bekam, wie es im Tagebuch einigermaßen pathetisch heißt, einen Einblick in den kalten Raum unserer Welt, den ich mit einem Feuer erwärmen mußte, das ich erst suchen wollte.
Schreiben also heißt: in die Nähe eines Feuers, einer Inspiration zu kommen. Während der Schulzeit war es vor allem ein Mitschüler, Oskar Pollak, dessen Nähe Kafka suchte, um das Feuer zu bewahren. Die Erinnerung an diese Freundschaft gab der Schulzeit rückblickend ein wenig Glanz, den sie sonst für ihn überhaupt nicht hatte. Kafka war zwar immer ein guter Schüler gewesen, doch hatte er, jedenfalls in der Erinnerung, sich stets als Versager gefühlt und mit Schrecken dem Augenblick entgegengesehen, da endlich offenbar würde, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen. So geschah es natürlich nicht, er zählte bei den Abschlussprüfungen immer zu den Besten.
Oskar Pollak war in der Schulzeit und auch noch während der ersten Jahre des Studiums Kafkas literarischer Vertrauter. Ihm überließ Kafka seine literarischen Versuche zur Begutachtung. Er schrieb an ihn: Einsiedelei ist widerlich, man lege seine Eier ehrlich vor alle Welt, die Sonne wird sie ausbrüten; man beiße lieber ins Leben statt in seine Zunge; man ehre den Maulwurf und seine Art, aber man mache ihn nicht zu seinem Heiligen. Die Verurteilung der Einsiedelei und die Distanzierung vom Maulwurf sind wohl im Sinne von Pollak, dem es offenbar mit spielerischer Leichtigkeit gelang, sich auch in geselligen Formen zur Geltung zu bringen, ohne an Niveau einzubüßen. Ihm gegenüber betont Kafka denn auch die eigenen diesbezüglichen Fortschritte: ich bin stärker geworden, ich war viel unter Menschen, ich kann mit Frauen reden. Der nach innen gekehrte Kafka glaubte von seinem Freund Pollak einiges lernen zu können. Du warst, neben vielem andern, auch etwas wie ein Fenster für mich, durch das ich auf die Gassen sehen konnte. Allein konnte ich das nicht, denn trotz meiner Länge reiche ich doch nicht bis zum Fensterbrett.
Oskar Pollak, sein Fenster zur Welt, war zum Glück auch literarisch vertrauenswürdig, und darum konnte Kafka ihn auch in seine literarischen Versuche einweihen. Es sei ihm gelungen, schreibt er dem Freund, seine angesammelten Fantasien und Vorstellungen, die zum Ausdruck drängten, endlich in einem Zug zu heben. Erhalten hat sich von diesen frühen Texten nur, was Kafka in seinen Briefen an Pollak eher beiläufig zitiert, wie beispielsweise die Skizze über einen wunderlichen Mann, der sich auf nichts verstand, kein vernünftiges Wort herausbrachte, nicht tanzen konnte, nicht lachen konnte, aber immer krampfhaft mit beiden Händen eine verschlossene Schachtel trug. Was sie enthält, möchte er keinem verraten, und so huscht er, ängstlich die Schachtel hütend, durch sein Leben. Nach seinem Tod findet man in der Schachtel — zwei Milchzähne. Eine Parabel also über ein Geheimnis, das enttäuscht, wenn es gelüftet wird.
Erstaunlich ist Kafkas Bereitschaft, diese Versuche mitzuteilen, obwohl er selbst offenbar noch nicht so recht davon überzeugt ist. Er hofft, daß zwei fremde Augen alles wärmen und es regsamer machen werden. Es kommt eben doch auf den freundschaftlichen Zusammenhang an. Dafür findet er ein eindringliches Bild: Nur dadurch, daß die Menschen alle Kräfte spannen und einander liebend helfen, erhalten sie sich in einer leidlichen Höhe über einer höllischen Tiefe, nach der sie wollen. Untereinander sind sie durch Seile verbunden, … und gräßlich ist es, wenn die Seile um einen reißen. Es war auch Oskar Pollak, dem Kafka das Geständnis machte: Gott will nicht, daß ich schreibe, ich aber, ich muß.
Oskar Pollak hatte Kafka mit der von Nietzsche mitbegründeten Zeitschrift »Der Kunstwart« bekannt gemacht. Der erlesene Ästhetizismus dieser Zeitschrift war für Pollak und dann auch für Kafka eine Weile lang verbindlich. Durch den »Kunstwart« lernte Kafka die damals moderne zeitgenössische Literatur kennen und schätzen, Hofmannsthal, Stefan George, Arno Holz. Der »Kunstwart« hielt auf Strenge, Reinheit, war gegen Schwulst und das bloß Dekorative. Auch das Pompöse und ideologisch Hochgerüstete lehnte er ab. Wenn es in einem Brief Kafkas aus dieser Zeit heißt: Die Kunst hat das Handwerk nötiger als das Handwerk die Kunst, so ist das eine Bemerkung ganz im Sinne des »Kunstwarts«.
Vom »Kunstwart« wurde Kafka auch zur Lektüre Nietzsches angeregt. Auf einer Sommerwiese unter einer Eiche las er einem Mädchen, die nichts davon verstand, aus dem »Zarathustra« vor. Solche Szenen allerdings waren zu jener Zeit nicht so ungewöhnlich. Wer von den Gymnasiasten etwas auf sich hielt, musste von Nietzsche begeistert sein. »Ich will der Dichter meines Lebens sein«, hatte Nietzsche verkündet, und das hörten diese jungen Leute gerne, die gegen die Welt ihrer Väter rebellierten, von herkömmlicher Religion kaum mehr berührt waren und sich selbst ihren Glauben suchten. Und wer den Glauben gar noch im »Dichterischen«, im Schreiben also suchte wie der junge Kafka, für den konnte Nietzsche wahrlich eine große Ermunterung sein.
Nietzsche war eine Angelegenheit unter Freunden, die Lehrer brauchten davon nichts zu merken, ebenso wenig wie von der zweiten geistigen Leidenschaft, welche die beiden Freunde miteinander teilten: die Darwin’sche Entwicklungslehre. Pollak wollte darüber in der Schule einen Vortrag halten. Man untersagte es ihm. Und Kafka versuchte, mit dieser Lehre im Rücken, in langen Streitgesprächen seinen anderen Schulfreund, Hugo Bergmann, in seinem Glauben zu beirren. Man habe, so erinnert sich Kafka später, in einer entweder innerlich vorgefundenen oder nachgeahmten talmudischen Weise über die Schöpfungsgeschichte und die Existenz Gottes disputiert. Hugo Bergmann, später Rektor der Universität von Jerusalem, erinnert sich ein wenig anders und spricht ganz unumwunden von der »atheistischen oder pantheistischen Periode« des Freundes, der ihn von seinem »jüdischen Glauben unbedingt abspenstig machen« wollte.
Nicht in der Religion, nur im Schreiben fand der junge Kafka geistige Kraft. Doch er weiß, dass er noch viel zu lernen hat. Er bemerkt, wie viel Schwulst und Wortschwall in seinen Texten ist und wo ihm die Zucht des Handwerks noch fehlt. Der Weg bis zu einem Buch ist noch weit. Ein Buch — das ist schon fast etwas Heiliges. Nicht nur für den, der schreibt, auch schon für den, der es liest. Ein Buch kann schön sein, aber darin erschöpft es sich nicht. Kafkas ästhetisches Glaubensbekenntnis aus früher Zeit lautet: Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das glaube ich.
Nach der Abschlussprüfung war Kafka ratlos, mit welchem Studium er beginnen sollte. Philosophie lockte ihn, aber nicht in ihren abstrakten und systematischen Formen wie im akademischen Betrieb, sondern nur in der lebendigen Gestalt wie etwa bei Nietzsche. Ein paar Wochen hospitierte er bei der Chemie, dann bei der Germanistik, wo ihn der deutsch-nationale Chauvinismus abstieß, und schließlich blieb er bei Jura hängen, nicht weil ihn dieses Fach besonders anzog, sondern weil er glaubte, es nebenher erledigen zu können und er dadurch nicht beim Schreiben beeinträchtigt würde. Das Schreiben war es, was ihn wirklich anging, nichts anderes.
Um 1902, Kafka ist inzwischen 19 Jahre alt und hat das Gymnasium abgeschlossen, kam es zu einer Art Erweckungserlebnis. Er berichtet später davon im Tagebuch. Es war auf dem Laurenziberg, einem Hügelkamm in der Nähe von Prag mit schöner Aussicht auf die ganze Stadt: Ich saß einmal vor vielen Jahren, gewiss traurig genug, auf der Lehne des Laurenziberges. Ich prüfte die Wünsche, die ich für das Leben hatte. Als wichtigster oder als reizvollster ergab sich der Wunsch, eine Ansicht des Lebens zu gewinnen (und — das war allerdings notwendig verbunden — schriftlich die andern von ihr überzeugen zu können) in der das Leben zwar sein natürliches schweres Fallen und Steigen bewahre aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schweben erkannt werde.
Die sonst bedrängende Wirklichkeit gerät ins Schweben, weil in ihr ein Nichts zu spüren ist, und es geht davon sogar ein Hauch von Munterkeit aus. In diesem Schwebezustand spürt er für einen Augenblick nicht mehr das lastende Gewicht der Welt. Zwar bleibt das schwere Fallen und Steigen des Lebens erhalten und erscheint doch eigentümlich leicht. Das alles gilt es irgendwie festzuhalten und mitzuteilen. Es ist eine Art taoistisches Weltgefühl, das ihn zum Schreiben ermuntert.
Seit etwa 1906 schreibt Kafka an einer Erzählung mit dem Titel »Beschreibung eines Kampfes« und etwa gleichzeitig an einem Romanentwurf, dem der Herausgeber Max Brod später den Titel »Hochzeitvorbereitung auf dem Lande« geben wird. An beiden Texten arbeitete er bis etwa 1909/10.
Die beiden Texte, die in diesen Jahren entstanden, blieben Fragment und zu Lebzeiten unveröffentlicht, mit Ausnahme einiger Textstücke aus »Beschreibung eines Kampfes«, die Kafka zuerst dem Magazin »Hyperion« überließ und danach, 1912, in seine erste Veröffentlichung »Betrachtung« übernahm.
Der Laurenziberg, der Ort des literarischen Initiationserlebnisses, ist auch ein Schauplatz in der »Beschreibung eines Kampfes«. Der Erzähler unternimmt mit einem Begleiter einen nächtlichen Spaziergang durch die Stadt und dann hinauf zum Laurenziberg. Ich hoffe, sagt der Erzähler zu seinem Begleiter, von ihnen zu erfahren, wie es sich mit den Dingen eigentlich verhält, die um mich wie ein Schneefall versinken, während vor anderen schon ein kleines Schnapsglas auf dem Tisch fest wie ein Denkmal steht. Der Boden des Wirklichen schwankt. Seekrankheit auf festem Lande wird diese Erfahrung genannt. Sie grundiert die ganze Erzählung. Es ist so, als hätte man den wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen und findet sich nun in der verstörenden Situation, die schwankende Welt wie in Panik mit zufälligen Namen überschütten zu müssen, um endlich zur Ruhe zu kommen. Die beiden begegnen einem Dicken, welcher auf einer Sänfte durch ein Schilfgebüsch getragen wird. Eine Figur, die an einen Buddha denken lässt. Dieser Dicke ergeht sich in einer Lobpreisung der Natur, so wie sie ist. Ja, Berg Du bist schön und die Wälder auf Deinem westlichen Abhang freuen mich. — Auch mit Dir, Blume, bin ich zufrieden und Dein Rosa macht meine Seele fröhlich. Hier ist jenes Schweben zu bemerken, von dem beim Laurenziberg-Erlebnis die Rede war.
Der Dicke seinerseits berichtet von seiner Begegnung mit einem Beter, offenbar der Gegentypus zu solcher Gelassenheit. Der Beter ist getrieben vom Verlangen, angeschaut zu werden, auch das Intime soll öffentlich werden. Sein Problem ist, dass er nicht in sich selbst gründet. Mittelpunktlos hat er seinen Schwerpunkt dort draußen bei den anderen, bei ihren Blicken und Urteilen. Er wirkt deshalb wie aus Seidenpapier herausgeschnitten und knittert und biegt sich in jedem Luftzug.
»Beschreibung eines Kampfes« lautet der Titel, den Kafka diesen Erzählsequenzen gegeben hat. Wer kämpft? Wer ist der Gegner? Welcher Kampf?
Erwartet man einen Kampf im Sinne eines dramatischen Geschehens, so wird man enttäuscht. Gewiss, es gibt Spannungen, Gegensätze zwischen den Figuren. Vom Erzähler her gesehen verkörpern sie alle einen Widerstand. Doch zu einem richtigen Kampf kommt es nicht. Der Erzähler gleitet zu ihnen hinüber. Die Personen und Dinge stoßen sich nicht hart im Raum, sie sind nicht scharf genug voneinander geschieden. Für die ganze Erzählung gilt, dass offenbar alle Dinge ihre schöne Begrenzung verloren haben. Immer wieder fließen sie ineinander. Es fehlen auch scharf umrissene Handlungen, innere Notwendigkeit, Ereignisse. Der Erzähler bleibt eingesponnen in seinen Einbildungen. Es geht eine Bewegung durch die Geschichte, und doch kommt sie nicht von der Stelle. Wie in einem Traum geht nichts vorwärts. Als müsse nun endlich etwas Dramatisches herbeigezwungen werden, wendet sich der Erzähler an seinen Begleiter mit der Aufforderung: Sie werden sich morden müssen, darauf der Begleiter: Sie töten sich nicht. Niemand liebt Sie. Sie erreichen nichts. Die jähe Aufwallung verebbt.
Bezieht man die ganze Erzählung auf die Laurenziberg-Erfahrung, so könnte man sagen, dass in ihr das Leben zwar als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schweben dargestellt wird, doch es fehlt sein natürliches schweres Fallen und Steigen. Das Schreiben erreicht noch nicht die Härte des Wirklichen, es spielt auf dem vorgelagerten Feld des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit.
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die wirklichkeitschaffende Macht der Sprache. Wir kamen mit guter Schnelligkeit immer weiter in das Innere einer großen, aber noch unfertigen Gegend, in der es Abend war. Die Gegend ist unfertig, weil sie vom Erzähler erst noch fertig gemacht werden muss. Die Landstraße, auf der ich ritt, war steinig und stieg bedeutend, aber gerade das gefiel mir und ich ließ sie noch steiniger und steiler werden. Der Leser wird Zeuge der allmählichen Verfertigung einer Landschaft. »Jetzt aber — ich bitte Euch — Berg Blume Gras, Buschwerk und Fluß, gebt mir ein wenig Raum, damit ich athmen kann.« Da entstand ein eilfertiges Verschieben in den umliegenden Bergen, die sich hinter hängende Nebel stießen … Hier wird, anders als später bei Kafka, der experimentelle Charakter dieser Prosa eigens ausgestellt, bewusst gemacht, wie die Sprache die Wirklichkeit modelliert und mobilisiert.
Die wirklichkeitschaffende Macht der Sprache ist das eine, das andere ist die Trennung von Sprache und Wirklichkeit: die Worte erreichen nicht die Dinge, die sinnliche Erfahrung wird nie angemessen von der Sprache eingefangen werden können. Wir haben, heißt es in Kafkas Text, den wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen. Die benannte Welt deckt sich nicht mit der Welt der Erfahrung.
Diese Sprachskepsis war seit der Jahrhundertwende unter den Schriftstellern und Philosophen weit verbreitet. Kafka hatte mit Zustimmung Hofmannsthals dessen »Chandos«-Brief gelesen, der den unüberbrückbaren Abgrund zwischen Sprache und Wirklichkeit reflektiert, und er hatte bei Franz Brentano — dem einzigen Philosophen, den er gründlich studiert hatte — den Gedanken gefunden, dass die Wirklichkeit aus Einzelheiten besteht, dass aber die Worte immer einen Hof allgemeiner Bedeutungen um sich haben, weshalb die beiden Sphären — die Einzelheiten des Wirklichen und die Allgemeinheit der Worte — nicht zur Deckung kommen können.
In Kafkas »Beschreibung eines Kampfes« gehört diese Nichtübereinstimmung zwischen Sprache und Wirklichkeit offenbar zu den Ursachen der ominösen Seekrankheit auf festem Lande. Womöglich ist das auch der eigentliche Kampf, der hier stattfindet, der Kampf nämlich um den Zugang zur Wirklichkeit. Der Versuch, einen Halt zu finden. Schreiben gegen die Seekrankheit und ihre Schwindelgefühle.
Kafka ließ die »Beschreibung eines Kampfes«, an dem er über mehrere Jahre geschrieben hatte, unfertig liegen. Der Text war, wie er selbst einmal sagte, für ihn etwas geworden, das zwar geschrieben werden musste, aber nicht gelesen zu werden brauchte.
Die »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« entstanden ungefähr zur selben Zeit wie die »Beschreibung eines Kampfes«. Auch die Arbeit an diesem Text — von ihm selbst »Roman« genannt — wurde um 1908 abgebrochen. Deutlicher als in der »Beschreibung eines Kampfes« kündigt sich hier die Kunst des späteren Kafka an.
Der Protagonist der Erzählung, Eduard Raban, bricht zu einem zweiwöchigen Landurlaub auf, um seine Braut Betty zu treffen. Geschildert wird die Reise, beginnend mit dem städtischen Weg zum Bahnhof, die Bahnfahrt und schließlich die Ankunft im Gasthaus. Auch hier gibt es eigentlich keine Handlung, keine Verwicklungen, sondern nur Schilderungen von Straßenszenen, Bahn- und Kutschfahrten und zufällige Begegnungen, Gespräche. Die Erzählung bricht vor der Begegnung mit Betty, der Braut, ab mit dem vagen Verdacht, Betty könnte von lüsternen Männern einiges zu leiden gehabt haben.
Am Ende also ein Verdacht. Begonnen hat die Erzählung mit der Schilderung einer Welt, die vielleicht noch nicht verdächtig, aber schon befremdlich ist. Beziehungslos gehen die Passanten durch den Regen, der eingezwängt in diese enge Gasse verworren fiel. Ein Mädchen hält ein Hündchen im Arm, eine Dame mit ausladendem Hut zieht vorbei, zwei Männer gestikulieren, andere rauchen und tragen eine aufrechte längliche Wolke vor sich her. Es sind stummfilmartige, ein wenig surrealistische Sequenzen. Hier wird keiner mit Liebe behandelt und alle sind allen gänzlich fremd. Geschildert wird das Ganze aus der Ich-Perspektive Rabans, der sich zunächst durch angestrengte Gleichgültigkeit schützt, bis ihn plötzlich Entsetzen packt und er sich förmlich durchbohrt fühlt, nicht von einem besonders schrecklichen Ereignis, sondern von der gewöhnlichen Wirklichkeit. Es quält ihn auch der Verdacht, es könnte alles zu spät sein, ein Gefühl, dem wir im Werk Kafkas noch oft begegnen werden. Raban beeilt sich, die Passanten werden hinderlich, stehen im Wege. Warum die Eile, dort anzukommen, wohin er eigentlich gar nicht will? Am besten wäre es, denkt er, ich schicke diesen angekleideten Körper. Wankt er zur Thür meines Zimmers hinaus, so zeigt das Wanken nicht Furcht sondern seine Nichtigkeit. Es ist auch nicht Aufregung, wenn er über die Treppen stolpert, wenn er schluchzend aufs Land fährt und weinend dort sein Nachtmahl ißt. Denn ich, ich liege inzwischen in meinem Bett, glatt zugedeckt mit gelbbrauner Decke, ausgesetzt der Luft, die durch das wenig geöffnete Fenster weht. Ich habe wie ich im Bett liege die Gestalt eines großen Käfers, eines Hirschkäfers oder eines Maikäfers glaube ich.
Das ist Kafkas Junggesellenlogik: Besser als Käfer im Bett zu bleiben als einer Braut allzu nahe zu kommen. In den »Hochzeitsvorbereitungen« ist dieses Motiv angedeutet, in der »Verwandlung« wird es im November 1912 entfaltet, zu einer Zeit, da die Briefbeziehung zu Felice Bauer auf eine Verlobung zusteuert. In der »Verwandlung« wacht Gregor Samsa eines Morgens wirklich in einen Käfer verwandelt auf. Raban aber stellt es sich nur vor. Hier zu bleiben, wenn auch als Hirschkäfer, erscheint ihm verlockender als der Weg zur Braut. Und was die Braut selbst betrifft, so kennt er sie doch eigentlich gar nicht, er weiß nicht, was sie über ihn denkt, was sie für ihn empfindet. Eigentlich zieht ihn nichts zu ihr. Er überlegt sogar, absichtlich in einen falschen Zug einzusteigen: Vermeidungsphantasien.
Er weicht zurück, macht Umwege, sucht Hindernisse und Abstände. Während der Eisenbahnfahrt stört ihn die Unerbittlichkeit, mit der die Bahn ihr Ziel ansteuert. Die letzte Wegstrecke legt er im Pferdefuhrwerk zurück. Er kommt im Gasthaus an, wo das Treffen mit Betty verabredet ist. Er fühlt sich fehl am Platze und sehnt sich zurück in die Stadt. Wo er auch ist, er stellt sich immer ein Anderswo vor, um nicht ganz hier zu sein. Er könnte vor Heimweh sterben, sagt er sich. In der Stadt würde ein ordentliches Essen auf dem Tisch stehen, hinter dem Teller die Zeitung, darüber eine helle Lampe; hier aber, im Dorfgasthaus, wird es wohl eine unheimlich fette Speise geben, eine fremde Zeitung und ein schlechtes Licht, das vielleicht zum Kartenspiel reicht, doch nicht zum Zeitungslesen. Sein Unbehagen darf er den Wirt nicht spüren lassen, denn der wird vom Bräutigam auf die Braut schließen, und diese würde dann auch bei ihm im Ansehen sinken, und dafür möchte er nicht verantwortlich sein. Vor der eigentlichen Begegnung mit der Braut bricht die Erzählung ab.
Ein Bräutigam, der zu den Vorbereitungen einer Hochzeit anreist, die ihn schreckt, der sich das aber nicht eingesteht und stattdessen alle möglichen Ungelegenheiten sucht und sich ausdenkt, der sich in dieses Gespinst von Möglichkeiten verstrickt und die Wirklichkeit scheut — ein solcher Bräutigam muss unweigerlich komisch wirken, ein Held der erotischen Handlungshemmung. Er lässt sich auf die Menschen und Dinge ein, insofern sie ihm Aufschub gewähren. Eine solche Welt des Aufschubs ist eine andere als jene Welt, die man eilig durchquert, um ans Ziel zu gelangen. Sie kann den Charakter des Rätselhaften und Geheimnisvollen annehmen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das, was vom Ziel ablenkt, und sie findet dort vieles zu entdecken. Wichtig wird, was am Wege liegt oder sich in den Weg stellt. Abzweigungen verlocken, das Ziel zu vermeiden. So wird die Wirklichkeit labyrinthisch. Im »Schloss«-Roman findet diese Wucherung von Möglichkeiten, die an kein Ziel führen, ihre ästhetisch vollkommene Gestalt.
Die »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« erzählen also von einem Bräutigam, der am liebsten ein Junggeselle bleiben würde. Die bei Kafka notorische Junggesellenproblematik wird hier zum ersten Mal thematisiert.
In den Jahren, als Kafka an den »Hochzeitsvorbereitungen« schrieb, war für ihn noch keine Braut in Sicht. Es gab eine Reihe von kleineren Liebesgeschichten, Affären. Einmal, um 1907, hatte er Umgang mit einer Kellnerin, die gelegentlich wohl auch der Prostitution nachging. Wie überhaupt Bordellbesuche auch für ihn etwas Selbstverständliches waren. Das Sexuelle lockte ihn nicht, es bedrängte ihn. Er hatte einen Abscheu davor, auch und gerade weil es periodisch so große Gewalt über ihn besaß. Er empfand es als entwürdigend, etwas Fremdes, das ihm geschah und eigentlich nicht zu ihm gehörte.
Es gab bei ihm starke Liebesgefühle mit Scheu vor dem Sexuellen, und es gab bei ihm sexuelles Begehren ganz ohne Verliebtheit. Eine Begegnung, womöglich die erste, schildert er in einem Brief an Milena, um ihr seine Angst vor der Sexualität anzudeuten. Was er ihr schildert, hat sich wohl kurz vor der ersten Staatsprüfung 1904 abgespielt.
Um sich von den Prüfungsvorbereitungen abzulenken, beobachtet er vom Fenster aus das Ladenmädchen eines gegenüber gelegenen Konfektionsgeschäftes. Er gibt ihr ein Zeichen, man verabredet ein Treffen nach Dienstschluss. Doch zum verabredeten Zeitpunkt tritt ein anderer Mann auf, bei dem sich das Mädchen einhängt, doch über die Schulter hinweg gibt sie ihm Zeichen. Nach einer Weile verabschiedet sie sich von dem anderen Mann, und Kafka geht mit dem Ladenmädchen in ein Stundenhotel. Und als wir dann gegen Morgen, es war noch immer heiß und schön, über die Karlsbrücke nachhause giengen, war ich allerdings glücklich, aber dieses Glück bestand nur darin, daß ich endlich Ruhe hatte vor dem ewig jammernden Körper, vor allem aber bestand das Glück darin, daß das Ganze nicht noch abscheulicher, nicht noch schmutziger gewesen war.
An solche Szenen konnte Kafka nur mit Schrecken und Schuldgefühlen denken. Dabei war er durchaus ein erotischer Mensch. In einem Brief an Felice blickt er mit einem stolzen Unterton auf eine Zeit zurück, da er mit Mädchen zusammen war, in die ich mich leicht verliebte, mit denen ich lustig war und die ich noch leichter verließ oder von denen ich ohne die geringsten Schmerzen mich verlassen sah.
Es gab bei ihm also die zahlreichen kürzeren und längeren Liebesgeschichten, doch es gab auch den Wunsch, der allerdings unerfüllt blieb, eine ganz normale Ehe einzugehen mit Kindern, Familie und allem, was dazugehört. Mit immer neuen Formulierungen hat er behauptet, erst ein solches Leben bedeute, in der Wahrheit zu leben. Er bezog sich dabei sowohl auf die jüdische Tradition wie auch auf sein großes Vorbild Flaubert, der, erotisch und sexuell hochaktiv, Junggeselle blieb und doch mit Ehrfurcht auf die eheliche Normalität blickte und sie als die eigentlich wahre Existenzform bezeichnete.
Später wird Kafka in seinem nie abgeschickten »Brief an den Vater« die Theorie entwickeln, dass der Vater das Terrain von Ehe und Familiengründung besetzt gehalten hätte, weshalb es für ihn tabu gewesen sei. So habe er nie ein Leben führen können, wie er es sich eigentlich gewünscht hätte, nämlich: heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen wollen, hinnehmen, in dieser unsichern Welt erhalten und gar noch ein wenig führen ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Weil ihm dieses Gebiet also versperrt war durch die schiere Existenz des machtvollen Vaters, habe er ausweichen müssen in die Welt des Schreibens.
Doch ist es wirklich so? Ist das Schreiben nur ein Ersatz, eine Notlösung? Oder ist nicht vielmehr der Wille zum Schreiben bei ihm so stark, dass Ehe und Familienleben demgegenüber ernsthaft nicht in Betracht kommen? Jedenfalls waren für ihn die angeblichen Wonnen des Familienlebens nur in der Rolle des Zaungastes auszuhalten.
Zweites Kapitel
Erste Buchveröffentlichung: »Betrachtung«. Euphorie des Schreibens. Das Doppelleben. Schreiben und Brotberuf. Im Büro. Bei den Eltern wohnen. Der Vater. Max Brod. Judentum
Das Junggesellentum ist aus der Perspektive des Schreibens womöglich eine notwendige Lebensform, von der bürgerlichen Normalität und von der religiösen Tradition her gesehen aber erscheint sie als Unglück und wird mit Schuldgefühlen belastet.
Unter die kurzen Texte, die Kafka in seine erste Buchveröffentlichung »Betrachtung« von 1912 aufnahm, gehört auch »Das Unglück des Junggesellen«, eine ziemlich unverschlüsselte Beschreibung der düster erscheinenden Aussichten einer Junggesellenexistenz: Es scheint so arg, Junggeselle zu bleiben, als alter Mann unter schwerer Wahrung der Würde um Aufnahme zu bitten, wenn man einen Abend mit Menschen verbringen will, krank zu sein und aus dem Winkel seines Bettes wochenlang das leere Zimmer anzusehn, immer vor dem Haustor Abschied zu nehmen, niemals neben seiner Frau sich die Treppe hinaufzudrängen, in seinem Zimmer nur Seitentüren zu haben, die in fremde Wohnungen führen, sein Nachtmahl in einer Hand nach Hause zu tragen, fremde Kinder anstaunen zu müssen und nicht immerfort wiederholen zu dürfen: ›Ich habe keine‹, sich im Aussehn und Benehmen nach ein oder zwei Junggesellen der Jugenderinnerungen auszubilden.
So wird es sein, nur daß man auch in Wirklichkeit heute und später selbst dastehen wird, mit einem Körper und einem wirklichen Kopf, also auch einer Stirn, um mit der Hand an sie zu schlagen.
Die Textsammlung »Betrachtung« war mit den beiden Verlegern Ernst Rowohlt und Kurt Wolff, die zu diesem Zeitpunkt noch zusammenarbeiteten, bei einem Besuch in Leipzig im Juni 1912 verabredet worden. Vor allem der in Verlagsgeschäften versierte Max Brod drängte seinen Freund dazu und leistete wichtige Vermittlungsdienste.
Kafka hatte gemischte Gefühle: er genoss es zwar, in Person eines namhaften Verlegers von der literarischen Öffentlichkeit anerkannt zu werden; diese öffentliche Sichtbarkeit erfüllte ihn schon auch mit einigem Stolz, aber er tat sich auch schwer, geeignete Texte aus seinem in den letzten Jahren angewachsenen Vorrat auszuwählen. Er war ja ein überaus strenger Beurteiler seiner eigenen Sachen. Einmal schrieb er dem Freund: willst du mir wirklich raten … bei hellem Bewußtsein etwas Schlechtes drucken zu lassen, das mich dann anwidern würde … ist denn das Nichtgedrucktwerden und noch Ärgeres nicht viel weniger schlimm als dieses verdammte Sichzwingen?
Schließlich ließ sich Kafka doch darauf ein, sparte aber nicht mit Bemerkungen, welche wie gewöhnlich die eigene Arbeit herabsetzen sollten, zum Beispiel kommentiert er Felice gegenüber die von den Verlegern gewählte Schrifttype so: Sie (die Schrifttype) ist zweifellos ein wenig übertrieben schön und würde besser für die Gesetzestafeln Moses passen als für meine kleinen Winkelzüge.
Manche dieser Winkelzüge deuten auf Späteres hin, etwa der Text »Entlarvung eines Bauernfängers«. Es handelt sich dabei um ein frühes Gegenstück zur berühmten Parabel »Vor dem Gesetz«. Dort lässt ein Mann vom Lande sich den Einlass ins Gesetz vom Türhüter versperren, obwohl der Eingang doch für ihn bestimmt ist. In der »Bauernfänger«-Geschichte versucht ein Türhüter den Protagonisten davon abzuhalten, in eine Gesellschaft zu gehen, zu der er eingeladen ist. Solche Bauernfänger, heißt es in dieser Geschichte, umgeben sich anlockend und bedrohlich mit einer Aura der Macht, die aber doch nur eine Anmaßung sei, nur ein täuschender Anblick einer Unnachgiebigkeit. Der einschüchternde Bann muss gebrochen werden. Erkannt! Sagte ich und klopfte ihm (dem Bauernfänger) noch leicht auf die Schulter. Dann eilte ich die Treppe hinauf … Aufatmend und langgestreckt betrat ich den Saal. Offenbar ein vorweggenommener, impliziter Kommentar zur späteren Parabel »Vor dem Gesetz«, der dazu ermuntert, sich nicht einschüchtern zu lassen von den Reden der verbietenden, hindernden Macht. Vielleicht sind sie doch nur — Bauernfängerei.
In die Sammlung der »Betrachtung« rettete Kafka einige Entwürfe und Skizzen, die in den Zusammenhang der Arbeit an der »Beschreibung eines Kampfes« gehören. Der Kampf um die Wirklichkeit hinter der Sprache, schon in der »Beschreibung eines Kampfes« ein wichtiges Motiv, zieht sich auch hier als roter Faden durch die Texte. Eine Skizze, »Der Nachhauseweg« überschrieben, beginnt mit dem Satz: Man sehe die Überzeugungskraft der Luft nach dem Gewitter! Auf die Überzeugungskraft der Luft setzt man, wenn einem Zweifel am Gewicht der Worte kommen. Ein anderer Text, »Der Fahrgast«, beginnt so: Ich stehe auf der Plattform des elektrischen Wagens und bin vollständig unsicher in Rücksicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser Stadt, in meiner Familie. Diese Unsicherheit besteht darin, dass dieses Ich, gefragt nach seiner Stellung in der Welt, nicht recht antworten kann. Es hapert bei den Wörtern. Ich kann es gar nicht verteidigen, dass ich auf dieser Plattform stehe. Das Unheil beginnt, wenn man zu seiner Verteidigung nichts vorzubringen, nichts zu sagen hat, und das in einer Situation, wo es auf eine Rechtfertigung im Medium der Sprache ankommt.
»Abweisung« variiert und verknüpft die Motive der »Beschreibung eines Kampfes« und der »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande«, also das Problem der Sprache einerseits und die hinausgeschobene oder vereitelte Begegnung andererseits. Ein Ich begegnet einem Mädchen, das stumm vorbeigeht. Nun stellt sich dieses Ich vor, was man hätte reden können, wie viel Welt man zwischen sich hätte sprachlich aufblühen lassen können, und würde doch am Ende zu demselben Ergebnis gekommen sein, nämlich dass man auseinandergeht. Ja, wir haben beide recht und, um uns dessen nicht unwiderleglich bewußt zu werden, wollen wir, nicht wahr, lieber jeder allein nach Hause gehen.
Diese erste Buchveröffentlichung fällt in eine Lebensperiode, für die sich deutliche Spuren eines gesteigerten literarischen Selbstwertgefühls finden lassen.
Am 19. Februar 1911 notierte Kafka im Tagebuch: zweifellos bin ich jetzt im Geistigen der Mittelpunkt von Prag. Er strich diese Passage durch, ließ aber die nicht weniger selbstbewusste Fortsetzung dieses Satzes stehen: Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe z.B. ›er schaute aus dem Fenster‹ so ist er schon vollkommen. In diesem Jahr — 1911 — häuften sich die Augenblicke der Euphorie beim Schreiben oder auch nur bei der Aussicht auf das Schreiben. Was würde er nicht alles aus sich herausholen können! Das Bewußtsein meiner dichterischen Fähigkeiten ist am Abend und am Morgen unüberblickbar. Ich fühle mich gelockert bis auf den Boden meines Wesens und kann aus mir heben was ich nur will.
Am 28. März 1911 besuchte Kafka einen Vortrag Rudolf Steiners. Er hatte zuvor um ein Gespräch gebeten und sich im Tagebuch dafür einige Notizen gemacht. Mein Glück, meine Fähigkeiten und jede Möglichkeit irgendwie zu nützen liegen seit jeher im Litterarischen. Und hier habe ich allerdings Zustände erlebt (nicht viele) die meiner Meinung nach den von Ihnen Herr Doktor beschriebenen hellseherischen Zuständen sehr nahestehen, in welchen ich ganz und gar in jedem Einfall wohnte, aber jeden Einfall auch erfüllte und in welchen ich mich nicht nur an meinen Grenzen fühlte, sondern an den Grenzen des Menschlichen überhaupt.
Es sei schwer zu ertragen, fährt er fort, zu Zeiten hellseherisch an den Grenzen des Menschlichen sich aufzuhalten und zu anderen Zeiten im Büro. Diese zwei Berufe können einander kaum vertragen. Steiner wusste offenbar keinen Rat, wie mit dieser Doppelexistenz — an den Grenzen des Menschlichen und im Büro — umzugehen sei. Ob Kafka einen solchen Rat wirklich erwartet hatte, sei dahingestellt.
Sogar beim Diktieren von amtlichen Texten im Büro, wenn ihm nach längerem Nachdenken ein treffender Ausdruck einfällt, überkommt ihn die Einsicht, daß zu einer dichterischen Arbeit alles in mir bereit ist und eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden für mich wäre. Und auch wenn das Schreiben stockt, zweifelt er nicht daran, dass er mit seinem ganzen Wesen ein Schriftsteller ist. Denn es ist ihm bewusst, dass er die Wirklichkeit im Medium der Sprache und des Schreibens erfährt, auch wenn er gerade nicht schreibt. Er ist eben stets angespannt und auf dem Sprung, sie in Worte zu fassen. Im Horizont des Schreibens erst kommt für ihn das, was er erfährt, zu seiner Wahrheit. Bereits die Antizipation des Schreibens — und nicht erst das Schreiben selbst — bestimmt sein Verhältnis zur Wirklichkeit und bedingt seine Erfahrung.
Das hat aber auch einen bedrohlichen Aspekt, denn ein nicht schreibender Schriftsteller ist allerdings ein den Irrsinn herausforderndes Unding. Warum? Der Schriftsteller ist für Kafka mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die voller Gespenster ist, die er von sich ablenkt, indem er schreibt. Wenn er nicht schreibt, greifen diese Gespenster ihn an — bis zum Irrsinn. Das mag nicht für jeden Schriftsteller gelten, für ihn aber gilt es.
Kafka muss schreiben. Doch ein Schriftsteller im professionellen Sinne möchte er nicht werden. In einem Briefentwurf an Felices Vater, bei Gelegenheit der Verlobung, nennt Kafka die Literatur zwar sein einziges Verlangen und auch seinen einzigen Beruf, doch um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, betont er, dass er nicht die Kraft dazu habe, mit der Literatur seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er will für die Literatur leben, aber nicht von ihr. Und so bleibt er auf den Posten bei der »Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt« angewiesen, auch wenn er dort Zeit verliert, die ihm dann beim Schreiben fehlt. Deshalb klagt er so häufig über das schreckliche Doppelleben, aus dem es wahrscheinlich nur den Irrsinn als Ausweg gibt.
Doch bisweilen sieht er alles ganz anders. Dann gesteht er sich ein, wie erleichternd es für ihn ist, nicht seine ganze Zeit für das Schreiben zur Verfügung zu haben. Womöglich gewährt die Berufsarbeit auch Schutz vor der verschlingenden, alles in sich hineinziehenden Macht des Schreibens, vielleicht ist es gerade das Büro, das ihn vor dem Irrsinn bewahrt.
Kafkas Berufsleben hatte im Sommer 1906 begonnen. Nach dem Rigorosum im Sommer absolvierte er zuerst ein Praktikumsjahr bei Gericht und in einer Advokatur, dann arbeitete er ein Jahr bei der »Assicurazioni Generali«, einer international agierenden Versicherungsgesellschaft, von der er sich erhofft hatte, später vielleicht nach Südamerika geschickt zu werden. Das war sein Traum, hinaus in die Ferne, diesem unheimlichen Prag mit seinen Krallen entkommen! Doch daraus wurde nichts. Bei der »Assicurazioni« herrschte ein strenges Arbeitsregime, an sechs Tagen bis abends 18 Uhr Bürozeit und oft darüber hinaus. Zum Schreiben, dieser entsetzlichen Beschäftigung, die jetzt entbehren zu müssen mein ganzes Unglück ist, blieb also keine Zeit und keine Kraft. Es reichte nur für Besuche in Nachtlokalen und Kabaretts, die er nun häufig frequentierte, meist zusammen mit Max Brod. Da seine Schuldgefühle immer hellwach waren, fühlte er sich schon fast als verkommenes Subjekt.
Als sich die Aussicht auf eine Stelle bei der »Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt« (AUVA) eröffnete, kündigte er bei der »Assicurazioni« mit der Begründung, dass ihm das allgegenwärtige Schimpfen im Büroalltag inzwischen unerträglich geworden sei.
Am 10. Juli 1908 trat Kafka seine Stelle bei der halbstaatlichen AUVA