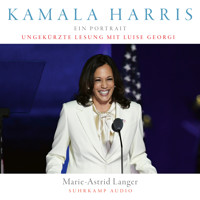13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Im suffragettenweißen Anzug tritt Kamala Harris am 7. November 2020 auf die Bühne in Wilmington, Delaware, als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Ihre Worte gehen um die Welt, sie selbst wird zur Ikone … Die US-Korrespondentin Marie-Astrid Langer gibt Einblick in die entscheidenden Momente auf dem Lebensweg von der Einwanderertochter zur mächtigsten Schwarzen Frau in Washington.
Ihre Mutter aus Indien, ihr Vater aus Jamaika, beide zum Studieren in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gekommen, beide in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, und so bekommt Kamala Harris den Kampf für Gleichberechtigung vom ersten Tag an in die Wiege gelegt. Als Grenzgängerin zwischen der harten Realität der Schwarzen Communities und den linken Eliten Kaliforniens entwickelt sie früh ihr politisches Denken, ihr Engagement, ihren Ehrgeiz. Und mit einer Vision von Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit, tief geprägt von der afroamerikanischen Geschichte, macht sie sich an einen unvergleichlichen Aufstieg, der mehr als einmal an den Widersprüchen und Ungleichheiten eines Landes zu scheitern droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Ähnliche
Titel
Marie-Astrid Langer
Kamala Harris
Ein Porträt
Suhrkamp
Widmung
Für meine Eltern
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Prolog
7. November 2020
1 In die Wiege gelegt
2 Identitätsfragen
3 Einsamer Aufstieg
4 Familienbande
5 Harte Fragen im Senat
6 Missglückter Griff nach den Sternen
7 Zurück an die Spitze
Nachwort
Geschichte schreiben
Quellen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Prolog
7. November 2020
Es ist Tag vier nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 und noch immer steht kein Sieger fest. Seit Tagen kleben Millionen von Zuschauern in den USA und in aller Welt vor den Bildschirmen. Rund um die Uhr verfolgen sie auf CNN und anderen Kabelsendern, wie stückweise Wahlergebnisse aus Nevada, Pennsylvania, Arizona und Georgia eintreffen und die Hochrechnungen sich ändern. Wie aus 215 Elektorenstimmen für Joe Biden erst 248 werden, dann 264, aber eben nicht die heiß ersehnten 270, die Schwelle für den Wahlsieg. Biden führt knapp in Pennsylvania, auch in Georgia und Arizona – es sind enorme Erfolge für die Demokraten, aber noch keine Entscheidungen. Rund um den Globus bangen die einen und hoffen die anderen: Ist die Präsidentschaft Donald Trumps vorbei?
Die Frau, die an diesem Tag Geschichte schreiben wird, ist am frühen Morgen walken. In Sweatshirt und mit dunkler Sonnenbrille läuft sie mit ihrem Ehemann über die Wiesen in Wilmington, Delaware – einen Steinwurf von dort entfernt, wo Bidens Wahlkampfteam seinen Hauptsitz hat. Nach einiger Zeit dreht sie um und geht ins Hotel zum Duschen. Gerade hat sie das Wasser angedreht, damit es heiß wird, als sie auf ihr Handy schaut: Die Nachrichtenagentur Associated Press hat soeben Joe Biden zum Sieger in Pennsylvania gekürt. Auf einmal ist alles klar. Er wird mehr als 270 Elektorenstimmen bekommen. Er wird die Präsidentschaftswahl gewinnen. Und sie, Kamala Harris, sein »Running Mate«, wird die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden.
Es ist halb 12 Uhr mittags amerikanischer Ostküstenzeit. Harris rennt aus dem Badezimmer – das Duschwasser läuft weiter –, raus auf die Wiese, zu ihrem Mann Doug. Sie fällt ihm um den Hals, verschwitzt und etwas atemlos, die Agenten des Secret Service stehen daneben. Dann greift Harris zum Handy und ruft den künftigen amerikanischen Präsidenten an. »Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Joe!«, sagt sie ins Telefon und lacht. Es klingt, als könne sie es selbst noch nicht glauben.
Wenige Stunden später hat Harris die Turnschuhe gegen Pumps getauscht, die Jogginghose gegen einen Hosenanzug. Sie trägt Weiß, die Farbe der Suffragetten – jener Feministinnen, die vor genau hundert Jahren das Wahlrecht für Frauen erkämpft hatten.
An diesem Abend schließt sich der Kreis. 244 Jahre nach der Gründung der Vereinigten Staaten gewinnt erstmals eine Frau das zweitmächtigste Amt im Land – und noch dazu eine Afroamerikanerin. Nach achtundvierzig Männern wird es erstmals heißen »Madame Vice President«. Um das zu würdigen, wird am Abend nicht nur der frischgekürte Präsidentschaftsgewinner eine Siegesrede halten, so wie üblich, sondern diesmal auch seine Stellvertreterin. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Wahl der Nummer zwei geschichtsträchtiger ist als die des Präsidenten.
Statt in einem Ballsaal werden Harris und Biden nun vor einem Parkplatz sprechen. Um halb neun Uhr abends sind auf dem Parkplatz vor dem Chase Center in Wilmington, Delaware Hunderte Menschen zusammengekommen. Wegen der Pandemie sitzen sie alle in ihren Fahrzeugen, manche auch auf Autodächern, einige schwenken die amerikanische Flagge. An eine Fensterscheibe hat jemand auf einen Zettel mit Hand geschrieben: »Von der Tochter von Zuwanderern zur Vizepräsidentin.«
Aus den Lautsprechern dröhnt die Stimme der Schwarzen Sängerin Mary J. Blige, als Harris auf die Bühne tritt und zum Mikrofon läuft. Autos hupen, die Menschen jubeln und johlen, Harris lacht und winkt. Sie streicht sich die Haare hinter die Ohren, atmet noch einmal tief durch – und fängt an zu reden. Bis die Menge sie zu Wort kommen lässt, muss sie sechs Mal ansetzen.
Harris beginnt mit John Lewis, dem verstorbenen Kongressabgeordneten, der seinen Kampf für das Wahlrecht für Schwarze einst mit Prügel und Haftstrafen bezahlte. Sie dankt ihren Mitarbeiter*innen, den Wähler*innen, ihrer Familie, vor allem Joe Biden. »Er hatte die Verwegenheit, eine Frau als Vizepräsidentin zu ernennen«, sagt sie, ihre Stimme zittert ein wenig. Sie dankt den Frauen, die jahrhundertelang für Gleichberechtigung gekämpft haben und auf deren Schulter sie stehe. Dann hält sie einen Moment inne, bevor sie zur Kernbotschaft an diesem Abend ansetzt. »Es mag sein, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin, aber ich werde nicht die letzte sein, denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zuschaut, sieht, dass in diesem Land alles möglich ist.«
Die Menge in Wilmington tobt und klatscht, Fernsehkameras fangen die Gesichter alter Frauen und junger Mädchen ein, die sich die Tränen aus den Augen wischen. Ihnen allen ist klar: Hier wird gerade Geschichte geschrieben.
Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass Harris in diesem Moment ein Versprechen einlöst: »Kamala«, hat ihre Mutter immer gesagt, »du wirst häufig die Erste sein, die etwas erreicht. Stell sicher, dass du nicht die Letzte bist.«
Überhaupt ist die Mutter der Leuchtturm in Harris' Leben. Die treibende Kraft, dank der die Tochter eine gläserne Decke nach der anderen durchbrochen hat. Die aus ihr die Frau gemacht hat, von der viele glauben, sie könnte bald die erste Präsidentin Amerikas werden. Wer verstehen will, wer diese Kamala Harris ist, wofür sie steht, was sie will – der muss verstehen, woher sie kommt.
1
In die Wiege gelegt
Lange bevor Kamala Harris Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten wird, bevor sie als zweite Schwarze Senatorin in den Kongress zieht, bevor sie die erste Generalstaatsanwältin Kaliforniens und erste Bezirksanwältin San Franciscos wird, wächst sie als Einwandererkind in der nordkalifornischen Bay Area auf. Hier in Oakland, im Kaiser Permanente Hospital im Stadtzentrum, wird Kamala Devi Harris am 20. Oktober 1964 geboren. Oakland ist nicht gerade die Wiege politischer Karrieren in den USA. Die Stadt ist der hässliche kleine Bruder San Franciscos: Auf der östlichen Seite der Bay gelegen, macht sie bis heute Schlagzeilen mit Schießereien, Bandenkämpfen, Drogenhandel.
In gewisser Weise ist Kamala Harris' Familie so ungewöhnlich, wie es nur für Amerika typisch sein kann: Ihre Mutter, Shyamala Gopalan, ist aus Indien zugewandert, ihr Vater, Donald Harris, aus Jamaika. Beide Eltern werden 1938 in einer britischen Kolonie geboren, allerdings an entgegengesetzten Enden der Welt. Shyamala Gopalan wächst im südöstlichen indischen Bundesstaat Tamil Nadu auf, als ältestes von vier Kindern eines hohen Staatsbediensteten und einer Bürgerrechtsaktivistin. Ihre Familie gehört der Brahmanen-Kaste an, der obersten Schicht im indischen Kastenwesen. Die Brahmanen begleiteten traditionell angesehene Positionen, etwa das Amt von Priestern; Brahaminnen sollten gar nicht arbeiten.
Gopalan wiederum hat ganz andere Pläne für ihr Leben. Schon als Mädchen will sie Biochemikerin werden, doch eine solche Laufbahn ist für Frauen im damaligen Indien grundsätzlich nicht vorgesehen. Stattdessen studiert sie an der reinen Frauen-Hochschule Lady Irwin College in Delhi das, was ihr offensteht: Haushaltswissenschaften. Der Vater und der Bruder ziehen sie damit auf. »Was studiert man denn bei Haushaltswissenschaften: Wie man den Teller richtig auf den Tisch stellt?« Nach außen habe seine Schwester über diese Sprüche gelacht, erinnert sich ihr Bruder Gopalan Balachandran, inzwischen achtzig Jahre alt. »›Ihr habt ja keine Ahnung‹, hat sie immer gesagt«, wie er am Telefon erzählt. Doch insgeheim schmiedet sie andere Pläne.
Die präsentiert sie ihrer Familie, als sie neunzehn Jahre alt ist und bereits den ersten Hochschulabschluss in der Tasche hat: Sie hat sich an der kalifornischen Universität Berkeley beworben und ist angenommen worden. Dort will sie nun Endokrinologie und Ernährungswissenschaften studieren – »nicht Haushaltswissenschaften«, fügt sie hinzu – und darin promovieren mit dem Ziel, Brustkrebs zu erforschen.
Die Familie ist überrascht. Die Universität Berkeley, eine der renommiertesten der USA, ist ihnen kein Begriff, niemand aus der Familie hat Indien je den Rücken gekehrt. »Mein Vater sagte ihr, er kenne niemanden in den USA und schon gar nicht in Berkeley«, erinnert sich der Bruder. Anders als heute ist die kalifornische Bay Area in jenen Tagen auch noch keine Enklave indischer Migranten, die der jungen Gopalan Rückhalt geben könnten. Trotzdem unterstützen die Eltern das Vorhaben. »Wir haben uns alle für sie gefreut, auch wenn wir sehr überrascht waren, weil wir von ihren Plänen ja nichts gewusst hatten. Es war eine aufregende Zeit in der Geschichte unserer Familie.« Seine Schwester habe schon immer ihren eigenen Kopf gehabt und zeitlebens Dinge gemacht, die sonst niemand machte. Der Vater nimmt Geld aus seiner Pensionskasse als Beamter, um der Tochter das erste Studienjahr zu finanzieren. Doch die Erwartungshaltung ist klar: Shyamala Gopalan soll nach dem Studienabschluss nach Indien zurückkehren. Die Eltern waren eine arrangierte Ehe eingegangen, für die Tochter planen sie das Gleiche.
Auch die anderen drei Geschwister werden später ihre eigenen Wege gehen: Eine Schwester studiert Geburtskunde in Indien und arbeitet als ärztliche Direktorin an einem der größten Krankenhäuser in Chennai; die andere als Informatikerin in Toronto; der Bruder Gopalan Balachandran promoviert in Volkswirtschaft und Computerwissenschaften in den USA. Alle verbindet das akademische Interesse, eine Sehnsucht nach dem Ausland und ein starker eigener Wille.
13 000 Kilometer entfernt, in einer anderen britischen Kolonie, sehnt sich ein junger Mann ebenfalls nach einem Studium in den Vereinigten Staaten. Donald Jasper Harris wächst an der Nordküste der Karibikinsel Jamaika auf, als Sohn einer großen Familie von Landbesitzern. Die Großmutter väterlicherseits zieht ihn auf. »Don« ist ein zielstrebiger und erfolgreicher Student, nach seinem Studienabschluss an der University of the West Indies bietet ihm die britische Kolonialregierung ein Stipendium an, um in Volkswirtschaften zu promovieren – unter der Annahme, dass er dies wie andere Stipendiaten in Großbritannien tun wird.
Doch der Dreiundzwanzigjährige hat genug von der britischen Gehirnwäsche, die er in seiner Schulzeit und dem Grundstudium erfahren hatte, erzählt er später in einem Interview. Schon als Teenager zog ihn die amerikanische Kultur in den Bann, besonders die afroamerikanische Musik, die er über amerikanische Sender im Radio hörte: Jazz-Lieder, die eine US-Marinebasis in Guantanamo spielt, und eine Rhythm-and-Blues-Sendung aus Nashville. Das Land wirkt für ihn »aus der Ferne betrachtet wie eine Gemeinde, in der sich die Leute lebhaft und dynamisch mischten«.
Speziell die Universität Berkeley hat Harris' Interesse geweckt. Er interessiert sich für die Bürgerrechtsbewegung in den USA und ist begeistert zu lesen, dass studentische Aktivist*innen von Berkeley extra in die Südstaaten gereist seien, um dort zu protestieren. Seine Bewerbung um einen Studienplatz wird angenommen, und nach einigem Hin und Her darf er sein Stipendium in die USA mitnehmen.
Harris kommt 1961, wenige Jahre nach Gopalan, in Berkeley an. Auch er ist ein Einzelkämpfer, weniger als 25 000 jamaikanische Zuwanderer leben in jenen Jahren gemäß dem Migration Policy Institute in den USA. Zum damaligen Zeitpunkt sind auch erst wenige Hundert der mehr als 20 000 Studenten in Berkeley Schwarz. Diese tun sich oft in politischen Studentenvereinigungen zusammen. Eine der einflussreichsten ist die »Afro-American Association«. Hier diskutieren die Studierenden, was »Black Culture« bedeutet, wie sich die Gesellschaft verändern lässt, wie wahre Gleichberechtigung aussehen könnte. Einige ihrer Mitglieder werden 1966 die Black Panther Party gründen, eine radikalsozialistische Bewegung in Oakland, die sich für die Belange der Schwarzen einsetzt – teils mit Waffengewalt.
Auch Harris gehört der »Afro-American Association« an. Im Herbst 1962 hält er für die Organisation einen Vortrag in Berkeley. Die Zuschauer drängen sich Schulter an Schulter in den Raum, als der großgewachsene, schlaksige Mann erzählt, wie er in Jamaika die britische Kolonialmacht erlebt hat. Eine kleine Gruppe Weißer habe dort eine »einheimische Schwarze Elite« geschaffen, sagt er; jedoch nur um darüber hinwegzutäuschen, welche enorme gesellschaftliche Ungleichheit es tatsächlich gebe.
Im Publikum steht eine schmächtige Frau, nur knapp über einen Meter fünfzig groß, doch mit ihrem Sari sticht sie aus der Masse heraus. Nach dem Vortrag nähert sie sich Harris, sie diskutieren über seine Annahmen. Es folgen weitere Treffen, und schon bald verlieben sich Shyamala Gopalan und Don Harris. Er ist ihr erster Freund.
Die beiden führen ein studentisches Doppelleben, wie es in Berkeley in jenen Jahren des gesellschaftlichen Umbruchs typisch wird: In ihren Studiengängen sind sie strebsam und erfolgreich, auch Gopalan erhält bald ein Stipendium. Am Wochenende wiederum protestieren sie auf dem Campus gegen den Vietnamkrieg, gegen das Apartheid-Regime in Südafrika, für die Gleichberechtigung aller Ethnien. Auch Berkeley erlebt in jener Zeit Umbruch: Die einst apolitische Stadt, in der vor allem weiße Männer studierten, wird durch die Proteste innerhalb weniger Jahre zu einer Hochburg progressiver Ideen und kulturell immer bunter. Vor allem der Vietnamkrieg und die damit verbundene Wehrpflicht erzürnen in den kommenden Jahren die Studierenden; bisweilen arten die Proteste auch gewaltsam aus.
Mit ihrer Familie hält Gopalan in jener Zeit so gut Kontakt wie möglich. Wie die meisten indischen Haushalte haben auch die Eltern kein Telefon zu Hause. Stattdessen schreiben sie sich Briefe auf hauchdünnem hellblauem Papier, sogenannte Aerogramme, die zwei Wochen mit der Post unterwegs sind.
Shyamala Gopalan und Donald Harris haben in Berkeley all das gefunden, was sie sich von den USA erträumt hatten: ein Netzwerk aus gleichgesinnten Aktivist*innen. Ein herausragendes akademisches Umfeld mit besten Karriereaussichten. Die Liebe. Der Kontrast zu ihren Heimatländern scheint ihnen unüberwindbar groß. Shyamala Gopalan ändert ihren ursprünglichen Plan: Statt nach dem Studienabschluss nach Indien zurückzukehren, zu den Eltern, den Geschwistern, beschließt sie, in den USA zu bleiben und zu heiraten. Sie stellt ihren künftigen Mann nicht mal den Eltern vor; auch mit der Tradition, die Hochzeit in ihrer indischen Heimatstadt zu feiern, bricht Gopalan. 1962 geben sie und Donald Harris sich das Ja-Wort. Keiner der Verwandten aus Indien kann daran teilnehmen, die Flugtickets sind zu teuer. Die Eheschließung sei gleichermaßen ein Akt aus Liebe wie aus Rebellion gegen die Eltern gewesen, sagt Kamala Harris später.
Zwei Jahre danach, mit fünfundzwanzig, schließt Gopalan im gleichen Jahr ihre Promotion ab und bringt die erste Tochter, Kamala, auf die Welt. Angeblich arbeitete die Mutter gerade im Labor an der Universität, als die Fruchtblase platzte. Gopalan besteht darauf, erst Kamala und später ihrer Schwester Maya Namen aus der indischen Mythologie zu geben; auch, damit die Mädchen ihre Herkunft nicht vergessen. Kamala bedeutet »Lotusblume« und ist einer der Namen einer Göttin, die besser als Lakshmi bekannt ist. Kamala Harris' Mittelname Devi beruht ebenfalls auf einer indischen Göttin, welche die Macht des Weiblichen verkörpert, aber auch den Schutzinstinkt einer Mutter. »Eine Kultur, die Göttinnen huldigt, bringt starke Frauen hervor«, ist Gopalan überzeugt.
Kamala bekommt das politische Engagement buchstäblich in die Wiege gelegt, wie sie später gern betont. Schon ihre Großmutter mütterlicherseits hatte in Indien misshandelte Frauen bei sich zu Hause aufgenommen und Frauen aus dem Dorf über die Verwendung von Verhütungsmitteln aufgeklärt. Auch Kamalas Eltern setzen ihre Protestaktivitäten nach der Geburt der Tochter fort und nehmen Kamala von klein auf mit. 1967 lernt die Mutter Martin Luther King jr. persönlich kennen, als er in Berkeley eine Rede hält.
Einmal – so erzählt Kamala Harris immer wieder bei Wahlkampfauftritten und in Interviews – nahm ihre Mutter sie mit auf eine Demonstration. Doch irgendwas passte dem Kleinkind nicht, wütend schimpfte Kamala im Kinderwagen vor sich hin. Die Mutter fragte schließlich, was denn los sei, ob Kamala etwas fehle. Da antwortete die Tochter das, was sie den ganzen Tag von den Erwachsenen gehört hatte: »Freiheit!«
Doch wie eine Fahne, die in der Sonne allmählich an Farbe verliert, verblasst die Liebe der Eltern. Shyamala und Don streiten immer häufiger. Nachdem der Vater seinen Doktortitel erhält, zieht die Familie immer wieder um; zwei Jahre nach Kamala wird ihre Schwester Maya im Bundesstaat Illinois geboren. Ihre Eltern seien wie Feuer und Wasser gewesen, schreibt Harris rückblickend. »Ich glaube, wenn sie älter und etwas reifer gewesen wären, dann hätte die Ehe vielleicht gehalten. Aber sie waren so jung.«
Als Donald Harris schließlich eine Dozentenstelle im fernen Bundesstaat Wisconsin angeboten bekommt, zerbricht die Ehe. Shyamala Gopalan und die Töchter bleiben in Berkeley, der Vater zieht 3300 Kilometer gen Nordosten, um Wirtschaftswissenschaften an der University of Wisconsin in Madison zu lehren. Kamala ist fünf, Maya drei Jahre alt. Zwei Jahre später werden die Eltern offiziell geschieden. Das Wenige, was die Eltern besitzen, teilen sie untereinander auf – die Mutter bekommt den Diaprojektor und die Musikalben, der Vater die Regale. Einzig über die Aufteilung der Bücher hätten sich ihre Eltern gestritten.
Donald Harris spielt von nun an nur noch eine Nebenrolle im Leben seiner Töchter, obwohl er wenige Jahre später zurück in die Bay Area zieht. Er sieht die Kinder lediglich an den Wochenenden und in den Ferien. Die Scheidung hinterlässt die Eltern tief zerstritten, sie reden irgendwann gar nicht mehr miteinander. Als Harris die Eltern Jahre später zu ihrer Abschlussfeier der High-School einlädt, befürchtet sie zunächst, dass entweder die Mutter oder der Vater nicht kommen wird; tatsächlich aber erscheinen beide.
Trotz der Scheidung und der Trennung von seinen Kindern legt der Vater Wert darauf, seinen Töchtern Stolz auf ihre jamaikanischen Wurzeln mitzugeben. Jahre später, im Sommer 1978, nimmt er sie beispielsweise mit auf ihr erstes Musikkonzert: Bob Marley and The Wailers spielen in Berkeley. Marley stammt aus dem gleichen Landkreis auf Jamaika – St. Ann in der Nordhälfte der Insel – wie die Familie Harris. Der Plan des Vaters geht auf. »Ich war völlig beeindruckt«, erinnert sich Harris, »bis heute kenne ich die Texte zu fast jedem Bob-Marley-Lied.«
Beruflich macht Donald Harris auf sich aufmerksam, weil er etablierte Wirtschaftstheorien hinterfragt. Er gilt als Anhänger des Marxismus und vertritt etwa die These, dass wirtschaftliche Ungleichheiten zwangsläufige Begleiterscheinungen des Wachstums in einer Marktwirtschaft sind. 1972 wird er zurück nach Nordkalifornien an die renommierte Universität Stanford in Palo Alto berufen. Dort hat er zunächst nur eine Gastprofessur. Auf Drängen der Studentenschaft wird er schließlich der erste Schwarze Akademiker an der Wirtschaftsfakultät mit einer Professorenstelle auf Lebenszeit. Es ist eine von vielen gläsernen Decken, die jemand aus der Familie Harris durchstoßen wird. Heute ist er dort noch als Professor emeritus bekannt für seine herausragende Karriere. Zudem berät Donald Harris immer wieder die jamaikanische Regierung in Wirtschaftsfragen.
Donald Harris schreibt Jahre später auf einem Blog der jamaikanischen Diaspora, dass er seinen Töchtern immer versucht habe zu vermitteln, dass »der Himmel die Grenze« für ihre Träume sei, dass sie aber auch nie ihre Wurzeln vergessen dürften. Sein enges Verhältnis zu Kamala und Maya sei zu »einem abrupten Ende« gekommen, weil der Bundesstaat Kalifornien im Sorgerechtsstreit fälschlicherweise angenommen habe, dass »Väter nicht die Kindererziehung übernehmen können (besonders im Fall dieses Vaters, ›einem N**** von den Inseln‹)«. Sein 1978 veröffentlichtes Buch »Capital Accumulation and Income Distribution« (Kapitalanhäufung und Einkommensverteilung) widmet er seinen beiden Töchtern.
Für die Mutter wiederum sei die Scheidung eine unerwartete Niederlage gewesen, hält Harris fest. Ihren indischen Eltern die Hochzeit zu erklären, sei schon hart gewesen. Ihnen die Scheidung zu vermitteln, sei wohl noch viel schlimmer gewesen.
Nach der Scheidung der Eltern ziehen Kamala und Maya mit der Mutter innerhalb von Berkeley um. Jahre später, im Präsidentschaftswahlkampf, wird Harris trotzdem immer wieder betonen, dass sie aus Oakland stamme. Hier wird sie in der Innenstadt im Januar 2019 ihre erste Rede als demokratische Präsidentschaftsanwärterin halten, um die Ecke vom Kaiser Permanente Hospital, in dem sie geboren wurde. Doch tatsächlich wuchs Harris in der Nachbarstadt Berkeley auf. Geografisch gesehen mag das kaum einen Unterschied machen, der Übergang zwischen den beiden Nachbarstädten ist fließend. Auch heute bemerkt man selbst als Fußgänger kaum, wo Berkeley endet und Oakland anfängt.
Doch politisch betrachtet sendet es eine grundlegend andere Botschaft, ob jemand aus Berkeley oder Oakland kommt. Berkeley ist seit den 1960er Jahren der Inbegriff des linken Amerika. Die Unistadt steht heute für Studentenproteste, »Ökos« und für eine akademische Elite.
Oakland wiederum ist das Herz der afroamerikanischen Gemeinde an der Westküste. Hier siedelten sich seit den 1940er Jahren Zehntausende Afroamerikaner*innen an, die vor der Rassendiskriminierung in den Südstaaten flohen. Die Kriegsindustrie zog sie wie ein Magnet an, denn insbesondere um den Hafen von Oakland herum lockten Arbeitsplätze im Schiffbau und im Zugverkehr.
Ob man aus Berkeley oder Oakland kommt, ist, als ob man aus Berlin Marzahn oder Zehlendorf stammt. Und ob man das linke Amerika ansprechen will – oder das Schwarze. Bis heute ist Oakland als Herz der afroamerikanischen Gemeinde im Westen bekannt – und mit diesen Federn will sich auch Harris schmücken.
Ehrlich wäre es zu sagen, dass sie eine Tochter beider Städte ist. Durch die Karriere der Mutter taucht sie in das akademische Umfeld ein, für das Berkeley weltberühmt ist. Gleichzeitig erfährt sie am eigenen Leib, was es in den 1970er Jahren selbst in Kalifornien bedeutet, Schwarz zu sein. Denn auch nach der Unterzeichnung der Civil Rights Act 1968 bleiben die Wohnviertel in Berkeley in Weiß und Schwarz geteilt. Auch das Urteil des Supreme Court aus dem Jahr 1954, das eine Integration weißer und Schwarzer Schulen anordnete, wird in Berkeley erst vierzehn Jahre später in die Tat umgesetzt.
Jeden Morgen, nachdem die Mutter die Frühstücksflocken für Kamala zusammengemischt und ihr den Schulranzen aufgesetzt hat, stapft die sechsjährige Harris aus dem zweistöckigen Wohnhaus im Bancroft Way zur Bushaltestelle zwei Straßen weiter. Dort steigt sie mit anderen Nachbarskindern in den großen gelben Schulbus – den mit der grünen Ente als Erkennungsmerkmal. Doch der Bus bringt sie nicht etwa zur nächstgelegenen Schule. Von der Flachebene in South Berkeley fährt er vierzig Minuten quer durch die Stadt, immer die Hügel hinauf nach »Thousand Oaks«, wo die Häuser größer und die Vorgärten hübscher sind. Hier leben teils Professoren der Universität und schicken ihre Kinder zur Schule. Dort hält der Bus schließlich vor der Thousand Oaks Elementary School.
Die Grundschüler sind Teil eines gesellschaftlichen Experiments. Harris' Schuljahrgang ist der zweite in Berkeley, der an dem sogenannten »Busing« teilnimmt: ein Versuch, die jahrhundertelange Trennung weißer und Schwarzer Schüler zu überwinden. Die Schülerschaft der Thousand Oaks Elementary School wird so auf einen Schlag zu 40 Prozent Schwarz.
Später, von der vierten bis zur sechsten Klasse, werden umgekehrt die Kinder aus den Berkeley Hills täglich mit Bussen den Berg herunter nach South und West Berkeley gefahren.
Das damalige Busing ist bis heute in den USA umstritten. Die einen sahen es als staatlich aufgezwungene und erniedrigende Zwangsdurchmischung, die anderen als notwendiges Mittel zur gesellschaftlichen Integration. Harris wiederum wird die Erfahrung Jahrzehnte später nutzen, um im Präsidentschaftswahlkampf auf sich aufmerksam zu machen.
Auch wenn das Busing kontrovers ist, ist die Thousand Oaks School rund fünfzig Jahre später stolz auf ihre berühmte Schülerin. Vor dem Eingang der Schule hängt seit dem Herbst 2020 ein großes Plakat mit der Aufschrift: »Herzlichen Glückwunsch, Thousand Oaks-Alumna, Madam Vizepräsidentin!« Eine Wandmalerei erinnert die Schüler bereits seit 2019 daran, dass Kamala Harris einst hier lernte. In der Ecke des riesigen Schulhofs, auf dem Kirschbäume wachsen, haben Schüler auf eine Mauer Harris' Gesicht gemalt, neben die Köpfe von Anne Frank, Serena Williams und anderen berühmten Frauen aus Politik, Sport und Geschichte. »Persist!«, also »Sei hartnäckig!« lautet der Titel des Kunstwerks. Der Stadtrat von Berkeley hat gar vorgeschlagen, die Schule zu Ehren der Vizepräsidentin in »Kamala Harris Grundschule« umzubenennen. Doch darüber werde erst in einigen Jahren abgestimmt, weil zunächst andere Schulumbenennungen anstünden, erzählt eine Mitarbeiterin vom Schulbezirk Berkeley.
Harris selbst beschreibt vor allem das Verhältnis zu ihrer Lehrerin Frances Wilson als prägend. Die Lehrerin habe »alles gegeben«, um die Schüler ab der ersten Klasse zu unterstützen, erinnert sie sich, und habe auch so ihr Leben geprägt. Frau Wilson, die inzwischen verstorben ist, saß in der ersten Reihe, als Harris zwanzig Jahre später ihren Juraabschluss in San Francisco feierlich überreicht bekam.
Auch Harris' Mutter dürfte wohl froh gewesen sein, dass die Tochter durch das Busing eine besonders gute Schulausbildung erhält. Die drei Frauen wohnen damals im ersten Stock eines zitronengelben Hauses am Bancroft Way, zehn Autominuten vom Universitätscampus entfernt. Heute ist das Viertel ein typisches Mittelstands-Quartier – Einfamilienhäuschen reihen sich aneinander, Unkraut sprießt auf den Bürgersteigen, die Vorgärten sind nicht ganz so penibel gejätet wie in den schickeren Wohnvierteln Berkeleys. In Harris' früherem Elternhaus sitzt inzwischen eine Montessori-Schule.
Während Harris' Kindheit unterhält dort ein afroamerikanisches Ehepaar eine Kinderbetreuungsstätte, welche die beiden Mädchen besuchen. Denn Gopalan jongliert zu jener Zeit mit den Verpflichtungen als alleinerziehende Mutter und Forscherin: Morgens und abends kümmert sie sich um Kamala und Maya, tagsüber erforscht sie, wie sich Hormone auf verschiedene Arten von Brustkrebs auswirken. Manchmal nimmt Gopalan ihre Töchter mit ins Labor. Dort dürfen die Mädchen zur Beschäftigung Reagenzgläser reinigen.
Zur Entspannung kocht Gopalan abends in der Küche – eine Leidenschaft, die Harris von ihrer Mutter übernimmt. Während ein Duft von Curry die Wohnung erfüllt, dröhnen aus den Lautsprechern die Stimmen von Schwarzen Sänger*innen wie Miles Davis, Nina Simone oder Aretha Franklin. Die Mutter liebt Gospelmusik, für ihre Stimme war sie einst in Indien ausgezeichnet worden. Immer wieder singt sie auch für die Töchter karnatische Lieder, die klassische Musik aus Südindien. Auch Kamala singt in einem Gospelchor der Baptistenkirche, die sie und Maya in Oakland besuchen. Abends beim Kochen tanzt Kamala zu den Klängen aus dem Musikspieler der Mutter – am liebsten zu »Young, Gifted and Black«, (»Jung, begabt und Schwarz«), Aretha Franklins' Cover-Version von Nina Simones Hit. »Das war der Soundtrack meiner Kindheit«, erinnert sich Harris.
Die Mutter vermittelt ihnen von klein auf Selbstbewusstsein. »Sie hat mich und meine Schwester im Glauben aufgezogen, dass wir alles erreichen können, wenn wir nur bereit sind, hart dafür zu arbeiten«, erinnert sich Harris. Gleichzeitig habe sie ihnen aber auch klargemacht, dass es im Leben nicht um sie gehe – sondern um das, was sie für andere tun.
Unterstützung bei der Kindererziehung erfährt Gopalan aus dem engmaschigen Netzwerk afroamerikanischer Freunde in Berkeley. »Fast ab dem Augenblick, an dem meine Mutter aus Indien herzog, wurde sie in die Schwarze Gemeinde aufgenommen und tauchte ganz in sie ein. Es war die Basis ihres neuen amerikanischen Lebens«, erinnert sich Harris in Interviews.
Im Erdgeschoss ihres Wohnhauses am Bancroft Way führt damals das afroamerikanische Ehepaar Shelton die Kindertagesstätte, die Kamala und Maya am Nachmittag besuchen, während die Mutter noch im Labor steht. »Mrs Shelton war eine zweite Mutter für Maya und mich«, schreibt Harris. Shelton, ursprünglich aus dem Bundesstaat Louisiana, habe sie und ihre Schwester »mit ihrer Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit überschüttet«. Sie sei einer der klügsten Menschen gewesen, denen Harris jemals begegnet sei, und habe fest die Überzeugung vertreten, dass man im Leben anderen in Not helfen muss.
An den Wänden der Tagesstätte hängen Poster von Afroamerikaner*innen wie Harriet Tubman, die im 19. Jahrhundert Dutzenden Sklaven zur Flucht aus den Südstaaten in die Freiheit verholfen hatte. Lebensgeschichten wie diese bekommen die Kinder bei den Sheltons vermittelt.
Als Harris Jahrzehnte später in Washington, D. C. zur Vizepräsidentin vereidigt wird, ruht ihre Hand auf zwei Bibeln: die eine von Regina Shelton, die andere von Thurgood Marshall, dem ersten Schwarzen Richter am Supreme Court. Auch ihre Amtseide als Kaliforniens Justizministerin und Senatorin legt Harris auf der Familienbibel der Sheltons ab. »Im Amt und in jeden Kampf trage ich Mrs Shelton«, sagte Harris einmal, »ohne diese Frau wäre ich nicht, wer ich bin.«
Auch andere Freunde der Mutter spielen eine prägende Rolle in der Kindheit der Töchter. Ein Mentor der Mutter an der Universität Berkeley bringt Harris von einer Reise nach Japan eine Perlenkette mit – bis heute eines ihrer liebsten Accessoires.
Doch Gopalan macht wiederholt Erfahrungen mit Rassismus. Wegen ihres indischen Akzents wird sie behandelt, als sei sie schwer von Begriff, erinnert sich Harris. Verkäuferinnen seien ihrer Mutter im Kaufhaus misstrauisch gefolgt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie sich als dunkelhäutige Frau die Bluse oder ein teures Kleid leisten kann. Auch Gopalan erinnerte sich daran, wie Kamala in der Schule auf ihren Intelligenzquotienten getestet wurde. Ein Beamter der Stadt Berkeley habe ihr daraufhin hocherfreut mitgeteilt, dass ihre Tochter hochintelligent sei. »Sie verstehen nicht – Kamala könnte aufs College gehen!« In das Weltbild des Beamten passte offenbar nicht, dass das Schwarze Mädchen vor ihm nicht aus ärmlichen Verhältnissen in Berkeley stammte, sondern die Tochter akademischer Ausnahmetalente aus Indien und Jamaika war.
Shyamala Gopalan wusste auch, dass die amerikanische Gesellschaft ihre indisch-jamaikanischen Töchter als Schwarze sehen würde. Entsprechend zog sie die beiden auf – mit dem Ziel, sie »zu selbstbewussten, stolzen Schwarzen Frauen zu erziehen«. Entsprechende Vorbilder haben die Kinder in Berkeley zur Genüge. Jeden Donnerstagabend nimmt Gopalan ihre beiden Töchter mit zum »Rainbow Sign«, einem der wichtigsten afroamerikanischen Zentren Amerikas – »ein Mix aus Hauptquartier Schwarzer Nationalisten und Gemeindehaus«, schreibt der Verein »The Berkeley Revolution«. Das »Rainbow Sign« liegt nur fünf Autominuten von Gopalans Wohnung entfernt. Tagsüber gibt es hier Kochkurse, Tanzunterricht, Theater-Workshops, abends dann Aufführungen und Diskussionsrunden von Schwarzen Tänzer*innen, Künstler*innen und Politiker*innen aus dem ganzen Land. Das Kulturzentrum liegt an der Ecke Grove Street / Derby Street in Berkeley; genau hier verläuft damals eine unsichtbare Linie, welche die Viertel der Stadt in Schwarz und Weiß teilt. »Redlining« nennt man diese Trennung verschiedener Ethnizitäten – »die Weißen in den Hügeln, die Schwarzen im Flachland«, lautet die Anordnung kurz gefasst. Das »Redlining« war damals überall in den USA verbreitet und trug enorm dazu bei, Nicht-Weiße zu diskriminieren.
Das »Rainbow Sign« hält sich nur sechs Jahre über Wasser, dann muss das Kulturzentrum seine Räume schließen. Heute ist in dem Eckgebäude eine psychiatrische Klinik der Stadt untergebracht, und die Hauptstraße davor wurde in »Martin Luther King Jr. Way« umbenannt. Doch Anfang der 1970er Jahre boomt das Kulturzentrum: Die afroamerikanische Sängerin Nina Simone tritt im »Rainbow Sign« auf; die Kongressabgeordnete Shirley Chisholm besucht das Zentrum, als sie eine Präsidentschaftskandidatur erwägt; die Pulitzer-Preisträgerin Alice Walker gibt dort eine Lesung. Kamala und Maya finden im »Rainbow Sign« ihre zweite Familie. »Hier lernte ich, dass künstlerischer Ausdruck, Ehrgeiz und Intelligenz cool waren«, schreibt Harris rückblickend über diese Zeit. Auch am Küchentisch der Familie diskutieren die Mutter und ihre Freunde abends über Politik und Gerechtigkeit. »Als Kind konntest du deinen Standpunkt kundtun, aber es wurde von dir auch erwartet, dass du ihn verteidigen kannst«, erzählt Harris immer wieder. Viele Freunde der Mutter sind Juristen. Die eigene Sichtweise zu verteidigen ist eine Fähigkeit, die sie in jenen Jahren lernt – und die sie später in Gerichtssälen und bei Senatsanhörungen unter Beweis stellen wird.
Harris' Interessen sind breit: Sie nimmt Klavierunterricht von einer afroamerikanischen Nachbarin, tanzt Ballett, lernt von Nachbarn das strategische Denken beim Schachspielen. Sie besucht sowohl einen Hindu-Tempel als auch eine Schwarze Baptistenkirche, zu der die Sheltons sie mitnehmen. Die USA