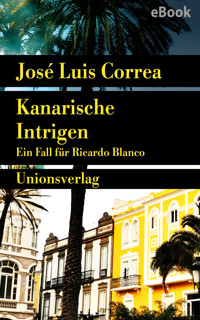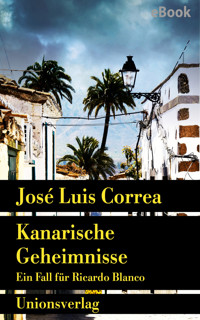
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der kanarische Frühling könnte so schön sein in Las Palmas, aber die örtliche Polizei hat einen aufsehenerregenden Fall am Hals. Zwei Männer werden kurz nacheinander ermordet aufgefunden, beide in Spitzenunterwäsche gekleidet. Die Leute tratschen, was das Zeug hält, und der Inspektor kommt nicht weiter. Privatdetektiv Ricardo Blanco hilft da natürlich gern aus. Blanco stöbert im Privatleben der Opfer und glaubt, ein Muster zu erkennen – doch des Rätsels Lösung ist nicht ungefährlich. Und wenn er recht hat, steht der nächste Mord kurz bevor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Ähnliche
Über dieses Buch
Der kanarische Frühling könnte so schön sein in Las Palmas, aber ein spektakulärer Fall bestimmt das Stadtgespräch. Zwei Männer werden kurz nacheinander ermordet, beide in Dessous gekleidet. Die Leute tratschen, was das Zeug hält, aber Privatdetektiv Ricardo Blanco sieht ein Muster. Und wenn er recht hat, steht der nächste Mord kurz bevor.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
José Luis Correa (*1962) ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität von Las Palmas. Für seine Romane erhielt er u. a. den Premio Benito Pérez Armas und den Premio Vargas Llosa. Seine Kriminalromane um den Ermittler Ricardo Blanco wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von José Luis Correa.
Verena Kilchling (*1977) studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen und überträgt seither Romane und Kurzgeschichten aus dem Englischen und Spanischen.
Zur Webseite von Verena Kilchling.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
José Luis Correa
Kanarische Geheimnisse
Ein Fall für Ricardo Blanco
Aus dem Spanischen von Verena Kilchling
Ricardo Blanco, Privatdetektiv auf Gran Canaria (2)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2004 bei Alba Editorial, Barcelona.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel Tod im April im Unionsverlag, Zürich.
Originaltitel: Muerte en abril
© by José Luis Correa 2004
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Stadt - Mauricio Abreu; Himmel - Tetra Images (beides Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30446-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 11.09.2023, 10:59h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KANARISCHE GEHEIMNISSE
1 – Mario Bermúdez hatte niemand besonders gut gekannt …2 – Er hieß Carlos. Carlos Ventura. Er war Krankenpfleger …3 – Sie hieß Lola und war siebenundzwanzig Jahre alt …4 – Nachdem wir Carlos Venturas Junggesellenwohnung von vorne bis …5 – Der dritte Tote erwischte uns im Bett von …6 – Bevor ich in meine Wohnung zurückkehrte, um mich …7 – Aber mein Glück sollte natürlich nicht von Dauer …8 – Am Donnerstag kam die Sonne heraus. Als ich …9 – Man merkte, dass Freitag war. Die halbe Stadt …10 – Es reichte nicht ganz für zwölf Stunden …11 – Der Montag begann trist, der Himmel war bewölkt …12 – Was sehr wohl landete, war der Freitag …13 – Bei Tageslicht wirkte der alte Kasten weit weniger …14 – Ich erwachte auf einem fremden Bett, in einem …Mehr über dieses Buch
Über José Luis Correa
Über Verena Kilchling
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von José Luis Correa
Zum Thema Spanien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Insel
Für meinen Sohn Carlos
1
Mario Bermúdez hatte niemand besonders gut gekannt. Anscheinend war er wortkarg, ein wenig zaghaft und hatte, wie einige Nachbarn behaupteten, »einen niedrigen Blutdruck«. Deshalb vermisste ihn auch keiner von ihnen, als er verschwand. Deshalb verweste er drei Tage lang in der Wanne seines Badezimmers. Deshalb waren die Tropfen aus dem undichten Wasserhahn durch die Haut seiner Stirn bis zum Knochen vorgedrungen. Deshalb war niemand da, um ihm die Augen zu schließen, die schließlich stumpf waren wie verdorrte Eisflächen. Deshalb gab es niemanden, der der Polizei hätte sagen können: »Wir können es ja selbst noch nicht glauben, Inspector. Er wirkte so unscheinbar, so farblos, so langweilig, keine Ahnung, was er in rostroten Spitzendessous und Strapsen unter der Dusche machte.«
Seit mehr als fünf Jahren vertrat Bermúdez einige wenig renommierte Elektrogerätehersteller auf den Kanaren, allerdings mit mäßigem Erfolg: Er hatte einfach nicht das, was man ein »Händchen« im Umgang mit Menschen nennt. Es war sogar so, dass ihm die Kunden reihenweise absprangen. Einer seiner Kunden, Armando Alvarado, vielleicht der Einzige, der noch seine Ware vertrieb, weil es sich für ihn lohnte, Gefriertruhen und Saftpressen an Kleinhändler auf dem Land zu verkaufen, hatte ihn sagen hören, dass er von dieser Arbeit die Nase voll habe und nach dem Sommer eine wichtige Änderung erwarte. Mario konnte ja nicht wissen, dass er den erhofften Erfolg nicht mehr erleben würde, weil er im April auf makabre Weise vor die Hunde gehen würde.
Die Leiche begann an einem Ostermontag zu stinken. Der Gerichtsmediziner, Don Ignacio Santa Ana, ein Mann, der schon ganz andere Schlachten geschlagen hatte und arrogant, bissig und kalt wie ein Eisberg war, staunte nicht schlecht, als er feststellte, dass Mario Bermúdez bereits am Freitag zuvor gestorben war: »Da wohnt einer in so einer Scheißwohnung mit Wänden aus Pappe, in der jedes Flüstern wie Donner widerhallt, und dann will keiner was gehört haben, das muss man sich mal vorstellen. Denn eins steht fest, Señores: Der Typ muss sich wie ein Schwein gewunden haben, während er starb. Und dann der Gestank, heilige Scheiße, dieses verfluchte Zimmer stinkt doch zum Himmel.« Der mit der Ermittlung beauftragte Polizist, Inspector Álvarez, hatte darauf bestanden, dass nur der Gerichtsmediziner und der Fotograf das Badezimmer betraten. Beim letzten Fall, in den er verwickelt worden war, dem Selbstmord eines reichen Söhnchens namens Toñuco Camember, hatten sich so viele Menschen um die Leiche geschart, dass man hätte meinen können, es wären Eintrittskarten verkauft worden. Und am Ende wusste kein Mensch mehr, welche Fingerabdrücke zu wem gehörten.
Das Problem im Fall Bermúdez war genau das Gegenteil: Es gab keine Fingerabdrücke. Nur die des Toten. Das war zumindest ungewöhnlich. Álvarez wandte sich an den Arzt, um seine Meinung über den Tod einzuholen.
»Der Tod ist immer eine Sauerei.«
»Klar. Schöne Scheiße. So weit war ich auch schon. Aber von was für einer Sauerei reden wir hier konkret?«
»Tod durch Ersticken.«
»Ist er in der Badewanne ertrunken?«
»Ertrunken? Schwachsinn! Erstickt, habe ich gesagt. Der Typ hat bei seinem letzten Fick ein wenig über die Stränge geschlagen, wollte wohl mal was Neues ausprobieren. Carajo, in der Liebe und im Krieg ist nun mal alles erlaubt. Sehen Sie hier und hier diese violetten Male? Die stammen nicht von Händen. Dem hat jemand wie einem Hühnchen den Hals umgedreht. Wenn Sie hier ein bisschen suchen, werden Sie den Gürtel von einem Morgenmantel finden oder ein dickes Kabel, das hier nicht hingehört, oder so etwas in der Art. Irgendetwas Breites, denn sonst hätte es eine ganz andere Narbe hinterlassen, einen richtigen Schnitt nämlich.«
»Wahnsinn. Ein Quacksalber, der auf Detektiv macht. Das hat mir gerade noch gefehlt.«
»Nun seien Sie nicht gleich eingeschnappt, Teniente, war ja nur eine Idee. Und mit Quacksalbern habe ich nichts am Hut. Zu mir kommen sie erst, wenn sie schon gesalbt sind.«
»Und wie erklären Sie sich, dass es keine Fingerabdrücke gibt? Welche Frau vögelt schon mit Handschuhen?«
»Sie sind der Experte.«
Während der Leichenschau machte sich Álvarez daran, den Boden hinter der Badezimmertür und die Kleiderschränke abzusuchen, für den Fall, dass Santa Ana mit seiner Intuition ins Schwarze traf. Er sah nach, ob Bänder an den Vorhängen, Schnüre an den Jalousien oder vielleicht sogar Schnürsenkel fehlten, fand aber nichts Ungewöhnliches. Was auch immer Bermúdez’ Spielgefährtin benutzt hatte, um ihm Vergnügen zu bereiten, sie musste es hinterher wieder mitgenommen haben. Bestimmt war sie im Eifer des Gefechts zu weit gegangen, in Panik geraten und Hals über Kopf geflohen, das kam in den besten Familien vor. Was Álvarez dennoch wunderte, waren die fehlenden Spuren von Gewalt, von denen am Nacken des Toten einmal abgesehen. Und die Sache mit den Fingerabdrücken. Die ganze Wohnung wirkte sauber, fast steril. Sogar die Kissen im Wohnzimmer waren systematisch nach Farbschattierung und Form geordnet. Im Schlafzimmer selbst fanden sich sowohl in der Brieftasche als auch auf dem Nachttisch Geldscheine und Münzen, eine beinahe abgelaufene Kreditkarte und sogar ein Scheck über siebzig Euro, was die Möglichkeit eines Raubüberfalls ausschloss. Wozu hätte der Mörder den armen Teufel auch in Spitzenunterwäsche stecken sollen, nur um ihm dann ein paar Moneten abzuknöpfen? Wenn irgendetwas bei diesem Fall feststand, dann, dass Diebstahl nicht das Motiv war.
Álvarez verbrachte den Rest des Vormittags damit, die Bewohner des Gebäudes zu befragen. Er hoffte, im selben Stockwerk irgendeinen neugierigen Nachbarn zu finden, der etwas Außergewöhnliches bemerkt oder eine unbekannte Person gesehen hatte, zumindest über die Gewohnheiten und Eigenheiten des Toten Bescheid wusste. Von den vier Wohnungen derselben Etage waren zwei keine große Hilfe: In einer hatte Bermúdez selbst gewohnt, und eine andere stand bereits seit einigen Monaten leer. Ihr aktueller Besitzer hatte erst alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie zu kaufen, und besaß nun nicht einmal den Anstand, auch in ihr zu wohnen. »Der wollte sicher nur Geld waschen, Inspector, das machen viele Leute, würde mich nicht wundern, wenn der Dreck am Stecken hätte. Sie müssen nur genau nachforschen, wer weiß, vielleicht hat der sogar was mit dem Tod dieses armen Mannes zu tun.« Álvarez schob der überbordenden Volksfantasie, so gut er konnte, einen Riegel vor und konzentrierte sich auf die anderen beiden Wohnungen. In der ersten lebte ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern, das zu dem Geschehenen nichts zu sagen hatte. Beide arbeiteten bei einer Nahrungsmittelfirma und verbrachten den Großteil des Tages außerhalb der Stadt. Mario sei jedenfalls ein vorbildlicher Nachbar gewesen, der einem nicht auf die Nerven ging, von dem man kaum etwas hörte und der sich nie über das Kindergeschrei beschwerte, kurz, ein liebenswerter Mann. In der anderen Wohnung, die direkt gegenüber von Bermúdez’ Wohnung lag, residierte eine Witwe mit ihrem alleinstehenden, in die Jahre gekommenen Sohn, einem Gymnasiallehrer. Doña Olga – auf diesen Namen hörte die gute Frau – war eine altmodische Mutter und lebte ausschließlich für ihren Sohn, weshalb sie fast immer zu Hause anzutreffen war. Abends ging sie spazieren und trank mit ihren Freundinnen aus dem Seniorenverein einen Tee, wovon sie normalerweise gegen halb neun zurückkehrte. Aber den Rest des Tages verbrachte sie zu Hause. Das Problem bestand darin, dass Doña Olga zwar von Natur aus gern tratschte, aber an einer »leichten« Schwerhörigkeit litt, die vielleicht doch ausgeprägter war, als sie selbst zugab. Sie war daher keine große Hilfe, so sehr sie sich auch bemühte. Glaubte man der Witwe, bekam Don Mario nur selten Besuch. Augenblick, jetzt, wo sie darüber nachdachte, fiel ihr ein, dass sie im Aufzug mehrmals einem jungen Mädchen begegnet war – vielleicht zu jung für Bermúdez –, das seine Wohnung mit einem eigenen Schlüssel betrat. Sie konnte das Mädchen nicht besonders gut beschreiben, »denn dieser verfluchte Kasten ist ja finsterer als weiß Gott was. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie klein und dunkelhaarig war; sie trug immer Jeans und einen von diesen Rucksäcken mit nur einem Träger, die jetzt so in Mode sind. Aber ich schwöre Ihnen, wenn Sie mich zu einer Gegenüberstellung vorladen würden und noch fünf andere Frauen hinter diesem einseitigen Spiegel stünden, könnte ich Ihnen nicht sagen, welche es ist.« Doña Olga hatte viel Zeit vor dem Fernseher verbracht.
Álvarez gab erschöpft auf. Als er zum Tatort zurückkehrte, hatte man Bermúdez’ bleichen Körper bereits zum Gerichtsmedizinischen Institut abtransportiert. Weil ihn niemand eingefordert hatte, würde er dort aufgebahrt werden, bis die Polizei den Fall abschloss. Was danach passierte, wusste Gott allein. Santa Ana, der von derlei Verflechtungen der Gesetzesbürokratie nichts wusste, hatte gerade sein Sezierwerkzeug eingesammelt und saß auf dem Klodeckel. Er hatte sich eine Virginia angezündet und das Bad in gräuliche, stinkende Nebelschwaden gehüllt. Der Inspector bedachte so viel Taktlosigkeit mit einem missbilligenden Blick und sagte vorwurfsvoll: »Scheiße, Santa Ana, ein wenig mehr Respekt vor dem Verstorbenen, bitte. Schauen Sie, was Sie hier für einen Qualm veranstaltet haben, verdammt noch mal!« Der Gerichtsmediziner ging bereits auf die sechzig zu. Seine grauen Haare waren sehr kurz geschnitten, und er trug eine Hornbrille, die in dreißig Jahren bestimmt wieder in Mode sein würde. Der Bauch hing ihm eine Handbreit über die Hosen, das Atmen fiel ihm schwer. Als er merkte, dass der Inspector ihn beobachtete, hob er den Blick über die Brillengläser, schloss den schwarzen Lederkoffer, atmete tief ein, als würde er bis zehn zählen, und antwortete: »Reden Sie keinen Scheiß, Inspector! Merken Sie denn nicht, dass ich damit den Gestank des Todes übertäuben will? Das ist kein Mangel an Respekt, sondern das genaue Gegenteil.«
Während Álvarez ins Polizeipräsidium zurückkehrte, ließ er sich die philosophische List des Gerichtsmediziners durch den Kopf gehen. Für ihn hatte das Verhalten Santa Anas etwas von Reue, von zwanghafter Schamhaftigkeit. Er hatte sein halbes Leben damit verbracht, in den verschrumpelten Eingeweiden von Menschen herumzustochern, die einmal gelebt hatten, und so etwas übersteht niemand, ohne sich einen Hauch von Zynismus anzueignen, ohne zu lernen, zumindest über sich selbst lachen zu können. Wenn man in diesem Beruf zulässt, dass einen die Emotionen überwältigen, hat man verloren. Álvarez wusste das nur zu gut. Aber er selbst hatte noch nicht diese Gefühlskälte, diese Abneigung erreicht, die bei Santa Ana so selbstverständlich wirkten. Er hatte es oft genug versucht. Hatte beim Rasieren vor dem Spiegel hämische Grimassen und gleichgültige Gesten einstudiert, hatte versucht, dem Tod verächtlich zuzuzwinkern, was regelmäßig damit endete, dass seine Frau sich über ihn mokierte: »Hör endlich auf, so ein Gesicht zu ziehen, du bist doch kein Schauspieler!« Sie hatte natürlich keine Ahnung von den Anforderungen, die sein Posten an ihn stellte, musste keine Härte gegenüber dem Gesindel zeigen, mit dem er sich ständig herumschlug. Susana, die Frau von Inspector Álvarez, war das genaue Abbild der Gattin von Kommissar Maigret, es schien fast, als hätte Simenon sie als Vorbild für seine Figur genommen. Oder vielleicht waren die Frauen von Polizisten überall gleich, ob in Paris oder in Las Palmas, in der Fiktion oder in der Realität. Álvarez mochte Simenon. Manchmal, wenn er früh nach Hause kam, las er Susana eine Passage vor, in der die so vernünftige und fügsame Madame Maigret vorkam, um dann zu sticheln: »Siehst du, Susana? Die versteht ihren Mann.«
Als er auf die Wache zurückkam, erwarteten ihn bereits einige Lokalreporter, die wie Hyänen der Blutspur gefolgt waren. Sie wollten Informationen über das, was sie für einen Mord hielten. Álvarez war kurz davor, sie zu fragen, wie zum Teufel sie so schnell Wind von allem bekamen, aber diesen Gefallen tat er ihnen nicht. Sie hätten ihm ohnehin geantwortet, dass das streng vertraulich sei, dass es nicht in ihrer Macht stünde, ihre Quellen preiszugeben, oder ähnlichen Unsinn. Also beschränkte er sich darauf, ihnen zu erzählen, was er wusste. Dass unter merkwürdigen und äußerst unangenehmen Umständen – er unterschlug die Aufmachung des Toten – eine Leiche aufgetaucht sei und man noch nichts ausschließen könne. Er wollte noch hinzufügen, dass dahinter sowohl ein Mord als auch ein sexueller Rekordversuch stehen könne, fand es dann aber zu peinlich. Der Mann – daran gebe es keinen Zweifel – habe keine Feinde gehabt und scheine ein ganz normaler Typ gewesen zu sein, das Ermittlungsverfahren sei aufgenommen worden, blablabla. Einer der Journalisten, ein gewisser Melo Torres, den der Inspector schon von anderen Fällen kannte, fragte ihn, ob die »unangenehmen Umstände« vielleicht etwas mit abnormalen sexuellen Vorlieben, weiblicher Intimwäsche oder einer anderen Art von Perversion zu tun hatten. Die Frage brachte Álvarez völlig aus der Fassung. Er erinnerte sich noch an einige Artikel dieses Torres, dessen oberflächliche Art ihm sauer aufstieß. Der Journalist zeigte keinerlei Respekt vor dem Leben der Menschen und noch viel weniger vor ihrem Tod. Er pervertierte einfach alles, um seine Leser zu ködern. Zu allem Überfluss hatte er ein Arschloch von Fotograf im Schlepptau, der für einen guten Schnappschuss seine eigene Mutter verkauft hätte, einen fiesen Mistkerl, der immer schwarz gekleidet war und selbst mitten im August wie in einem schlechten Film einen Cowboymantel trug. Der Inspector setzte zu einer wütenden Antwort an, brachte aber nur einen schwachen Protest hervor: »Hören Sie, Torres, dazu kann ich Ihnen erst etwas sagen, wenn bei der Autopsie Ergebnisse herauskommen, die Licht in die Angelegenheit bringen. Daher nur so viel: Mario Bermúdez hat es zwar nicht verdient, weil er ein armer Kerl war, der keiner Fliege was zuleide tat, aber ihn hats erwischt, und er ist tot.«
»Wollen Sie damit sagen, dass jemand den Tod verdient?«
»Ich kenne jedenfalls ein paar Typen, denen niemand eine Träne nachweinen würde.«
»Darf ich diese Aussage in meiner Kolumne zitieren?«
»In diesem Land herrscht Recht auf freie Meinungsäußerung, Torres.«
»Danke, Comisario Álvarez.«
»Ich bin nur Inspector.«
Sobald die Berichterstatter aus der Tür waren, stürzte sich Álvarez auf seine Schreibtischschublade und holte eine Tablette gegen Sodbrennen hervor. Typen wie Torres schlugen ihm auf den Magen. Der Tag hatte so schön angefangen, der Frühlingshimmel hatte sich wie eine Immortelle über Las Palmas festgesetzt, doch dann war innerhalb von zwei Stunden alles vor die Hunde gegangen. Das Ergebnis war eine übel zugerichtete Leiche, eine schwarze Witwe, die frei in der Stadt herumlief, und eine Schmeißfliege, die in Form eines Journalisten über seinem Schreibtisch schwirrte. Es kam ihm wie ein Albtraum vor.
Während der ganzen folgenden Woche versuchte er, daraus aufzuwachen, aber es war nirgendwo ein Lichtblick zu entdecken. Er machte kaum Fortschritte. Die halbe Stadt hatte die Insel verlassen, und die andere Hälfte verbrachte die Osterferien am Strand. Die Autopsie untermauerte die Theorie von Ignacio Santa Ana und brachte nur eine neue Erkenntnis: Bermúdez, dieser Schuft, hatte ein überaus bewegtes Ende gefunden. Neben Hinweisen auf eine beträchtliche Dosis eines Barbiturats in seinem Urin fanden sich überall Spermaspuren, und zwar in einer Menge, die auf mindestens drei Ejakulationen schließen ließen oder auf zwei nach langer Enthaltsamkeit. Ein süßer Tod, verdammt noch mal! Er würde wohl damit anfangen müssen, das Mädchen zu finden, von dem Doña Olga gesprochen hatte. Dennoch: Glaubte man der Version der Alten, konnte das Mädchen nicht mehr als eins sechzig groß sein und wog wohl um die fünfzig Kilo. Verglichen mit den über achtzig Kilo, die Bermúdez auf die Waage brachte, ein ungleicher Kampf. Auch wenn das Bett natürlich der einzige Ort ist, an dem sich die Kräfteverhältnisse ausgleichen. Daher war die mysteriöse junge Frau der einzige Hinweis, der Álvarez weiterbrachte. Vielleicht würde sie aufs Revier kommen und ihre Aussage machen, sobald die Zeitungen von dem Tod berichteten, vielleicht würde ihr klar werden, dass sie sich noch verdächtiger machte, wenn sie schwieg, vielleicht bekam sie Angst und war jetzt schon auf dem Weg zu seinem Büro. Der Inspector gab keinen Cent darauf, dass das passierte, aber ihm blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob sich etwas regte. Und drei Nächte später regte sich tatsächlich etwas. Allerdings ganz anders, als er gedacht hatte.
2
Er hieß Carlos. Carlos Ventura. Er war Krankenpfleger und hatte im Gegensatz zum anderen Opfer einige Freunde, die für ihn einstehen konnten. Man konnte zwar nicht behaupten, dass er bei allen beliebt war, aber das kann man schließlich von niemandem sagen. Er arbeitete seit mehr als acht Jahren in der Clínica del Perpetuo Socorro und war seiner Arbeit nicht einen Tag ferngeblieben. Genau wie Bermúdez lebte er allein, aber das war nicht immer so gewesen. Tatsächlich war er mal mit Cristina Santiago zusammen gewesen, einer Radiologieassistentin, mit der ihn eine kurze, leidenschaftliche Liebesgeschichte verband, die schließlich an einem Missverständnis zerbrach. Diese Version hatte Ventura zumindest seinen Kollegen anvertraut: »Ja, Señor Inspector, Carlos hat Stein und Bein geschworen, dass er nichts mit dieser Stripperin hatte.« Aber Cristina glaubte ihm nicht, und von da an zerfraßen Misstrauen und Argwohn der Radiologin die Beziehung. Die Angelegenheit ging durch die Klinik, und jeder gab seinen Senf dazu. Die Kolleginnen von Cristina unterstützten natürlich die Entscheidung der jungen Frau: »Also ich hätte ihm das auch nicht verziehen, Inspector Álvarez, dieses Schwein hat sich schließlich mit einem Flittchen eingelassen, wer weiß, mit wem die noch alles was hatte. Keinen Pfifferling war die wert, die war doch noch nicht mal hübsch, hätte mich auch gewundert. Gut, sie hatte große Titten, aber die waren falscher als ein Eineuroschein. Außerdem ist mit solchen Sachen heute nicht mehr zu spaßen, heute holt man sich keinen einfachen Tripper mehr, heute gehts um ernstere Dinge, Aids zum Beispiel. Also, wenn mein Freund mir so was antut, schicke ich ihn schneller in die Wüste, als ich gähnen kann, den setze ich im hohen Bogen vor die Tür!« Íñigo Lozano, ebenfalls Krankenpfleger und außerdem sein bester Freund, schlug sich hingegen auf Carlos’ Seite: »Ich kannte ihn gut, der war keiner, der durch die Gegend gevögelt hat, das schwöre ich Ihnen. Auf andere mag das durchaus zutreffen, aber Carlitos Ventura? Der war doch treudoof und außerdem total vernarrt in seine Freundin. Die Sache war eine Hundsgemeinheit, irgendjemand, der Interesse daran hatte, hat Cristina gesteckt, dass er in einem dieser Etablissements gesehen worden war, dabei war es nur ein Junggesellenabschied, ich glaube der von Benito Padrón, der arbeitet in der Traumatologie. Wir hatten uns zum Abendessen verabredet, und später hat dann jemand das mit der Peepshow vorgeschlagen; zu allem Unglück war Carlos auch noch der Einzige, der die Idee doof fand, daran erinnere ich mich noch genau, da können Sie jeden der Jungs aus der Traumatologie fragen. Kurz und gut, Señor Agente, er hat das nicht verdient.«
Wieder kam Álvarez das Gespräch mit dem Journalisten Melo Torres in den Sinn, in dem es darum gegangen war, ob jemand verdiente, dass man ihn tötete. Denn hier ging es, verdammt noch mal, nicht mehr um einen sexuellen Exzess, peccata minuta, sondern um einen Mord: Carlos Ventura war ermordet worden, das war sonnenklar. Jetzt ging es darum, die losen Enden des Fadens zusammenzufügen. Álvarez war zu alt und zu misstrauisch, um an Zufälle zu glauben. Von wegen flotte Nummer. Die Sache mit Carlos Ventura war ein Verbrechen, wie es im Buche stand. Man hatte ihn umgebracht. Genau wie Bermúdez. Ebenfalls an einem Freitag. Nur die Kleidung, die man ihm angezogen hatte, war anders. Diesmal war es ein Leibchen, eine Art besticktes Nachthemd in Indigoblau, das der Leiche ein skurriles, groteskes Aussehen verlieh. Der Körper lag rücklings auf einer alten Eisenpritsche, einem beängstigend wirkenden Museumsstück, das sich krass vom Rest des Zimmers abhob. Später fand man heraus, dass es das einzige Einrichtungsstück war, das dem Toten gehört hatte – die Wohnung wurde möbliert vermietet –, und dass es sich um ein Erbstück seiner Uroma handelte, einer Kastizin aus Caracas. Und weil Carlos Ventura Einzelkind war, fiel ihm nach dem Tod seiner Eltern das Bett zu.
Auf Venturas Gesicht lag ein Ausdruck von Verlorenheit und Verblüffung, so als könnte er nicht glauben, was ihm gerade widerfuhr. Das war kein Anflug von Panik vor dem Tod. Es schien, als wäre es nicht das Sterben selbst, das den armen Teufel störte, sondern das Antlitz, mit dem es ihm den letzten Atemzug abschnitt. Álvarez ließ Santa Ana rufen.
Er holte ihn aus dem Bett, schließlich war es ein dringender Anlass. Der Gerichtsmediziner erschien prompt mit einer schlechten Laune, die sich gewaschen hatte: »Was ist denn jetzt wieder passiert, Álvarez? Scheiße, schon wieder eine Mumie, wir kommen mit den Beerdigungen bald gar nicht mehr nach.« Santa Ana setzte sich mit einer Zurückhaltung und einem Feingefühl auf den Rand der Pritsche, die man einem Arzt, den man gerade aus seiner Siesta gerissen hatte, nicht zugetraut hätte. Es schien, als wollte er einem Körper, dem man bereits derart mitgespielt hatte, unnötige Grausamkeiten ersparen. Aus Rücksicht auf Santa Anas Arbeit verließ der Inspector das Schlafzimmer und vertrieb sich die Zeit damit, nach Spuren zu suchen, obwohl er schon ahnte, dass er nicht viel finden würde. Tatsächlich war alles an seinem Platz. Es herrschte eine ähnliche Ordnung wie in der Wohnung des anderen Opfers: Das Wohnzimmer war sorgfältig aufgeräumt, die Küche sauber und ordentlich, nur im Badezimmer gab es Anzeichen dafür, dass dort jemand gelebt hatte: In der Badewanne klebten Haare, und die Handtücher waren achtlos auf einen Wäschekorb geworfen worden. Auf der Ablage unter dem ovalen Badezimmerspiegel bildeten einige Pflegeprodukte eine unordentliche Reihe: eine Dose Rasierschaum, ein Einwegrasierer, eine Flasche mit Lotion, die nach Friseursalon roch.
Es gab jedoch etwas, das sich dem Gesetz dieses Badezimmers nicht anpassen wollte: ein orangefarbener Plastikbecher mit einer Tube Zahnpasta und zwei Zahnbürsten, einer roten und einer grünen. Álvarez machte sich auf die Suche nach einer Tüte, legte die Zahnbürsten hinein und versiegelte sie. Dann machte er sich eine Notiz und steckte die Beweismittel ein. Er wollte später etwas nachprüfen.
Als der Polizist ins Schlafzimmer zurückkam, war der alte Gutachter bereits fertig mit seiner Untersuchung der Leiche, die die gleichen blauen Flecken am Hals aufwies wie Mario Bermúdez. Santa Ana hatte seine Handschuhe noch an und wühlte im Nachttisch herum. »Was suchen Sie, Doktor?«, fragte der Inspector. »Spielen Sie wieder Detektiv?« Der Arzt drehte sich um und streckte Álvarez triumphierend einen der kleinen, grauen Inhalationsapparate mit blauer Kappe entgegen, die man bei Asthma verwendet. Mit einem tausendmal einstudierten geheimnisvollen Lächeln sagte er ihm, was er wusste: »Das hier habe ich gesucht, mein Lieber. Entweder ich täusche mich gewaltig, oder dieser Typ war Asthmatiker. Das ändert natürlich alles.«
»Und was ändert das?«
»Die Perspektive.«
»Gehen Sie mir nicht mit Ihrer Geheimnistuerei auf die Nerven, Santa Ana.«
»Sie verlieren aber schnell die Geduld, mein Freund. Was ich sagen will, ist, dass dieses Medikament die Schlussfolgerungen, die wir bei dem anderen Todesfall gezogen haben, völlig auf den Kopf stellt.«
»Ich weiß auch nicht, warum, aber genau das hatte ich befürchtet. Inwiefern auf den Kopf stellt?«
»Insofern, dass wir etwas für erwiesen gehalten haben, was nicht stimmt: dass Bermúdez Drogen nahm.«
»Nahm er etwa keine?«
»Nein. Diese Leiche weist die gleichen Spuren auf wie die von Bermúdez. Ich bin mir sicher, dass wir ein vergleichbares Barbiturat in seinem Urin finden werden. Aber so, wie es aussieht, litt Ventura an Asthma, und als Krankenpfleger kannte er zweifellos die Konsequenzen: Er wusste, dass es ihn umbringen konnte.«
»Wirkt das Zeug so stark?«
»Es geht nicht darum, wie stark es wirkt, sondern um die Assimilation: Ein Asthmatiker leidet ohnehin an ernsthaften Atmungsdepressionen (und ganz besonders in einem Klima wie unserem), und wenn er dann noch ein Barbiturat von diesem Kaliber nimmt, gute Nacht.«
»Und weiter?«
»Daraus lassen sich nur zwei Dinge schließen: Entweder wollte sich der Krankenpfleger umbringen (was nicht der Fall zu sein scheint), oder man hat ihn unter Drogen gesetzt, bevor man ihn umbrachte.«
Die Sache wurde immer undurchsichtiger. Warum gab der Mörder seinen Opfern Drogen, bevor er sie um die Ecke brachte? Was hatte er davon? Das Einzige, was feststand, war, dass beide Verbrechen von derselben Person begangen worden waren. Von jemandem mit übersteigerten Rachegelüsten, der viel Schaden anrichten wollte und wusste, wie er es anstellen musste, von jemandem, dem es gleichgültig war, dass er sein Opfer bis über den Tod hinaus erniedrigte, von jemandem, der einen eindeutigen Hang zur Grausamkeit hatte. Oder zutiefst unglücklich war.
Die einzige Verbindung zwischen den Morden bestand darin, dass beide Männer allein gelebt hatten. Von dieser Übereinstimmung abgesehen, hatte ihr Leben nichts miteinander gemein: verschiedene Berufe, unterschiedliches Alter und Aussehen, verschiedene Schicksale. Wenn jemand sie tot sehen wollte, dann nicht aus einer bestimmten Aversion heraus. Álvarez dachte an die Filme, in denen die Serienmörder immer von einem konkreten Opferprofil besessen waren. Es ging um Mörder, die Männer mit Schnurrbart hassten oder rothaarige Frauen oder jeden, der ein rotes Cabrio fuhr, nur weil es sie an einen saufenden Vater oder eine besitzergreifende Mutter oder einen Fahrer erinnerte, der einen Zebrastreifen missachtet und so ihr Leben zerstört hatte. Aber das hier war die Wirklichkeit. Und zwischen den beiden Leichen gab es keine Verbindung. Es einte sie allein die lächerliche Verkleidung, die man ihnen vor – oder nach? – ihrer Ermordung verpasst hatte. Aber es musste etwas geben, was dem Inspector entging, ein subtileres, vielleicht verborgeneres Detail im Leben von Mario Bermúdez und Carlos Ventura. Bisher jagte er nur dem scheuen Schatten eines jungen Mädchens hinterher, das zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt, dunkelhaarig und von mittlerer Statur war und Jeans und einen Rucksack trug. Eine von wahrscheinlich Tausenden jungen Frauen in Las Palmas, auf die diese Beschreibung passte. Eine junge Frau, die Angst hatte, seit sie in der Zeitung gelesen hatte, dass es bereits zwei mysteriöse Morde gab und die Polizei nach ihr suchte. Eine junge Frau, die vermutlich an der Universität studierte oder in einem Modegeschäft arbeitete und Raquel oder Sandra oder María Luisa hieß.
3
Sie hieß Lola und war siebenundzwanzig Jahre alt. Sie studierte an der Außenhandelsschule und träumte davon, eines Tages ihre eigene Firma zu führen. Und sie hatte tatsächlich schreckliche Angst. Sie hatte Mario Bermúdez per Zufall kennengelernt, in einem Café in der Calle León y Castillo, nur zwei Straßen von der Schule entfernt. Dort frühstückte sie jeden Morgen, weil ihr der Ort nicht gefiel, an dem ihre Kommilitonen sich zum Kaffee trafen. Lieber ging sie ein Stück zu Fuß und wich dem Trubel aus. Dabei hielt sie sich nicht etwa für etwas Besseres, weiß Gott nicht, sie hatte sich noch nie viel auf sich eingebildet, ganz im Gegenteil: Sie war gutmütig und ließ sich leicht übers Ohr hauen. Es lag eher am Alter, denn Lola war etwas älter als die anderen. Sie hatte erst spät mit dem Studium begonnen, weil ihre Eltern es nicht finanzieren konnten. Für diesen Studiengang hatte sie sich nur einschreiben können, weil sie genug Geld als Supermarktkassiererin und Putzhilfe verdient hatte. Kurz, sie hatte andere Sorgen und Nöte als die übrigen Studenten, weshalb sie sich ihnen nicht sehr nahe fühlte und keinen von ihnen näher kennenlernen wollte.
Vielleicht war ihr Mario deshalb aufgefallen. Auf Lola wirkte er genauso einsam wie sie selbst. Sie sah ihn, als er eines Tages in der dunkelsten Ecke der Bar vor einem kleinen Milchkaffee und einem Zuckergebäck saß und gierig La Provincia verschlang. Als sie das erste Mal mit ihm redete, bat sie ihn um die Zeitung. Lola hatte nämlich eine Anzeige aufgegeben, um eine Stelle als Babysitterin zu finden, und wollte sehen, ob sie veröffentlicht worden war. Mario faltete die Zeitung zusammen und gab sie ihr. Sie schlug sofort die Seiten mit den Kleinanzeigen auf, überflog sie, nickte zufrieden und gab ihm die Zeitung wieder zurück. Er forderte sie auf, sich doch bitte nicht zu beeilen, er habe die Zeitung schon fertig, sie könne sie ganz in Ruhe lesen. Sie bedankte sich, und als sie ihm die Zeitung zurückgab, hatten sie sich einander längst vorgestellt: »Ich heiße Lola und studiere an der Handelsschule. Mir ist aufgefallen, dass Sie auch ziemlich oft in diese Bar kommen.« Und er antwortete: »Ich bin Mario Bermúdez, und du kannst mich nennen, wie du willst, aber siez mich doch bitte nicht, sonst komme ich mir älter vor, als ich bin.« Und sie: »Ach was, Sie sind doch nicht … du bist doch nicht alt. Ich bin nur daran gewöhnt, die Leute zu siezen, und es fällt mir schwer, jemanden zu duzen, den ich gar nicht kenne.« Und er: »Schön und gut, aber mich kennst du ja jetzt, ich bin Mario, weißt du noch? Der, der dir die Zeitung geliehen hat und oft hierher zum Frühstück kommt. Ich bin übrigens Großhändler, wenn du also mal einen Fernseher brauchst, kann ich dir günstig einen besorgen.« Und sie: »Tut mir leid, aber ich sehe nicht fern, da läuft doch nur Schwachsinn. Ich lese lieber.« Und er: »Schöne Scheiße, was für eine Art, mir so das Geschäft zu versauen! Vier von deiner Sorte, und ich kann mich zur Ruhe setzen.«
Fast eine Woche lang teilten sie sich die dunkle Ecke an der Bar und das Zuckergebäck, während sie Träume von einer glorreichen Zukunft austauschten und um Erinnerungen schacherten. So erfuhr Mario, dass sie eine ruhige Arbeit ohne allzu feste Arbeitszeiten suchte, um sich das Studium zu finanzieren, so erfuhr er von ihren finanziellen Schwierigkeiten und von ihrer Anzeige. Und ohne lange darüber nachzudenken, bot er ihr einen mehr oder weniger festen Job an: Er hatte zwar keine Kinder, die abends gehütet werden mussten, dafür aber zwei linke Hände im Haushalt, weshalb er dringend jemanden brauchte, der sich mehrmals die Woche darum kümmerte. Mario musste das Mädchen sehr ins Herz geschlossen haben, denn er log ihr das Blaue vom Himmel herunter, erzählte ihr, dass seine Kunden oft zu ihm nach Hause kämen und seine Wohnung deshalb in gutem Zustand sein müsse. Vielleicht hatte er sich sogar in sie verliebt, denn er war trotz seiner beruflichen Schwierigkeiten bereit, ihr sechzig Euro pro Woche zu zahlen.
Lola ihrerseits glaubte ihm oder wollte ihm glauben, vielleicht musste sie ihm aber auch dringend glauben, um über die Runden zu kommen. Und so nahm sie den Job an. Deshalb kam sie so oft zu Bermúdez nach Hause und stieß im Aufzug so oft mit jener Señora zusammen, die sie von Kopf bis Fuß musterte, als suchte sie einen Makel. Deshalb hatte sie seinen Haustürschlüssel. »Und deshalb, das schwöre ich, Don Ricardo, wäre ich fast in Ohnmacht gefallen, als ich die Leiche in der Badewanne fand. Das war am Montag, glaube ich, ja genau, am Ostermontag, und ich habe mir fast in die Hose ge…, Entschuldigung, ich habe Angst gekriegt, weil der Arme einfach dalag, ganz steif, in dieser lächerlichen Aufmachung und mit diesem starren Blick, der einem überallhin gefolgt ist, egal, wo man hinging.«
»Und warum haben Sie nicht die Polizei gerufen?«
»Habe ich Ihnen doch schon gesagt. Weil ich Angst hatte.«
»Angst wovor? Waren wir uns nicht einig darüber, dass Sie unschuldig sind?«
»Und wer hätte mir das geglaubt? Ich bringe alle Voraussetzungen dafür mit, dass man mir den Mord anhängt: Ich hatte den Schlüssel für seine Wohnung, ich hatte die Gelegenheit, ihn umzubringen, und ich hatte das älteste Motiv der Welt, denn meine finanzielle Situation ist nicht gerade rosig, um es milde auszudrücken. Vielleicht hätten sie sogar geglaubt, dass ich Mario ausgenutzt habe, dass ich ihm sein Geld abgeknöpft habe, dass zwischen uns beiden etwas lief.«
»Und, lief da was?«
»Nein. Das schwöre ich Ihnen, Señor Blanco. Er war ein Gentleman und hat mich immer zuvorkommend behandelt. Er ist nie handgreiflich geworden oder zu weit gegangen. Das hätte ich ihm auch ganz sicher nicht durchgehen lassen: Ich war ihm sehr dankbar, aber das wars auch schon. Das müssen Sie mir glauben.«
»Ich glaube Ihnen ja. Die Frage ist nur, ob ein Richter Ihnen auch glauben würde. Verraten Sie mir eins: Als Sie hineingingen, sind Sie da direkt ins Bad gegangen, wo die Leiche war?«
»Ja. Das war immer das Erste, was ich machte, wenn ich ankam. Dort zog ich mich um und hängte meine Kleider an den Haken hinter der Tür. Mit dem Putzen habe ich dann immer in der Küche angefangen. Aber an jenem Tag bin ich abgehauen, als wäre der Teufel hinter mir her. Was hätten Sie denn getan?«
»Sehr wahrscheinlich dasselbe. Aber das erklärt nicht, warum es keine Fingerabdrücke von Ihnen gab. Sie müssen doch die Tür geöffnet und wieder geschlossen haben. Sie müssen doch etwas berührt haben.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich Schi… Angst hatte. Bevor ich ging, habe ich alles mit einem Lappen abgewischt.«
»Und genau das ist am allerverdächtigsten. Erzählen Sie das bloß niemandem, sonst geht der Schuss nach hinten los. Wie dem auch sei, Lola, und damit will ich Ihnen keine falschen Hoffnungen machen: Sie haben auch ein paar Trümpfe in der Hand.«
»Und die wären?«
»Erstens, dass Sie den zweiten Toten überhaupt nicht kannten, es gibt nichts, was Sie mit ihm in Verbindung bringen könnte. Und zweitens ist beziehungsweise war Bermúdez, wenn ich mich nicht irre, Ihre einzige Einkommensquelle: Ihn umzubringen, wäre so, als würden Sie das Huhn töten, das goldene Eier legt. Außerdem …«
»Was?«
»Außerdem lag Geld auf dem Nachttisch.«
»Ja. Das war mein Wochengehalt.«
Als Lola mein Büro verließ, hatte sie zwar nicht die Hoffnung, aber zumindest ihr Lächeln wieder gewonnen. Bevor sie ging, fragte sie mich nach meinen Honorarsätzen, weil sie – wie sie mir mit glasigen Augen mitteilte – nicht viel zahlen konnte. Ich antwortete, dass »viel« ein relativer Begriff sei, der ganz von demjenigen abhängt, der die Ernte einholt, und dass die Bezahlung in diesem Fall sicher mehr als ausreichend sein würde. Ich konnte Mario Bermúdez verstehen: Das Mädchen war absolut liebenswert, hatte einen aufrichtigen Blick und ein süßes Gesicht. Zwar war sie noch jung, und es würde die Zeit kommen, in der sie beides einbüßte, aber ich war mir sicher, dass dieses Mädchen mehr als nur ein Herz brechen würde.
Ich bat Inés, meine Sekretärin, alle Nachrichten für mich entgegenzunehmen, und machte mich auf den Weg zu meinem Freund Álvarez. Mal sehen, was ich ihm aus der Nase ziehen konnte. Auf dem Weg dachte ich darüber nach, was die Tageszeitungen über das letzte Verbrechen geschrieben hatten. Die Polizei hatte die Kommentare nicht länger unterdrücken können. Eine Leiche hat jeder im Keller, bei zweien wird der Gestank zu groß. Die stillen Mutmaßungen hatten ein Ende, alle Zeitungen schrieben über den Fall, manche von der ersten Seite an. Daten und Fotos der beiden Männer wurden veröffentlicht, man schürte die Panik: »Mörder läuft frei in der Stadt herum. Polizei steht vor einem Rätsel.« Für die Zeitungsreporter, die es leid waren, nichtigen Meldungen über politische Schachereien hinterherzujagen oder von langweiligen Nachbarschaftsintrigen zu berichten, waren die Mordfälle einen ganzen Frühling lang unerschöpflicher Quell pikanter Berichte.
Ich fand Álvarez im Deenfrente, einer kleinen Bar, die aus offensichtlichen Gründen so hieß, denn sie lag gegenüber der Polizeiwache und war der Ort, an dem die Polizisten während ihrer Dienstzeiten aßen. Ein Cabo hatte mir gesagt, dass Álvarez gerade gegangen sei und ich ihn sicher bei einem Bierchen antreffen würde. Tatsächlich saß dort der Inspector und hielt stille Zwiesprache mit einem schaumigen Blonden. In seinem Mund steckte eine Zigarette. Jeden Sonntagabend schwor er sich, sich dieses Laster abzugewöhnen, und jeden Montag erwartete ihn irgendeine lästige Angelegenheit, die ihn davon abhielt. Als er mich sah, zog er ein mürrisches Gesicht und knurrte, ohne den Blick vom Spiegel hinter der Bar abzuwenden: »Als ob ich nicht schon genug am Hals hätte! Scheiße, Ricardo Blanco, du hast mir gerade noch gefehlt.« Ich setzte mich rechts von ihm auf einen freien Barhocker. »Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Álvarez. Was macht das Leben?« Der Inspector blickte immer noch ins Leere und fragte: »Bringt mal jemand meinem Freund hier was zu trinken?« Dann wandte er sich an mich: »Was trinkst du, Ricardo?«
»Das Gleiche wie Sie.«
»Was führt dich in diese Gegend?«
»Verdammt, darf man denn nicht mal seine Freunde besuchen?«
»Verarsch mich nicht, Ricardillo.«
»Da hat wohl einer miese Laune, was?«
»Liest du keine Zeitung?«
»Doch, ich hab da so was gelesen. Was haben wir über die beiden Toten?«
»Wir? Ich weiß ja nicht, was du hast, aber ich habe absolut gar nichts.«
»Also, wenn du mich fragst, muss es doch irgendeinen Faden geben, an dem man ziehen kann.«
»Nicht den geringsten. Kein einziger Fingerabdruck, der nicht von den Toten stammt.«
»Saubere Arbeit.«
»Du sagst es.«
Álvarez wirkte entmutigt. Er wusste nicht, wo er anfangen sollte, und Gott und die Welt saßen ihm im Nacken: Die Reporter riefen ununterbrochen an und publizierten, was noch schlimmer war, endlosen Schwachsinn über einen Psychopathen, der Junggesellen mittleren Alters angriff. Das Büro des Bürgermeisters schickte Anfragen, was zum Teufel alles unternommen wurde, um den Mörder zu schnappen, die Leute seien bereits total verängstigt und sähen überall Gespenster. Und das Polizeipräsidium drohte mit blitzartigen Entlassungen und Amtsenthebungen. Das Geschwür drohte Álvarez umzubringen, und meine Anwesenheit machte die Situation keinen Deut besser. Angesichts der Lage beschloss ich, mich mit ihm zu verbünden, sobald er mir ausführlich berichtet hatte, was er über die beiden Verbrechen wusste. Ich schlug vor, gemeinsam zu Venturas Wohnung zu fahren, um dort nach einem Anhaltspunkt zu suchen, und köderte ihn – nicht ohne mich ein wenig für mein Verhalten zu schämen – mit dem Spruch, dass vier Augen mehr sehen als zwei und dass ihnen bei der ersten Untersuchung vielleicht etwas entgangen war. Álvarez erhob keine Einwände. Falls er sauer war, ließ er es sich nicht anmerken. Er trank sein Bier aus und nahm mich beim Arm: »Weißt du, Ricardo, ich glaube zwar nicht, dass es viel bringt, aber scheiß drauf. Bisher habe ich überhaupt nichts vorzuweisen, und ich habe die Nase gestrichen voll von all diesen Ungereimtheiten. Schnüffeln wir also ein bisschen herum.«
Es war nicht weiter schwierig, das Klebeband zu durchtrennen, mit dem die Polizei die Haustür von Carlos Ventura versiegelt hatte. Mir kam es vor, als hörte ich gedämpfte Schritte hinter der gegenüberliegenden Tür, wahrscheinlich die der Nachbarin; ich stellte mir vor, wie sie sich reckte, um uns durch den Türspion zu beobachten, und bekam Lust, ihr einen Rüffel zu erteilen, verkniff es mir dann aber. Die Wohnung muffelte, roch alt, feucht und staubig. Auf den Sesseln und Möbeln sah man noch Reste des Pulvers, mit dem Fingerabdrücke sichtbar gemacht werden. Davon abgesehen war alles an seinem Platz. Es war, wie der Inspector gesagt hatte: Es herrschten ein Gleichgewicht und eine beinahe manische Symmetrie, die ungewöhnlich waren für einen Junggesellen. Ich selbst habe einen großen Teil meines Lebens allein gelebt und weiß, wovon ich rede. Dennoch erinnerte mich das Wohnzimmer an mein Büro, an die Art, mit der Inés Mappen und Bücher, Heftmaschinen und Aktentaschen anordnete. Eine irgendwie ganz eigene Art, wie ein Markenzeichen.
Zuerst fiel es mir nicht auf, weil ich zu hartnäckig darauf bedacht war, alles in mich aufzunehmen – manchmal ist man so beschäftigt damit, sich eine grobe Vorstellung von einer Person zu machen, dass man die entscheidenden Details übersieht –, aber als ich das Schlafzimmer betrat, veranlasste mich irgendetwas zur Umkehr. Vielleicht war es nur eine Spinnerei, vielleicht wollte ich aber auch vor Álvarez angeben. Vielleicht bin ich einfach übereifrig, aber es gab zwischen den Sesseln im Wohnzimmer ein niedriges Glastischchen, das meine Neugier erregte: Auf dem Tischchen befanden sich fünf Gegenstände – ein Aschenbecher, eine Kaolinvase mit Trockenblumen, eine Tonschale mit künstlichen Bonbons, ein bemalter, handgeschnitzter Glücksuhu und ein leerer Kerzenhalter –, die auf ungewöhnliche Weise angeordnet waren. Wenn man sich eine Linie zwischen ihnen dachte, entstand der Großbuchstabe M