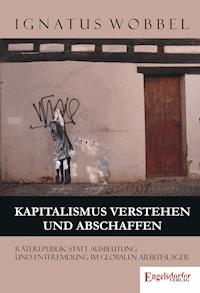
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Was ist der Grund, dass das alles passiert, dass die Verhältnisse nicht so sind, wie sie sein sollten? Warum verfällt unser Leben immer mehr, obwohl die Apologeten nicht müde werden, das Gegenteil zu behaupten? Warum funktionieren wir, obwohl viele von der Perspektivlosigkeit der Verhältnisse zunehmend überzeugt sind? Was ist der Grund, dass wir uns Zumutungen leisten, über die spätere Generationen einmal genauso den Kopf schütteln werden wie wir heute über das Leben im Mittelalter, dass wir ein würdeloses Leben als Freiheit betrachten? Und warum hat dieses perfide Lebensmodell, diese Bauruine eines menschlichen und erfüllten Daseins so alternativlos jeden Flecken dieses Planeten und jeden Winkel unseres Bewusstseins unter dem Schlachtruf der »Globalisierung« erobert? Warum ist es so geworden, wie es ist? Was gäbe es stattdessen? Wie käme »man« dahin?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignatus Wobbel
Kapitalismus verstehen
und abschaffen
Räterepublik statt Ausbeutung und Entfremdung im globalen Arbeitslager
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2012
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
1 Unterwerfung
Ich sitze in meinem Garten, die Füße weit von mir gestreckt. Die Sonne steht schon hoch über dem Horizont und verspricht einen warmen Frühlingstag. Sanft rauschen die Blätter in dem zarten Grün der Frühlingszeit. Die Vögel zwitschern schon seit einer Weile. Auch sie freuen sich über die Sonne.
Spät bin ich aufgestanden. Als Selbstständiger kann ich mir das hin und wieder leisten. Vor mir steht der dampfende Kaffee. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in meinem Dorf, habe es noch keine Sekunde bereut, hier meinen endgültigen Wohnort gefunden zu haben. Ich mag die Pfalz sehr, liebe den kleinen Ort, in dem wir so gut aufgenommen wurden, und den hiesigen Rotwein, der zu den besten gehört.
So langsam, denke ich, ist es Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Da schellt es an der Tür. Ich gehe zum Ausgang, nehme das Paket entgegen, das mir die Postbotin reicht. Sie blickt mich kurz an, dann eilt sie zurück in ihr Fahrzeug.
Gedankenverloren schaue ich ihr hinterher, beobachte sie, wie sie die einzelnen Häuser bedient und ihre Post abgibt. Als sie mit unserer Straße fertig ist, braust sie mit aufheulendem Motor an meinem Haus vorbei und winkt mir kurz zu.
Stille senkt sich wieder über »mein« Dorf. Da sehe ich ein anderes Fahrzeug in meine Straße eindringen. Ein Postwagen auch dieser, allerdings von der anderen Firma. Ein junger Farbiger steigt aus, klingelt bei meinem Nachbarn, kommt dann aber schnell zu mir, um das Paket auszuhändigen. Auch er geht die Schritte in Eile und nachdem er kurz auf seine Uhr geschaut hat, geht sein Tempo in Laufschritt über.
Kaum ist er weg, kommen die Müllwerker um die Ecke. Donnerwetter, denke ich, hier wird mir ja richtig was geboten. Na klar, heute ist der erste Montag im Monat und ein großes Auto des Müllentsorgers steht vor meiner Tür. Ich sehe, wie ein Mann in Orange von der Stufe des Wagens springt, die Tonne packt, sie entleert.
Während der Müllwerker meine Mülltonne so in den Garten zurückstößt, dass diese taumelt, aber dann doch nicht umstürzt, fährt das Müllauto bereits wieder an. Der Müllwerker rennt hinterher, springt auf das fahrende Auto und bei der nächsten Tonne wieder runter. Kopfschüttelnd will ich endlich meine Schritte zur Arbeit lenken, da höre ich Stimmen.
Die Tür vom Haus gegenüber wird aufgerissen. Mein Nachbar eilt heraus, seine beiden kleinen Kinder hinter sich her zerrend.
Mein Nachbar, muss man wissen, ist Lehrer. Sein Arbeitstempo ist nicht mit dem eines Postboten vergleichbar. Aber bevor hier gleich wieder alte Vorurteile gepflegt werden: Dafür sitzt er manche Nacht bis in die frühen Morgenstunden in seinem Arbeitszimmer, korrigiert Klausuren und bereitet Unterricht vor.
Heute hastet er allerdings wie ein Postbote zum Auto. Als ich wissen will, warum seine Kinder Tränen in den Augen haben, ruft er mir zu, dass die Tagesmutter erkrankt sei und er jetzt beide geschwind bei einer Bekannten parken müsse, damit er noch rechtzeitig zum Unterricht komme – und ob ich heute Abend Zeit habe.
Ich habe zwar keine Zeit, will aber meinen Nachbarn nicht schon wieder hängen lassen. Denn immer wieder stellt sich heraus, dass das diffizile Betreuungssystem, mit dem er seinen Arbeitsplatz, die Kindergruppe seiner Kinder, Einkäufe und Hausarbeit unter einen Hut bringen will, sehr störanfällig ist. Es bricht immer wieder mal zusammen und dann gibt es Ärger, heulende Kinder und manchmal ausfallenden Unterricht. Ich sage also zu.
Als er weg ist, gehe ich zurück in meinen Garten. Die Sonne ist ein Stück weiter gewandert. Sie ist gelb strahlend auf blauem Himmel. Die allgemeine Stille, die wieder in »mein« Dorf eingekehrt ist, kommt mir plötzlich verlogen vor. Meine innere Ruhe ist dahin, mein Kaffee nur noch lauwarm. Ich hasse lauwarmen Kaffee.
1989 brach mit einem halblauten Knall der Staatsmonopolismus der DDR zusammen. Was niemand für möglich gehalten hatte, war eingetreten. Die Berliner Mauer war weg und die Menschen, die in den Westen kamen, wurden mit Bananen und einem 100-DM-Schein stürmisch begrüßt. Man hoffte, durch bloßes Dranklatschen der DDR an den Kapitalismus seinen Trabi in einen BMW umwandeln zu können.
Die Herrschenden und ihre Schreiber redeten von Reisefreiheit, DM, Wohlstand, Bananen und wieder Reisefreiheit. Man quatschte von der Friedensdividende, von vollen Läden und leeren Parteibüros. Man redete von Landschaften, die jetzt unweigerlich mit dem Untergang des »Kommunismus« und der Wandlung zum Kapitalismus aufblühen würden. Endlich war die Blockkonfrontation weg.
Mir war klar, dass die Klimakatastrophe trotzdem kommen würde. Ich wusste, dass der Kampf gegen den globalen Hunger keinerlei Erfolg haben würde. Ich wusste, dass nun wieder eine neue Phase von Kriegen ausbrechen würde. Ich wusste, dass die Menschheit sich jetzt für die Barbarei entschieden hatte, nachdem die sozialistische Idee im Durcheinander der Weltgeschichte erstickt schien. Ich wusste, dass jetzt der Kapitalismus seine Zähne zeigen würde, so wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht mehr gekannt hatten. Ich wusste, dass globaler Kapitalismus Zerstörung der Gattung Mensch bedeutete. Wieder wusste ich alles besser. Wieder fühlte ich mich als radikale Minderheit, noch mehr allein als sonst und zog mich beleidigt in meine Schmollecke zurück. Denn – mir hörte sowieso keiner zu.
Immerhin glaubte ich noch lange Zeit, dass ich persönlich davonkommen könnte. Ich glaubte, dass der Verfall so langsam kommen würde, dass ich noch eine Zukunft in meiner Nische in meinem Dorf haben könnte. Ich ging davon aus, dass ich mit 65 mit dem Arbeiten aufhören und von meiner Rente leben könnte. Ich sah mich in meinem geliebten Garten sitzen, frei von Leistungsterror und Arbeitszwang, und meinen Interessen und Hobbys nachgehen.
Seit dem Krieg der NATO gegen Serbien 1999 glaube ich das nicht mehr. Der ökologische, gesellschaftliche und soziale Verfall tritt schneller ein, als ich alt werde. Meine Hoffnung ist vorbei, dass ich eine sorgenfreie Zukunft haben werde und die Früchte meiner Arbeit genießen könnte. Im globalen Arbeitslager wird jetzt die Post im Laufschritt ausgetragen und die Beschleunigung verschont keinen Lebensbereich.
Der Vorteil des Alters soll es sein, dass der Mensch dann ruhiger wird, sich also Senilität mit weinseliger Gutgläubigkeit vermischt. Selbst wenn ich wollte, würde das bei mir nicht funktionieren. Ich glaube zwar auch, dass man im Alter viele Dinge gelassener sieht – aber nur, um den eigenen Zorn dann umso heftiger auf jene Dinge zu richten, die diesen Zorn dann auch tatsächlich verdienen.
Der Mensch könnte frei sein – doch spürt er seine Unfreiheit nicht, weil er sich nicht rührt, sondern jeden Tag den Fernseher einschaltet. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren grundlegend geändert. Unser Leben ist in dieser Zeit nicht freier geworden. Das Gegenteil ist der Fall.
Nicht nur die Lebensumstände sind schlechter geworden, sondern auch das innere Lebensgefühl hat sich verändert. Auch diese innere Veränderung ging schleichend vonstatten. Wir sind nicht die, die wir zu sein glauben. Unbemerkt sind wir zu devoten Anpassern geworden, halten uns aber für freie Menschen.
Diejenigen, die heute 20 sind, haben nicht einmal einen Kapitalismus erlebt, der wenigstens in den allerschlimmsten Auswüchsen in den Metropolen gezähmt war. Sie haben es nie erlebt, ein Leben ohne vollständige Perspektivlosigkeit, mit weniger Unsicherheit, mit weniger Angst, mit weniger Notwendigkeit der Verdrängung und des persönlichen Selbstbetruges. Sie wissen nicht, wie sich eine zumindest ansatzweise menschliche Gesellschaft überhaupt anfühlt, mit menschlichen Bindungen, tragfähigen Beziehungen, weniger Rohheit und Leistungsterror und mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag.
Sie kennen nur das globale Arbeitslager!
Herzlich willkommen!
Im globalen Arbeitslager
Vor 30 Jahren gab es eine Handvoll grundlegende Gewissheiten, elementare Sicherheiten und stabile Umstände, auf die Menschen ihr Leben aufbauen, Familien gründen und ihre Zukunft planen konnten, obwohl es auch damals schon Kapitalismus gab.
Heute dagegen hat sich alles im Veränderungsterror der Globalisierung und seiner Dynamik aufgelöst. Unsere Lebensgeschwindigkeit hat ein unerhörtes Ausmaß angenommen. Es gibt keinen Stillstand. Zeit ist für die meisten Menschen zu einem äußerst knappen Gut geworden. Sie wird täglich weiter verdichtet und unserer Entscheidung entzogen, wie wir unser Leben menschlich gestalten wollen. Entfremdet stolpern wir durch die globalisierte Wirtschaft, immer auf der Hut vor neuen Veränderungen.
Wenn ein Altenpfleger in kürzester Zeit alte Menschen umbetten muss, wenn eine Putzfrau für 2,50 Euro ein Zimmer säubern muss, wenn ein LKW-Fahrer trotz Stau termingerecht abliefern muss, wenn Kunden alles haben wollen und das sofort, dann ist das normaler Alltag. Zeitdruck überall.
In den Neunzigerjahren wurde festgestellt, dass die Komplexität moderner Bürosoftware fast der Komplexität eines Lehrberufes entspricht, der eine Lehrzeit von drei Jahren erfordert. Ich zähle auf meinem Rechner ca. 15 Softwareprodukte, die ich regelmäßig nutze. Die Ankündigung neuer Updates nehme ich inzwischen mit einem Wutanfall zur Kenntnis.
Was ein gutes Leben ist, bestimmen nicht wir selbst, sondern Finanzjongleure, Marketingstrategen und Produktdesigner. Umgeben von sprechenden PCs, ferngesteuert denkenden Kühlschränken, intelligenten Auto-Navigationssystemen, penetrantem Handyterror und vielem mehr werden wir immer mehr zu Marionetten, die Maschinen bedienen müssen, um ihr Leben zu organisieren. Genau genommen sind wir alle inzwischen zum Anhängsel einer technisch-ökonomischen Maschinerie geworden, die wir nicht mehr beeinflussen können, sondern der wir uns unterwerfen müssen, um leben zu können.
Wir sind der rigidesten Arbeitsdisziplin unterworfen, die je eine Generation erdulden musste. Die Arbeit wird mehr. Gleichzeitig wird Personal eingespart. Immer weiter zunehmende Arbeitsverdichtung ist für fast alle Menschen Alltag. In vielen Berufen wird Arbeitseinsatz bis zur Erschöpfung erwartet.
Es gibt keine Phasen der inneren und äußeren Ruhe. Geschäftigkeit, Schnelligkeit, Geschwindigkeit wird in allen Berufen gefordert. Die geforderte und erwartete Arbeitsdisziplin wird umso rigider, je länger die kapitalistische Krise dauert und je ängstlicher die Menschen werden.
Die Arbeit darf ruhig stupide sein. Sie darf den Arbeitenden krankmachen und gesellschaftlich vollkommen sinnlos sein oder die Umwelt zerstören. Die Arbeit darf lange dauern und schlecht bezahlt sein. Es darf Demütigung und Mobbing stattfinden, eine Arbeit, zu der man keine Lust hat, für die man nicht ausgebildet ist. Wer nach Arbeitsinhalten fragt, nach Selbstverwirklichung, outet sich als hoffnungsloser Sozialromantiker des letzten Jahrhunderts. Hauptsache Arbeit, ist der Schlachtruf.
In den Unternehmen gibt es kleinliche Vorschriften und vielfältige Kontrollen. Der individuelle Bewegungsspielraum ist eingeschränkt. Alle Menschen sind Anhängsel interner Prozesse, die sicherstellen sollen, dass jede Aufgabe so effizient und damit kostengünstig erledigt wird wie möglich.
Schikanen und öffentliches Bloßstellen durch Vorgesetzte, lächerlich machen gehören zum Alltag. Unter den »lieben« Kollegen gibt es genügend, die einem anderen das Arbeitsleben noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. Permanente Sticheleien, vorenthaltene Informationen und Unterschieben von Fehlern sind Methoden, die dabei gerne eingesetzt werden.
Man tut gut daran, nicht zu sagen, was man wirklich denkt. In offiziellen Runden sitzen die Menschen mit ihren äußeren Gesichtsmasken. Früher nannte man das Ganze »Unterwerfung«. Heute heißt es »Selbstmarketing«, »Diplomatie« oder »Anpassungsfähigkeit«. Die Unterwerfung ist normal geworden. Die Menschen gewöhnen sich daran, dass sie unterworfen sind.
Flexibilität und Mobilität sind geheiligte Prinzipien des wirtschaftlichen Verkehrs und bis zur völligen Selbstaufgabe gefordert. Die Arbeitszeit wird verlängert. Es ist ganz selbstverständlich, dass nur noch die wenigsten pünktlich Feierabend machen. Im Zuge der Krise wird die Anzahl der Urlaubstage gekürzt. Feiertage werden abgeschafft. Von den Menschen wird erwartet, dass sie rund um die Uhr, am Wochenende, im Urlaub, 24 Stunden am Tag erreichbar sind für die ungeheuer wichtigen Problemchen, die nicht Zeit bis Montagmorgen haben können. Drei Viertel aller berufstätigen Männer sind auch außerhalb der normalen Arbeitszeit per Handy oder E-Mail für den Arbeitgeber erreichbar, ein Drittel sogar rund um die Uhr und auch am Wochenende.
Vielen Menschen reicht ein Job nicht mehr, um zu leben. Sie nehmen neben ihrem »eigentlichen« Beruf noch Stellen nebenher an. Ohne den zweiten oder dritten Job können sie nicht mehr existieren.
Die meisten Menschen haben Angst vor der Zukunft. Viele fürchten sich vor Arbeitslosigkeit und Verarmung, davor, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können, davor, dass sie im Winter nicht mehr ausreichend heizen können, davor, dass sie ihren Kindern keine Zukunft bieten können. Sie haben Angst, nicht mithalten zu können mit den schnellen Veränderungen. Ungesicherte Verhältnisse begleiten die Menschen auf ihrem gesamten Berufsweg.
Die jungen Menschen müssen sich von Praktikum zu Praktikum durchhangeln, ohne je die Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Zeitvertrag und Projektarbeit bieten immer nur ein (Schein-) Auskommen für eine kurze Weile. Die Angst vor dem Altern nimmt zu, weil die Armut im Alter zunimmt. In zwanzig Jahren werden die wenigsten Menschen von ihrer Rente leben können. Unsicherheit ist das zentrale Lebensgefühl von der Wiege bis zur Bahre.
Unsere Kinder vergiften wir mit Ritalin. Hauptsache, die Kinder sind äußerlich unauffällig und funktionieren reibungslos im Arbeitslager. Dass Psyche und Gehirn nachhaltig und auf Dauer geschädigt werden, ist kein Grund dafür, ernsthafte Bedenken dagegen einzuwenden, den natürlichen Drang des Kindes nach Bewegung und sozialer Wärme chemisch zu zerstören.
Immer mehr Menschen glauben daran, dass die Zukunft nicht besonders rosig aussehen wird. Jenseits der von den Medien konstruierten Spaßgesellschaft glauben die Menschen tief drinnen nicht daran – auch wenn sie äußerlich so tun und immer noch ihre Fassade aufrechterhalten. Würden sie offen darüber reden, würden sie als »Showstopper« und »Partykiller« ausgegrenzt.
Die Arbeit im Kapitalismus macht uns krank. Die Hälfte aller Deutschen, die einer Beschäftigung nachgehen, klagt darüber, dass sie arbeitsbedingte Schmerzen haben. Viele können nachts nicht schlafen. Sorgen und Grübeleien über das Morgen rauben ihnen die Ruhe. Millionen klagen über Kopfschmerzen. Depressionen vergiften die Lebensfreude. Burn-out ist ein massenhaftes Phänomen geworden. Zwischen 2004 und 2010 stieg die Zahl der Krankheitstage wegen eines Burn-outs um 900 Prozent. Die psychisch bedingten Krankheiten nehmen insgesamt rapide zu. Trotz Krankheit kommen viele zur Arbeit, weil sie nicht riskieren wollen, dass sie in der nächsten Entlassungsrunde dabei sind.
Lebensmittel sind ärmer an Nährstoffen, weil die Böden ausgelaugt sind. Unsere Nahrung ist ungesünder, weil sie durch industrielle Herstellungsprozesse misshandelt wird. Ihre Giftbilanz nimmt zu, weil wir immer mehr und neue Gifte produzieren, die nicht abbaubar sind.
Aufgebackene Industriepappe in den Bahnhöfen Europas als Baguettes, Donuts, Bagels oder Muffins angeboten – mit Grausen betrachtet der kritische Bürger den Schrott, der ihm als Lebensmittel verkauft wird. Das Angebot im Supermarkt, beim Buffet im Viersternehotel oder in einem durchschnittlichen Restaurant kann nur noch als eine moderne Form der Biomüllentsorgung betrachtet werden. Gesundes Essen ist das nicht.
Aber auch zu Hause ist die Ernährungssituation keinesfalls besser. In ihrem täglichen Terminstress wursteln sich die Menschen ernährungsmäßig irgendwie durch, haben keine Zeit, sich darum zu kümmern, was sie da zu sich nehmen. Tausende künstlicher Aromen aus der Höllenküche moderner Alchimisten traktieren die Gesundheit. Ihre Verdickungs-, Süß- und Schaummittel, ihre Geschmacksverstärker und Farbstoffe machen es möglich, dass Käse verkauft wird, der keinerlei echte Milch enthält, dass Zedernspäne zu Himbeeren verarbeitet werden, dass aus Holzabfällen der Papierindustrie Erdbeeraroma erzeugt wird und Rindfleischsuppen ohne ein Gramm echtes Fleisch.
Weil wichtige Stoffe in den Lebensmitteln fehlen, kommt der Hunger schneller zurück. So plagen sich viele Menschen mit Übergewicht, was kein Zeichen von Wohlstand ist, sondern für das Gegenteil, nämlich Mangelerscheinung durch miese Lebensmittel. Wer nunmehr auf Diätlebensmittel zurückgreift, setzt den Teufelskreis erst richtig in Gang. Diese Produkte werden industriell besonders misshandelt und mit künstlichen, leeren Stoffen aufbereitet, um eben Kalorien zu vermindern.
Mit Dioxin belastete Milch, Tierkrankheiten wie BSE, Antibiotika in Garnelen, Acrylamid in Keksen, Schadstoffe in Mozzarella usw. usw. – Müttern wird empfohlen, ihre Kinder nicht mehr zu stillen, um sie nicht mit Muttermilch zu vergiften. Acht Lebensmittel-Kontrolleure überwachen in Rheinland-Pfalz 16.000 Betriebe. So führt der schlanke Staat dazu, dass Lebensmittel reicher an Schadstoffen als an Vitaminen sind. Der gesundheitsbewusste Mensch stürzt sich auf Biolebensmittel, in der Hoffnung, dass er für einen doppelten Preis nur die Hälfte der Giftstoffe zu sich nimmt.
Wer viel arbeitet, zu viel arbeitet, ist auch viel erschöpft. Die Familie leidet darunter, wenn die Eltern ständig unterwegs oder innerlich auf dem Sprung sind. Nachbarschaften und Freunde werden vernachlässigt, weil ihre Pflege Zeit und innere Bereitschaft benötigt. Zeitmangel und chronische Müdigkeit vieler Menschen führt zu einer zunehmenden Entfremdung und Isolation.
Die ständig zunehmende Beschleunigung zerstört Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen zu echten glücklichen Beziehungen. Die Sorgen tragen zu gedanklicher Ablenkung, zu Grübeleien, zur Verschlossenheit und Abschottung bei.
Jemand, der für einen Auftrag durch die halbe Republik reist und am Freitag spät abends heimkommt, um am Montagmorgen sehr früh wieder irgendwo anders zu sein, kann nur die notwendigsten häuslichen Dinge aufrecht erhalten. Er wird seine Kinder vernachlässigen müssen – von sozialen Kontakten ganz zu schweigen. Die so vom Beruf absorbierten sind froh, eine Weile allein zu sein, wollen in ihrer knappen Freizeit nicht auch noch (soziale) Verpflichtungen.
Menschliche Bindungen im Sinne von intensiven, verlässlichen Beziehungen lösen sich auch in den Unternehmen auf. Die Kollegialität nimmt ab und kann nicht aufgebaut werden, wenn der Job alle zwei Jahre gewechselt und in eine andere Stadt gezogen wird. Und der tägliche Arbeitsdruck macht das ziellose Beisammensein bei einem halbstündigen Büroplausch unmöglich.
Es kann viele Paare jederzeit treffen: die Trennung aus beruflichen Gründen. Denn wenn ein Partner plötzlich vor die Wahl »Arbeitslosigkeit oder örtliche Veränderung« gestellt wird, ist die Entscheidung klar: zuerst die Arbeit, dann die Beziehung. Falls jemand sich traut, anders zu entscheiden, drohen finanzielle Sorgen und anzügliche Bemerkungen von Freunden und Verwandten.
Familiengründung wird schwerer. Die Scheidungsrate nimmt zu. Die wechselseitigen Erwartungen werden zu turmhohen Wünschen, die kein normaler Mensch mehr befriedigen kann. Der Partner wird mit Erwartungen beladen wie ein Pferd und ist völlig überfordert. Beziehungen und Ehen gehen vor die Hunde, weil keine Zeit mehr zu ihrer Pflege verfügbar ist. Gepflegt werden Softwareprodukte, Produktlinien, Autos, Kundenbeziehungen – nicht jedoch die Liebesbeziehung. Die muss so funktionieren.
Noch nie haben so viele Menschen über so große Distanzen gelebt und geliebt wie heute. Auch wenn sich viele Paare unter dem Beifall der Apologeten selbst belügen: Eine Fernbeziehung über eine große Distanz hält in der Regel nicht lange.
Abends traben sie in ihre Single-Wohnungen, in der mit einigen Gegenständen auf weltgewandt gemacht wird und die trostlose Einsamkeit durch coole Einrichtung versteckt werden soll. Sie gehen ins Internet und versuchen verzweifelt, einen Partner herbeizugoogeln. Das Leben vieler Menschen spiegelt weniger die »Spaßgesellschaft” wider und ist weniger ein hedonistisches Leben als vielmehr ein Leben in Selbstisolation. Innerlich gefühlte und äußerlich erlebte Einsamkeit ist eine Seuche, unter der Menschen aller Altersgruppen leiden. Weite Teile der 25- bis 35-Jährigen in Deutschland werden von ihrem Beruf aufgerieben. Sie sind kontaktarm und sexuell unterversorgt. Wenn man sich vor Augen hält, dass fast die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland regelmäßig auch an Wochenenden, Feiertagen oder nachts arbeitet, ist das nicht weiter verwunderlich.
Intimität, Liebe und Sex werden zur Nebensache, Sex ist im globalen Arbeitslager lediglich eine konsumierbare Ware, ein Rausch, der die Funktion hat, die Arbeitsfähigkeit zu erhöhen. Die lustvollen Facetten von eruptivem Sex, aber auch von dauerhafter körperlicher Liebe als wesentliche Grundlage für tiefgehende Gefühle und Intimität zwischen erwachsenen Menschen werden reduziert und auf Pornoseiten im Internet kommerzialisiert.
Damit soll nichts gegen den schnellen Sex gesagt sein – nur als ausschließliches und dauerhaftes Befriedigungsmodell ist er ungeeignet. Echte Liebe braucht Zeit. Echte Liebe braucht Intimität. Befriedigender Sex braucht Raum und Verständnis.
Wenn dann die Arbeit doch einmal zu Ende sein sollte, steht der Bürger im Stau. Um vom Arbeitsplatz zum Wohnort zu kommen, werden jedes Jahr viele Stunden Zeit vergeudet. Totale Flexibilität heißt, dass der Bürger seiner Arbeit einem Nomaden gleich an jeden Ort hinterherreist. Der entsprechende zeitliche Aufwand ist selbstverständlich keine bezahlte Arbeitszeit, sondern privat, quasi eine Art »Hobby«.
Funktioniert ein technisches Gerät nicht, so gibt es eine Hotline, die von Indien aus in gebrochenem Deutsch dem »Kunden« deutlich zu machen sucht, auf welcher Webseite er möglicherweise Informationen zu seinem technischen Problem finden kann. Aber erst, nachdem der Kunde durch eine Warteschleife mit durch Zahlen geführte Benutzerführung gequält wurde. Kreditkartenfirmen und Versicherungen schicken ihre Anrufer in Labyrinthe aus Telefon-Warteschleifen und weltweit verstreuten Call-Centern.
Wenn das nicht hilft, organisiert der Kunde den Rückversand seines defekten Gerätes selbst. Flugpassagiere erledigen ihren eigenen Check-in an einem Computer in der Abflughalle. Statt einen Kundenberater ihrer Bank anzurufen, surfen sie zur Webseite. Sie besuchen sogar ihren Arzt erst nach einer Selbstdiagnose per Internet. Für dieses Engagement verbringen manche Bürger acht bis zwölf Stunden pro Woche zusätzlich vor dem Bildschirm, einen vollständigen Arbeitstag.
Nicht nur die Kunden von Ikea bauen sich ihr Regal selbst zusammen. Auch Eltern werden aktiv. Sie streichen in ihrer Freizeit ganze Schulen, weil die Räume für Kinder unzumutbar sind und die Kommune kein Geld für Handwerker hat. Sie reparieren Dächer und isolieren Wände. Wenn es sein muss, basteln Eltern als Hilfslehrer sogar modernen Unterricht zusammen.
»Bürgerschaftliches Engagement« hieß früher, gegen die Zumutungen von Eliten und Staat auf die Straße zu gehen. Heute bedeutet es, die grundlegenden Aufgaben selbst zu organisieren – weil Staat und Unternehmen aus Kostengründen viele Aufgaben brachliegen lassen.
Wenn es passiert, dass jemand nach der Rotphase nicht sofort durchstartet, erntet er in der Regel ein wütendes, heftiges Hupkonzert. Wie kann man es wagen, zwei Sekunden unaufmerksam zu sein! Wer sich traut, Geschwindigkeitsregeln einzuhalten, hat schnell einen wütenden Verkehrsteilnehmer an der Stoßstange, der seinem Ärger durch dichtes Auffahren Ausdruck gibt. Der Kampf um die Vorfahrt endet hin und wieder mit einem Toten. Auch die Suche nach einem Parkplatz ist kein normaler Vorgang, sondern ein riskanter Prozess.
Als junge Eltern erlebt man sehr schnell, was das allumfassende Geschwindigkeitsdiktat auf der Straße für den Umgang mit Kindern bedeutet. Für die Langsamkeit eines Kindes gibt es wenig Verständnis. Ob an der Kasse im Supermarkt, beim Aussteigen aus dem ICE oder beim Überqueren der Straße: Die nachdrängenden Menschen zeigen deutliche Anzeichen von Ungeduld bis Zorn, wenn es ein paar Sekunden zu lange dauert.
Wenn die alte Dame an der Kasse im Supermarkt länger braucht, um das gesuchte 2-Cent-Stück auch tatsächlich zu finden, weil die Augen nicht mehr so wollen oder die zittrigen Hände das Geld nicht richtig festhalten können, oder wenn ein Senior die Benutzeroberfläche des elektronischen Fahrkartenautomaten bei der Bahn nicht versteht, dann können sie nicht automatisch mit Verständnis oder freundlicher Hilfe rechnen. Wenn Rentner mit ihrem Auto langsam über die Landstraße rollen, drängeln hinter ihnen wütende Berufsfahrer, die über ihren Knopf im Ohr aus der Firmenzentrale gerade ihre Effizienzanweisungen erhalten.
Wer hinter einem anderen Kunden durch die Schwingtür eines Kaufhauses geht, kann sich glücklich schätzen, wenn ihm die Tür nicht vor der Nase zugeschlagen wird, weil der Mensch vor ihm wie taub und blind zu den nächstgelegenen Sonderangeboten stürmt. Hin und wieder werden schon mal Menschen totgetrampelt, weil es im Elektronik-Markt Hochleistungsrechner im zeitlich befristeten Sonderangebot gibt.
Als die Post privatisiert wurde, wurden erst einmal zwei Drittel aller Briefkästen im Bundesgebiet abgeschraubt. Dafür wurde die Post dann auch nicht mehr von einem, sondern gleich von vier unterschiedlichen Firmen ausgefahren. Pakete und Briefe werden nun nicht mehr in den Briefkasten gesteckt, sondern mehr so vor die Tür geworfen. Falls der Adressat nicht zu Hause ist, wird jetzt die Nachbarschaft in den Postverteilungsprozess integriert. Diese darf dann nach Feierabend die Pakete an die entsprechenden Nachbarn verteilen.
Auch meine Zeitung wird nicht mehr von einem Zeitungsboten gebracht, sondern von einem Zeitungshinwerfer aus einer Distanz von ungefähr 10 Metern sachgerecht vor die Tür geworfen. Sie sieht dann immer so aus, als hätte die Marktfrau ihren Fisch bereits damit eingewickelt. Meine diesbezügliche Beschwerde wurde von dem indischen »Call Business Service« freundlich entgegengenommen. Freunde sagten mir, ich solle mich nun in der Zentrale direkt beschweren, aber das lasse ich lieber sein, weil mir keiner eine Garantie dafür abgeben kann, dass der Zeitungshinwerfer mir nicht den Schädel einschlägt, wenn er seinen Job aufgrund meiner Beschwerde verloren hat.
Es ist normal, dass der Bürger als Kunde wie ein Schießhund achtgeben muss, dass er nicht übertölpelt wird. Es gehört zur Funktionsfähigkeit des globalen Marktes, dass sich jeder holt, was er kriegen kann, und alles verspricht, auch wenn er es nicht halten kann – wie auf einem arabischen Bazar.
Bei den Waren, die er täglich kauft, stellt der Bürger nur bei hoher Aufmerksamkeit fest, dass sich plötzlich bei gleichem Preis weniger Inhalt in der Verpackung befindet. Gestern waren es noch 500g und heute plötzlich nur noch 400g – die Packung ist aber optisch so aufbereitet, dass nur bei genauerem Hinsehen ihre geringere Größe auffällt.
Ein unüberschaubarer Tarifwust bei Strom- und Gasanbietern, bei Providern, bei der Telekommunikation etc. lässt den Bürger resignieren. Er kann zwar die geballten Informationen des Internet für Preisvergleiche nutzen. Doch dazu muss er mehrere Nachmittage mit Surfen verbringen, um die gewünschten Informationen zusammenzutragen und das klein Gedruckte zu vergleichen, weil bei dem scheinbar günstigen Anbieter an anderer Stelle Zusatzkosten versteckt sein können.
Nach einem halben Jahr ist dieser Aufwand dann erneut fällig, weil neue Tarife entstanden sind, Unternehmen fusioniert wurden, andere in Konkurs gingen, Aktienpakete den Besitzer wechselten – und damit Verträge und Tarifstrukturen »optimiert« wurden – was das bisherige Wissen vollkommen nutzlos macht. Also wieder von vorn.
Handys gehen nach wenigen Monaten in die Grätsche. Die im Baumarkt erworbenen Halogenbirnen müssen jedes halbe Jahr erneuert werden. Bei Kleidungsstücken ist der Stoff schon nach vier Wochen durchgerubbelt. Selbst bei teurer Kleidung löst sich nach einem halben Jahr der erste Knopf. Socken sehen nach der fünften Wäsche aus, als hätte sie schon Karl V. getragen. Bei einer Tube Klebstoff bricht die Kappe bereits nach dem dritten Gebrauch ab, sodass man sie in den Müll werfen muss. Die Knoblauchpresse weist nach der zehnten Benutzung Gebrauchsspuren auf, als würde der Hausherr damit seinen Zement anrühren. Die Zeitung, die ich eine Woche vor Weihnachten gekauft habe, wünscht mir in großen Lettern ein frohes Osterfest. Kerzen, die ich neu gekauft habe, brennen nur halb ab, dann ist der Docht verrußt und ich kann meine Ratlosigkeit nur in einer Flasche Rotwein ertränken, bei der der Korken leider abgebrochen ist. Das für viel Geld erworbene Designerregal ist eine Augenweide – allein die Befestigungen sind aus Kostengründen unterdimensioniert und nach einem halben Jahr bricht das Teil von der Wand ab.
Jetzt sagen die Apologeten, dass Konkurrenz das Geschäft belebe, weil der Tritt des Marktes zur Belebung des Kreislaufes und zu besserer Qualität führen würde. Das ist jedoch blanke Theorie. In der Praxis hilft mir das nichts, weil ich die Qualitätsdefizite erst nach einem halben Jahr feststelle, wenn ich die Ware bereits erworben und in Gebrauch habe. Bei jeder Modellrechnung, die angestellt wird, um mir den Nutzen meiner Geldanlage zu beweisen, wird immer der best case zugrunde gelegt – es ist also nicht direkt gelogen. Dass die Renditen, die für Risikolebensversicherungen zugesagt wurden, nie eingehalten werden, ist eben – Lebensrisiko.
Wer sich ein neues Auto zulegt, riskiert eine Rückrufaktion, weil die Elektronik den Fahrer misshandelt. Mal ist es die Benzinpumpe, mal ist es der Scheibenwischer, mal sind es die Schiebedächer. Im Jahr 2010 mussten Millionen Autos zurückgerufen werden. Bei den hochmodernen Fahrzeugen, bei denen die Elektronik intelligenter ist als so mancher Fahrer, bestand die Gefahr, dass das Gaspedal (!) nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückkehrte, wenn man den Fehler beging, es zu benutzen. Jeder LKW auf der Straße kann eine Zeitbombe sein. LKWs im schlechten Zustand, große Hetze, zu enge Termine und übermüdete Fahrer machen die Straßen zum Abenteuerspielplatz.
Immerhin vier Jahre lang konnte der ICE die neu gebaute Strecke München – Nürnberg mit 300 km/h bedienen. Der Winter 2009 bereitete dem schnellen Fahrvergnügen ein Ende, weil man ja bei der Erstellung der Gleiskörper beim besten Willen nicht ahnen konnte, dass in Bayern im Winter die Temperaturen auf unter null Grad fallen könnten. Zum Jahresende 2009 durften mehrere hundert Fahrgäste ihre Nacht unterirdisch im Nordseetunnel in einem Zug verbringen, da der Zug nicht mehr zu bewegen war, weil Kondenswasser die hochmoderne Elektronik lähmte.
2007 fegte Kyrill durch Europa. Am neu gebauten Berliner Hauptbahnhof donnerten tonnenschwere Stahlträger vom neuen Bahnhofsdach auf den Boden. Aus Kostengründen hatte man auf besondere Befestigungen verzichtet und gehofft, dass zwei Tonnen schon ausreichen würden, den Stahlträger auf der Brüstung zu halten.
In Überlingen kam es 2002 zum Zusammenstoß zweier Flugzeuge. Die Folge waren viele Tote und schließlich auch ein toter Fluglotse, weil ein trauernder Vater den Fluglotsen erschoss, der falsche Anweisungen gegeben hatte. Aus Kostengründen wird nachts nur noch ein übermüdeter Fluglotse eingesetzt.
2008 stürzte das Stadtarchiv in Köln ein, weil im Untergrund Bahntunnel gegraben wurden. Die Bauaufsicht war aus Kostengründen reduziert. Es gab einen hohen Termin- und Zeitdruck. Wie sich später herausstellt, gab es auch »Unregelmäßigkeiten« bei dem U-Bahn Bau, in verständlichem Deutsch: Es wurde zu wenig Beton verbaut, nur 17 Prozent der zur Sicherung der Wandlamellen vorgesehenen Stahlbügel wurden eingesetzt.
So viele Fragen...
Im globalen Arbeitslager werden wir zu Leistung und Optimierung getreten, taumeln ohne Perspektive, ohne Sicherheit, ohne Zukunft mit großen Lebensrisiken durch unser Dasein. Selbst wenn es außen mal etwas langsamer gehen sollte, so kommen wir innerlich nicht zur Ruhe. »Sei stark«, »Sei perfekt«, »Sei schnell«, »Streng dich an«, »Machs allen recht«, raunzen uns unsere inneren Antreiber an. Angetrieben durch die Tritte des Marktes, gehetzt durch unsere inneren Antreiber, die durch die Verhältnisse täglich treffliche Nahrung erhalten, sind wir geknebelt und unterworfen.
Ich führe Seminare für Erwachsene durch. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, vor allem außerhalb der täglichen Arbeitsroutine und des täglichen Leistungsdrucks, weil dort viel Nähe und Menschlichkeit möglich ist.
Zunehmend frage ich mich jedoch, wie lange ich meinen Beruf noch ausüben will und kann. Zeitdruck und Leistungsterror nehmen auch in meinen Seminaren und in der Beratung in einem unerträglichen Maß zu. Es wird nur noch auf Äußerlichkeiten geachtet, auf Effizienz und Sparsamkeit. Trainings und Beratungsprozesse werden kürzer, die Themenvielfalt größer – so, als wäre die menschliche Psyche ein Computer, deren Festplattenkapazität durch technische Maßnahmen vervielfacht werden könne.
Die Teilnehmer werden deformierter, ihr Misstrauen gegen mich nimmt zu, weil sie nicht wissen, welchen geheimen Auftrag ich von ihren Chefs in Zeiten des Personalabbaus noch bekommen habe. Sie werden feindseliger, weil sie in ihrem Arbeitsalltag so viel runterschlucken. Im Seminar haben sie jemanden gefunden, dem sie zwar misstrauisch gegenüber treten, aber in weit größerem Ausmaß ihren gesamten psychischen Müll vor die Füße werfen können, als an jedem Ort im Unternehmen.
Was ist der Grund, dass das alles passiert, dass die Verhältnisse nicht so sind, wie sie sein sollten? Warum verfällt unser Leben immer mehr, obwohl die Apologeten nicht müde werden, das Gegenteil zu behaupten? Warum funktionieren wir, obwohl viele von der Perspektivlosigkeit der Verhältnisse zunehmend überzeugt sind? Was ist der Grund, dass wir uns Zumutungen leisten, über die spätere Generationen einmal genauso den Kopf schütteln werden wie wir heute über das Leben im Mittelalter, dass wir ein würdeloses Leben als Freiheit betrachten? Und warum hat dieses perfide Lebensmodell, diese Bauruine eines menschlichen und erfüllten Daseins so alternativlos jeden Flecken dieses Planeten und jeden Winkel unseres Bewusstseins unter dem Schlachtruf der »Globalisierung« erobert? Warum ist es so geworden, wie es ist?
Was gäbe es stattdessen?
Wie käme »man« dahin?
Teil 1
Kapitalismus verstehen
2 Die Ökonomie des Kapitalismus
»Und zudem herrscht in Deutschland die merkwürdigste Unwissenheit und Begriffsverwirrung über die einfachsten ökonomischen Verhältnisse, von den patentierten Verteidigern der bestehenden Zustände bis hinab zu den sozialistischen Wunderschläfern und den verkannten politischen Genies.« (Karl Marx, Ökonom)
Nachdem 2007 mit dem Zusammenbruch von einigen wichtigen Banken in den USA die größte Wirtschaftskrise seit 1929 begann, herrschte große Ratlosigkeit, wie das denn passieren konnte. Auf jeden Fall wurde schon mal Entwarnung gegeben, da man ab jetzt alles im Griff habe. Im August 2009 stand in deutschen Boulevardzeitungen, dass Forschungsinstitute und Bankfachleute die Konjunkturentwicklung in Deutschland als »deutlich günstiger als noch vor kurzem« ansahen. Vier Wochen später, im September 2009, schrieben die Zeitungen allerdings, dass dem Arbeitsmarkt das Schlimmste erst noch bevorstehe.
Einen Monat später, am 15. Oktober 2009, schrieb eine Zeitung, dass die Wirtschaft jetzt aber die Talsohle verlassen würde und ein Wachstum von zwei Prozent für das Jahr 2010 zu erwarten sei. Am 16. Oktober, also einen Tag später, schrieb die gleiche Zeitung, dass der Aufschwung aber doch noch auf sich warten lassen würde.
In der Woche darauf, am 23. Oktober, erzählte uns eine »Qualitäts«Zeitung, dass die Unternehmensgewinne sich besser entwickeln würden als erwartet. Am 20. November 2009 behauptete die gleiche Zeitung, dass wir laut OECD »das Schlimmste hinter uns« hätten. Wiederum die gleiche Zeitung berichtete drei Tage später am 23. November 2009, dass auf dem Arbeitsmarkt das schlimmste erst noch bevorstehen würde. Im Januar 2010 schrieb eine andere Zeitung, dass sich die Konjunktur doch »überraschend schwach« entwickeln würde.
Unwillkürlich tritt der Verdacht auf, dass die Redakteure jeden Tag eine ordentliche Menge Rotwein zu sich nehmen, bevor sie in die Tastatur hauen und solche Textruinen verfassen. Aber es sind nicht nur Journalisten, deren Denkversuche immer dann vor die Wand laufen, sobald es um ökonomische Probleme geht. Manche bringen es damit sogar bis zum Wirtschaftsminister: Alois Rhiel zum Beispiel.
Vor den fassungslosen Augen seiner Leser entfaltete er seine anspruchsvolle Wirtschaftstheorie in fünf Zeilen. »Deutschland hat zu hohe Lohn- und Lohnnebenkosten«, meinte er. »Deshalb müssen wir die Kosten der sozialen Sicherung auch von den Löhnen entkoppeln ... Dann wird es für Arbeitgeber günstiger, Jobs zu schaffen. Und wenn die Menschen Arbeitsplatz-Sicherheit haben, hört auch das übertriebene Angstsparen auf, was in Deutschland derzeit um sich greift. Dann springt auch irgendwann der Konsum an – und die Menschen kaufen zum Beispiel auch wieder Autos.” Also bevor einen der Konsum anspringen kann, muss seiner Meinung nach dem Deutschen, der ein übertriebener Angsthase sei, die Angst dadurch ausgetrieben werden, das man ihm die Löhne kürzt und den Arbeitsschutz wegnimmt. Alois Rhiel sagte das 2004 und da war er Wirtschaftsminister in Hessen. Übrigens: Volkswirtschaftslehre hat er sogar studiert.
»Je höher die Preise für Agrarrohstoffe steigen, desto besser für uns alle«, sagt einer der erfolgreichsten Investoren in Lebensmittel. Was sich skrupellos anhört, folgt nur dem neoliberal-religiösen Gedöns. »Wenn die Preise für Agrarrohstoffe nicht steigen, werden wir in absehbarer Zukunft keine Bauern mehr haben. Und wenn wir keine Bauern mehr haben, wird kein Land mehr kultiviert, und wir werden eine globale Nahrungsmittelkrise erleben.« Demnach verursachen nicht teure Lebensmittel den Hunger in der Welt, sondern billige.
Die Tradition der ökonomischen Verblödung reicht zurück bis Helmut Schmidt. In den Siebzigerjahren war mal wieder Krise der kapitalistischen Wirtschaft. In dieser Zeit brachte der Sozialdemokrat folgenden legendären Satz heraus: Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen- ein Leitsatz, der eherne Gültigkeit im wirtschaftlichen Diskurs der Apologeten hat. Heute geben die selbsternannten Verteidiger der bestehenden Zustände und die verkannten politischen Genies in bundesdeutschen Talkshows ihr Viertelwissen einem Millionenpublikum zum Besten. Aber was will man von Experten einer Gesellschaft erwarten, die in der Schule den Schülern erklären, dass die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital seien?
Um wirklich zu verstehen, wie Kapitalismus funktioniert, ist es notwendig, seinen Kern zu betrachten, der jenseits aller nationalen Varianten und Formationen sein Wesen ausmacht. Der Kern, der unveränderlich und von jeglicher politischen und sozialen Reform unberührt bleibt, unberührt bleiben muss, weil sonst der Kapitalismus als Kapitalismus nicht mehr existierte. Das Verständnis der Kernstruktur der kapitalistischen Ökonomie ist die wichtigste Basis für das Verständnis nicht nur der globalen Wirtschaftskrisen, sondern aller anderen gesellschaftlichen und sozialen Prozesse.
2.1 Die kapitalistische Kernstruktur
Der Wert der Ware
Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Wirtschaft muss die Frage sein: Was braucht ein Mensch zum Leben? Und auf welche Weise kann das für das Leben Notwendige produziert und verteilt werden? Die primären Fragen sind nicht, ob es einen Wirtschaftsaufschwung oder funktionsfähige Märkte gibt, ob es dem Euro gut geht oder dem Investor, sondern ausschließlich, ob am Ende der (ökonomischen) Tätigkeit die Menschen real einen vollen Kühlschrank haben, real über eine warme Wohnung verfügen und sich real gut kleiden können. Ausgangspunkt jeglicher Überlegungen zur Ökonomie sind immer die Lebensbedürfnisse der Menschen und die Möglichkeit ihrer Befriedigung.
Was der Mensch zum Leben braucht, wächst nicht im Balkonkasten. Lebensmittel müssen geerntet, Brot muss gebacken, Kleidung genäht, Tische müssen gebaut und Bier muss gebraut werden. Zur Herstellung von Gegenständen und zur Ernte dessen, was er zum Existieren braucht, muss der Mensch Aktivitäten entfalten. Er muss seine Arbeitskraft einsetzen. Nur durch den Einsatz dieser Arbeitskraft kann der Mensch aus der Natur die für ihn notwendigen »Ressourcen« gewinnen. Nur durch Arbeit kann er aus rohen Materialien Gegenstände erzeugen.
»Geld verdienen« ist nicht arbeiten. Arbeiten heißt, das real herzustellen, jenes tatsächlich zu ernten, was für die Existenz des Menschen benötigt wird. Arbeiten bedeutet über einen gewissen Zeitraum Kraft, Energie, Wissen, Kalorien etc. einzusetzen, um das Notwendige zu produzieren oder zu ernten.
Im Kapitalismus – wie übrigens in jeder arbeitsteiligen Gesellschaft – stellt der einzelne Mensch nicht alles selbst her, was er braucht. Er erntet nicht seine Äpfel selbst, backt kein Brot selbst, näht nicht selbst seinen Mantel, braut sein Bier nicht selbst. Er produziert vielmehr jene Gegenstände, für deren Produktion er über die notwendigen Voraussetzungen (Wissen, Produktionsmittel, etc.) verfügt. Er stellt etwas her und tauscht dieses auf dem Markt gegen das ein, was er zum Leben braucht. Wenn ein Tischler Brot braucht – dann baut er einen Tisch, um diesen gegen Brot einzutauschen. Wenn unser Tischler einen Mantel benötigt – dann baut er wieder einen Tisch, um diesen gegen einen Mantel einzutauschen. Egal, welches Bedürfnis sich regt und was auch immer er benötigt: Der Tischler baut einen Tisch, um ihn gegen das einzutauschen, was er zum Leben braucht.
Der Tisch, den der Tischler herstellt, ist für den Tischler keiner. Der Tischler baute ihn nicht, um selbst etwas darauf abzulegen, also nicht, um ihn selbst als Tisch zu nutzen. Der Tischler baute ihn nur für den Tausch gegen etwas anderes. Der Tisch hat also für den Tischler nur einen Nutzen – ihn gegen andere Produkte zu tauschen, die er zum Leben benötigt. Der Tisch hat für den Tischler keinen Gebrauchswert. Er ist Ware.
Im Kapitalismus stellt jeder Mensch Waren (oder Dienstleistungen) her, die für ihn selbst nur einen einzigen Nutzen haben: sie gegen andere Waren auf dem Markt – und zwar über den Umweg Geld – einzutauschen. Alle Erzeugnisse der menschlichen Arbeit sind also Waren, die nur erzeugt wurden, um sie auf den Märkten gegen jene Waren einzutauschen, die für die eigenen Bedürfnisse benötigt werden. Leben ist im Kapitalismus nur möglich durch die Herstellung von Waren – und deren erfolgreichen Tausch (»Verkauf«) auf dem Markt. Alle Produzenten in der Warengesellschaften müssen zwei Dinge unbedingt beherrschen: (irgendeine) Ware zu produzieren und diese erfolgreich zu tauschen.
Für den Tischler ist also die ganze Angelegenheit noch nicht erledigt, wenn der Tisch fertig ist. Er muss ihn erfolgreich tauschen (bzw. verkaufen). Wenn er den Tisch nicht erfolgreich verkaufte, hätte er ihn überflüssig – buchstäblich umsonst – hergestellt.
Wenn der Tischler seinen Tisch eintauscht, stellt sich für ihn eine existenzielle Frage: Wie viel Brot bekomme ich für meinen Tisch? Wie viele Kisten Bier ist mein Tisch wert? Welche Menge Tisch muss ich hergeben, um den gewünschten Mantel zu bekommen? Einen, zwei, fünf oder nur einen halben oder lediglich das Tischbein, oder anders ausgedrückt: Wie hoch ist der Tauschwert meines Tisches?
Arbeiten heißt, dass ein Mensch über einen gewissen Zeitraum seine Arbeitskraft einsetzen muss und zwar so lange, bis er das zusammen hat, was er zum Leben braucht. Wenn der Tischler einen Tisch baut, kann er nicht gleichzeitig Äpfel ernten, Brot backen, einen Mantel nähen. Er setzt seine Kalorien, Energie, Kraft, seine Werkzeuge, sein Können, seine Zeit in die Herstellung dieses Tisches. In den Tisch weiterhin eingeflossen sind Holz, Energie, Farbe etc. Vorher war das Holz roh, die Farbe im Eimer, die Energie vorhanden, jetzt ist aus allem ein Tisch geworden. Die Arbeit des Tischlers verwandelt alles in einen Tisch, so wie das Chlorophyll Kohlenstoff in Sauerstoff verwandelt.
Das in den Tisch durch den Einsatz von Arbeit eingegangene Holz, die verbrauchten Kalorien, das eingesetzte Können, die verbrauchte Zeit bilden eine Quantität, eine Menge. Diese Menge bildet den Wert des neuen Gegenstandes »Tisch«. Aber der Wert des Tisches ergibt sich nicht nur aus der Summe der Rohstoffe, die eingeflossen sind. Die vom Tischler eingesetzte Arbeitskraft hat ebenso einen Wert. Die Arbeit des Tischlers hat vorhandene Werte (Holz, Energie, Farbe ...) verwandelt und neue Werte hinzugefügt (Arbeitszeit des Tischlers). Die in den Tisch geflossenen Werte bilden den neuen (Gesamt)Wert »Tisch«.
Wenn der Tischler den von ihm hergestellten Tisch hergibt, muss er einen adäquaten Ersatz dafür erhalten, der ihm alles ersetzt, was in den Tisch eingeflossen ist. Wäre das nicht der Fall, könnte er dauerhaft nicht leben. Er hätte nicht genug zu essen, könnte das Holz nicht bezahlen, das in den Tisch eingegangen ist, nicht die Farbe, mit der er den Tisch strich. Diese Werte bilden also die Grundlage für den Tauschwert des Tisches. Da das, was für den Tischler gilt, auch den Bauern betrifft und die Putzfrau, so gilt die einfache Formel: Eine Stunde Arbeit des einen hat den gleichen Wert wie eine Stunde Arbeit des anderen.
»Falsch!« trumpfen die ungeduldigen Apologeten der herrschenden Verhältnisse auf. »Wir sind ja doch weiter als im Mittelalter. Es gibt Maschinen, der Arzt ist qualifizierter als eine Putzfrau, mit einem Auto geht der Transport viel schneller als zu Fuß. Alles ist komplexer geworden. Eine ärztliche Sprechstunde ist doch wertvoller als eine Stunde putzen.« Das stimmt – allerdings nicht ganz.
Wenn ein Tischler für die Produktion des Tisches eine Woche Arbeit benötigt, so fließt in den Tauschwert des Tisches – neben den Materialien – diese eine Woche Arbeit. Neben der reinen Arbeitszeit und den Ausgangsmaterialien Rohholz (20kg), Farbe (2 l), Strom für die Maschinen (500 KW) fließt aber auch der Wert jener Güter ein, die durch die Herstellung eines einzelnen Tisches nicht verbraucht worden sind, sondern für die Herstellung weiterer Möbelstücke eingesetzt werden können: Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsräume etc. Sie werden anteilig auf den einzelnen Tisch angerechnet. Wenn zum Beispiel eine Maschine 250 Tische produzieren kann, bevor sie gegen eine neue ausgetauscht werden muss, fließt in den einzelnen Tisch 1/250 des Wertes der Maschine ein.
Die Arbeitskraft des Tischlers selbst hat auch einen Wert. Dessen Höhe wird bestimmt von den Werten, die zur Produktion und Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind, also neben Lebensmitteln auch Kleidung, Unterkunft, Ausbildung des Tischlers etc. Auch diese fließen über die Arbeit in die Wertebilanz des vom Tischler hergestellten Tisches, und zwar anteilsmäßig.
Der Tischler braucht einen Mantel, um in der Kälte zu überleben. Wenn der Mantel 20 Jahre halten würde und seine Herstellung (inkl. Herstellung seiner Rohstoffe etc.) 1.000 Stunden benötigt, so würde die gleichmäßige rechnerische Verteilung dieses Arbeitsaufwandes zu einer Erhöhung der täglich notwendigen Arbeitszeit für den Tisch von 15 Minuten führen. (200 Arbeitstage als Grundlage: 1.000 Stunden Arbeitsaufwand für den Mantel verteilt auf 20 Jahre * 200 Arbeitstage/Jahr macht 4.000 Arbeitstage oder 800 Tische). Zur Reproduktion des Mantels ist in der Wertebilanz des einzelnen Tisches also pro Tag eine Viertelstunde zu berücksichtigen, sonst stünde der Tischler nach 20 Jahren ohne Mantel da und müsste frieren.
Wenn wir die Tauschwerte jener Waren betrachten, die in die Wertebilanz des Tisches einfließen, so stellen wir fest, dass Holz, Werkzeuge, Energie die gleiche Grundstruktur des Wertegesetzes aufweisen wie der Tisch selbst. Um Energie zu erzeugen, wird wiederum Arbeitskraft benötigt, Rohstoffe, ein Gebäude (Kraftwerk) etc. Auch die Maschinen sind Ergebnis eines Produktionsprozesses, bei dem Arbeit, Rohstoffe, Fabrikhallen eingesetzt werden mussten, um diese zu herstellen zu können. Für die Farbenproduktion sind wiederum Maschinen notwendig. Auch diese weisen die gleiche Kernstruktur auf. Auch in ihnen sind Arbeit, Rohstoffe, Werkzeuge enthalten.
Alle Güter, die für die Produktion notwendig sind, bestehen, bis zu ihrem letzten Ursprung zurückverfolgt, aus Rohstoffen im Boden, dem Sauerstoff in der Luft, den Pflanzen, dem Wasser aus den Flüssen, den Mineralien und Elementen, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Aber erst die Arbeit eines Menschen macht aus Rohmaterialien MP3-Player, Liegestühle und Himbeertorten. Erst die Arbeit verwandelt die Rohmaterialien in Produkte und bildet den Tauschwert. Letztendlich setzen sich alle Tauschwerte der Waren zu 100 Prozent aus Arbeit zusammen, »lebendiger« und »toter« Arbeit. »Lebendige« Arbeit wurde für die Produktion einer bestimmten Ware unmittelbar eingesetzt und »tote« Arbeit steckt in den Rohstoffen, Materialien, Werkzeugen, die in vorgelagerten Produktionsprozessen entstanden und für die Produktion einer bestimmten Ware ebenfalls unverzichtbar sind.
Das Wertegesetz gilt nicht nur für Güter der materiellen Produktion, sondern selbstverständlich auch für geistige Arbeit und Dienstleistungen. Denn auch hier kann gemessen werden, wie viel Arbeitszeit notwendig war, um eine bestimmte Dienstleistung zu erzeugen.
Der Wert einer Ware ist also die Summe sämtlicher Wertbestandteile, die zur Produktion dieser Ware notwendig waren. Es bleibt dabei: Eine Stunde Arbeit ist gleich eine Stunde Arbeit – allerdings sowohl »lebendige« als auch »tote« Arbeit.
Resümee: Der vollständige Tauschwert einer Ware oder Dienstleistung ergibt sich
§ aus der Dauer der für die Herstellung der Ware eingesetzten Arbeitszeit, aus der sich aus der Dauer dieser eingesetzten lebendigen Arbeit ergebenden Anteile für die Produktion und Reproduktion der eingesetzten Arbeitskraft
§ aus den Rohstoffen, Produktionsanlagen, der Energie etc., die ebenfalls anteilsmäßig entsprechend der Dauer der eingesetzten Arbeit einfließen.
§ Basis für diese Berechnung ist allerdings nicht die konkrete Arbeit des individuellen Tischlers, sondern die abstrakte Arbeit. Die abstrakte Arbeit entsteht ausschließlich aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse und ist eine analytische Kategorie, keine konkrete. Ausgangspunkt für den Wert eines Tisches ist der Durchschnitt an gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit für diesen Tisch bei Annahme von durchschnittlichen Produktionsmitteln, Arbeitstempo und handwerklicher Fähigkeit aller Tischler einer Gesellschaft.
Gebrauchswert und Tauschwert
Gegenstände, die dem Menschen nützlich sind, haben einen Wert für ihn. Die Nützlichkeit dieser Gegenstände macht sie zum »Gebrauchswert« für den Menschen. Holz taugt z. B. zum Wärmen und Heizen oder als Grundlage für die Tischherstellung. Äpfel sind Nahrungsmittel mit Vitaminen und Mineralien. Spargel ist tauglich für erstklassige Suppen. Rohstoffe jeglicher Art sind wichtige Grundlage für die Güterproduktion.
Der Gebrauchswert eines Gegenstandes ist nicht objektiv bestimmbar oder quantifizierbar. Die Nützlichkeit eines Gegenstandes kann von verschiedenen Individuen unterschiedlich beurteilt werden. Er unterliegt damit jedoch nicht uneingeschränkt der subjektiven Bewertung des Betrachters.
Der Gebrauchswert stellt also den ideellen und materiellen Nutzen eines Gegenstandes, also Qualität für den Menschen dar. Gebrauchswert ist nicht messbar. Gebrauchswert entsteht nicht zwingend nur durch Arbeit.
Der Tauschwert einer Ware ist dagegen Quantität. Er definiert, welche Menge einer produzierten Ware gegen welche Menge einer anderen Ware eingetauscht werden kann. Der Tauschwert ist also messbar. Der Tauschwert einer Ware ist unsichtbar. Er entsteht ausschließlich durch Arbeit und zwar nur in Waren produzierenden Gesellschaften.
Wasser hat einen elementaren Gebrauchswert, fällt aber vom Himmel ohne Tauschwert zu haben, weil keine menschliche Arbeit dazu notwendig ist, dass Wasser vom Himmel fällt. Rohstoffe im Boden haben einen hohen Gebrauchswert für die menschliche Produktion, aber solange sie im Boden schlummern, ohne das menschliche Arbeit irgendetwas damit tat, haben sie null Tauschwert.
Umgekehrt gibt es Waren, die einen hohen Tauschwert haben, weil viel menschliche Arbeitskraft darin steckt, aber kein Atom Gebrauchswert, weil sie für menschliches Leben überflüssig sind. Tischstaubsauber, elektrische Luftbefeuchter, der jährliche Modekrempel etc.
Wenn Rembrandt für ein Gemälde drei Tage brauchte, die Herstellung eines Tisches jedoch fünf Tage dauert, so ist der Tisch wertvoller als dieser »Rembrandt«. Aber wenn für einen Kunstliebhaber das Leben ohne einen echten Rembrandt sinnlos ist, hat dieses Gemälde für ihn einen hohen (Gebrauchs)Wert und kann einen Preis erzielen, der tausendfach über dem Preis eines Tisches liegt.
Wenn ein Porschefahrer gefragt würde, ob er seinen Porsche gegen zehn Liter Wasser tauschen würde, so wäre diesem das nicht einmal ein mitleidiges Lächeln wert. Der (Tausch)Wert eines Porsches ist weit höher als der von Wasser. Vollkommen anders wäre die Situation in der Wüste Sahara. Dort würde der Porschefahrer seine Schüssel sehr gerne gegen das überlebensnotwendige Wasser eintauschen, wenn er sonst verdursten würde. Der (Gebrauchs)Wert von Wasser ist offenkundig – jenseits aller subjektiven Konstrukte – größer als der eines Porsches und daran wird der Fahrer in der Wüste schmerzhaft erinnert. Der Tauschwert des Porsches hat sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geändert. Er wäre immer noch deutlich größer als Wasser, stünde der Porsche in der Wüste oder in einer Garage in Landau.
Im Kapitalismus haben die Dinge plötzlich einen zweiten Wert bekommen. Neben dem ursprünglichen Gebrauchswert einen ausschließlich gesellschaftlich entstehenden Tauschwert. Beide sind voneinander unabhängig. Sie können sogar im Gegensatz zueinander stehen, d. h. ein hoher Tauschwert verursacht die Zerstörung von Gebrauchswerten – wie das Kapitel »Zerstörung der ökologischen Grundlagen« zeigen wird.
Der Konkurrenzkampf
Alle Menschen treten auf dem Markt als Anbieter von Waren und Dienstleistungen in der Rolle von »Wettbewerbern« gegeneinander an. Der euphemistisch genannte »Wettbewerb« am Markt ist – für den einen früher, für den anderen später, für den einen mehr, für den anderen etwas weniger – ein Konkurrenzkampf ums Überleben. »Konkurrenz belebt das Geschäft« ist einer der hirnlosesten Sprüche, die eine Horde debiler Schafe auf ihrem Weg zur Schur von sich geben könnte. Es wäre reizvoll, sich mit dem menschenverachtenden Menschenbild intensiver zu beschäftigen, das hinter diesem dämlichen Spruch verborgen liegt. Denn offenkundig geht der entsprechende Sprücheklopfer davon aus, dass der Mensch ein asoziales, faules Subjekt sei, das sofort in völliger Arbeitsverweigerung erstarrt, wenn es nicht täglich mehrmals Tritte in den Hintern erhalten würde.
Es ist ein Merkmal des Kapitalismus, dass es – scheinbar – von allem zu viel gibt. Die Lager sind voll. Es gibt zu viele Waren. Es gibt zu viele Anbieter. Jeder konkurriert mit jedem, um seine Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu verkaufen. Wer dabei erfolgreich ist, kann große Reichtümer gewinnen, wer im Konkurrenzkampf dauerhaft verliert, riskiert seine menschliche Existenz.
Da das Überleben im Wesentlichen davon abhängt, billiger als die Konkurrenz zu sein, ist die permanente Jagd nach »Kostenoptimierung« und die Suche nach Einsparpotenzial existenziell. Der Konkurrenzkampf ist im Wesentlichen ein Preiskampf und umso schärfer, je mehr die Einkommen und damit die Nachfrage hinter dem Warenangebot hinterherhinken.
»Halt!!« rufen da die inzwischen genervten Apologeten dazwischen. »Nur unkluge Menschen achten ausschließlich auf den Preis. Kluge Menschen achten auch auf Qualität und Nachhaltigkeit.« Immer wieder bin ich irritiert über die Verdrängungsleistung der Apologeten und ihre Fähigkeit, beide Augen fest zu verschließen, sobald es gilt, ökonomische Prozesse zu verstehen.
Betrachten wir doch einmal den Geldbeutel eines Konsumenten, der sich ein neues Sofa zulegen möchte. Auch wenn der Konsument sich vorher kundig gemacht hat, auch wenn sein Herz für die Umwelt schlägt und er ein Sofa haben will, das er später an seine Enkel vererben kann, auch wenn er auf ökologische Materialien und die Vermeidung von Kinderarbeit achten möchte: Spätestens, wenn ihn die letzten zweihundert Euro müde aus seinem Geldbeutel angähnen und er sich erinnert, dass die Kredite bei der Bank schon ausgereizt sind, wird er seine »Extra-Wünsche« vergessen und ernüchtert seine Schritte in Richtung Möbelgroßmarkt lenken.
Natürlich wird der Kapitalist möglichst viel Qualität erzeugen wollen, auch er hat Kinder, mag die saubere Natur und ein reines Gewissen. Auch hängt sein langfristiger Ruf davon ab. Allein: Er muss seine Waren heute loswerden, er muss heute gegen die preiswerte Konkurrenz erfolgreich sein, sonst kann er heute nicht überleben. In diesem Fall braucht er sich sowieso keinerlei Gedanken mehr darüber zu machen, ob er morgen ein schlechtes Image hat.
Seine Wünsche, Qualität zu erzeugen, nachhaltig zu produzieren, die Umwelt nicht zu vergiften und seinen Arbeitern einen fairen Lohn zu zahlen, nutzen dem Kapitalisten jedoch wenig, wenn die Realisierung seiner Wünsche seine Kosten um ein Stück nach oben schiebt und er auf seinen Waren sitzen bleibt. Die Umweltzerstörung nimmt zu, weil Kosten für ordnungsgemäße Entsorgung eingespart werden. Gleichzeitig muss immer das Billigste verwendet werden, egal, wie schädlich diese Materialien für die Umwelt sind. Der Konkurrenzkampf ist ein Preiskampf und zwar blutig, ohne dass Blut fließt.
Umweltzerstörung, Arbeitsplatzabbau, Qualitätsreduktion, Lohndumping, die Zunahme von Zeitdruck und Arbeitshetze etc. unterliegen nicht dem subjektiven Wollen eines Akteurs oder eines individuellen Kapitalisten oder ihrer privaten Moral, sondern folgen dem ökonomischen Diktat der Kernstruktur. Auf Deutsch: Qualität, Schonung der Umwelt, faire Löhne etc. sind im Kapitalismus schon möglich, aber leider nur allgemeinphilosophisch als Konstrukt im Kopf, nicht jedoch in der Realität. Im realen Leben zerschellen diese Vorstellungen an den Gesetzen der kapitalistischen Ökonomie.
Jeder Mensch, der noch ganz bei Verstand ist, müsste froh sein, wenn die Arbeit, Mühsal und Plag weniger werden und man sich auf die schönen Seiten im Leben konzentrieren könnte. Der Kapitalismus zwingt die Menschen aber, mehr zu arbeiten statt weniger, weil jede Produktivitätssteigerung dazu führt, dass mehr Waren in der gleichen Zeit hergestellt werden und dadurch die Arbeitskraft ein Stück entwertet wird.
Da das Überleben auf den Märkten auch davon abhängt, seine Optimierungen und Verbesserungen vor der Konkurrenz zu realisieren, steigern sich auch dadurch Zeitdruck und Arbeitshetze von Jahr zu Jahr. Verschärft wird diese Situation durch den allgemeinen Personalabbau, der in allen Branchen betrieben wird, um Kosten zu sparen, so dass die Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt wird. Menschen im Kapitalismus müssen daher immer mehr statt weniger und immer schneller arbeiten. Das Leben im Kapitalismus, schon heute unerträglich schnell, wird an Geschwindigkeit weiter zunehmen.
Tendenziell setzt sich im Kapitalismus derjenige Anbieter durch, der billiger ist als die Konkurrenz, weil er die notwendige Arbeit reduziert hat. Sobald ein Konkurrent erfolgreicher und billiger auftritt, wird der Hersteller sich was einfallen lassen müssen. Das heißt, seine Kosten so zu reduzieren, dass er die Konkurrenz wieder einholt und sogar überbietet. Falls ihm das gelingt, hat nunmehr die Konkurrenz ein Problem. Sie muss ihrerseits jetzt billiger werden. Und so unterbieten sich die beiden immer weiter, bis der Stärkere übrig bleibt und den Schwächeren okkupiert (»aufkauft«).
Da jeder Kapitalist diesen Zwang kennt, wartet er normalerweise nicht, bis die Konkurrenz ihm davonläuft, sondern wird eher versuchen, der erste zu sein, der seine Produktion optimiert und einen Extramehrwert einheimst, statt immer nur den Verlusten hinterher zu laufen. Den Zwangsgesetzen der Konkurrenz kann sich niemand entziehen.
Das Wertegesetz ist keine Theorie unter vielen möglichen, sondern hat zwingende Gültigkeit wie etwa das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ein Hausbauer das Gesetz der Schwerkraft missachtet, purzelt ihm das Dach über dem Kopf ebenso zusammen, wie seine wirtschaftliche Tätigkeit zusammenbricht, wenn er das Wertegesetz missachtet. Es ist ein beinhartes, bei Strafe des Untergangs einzuhaltendes Prinzip jeglicher ökonomischen Tätigkeit. Die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus sind Ergebnis der Macht- und Eigentumsverhältnisse und erzwingen ein entsprechendes Handeln unabhängig vom persönlichen Wollen und unabhängig, ob sie diese Wirkgesetze in ihrer Tiefe geistig durchdrungen haben oder nicht. Markt und Wertegesetz kennen kein Pardon, unterwerfen die Menschen unter ihre Prozesse und knechten sie mehr als jede politische Diktatur.
Das Wertegesetz ist damit Bestimmungspunkt jeglicher ökonomischer Überlegungen, unabhängig von der Art der Ware oder Dienstleistung. Egal, ob Tische hergestellt werden oder Autos, Babynahrung oder eine CD, Urlaubsreisen oder Finanzdienstleistungen im Angebot sind. Und: Es hört nie auf. Niemand wird dauerhaft davonkommen. Denn jeder Status, der erreicht scheint, wird irgendwann von irgendeinem unterboten, der noch schneller und billiger mehr zu produzieren in der Lage ist, der bereit ist, seine Arbeitskraft für noch geringeren Lohn als bisher zu verkaufen.





























