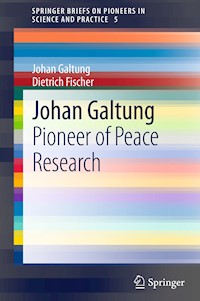9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
«Dieses Buch bemüht sich, die Europäische Gemeinschaft aus globaler Sicht zu betrachten. Obwohl von einem Europäer geschrieben, konzentriert es sich nicht auf die Fragestellung, die in der von der Europäischen Gemeinschaft selbst publizierten Literatur zu finden ist, nämlich: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für uns, für unsere Mitgliedstaaten? Statt dessen werden zwei andere Perspektiven angeboten: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für die Massen der Welt, für das Weltproletariat, und was bedeutet sie für die Weltgemeinschaft allgemein?»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Johan Galtung
Kapitalistische Großmacht Europa oder Die Gemeinschaft der Konzerne?
«A Superpower in the Making»
Aus dem Englischen von Hedda Wagner
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Dieses Buch bemüht sich, die Europäische Gemeinschaft aus globaler Sicht zu betrachten. Obwohl von einem Europäer geschrieben, konzentriert es sich nicht auf die Fragestellung, die in der von der Europäischen Gemeinschaft selbst publizierten Literatur zu finden ist, nämlich: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für uns, für unsere Mitgliedstaaten? Statt dessen werden zwei andere Perspektiven angeboten: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für die Massen der Welt, für das Weltproletariat, und was bedeutet sie für die Weltgemeinschaft allgemein?»
Über Johan Galtung
Johan Galtung, geb. 1930, Studium Mathematik und Soziologie, zahlreiche Professuren im In- und Ausland. Berater bei der UNESCO, OECD und beim Europarat für Friedensforschung, Hochschulausbildung und Europäische Zusammenarbeit.
Veröff. u.a.: «Ghandi’s Political Ethics» (mit Arne Næss); «Theory and Methods of Social Research»; «Members of Two Worlds»; «Co-operation in Europe».
Inhaltsübersicht
Vorwort
Dieses Buch bemüht sich, die Europäische Gemeinschaft aus globaler Sicht zu betrachten. Obwohl von einem Europäer geschrieben, konzentriert es sich nicht auf die Fragestellung, die in der von der Europäischen Gemeinschaft selbst publizierten Literatur zu finden ist, nämlich: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für uns, für unsere Mitgliedstaaten? Statt dessen werden zwei andere Perspektiven angeboten: Was bedeutet die Europäische Gemeinschaft für die Massen der Welt, für das Weltproletariat, und was bedeutet sie für die Weltgemeinschaft allgemein?
Die hier erstellte Analyse betrachtet die Europäische Gemeinschaft aus beiden Perspektiven kritisch. Diese kritische Sicht folgt nicht so sehr aus dem, was die Europäische Gemeinschaft heute ist, sondern aus dem, was sie einmal werden kann, wenn der gegenwärtige Trend – sprich: fortschreitende Erweiterung der Mitgliedschaft und Vertiefung der Integration – anhält. Natürlich ist die Zukunft ungewiß; keine soziale oder menschliche Zukunft ist absolut vorherbestimmt. Daher müssen Analysen unbedingt auch Aussagen über die Zukunft machen, anstatt bloße Rechenschaftsberichte über Gegenwart und Vergangenheit zu sein, wie dies in den Sozialwissenschaften bisher üblich war. Sobald man den sicheren Boden der Empirie verläßt, wird die Analyse spekulativ. Aber es versteht sich von selbst, daß jede derartige Analyse nicht zuletzt auch in der Hoffnung erstellt wird, sie möge sich selbst widerlegen, das Wesen der Europäischen Gemeinschaft werde den Menschen zunehmend bewußt werden und Gegenkräfte auf den Plan rufen.
Die Anregungen, die ich aus Gesprächen mit Hörern gewonnen habe, denen das Buch in Form von Vorlesungen vorgestellt wurde, sind für sein Zustandekommen von unschätzbarem Wert gewesen. Diese Gespräche haben sich in den hier dargelegten Analysen durchweg niedergeschlagen. Seit Anfang 1971 hatte ich Gelegenheit, das Thema Europäische Gemeinschaft mit Hörern in 16 Ländern zu diskutieren, in Mitglied- und Nicht-Mitgliedstaaten Westeuropas, in Osteuropa (Polen, Jugoslawien), in Ländern der Dritten Welt (Indien, Ägypten, Uganda) und in den USA. Die Adressaten waren in der Tat sehr unterschiedlich: Gewerkschaftsgruppen, Beamte vom Außenministerium, Universitätsseminare und -lehrgänge, wissenschaftliche Tagungen, oppositionelle politische Kleingruppen, Großveranstaltungen des „Establishment“. Der formale Rahmen war der einer Vorlesung, einer einführenden Darstellung des Themas mit einer Gegendarstellung (manchmal von der EG-Kommission) und anschließender Diskussion, an der sich die Hörer gewöhnlich außerordentlich lebhaft beteiligten. Aus den Diskussionen konnte man allgemein den Eindruck gewinnen, daß sich die Europäische Gemeinschaft im Hinblick auf das politische Bewußtsein immer noch weitgehend im luftleeren Raum bewegt, ja es scheint sogar so zu sein, daß das Interesse an der Gemeinschaft bei den Nicht-Mitgliedsländern stärker ist als bei den Staaten, die ihr angehören. Dabei ist doch gerade diese Bewußtseinsbildung von entscheidender Bedeutung, und das vorliegende Buch soll hierzu einen kleinen, wenn auch gewiß bei weitem nicht ausschlaggebenden Beitrag leisten. Der Hauptbeitrag wird in keinem Falle von intellektuellen Analysen zu leisten sein, sondern von den sehr konkreten gesellschaftlichen Prozessen, die die Europäische Gemeinschaft selbst – im Guten wie im Bösen – in der ganzen Welt in Gang setzen wird.
Obwohl von einem Norweger geschrieben, bietet die vorliegende Arbeit keine spezielle Analyse der mit dem norwegischen (und dänischen) Beitrittsgesuch verbundenen Probleme. Das ist zum Teil damit zu erklären, daß in den beitrittswilligen Ländern inzwischen soviel gute Literatur über diese Probleme vorliegt. Der Hauptgrund für den Verzicht auf eine solche spezifische Analyse ist jedoch, daß die Europäische Gemeinschaft sich durch die Ab- oder Anwesenheit dieser beiden Länder nicht wesentlich verändern wird. Die Europäische Gemeinschaft ist ein Phänomen von globaler Bedeutung, und es ist die Pflicht jedes einzelnen Menschen, sich über sie eine Meinung zu bilden und danach zu handeln, unabhängig davon, ob das Land, dessen Staatsbürger er zufällig ist, der Gemeinschaft angehört oder nicht.
Obwohl von einem Sozialwissenschaftler geschrieben, ist das Buch in seiner Kritik recht eindeutig, aber nicht, weil ich es als eine Art Arbeitsgemeinschaft betrachte, sondern weil ich Gesellschaftskritik für einen unabdingbaren Bestandteil der sozialwissenschaftlichen Analyse halte. Die sogenannte objektive Information ist gemeinhin nichts anderes als verschleierter Konservativismus. Die minimale Voraussetzung für eine „wissenschaftliche“ Kritik ist, daß sie die Werte, an denen sie sich orientiert, sehr deutlich ausspricht und Tatsachen und Tendenzen einigermaßen sorgfältig auseinanderhält. Der Leser wird beurteilen müssen, inwieweit dies in dem vorliegenden Buch geschehen ist. Für Kommentare wäre ich außerordentlich dankbar.
Im übrigen ist praktisch jede Aussage über die Europäische Gemeinschaft richtig und zugleich falsch. Sie ist eine dermaßen vielschichtige Erscheinung, daß die Worte, Artikel, Bücher und sogar Zeitschriften, die ihrer Beschreibung, Analyse, Kritik und/oder Bewunderung gewidmet sind, kein Ende nehmen. In dem hier vorgelegten Buch haben wir uns bemüht, ein bestimmtes Thema zu verfolgen, das auch im Buchtitel zum Ausdruck kommt. Aber bei der Bearbeitung dieses Hauptthemas tauchen immer wieder zahlreiche Nebenthemen auf, die zum Teil in den Haupttext, zum Teil in die relativ ausführlichen Anmerkungen eingegangen sind. Der Leser, der an einer detaillierteren Abhandlung des Themas interessiert ist, mag daher die Anmerkungen einer genaueren Betrachtung wert erachten; sie enthalten nicht nur Literaturhinweise.
Mein Dank gilt in erster Linie den Diskussionsteilnehmern in den verschiedenen Ländern, vor allem den Gegnern, von denen ich viel über das Selbstverständnis der Europäischen Gemeinschaft gelernt habe. Ferner danke ich der School of International Studies der Jawaharlal Nehru-Universität in Neu-Delhi, namentlich Herrn Prof. K.P. Misra, dafür, daß sie mich während meines Delhi-Aufenthaltes als Gastprofessor im Frühjahr 1971 ermutigt haben, aus all den mündlichen Darstellungen des Themas ein Buch zu machen. Auch den Kollegen und Freunden am Internationalen Friedensforschungsinstitut in Oslo gilt mein Dank für die zahllosen und stets anregenden Gespräche über die europäische Problematik, namentlich Asbjørn Eide, Nils Petter Gleditsch, Helge Hveem, Knut Hongrø, Tord und Susan Høivik, Sverre Lodgaard und Marek Thee.
Und schließlich danke ich Fumiko Nishimura Galtung, die mich mehr als sonst jemand gelehrt hat, wie Europäer – linke oder rechte, Establishment oder Anti-Establishment – aus der Perspektive anderer Teile der Welt aussehen können.
Johan Galtung
Dieser deutschen Ausgabe ist ein Epilog zum Ausgang der Referenda in Norwegen und Dänemark angefügt worden.
Johan Galtung
Erstes Kapitel Der Hintergrund
In diesen Jahren und Monaten, ja allwöchentlich und tagtäglich nimmt in Westeuropa eine neue Supermacht Gestalt an: die Europäische Gemeinschaft (EG). Dies ist ein langer und problematischer Prozeß. Sicherlich gibt es viele, die der These nicht zustimmen würden, daß die Erweiterung und Vertiefung der Gemeinschaft unweigerlich zu einem Superstaat führen und dieser Superstaat früher oder später zwangsläufig in einer Supermacht enden wird – in der Welt, so wie sie heute ist, mit ihrer derzeitigen Struktur und der derzeitigen Führung. Aber den Menschen ist der Blick so sehr durch die Giganten USA und Sowjetunion verstellt, daß es schon eine lange Zeit brauchte, bevor sie sich ernsthaft mit China und manche auch mit Japan zu befassen begannen. Zudem hat man sich häufig auf die Schwächen der Europäischen Gemeinschaft konzentriert, zum Beispiel auf ihren toten Punkt 1965/66, als sie nach der Krise vom 30. Juni von Frankreich boykottiert wurde, anstatt ihre Stärken in den Mittelpunkt zu rücken. Es wurde ausführlich über das Scheitern von Verhandlungen berichtet, nicht aber über die ruhige Alltagsarbeit des Apparats, mit anderen Worten: Journalisten interessieren sich in erster Linie für einzelne dramatische Vorfälle und nicht so sehr für die stetige Entwicklung der Dinge. So liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung in jüngster Zeit denn auch auf den Problemen der beitrittswilligen Länder, anstatt auf den Staaten, die bereits Mitglied der Gemeinschaft sind. Da gibt es endlos lange Listen mit Argumenten für und wider die Gemeinschaft, wie sie gegenwärtig gesehen wird, aber welche Rolle die Gemeinschaft zukünftig spielen könnte, wird nie ernsthaft diskutiert.
Wie bedeutend dies ist, kann kaum genug betont werden. Die Beitrittsanwärter erörtern Probleme, die die Mitgliedsländer bereits ausdiskutiert haben, denn sie müssen ja auf der Grundlage der Verträge von Paris und Rom, vor allem des Gründungsvertrages des Gemeinsamen Marktes beitreten. Zudem müssen sie die Bestimmungen dieser Verträge in der Praxis der Europäischen Gemeinschaft akzeptieren – wo die Kommission zum Beispiel allein im Jahre 1970 und überwiegend im Agrarbereich 2448 Verordnungen in Kraft setzte.[1] Daß sich hieraus Fragen der Anpassung an die bestehenden Realitäten ergeben, liegt auf der Hand, und diese Fragen sind auch Hauptgegenstand zumindest des Teils der Verhandlungen, der an die Öffentlichkeit dringt. Aber der Schwerpunkt der Diskussion in der EG selbst ist weitaus stärker zukunftsbezogen; dies beweisen das Kommunique der Haager Gipfelkonferenz vom 1./2. Dezember 1969, die Treffen der Außenminister wie die auf höherer Ebene und vor allem der Davignon- und der Werner-Plan.[2]
Das bedeutet, daß die beitrittswilligen Länder und die Öffentlichkeit in diesen Ländern nun wohl einen Lernprozeß durchmachen müssen, und zwar insofern, als die Überbetonung der Anpassung in Detailfragen mit der Unterbetonung der zugrunde liegenden Prinzipien und Perspektiven in Einklang gebracht werden muß. Dabei werden sich Fraktionen bilden, die nicht unbedingt den traditionellen Parteienstandpunkten entsprechen, und diese Fraktionen werden nach wie vor daran interessiert sein, die Richtigkeit ihrer in der bisherigen Debatte vertretenen Ansichten zu beweisen. Die Befürworter werden unterstreichen, daß es leichter sei, sich anzupassen, die Gegner werden dem widersprechen – was dem Eindruck, den diese Länder bisher gewonnen haben, eine gewisse Zeitdimension verleihen wird. Aber solche grundsätzlichen Fragen wie die zukünftige Rolle der EG in der Weltgemeinschaft, ihre Anpassung an die Welt insgesamt und umgekehrt die Anpassung der Welt an sie, Fragen, die viel weiter reichende Folgen für die gegenwärtigen und zukünftigen Mitgliedstaaten haben können, als die Anpassung der Beitrittskandidaten an die EG und der EG an die Beitrittskandidaten – solche Fragen werden fast nirgends gestellt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der zukünftigen Rolle der EG in der Welt. Wir stützen uns dabei auf das, was bisher geschehen ist, auf gegenwärtige und absehbare Entwicklungen in der Welt sowie auf (hoffnungsvoll genährte) Vermutungen über die Zukunft.
Die These lautet, daß eine neue Supermacht im Entstehen begriffen ist. Schärfer formuliert, heißt das: Die Europäische Gemeinschaft ist ein Versuch der Wiederherstellung
einer eurozentrischen Welt, also einer Welt, deren Zentrum in Europa liegt;
b)eines unizentrischen Europa, also eines Europa, dessen Zentrum im Westen liegt.
Da es sich nun aber so verhält, daß die Welt lange Zeit gerade so aussah – vielleicht seit der Zeit der Großen Entdeckungen oder zumindest seit Beginn der Kolonialherrschaft der westlichen Staaten bis etwa Ende des Zweiten Weltkrieges –, könnten wir unsere These auch so formulieren: Die Europäische Gemeinschaft ist ein Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, nur mit dem Unterschied, daß nun eine neue Dimension, die moderne Technologie, hinzutritt.
Wir sagen „Versuch“, da es nur kurzfristig gelingen wird. Es ist ein logischer Versuch, mit einiger Grundkenntnis der westeuropäischen Geschichte und ein wenig Gesellschaftstheorie leicht erklärbar und vorhersehbar. Dennoch ist die Gemeinschaft ein geschichtswidriger Ansatz, ein Versuch, gegen die grundlegenderen Prozesse, die sich zwischen und mit den Nationen der Welt vollziehen, anzurennen. Da Westeuropa stark ist, wird es Jahre, ja Jahrzehnte der Expansion dauern, bevor Gegenkräfte stark genug sein werden und der neue Gigant das Schicksal aller vor ihm dagewesenen Giganten erleidet.
Was geschah um 1945, daß die Europäische Gemeinschaft als ein Versuch gewertet werden kann, es ungeschehen zu machen? Offensichtlich war Hitlers Drittes Reich von dem mächtigsten Militärbündnis geschlagen worden, das die Welt je gesehen hat. Aber das war nicht maßgebend. Die Welt hat sehr, sehr viele Kriege zwischen europäischen Mächten erlebt; an dreien davon war Deutschland innerhalb dreier Generationen beteiligt. Per definitionem sind die Kriege zwischen europäischen Mächten die „wichtigsten“ gewesen, insofern die wichtigsten Kriege die von den wichtigsten Mächten ausgetragenen sind. In diesem Sinne war der Krieg gegen Hitler ein um hundert Jahre verspäteter Krieg des 19. Jahrhunderts, ein Krieg, der im Geiste jenes zutiefst dem 19. Jahrhundert verhafteten Mannes, Winston Churchill, geführt wurde. Es war eine innereuropäische Stammesfehde zwischen Nationalstaaten;[3] es war kein Krieg des 20. Jahrhunderts: weder ein Kampf um nationale Befreiung vom Kolonialismus, noch ein Volkskrieg zur Befreiung von Ausbeutung durch fremde Mächte oder das eigene Land. Mag der Krieg gegen Hitler am Ende auch anders ausgegangen sein, so war er im Grunde doch ein horizontaler Krieg zwischen souveränen Nationen. Es war ein klassischer Krieg, kein Klassenkrieg, aber auch ein Krieg, der auf beiden Seiten die gesamte Nation mobilisierte.
Was diesen Krieg von anderen unterschied, war seine Technologie und sein Ausmaß. Nie zuvor hatte die Welt erlebt, daß soviel Technik in einem Krieg eingesetzt wurde, der in zunehmendem Maße auf beiden Seiten zum Völkermord ausartete: Völkermord in den eroberten Gebieten, gerechtfertigt durch die Ideologie der Nationalsozialisten, und Völkermord über die Fronten hinweg, gerechtfertigt durch die Ideologie des Krieges. Der Völkermord, den der Verlierer begeht, zum Beispiel mit Gas, gilt allgemein immer noch eher als Verbrechen gegen die Menschheit als der Völkermord, den der Sieger begeht, zum Beispiel mit Bombenteppichen. Die moderne Technik ermöglichte die Verschärfung und Ausweitung der Kriegführung in einem bisher ungeahnten Ausmaß, doch die Struktur des Krieges war die alte.
Auch die Beteiligung der mächtigen europäischen Peripherie – der USA und der Sowjetunion – war an sich nichts Neues; beide Länder waren schon am Ersten Weltkrieg beteiligt gewesen. Aber diesmal war der Einfluß dieser Peripheriebeteiligung ein anderer: er war entscheidend. Europa wurde überrannt. England konnte sich höchstens selbst verteidigen, aber nicht die Achsenmächte schlagen. Der von Deutschland bzw. Japan herausgeforderte Kriegseintritt der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten im Jahre 1941 bedeutete die Niederlage nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Europa, von Brest (in der Bretagne) bis Brest(-Litowsk), war nicht mehr in der Lage, seine Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. 1945 waren Sieger und Besiegte gleichermaßen erschöpft, heruntergekommen, bankrott; überall irrten frierende und hungernde Menschen durch die Straßen und stocherten in den Ruinen herum. Drei Kriegsmaschinerien waren übriggeblieben: die US-amerikanische, die britische und die sowjetrussische. Alle übrigen waren zerschlagen oder auf kleine Einheiten reduziert worden, die im Ausland ausgebildet und stationiert wurden, Partisanengruppen, Einheiten der Maquis und andere Résistance-Kräfte, usw. Die eigentlichen Sieger waren die USA und die UdSSR; selbst Großbritannien war am Ende.[4]
Nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt war durch den Krieg zerstört worden. Aber da gab es wichtige Unterschiede. Die Regimes in Westeuropa waren in den Augen der Bevölkerung immer noch im großen und ganzen zur Herrschaft legitimiert: Das nationalsozialistische Deutschland hatte durch Quisling-Regierungen geherrscht, die besetzten Nationen hatten Widerstand geleistet (wobei Frankreich wegen eines Gutteils Kollaboration einen Grenzfall bildete), und die staatlichen Machtträger hatten in London Zuflucht genommen. Aber in Osteuropa (Bulgarien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei) waren viele Regimes zu Hitlers Verbündeten gemacht worden, weshalb sich die Bildung von Marionettenregierungen erübrigte, und große Teile der Nationen hatten mit dem Nationalsozialismus kooperiert. Während Westeuropa zum Zeitpunkt der Rückkehr der als legitim definierten Machthaber zwar wirtschaftlich darniederlag, politisch und gesellschaftlich jedoch intakt war, herrschte in Osteuropa sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht das Chaos.
In einem gewissen Sinne entsprach diese Situation durchaus den Fähigkeiten und Möglichkeiten der beiden großen Sieger. Der Sieger im Westen, die Vereinigten Staaten, hatte eher mit Kapital und Technologie als mit einer alles überwindenden, eindeutig politischen Idee gekämpft, und der Krieg war beiden, Kapital wie Technologie, förderlich gewesen. So waren die USA ohne weiteres in der Lage, den total geschwächten Volkswirtschaften Westeuropas Hilfe zu leisten, zumal es mit den dortigen Regimes keine soziopolitischen Differenzen gab. Tatsächlich herrschte zwischen ihnen eine dermaßen große Harmonie und ein so gutes Einvernehmen, daß es für die USA zu einer Selbstverständlichkeit wurde, den westeuropäischen Regimes auch gegen die Bedrohung von seiten jener Kräfte den Rücken zu stärken, die für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung eintraten, insbesondere gegen die kommunistischen Parteien. Daher vollzog sich der wirtschaftliche Wiederaufbau nach dem Kriege so, daß die USA den westeuropäischen Regimes und damit der sozioökonomischen Struktur, die diese repräsentierten, Unterstützung gewährten, und das bedeutete mehr als bloße Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung und Wiederaufbau der westeuropäischen Produktionsanlagen, nämlich auch und nicht zuletzt „Kampf gegen den Kommunismus“.
Auf der anderen Seite stand der Sieger im Osten, die Sowjetunion. Sie hatte unter Einsatz ihrer eigenen und fremder Ressourcen gekämpft, aber auch mit einer Überzeugung und einer Ideologie, welche dem Haß der meisten Sowjetbürger gegen die nationalsozialistischen Eindringlinge Nachdruck verlieh. Unmittelbar nach dem Kriege war die Sowjetunion nicht in der Lage, wirtschaftliche Hilfe anzubieten. Im Gegenteil, sie schlug Kapital daraus, daß Osteuropa mit dem Nationalsozialismus kollaboriert hatte, und verlangte erhebliche Reparationszahlungen. Zugleich hatte die UdSSR ebenso ausgeprägte Vorstellungen über den politischen Wiederaufbau, wie die USA über den wirtschaftlichen. Sie machte nicht nur die osteuropäischen Regimes, sondern die gesamte Struktur Osteuropas für die Kollaboration verantwortlich, und die einzige Antwort auf diese Schlußfolgerung war eine Revolution. Wie der wirtschaftliche Wiederaufbau im Westen sich in Form von US-Investitionen und Durchdringung der Führungspositionen in der Wirtschaft vollzog, so vollzog sich der gesellschaftspolitische Wiederaufbau im Osten in Form von politischen Investitionen der Sowjetunion sowie einer sehr starken militärisch-politischen Durchdringung der gesellschaftlichen Führungspositionen. Beide Siegermächte, die USA wie die UdSSR, ließen sich dabei von einer zweifachen Absicht leiten: zum einen, sich selbst zu schützen, zum andern, den Typ von Regime zu errichten, der ihnen für andere Völker der beste zu sein schien, nämlich einen, der ihrem eigenen glich. Unglücklicherweise gilt in den Augen des Westens der gesellschaftliche Wiederaufbau als „ideologisch“ und der wirtschaftliche als „technologisch“ – wo doch beide zutiefst politisch sind.
So mußte die eurozentrische Vorkriegswelt denn den ersten Schlag hinnehmen, und zwar nicht nur, weil das ganze Europa zerstört worden war, sondern weil die USA und die UdSSR den jeweils „ihrigen“ (laut Definition der Abkommen von Teheran und Jalta) Teil nach ihrem eigenen Bilde wiederaufbauten, einem Bild, das durch den Sieg über den Feind eine enorme Bestätigung erfahren hatte. Europa wurde nicht nur bizentrisch, nein, es wurde bizentrisch in dem Sinne, daß es fortan ein Zentrum in Washington und eines in Moskau gab, mit anderen Worten: die zwei neuen Zentren lagen außerhalb Europas. Dies kommt einer Kolonisation gleich. Aber es war eine Kolonisation in zwei Imperien, und die beiden Teile traten sich fast im gleichen Moment feindlich gegenüber, d. h: Europa war nicht nur bizentrisch geworden, es wurde auch bipolar, insofern sich zwei Militärblöcke, NATO einerseits und Warschauer Vertrag[5] andererseits, herausbildeten.
Wie konnte dies geschehen? Rückblickend vermutlich aus einem ganz einfachen Grunde: der veränderten Hegemonie über Osteuropa. Westeuropa war daran gewöhnt gewesen, daß dies sein Privileg war (wenn es auch hauptsächlich von Deutschland wahrgenommen wurde) – und nun fiel es Moskau zu. Im Westen interpretierte man dies als Ausdruck der Machtgier der UdSSR im allgemeinen und Stalins im besonderen, ohne auch nur mit einem Wort den politischen Bankrott zu erwähnen, den die Mehrzahl der osteuropäischen Staaten mit ihren fast durchweg nicht legitimierten Regimes erlitten hatte. Tatsächlich war das einzige Volk, das als solches der Okkupation durch die Deutschen wirklich Widerstand geleistet hatte, in Jugoslawien zu finden, und selbst dort nicht geschlossen und problemlos. Das Nachkriegsregime Titos besaß also echte, von keiner fremden Macht abhängige Legitimation, wie die Ereignisse vom Juni 1948 zweifelsfrei beweisen. Polen hätte die zweite Ausnahme werden können, wäre sein Widerstand nicht im August 1944 gebrochen worden.
Mit Ausnahme des tschechoslowakischen waren die sozioökonomischen Systeme Osteuropas mit ihren feudalen und vorkapitalistischen Strukturen stark zurückgeblieben. Es mußte Aufbauarbeit geleistet werden, und es lag in Moskaus eigenem Interesse, daß dies unter seiner Aufsicht geschah, ja häufig sogar von der Sowjetunion selbst übernommen wurde. Auch in Westeuropa mußte Aufbauarbeit geleistet werden, nämlich der wirtschaftliche Wiederaufbau, und es lag im Interesse der USA, dies selbst zu übernehmen. So bot das Ende des Zweiten Weltkrieges beiden Siegermächten Gelegenheit zu expandieren, zu investieren und ihre ökonomische Botschaft und Struktur per Marshall-plan und Europäische Wirtschaftsorganisation (OEEC) respektive kommunistische Parteien dem jeweiligen Teil Europas aufzuprägen.
1945 mußte die eurozentrische Welt einen weiteren Schlag von noch größerer Tragweite hinnehmen: den Anfang vom Ende des Kolonialismus. Der Erste Weltkrieg hatte die Zerschlagung der beiden europäischen Kolonialreiche, des deutschen (in Afrika und dem Fernen Osten) und des türkisch-osmanischen (in der arabischen Welt) mit sich gebracht. (Spanien hatte als erstes Land seine Kolonien verloren, den größten Teil Lateinamerikas in den Kriegen von 1810–1825, Kuba und die Philippinen in den Kriegen mit den USA um die Jahrhundertwende.) Aber Deutschland war es gelungen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa eine Art Neokolonialreich zu errichten, und im Verlauf des Krieges hatte es dann weitere Schritte in Richtung auf die vollständige Kolonisation unternommen, indem es Osteuropa der Art von Behandlung unterwarf, der die Indianer in Amerika oder die Opfer der belgischen, holländischen, französischen und britischen Kolonialherrschaft andernorts ausgesetzt waren – nur, daß es nicht so publik wurde. Die Hauptformeln dieses deutschen Neokolonialismus hießen Ausrottung, Terror, Zersplitterung und extreme Arbeitsteilung.
In der auf die Niederlage von 1945 folgenden Zeit verloren sechs westeuropäische Mächte ihre Kolonien: Deutschland (in Osteuropa), Frankreich, Italien, Belgien (einschließlich Luxemburg), die Niederlande – und Großbritannien. Die ersten fünf (oder sechs, wenn wir diesen belgischen Appendix, der sich Luxemburg nennt, mit einbeziehen) wurden Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaft, die sechste und letzte Macht, Großbritannien, entwickelte sich zum führenden Beitrittskandidaten. Das bringt uns auf eine Grundformel für das Verständnis der Gemeinschaft: Man nehme fünf zerfallene Kolonialreiche, füge das sechste später hinzu und mache aus all dem ein einziges großes Neokolonialreich. Die Richtigkeit dieses kleinen Rezepts soll in den Kapiteln fünf bis neun geprüft werden. An dieser Stelle wollen wir lediglich darauf hinweisen, daß Spanien (dessen Verfall als Kolonialmacht 150 Jahre früher stattfand), die Türkei (die ihre Eklipse nur um einen Weltkrieg früher erlebte) und Portugal (das in allen Entwicklungen stets hinterherhinkte, so auch in bezug auf den Verlust seiner Kolonien) nicht dazugehörten. Weder paßte die genannte Formel auf sie, noch paßten ihre Regimes auf die Grundannahme der Europäischen Gemeinschaft von einer strukturellen Gleichartigkeit. Was daraus folgte, soll im zweiten Kapitel dargelegt werden.
Kommen wir zum Schluß: Nach 1945 wurde die Welt nicht mehr von rivalisierenden europäischen Mächten beherrscht. Die Kolonialmächte hatten ihre Reiche verloren oder waren gerade zu der Zeit von ihrem rapide voranschreitenden Verlust betroffen, als Europa selbst in zunehmendem Maße von den beiden neuen Zentren, Washington und Moskau, beherrscht wurde. Und dies alles vollzog sich in der kurzen Zeitspanne von zehn oder zwanzig Jahren! Jeder, der nicht wahrhaben will, daß sich die Welt so rasch verändern kann, sollte dies berücksichtigen. Man könnte aber auch sehr wirkungsvoll entgegnen: Es bedurfte einer großen sozialen Katastrophe, eines Weltkrieges, um diese Veränderung zu bewirken, und dennoch ist das soziale Beharrungsvermögen in der Welt so tief verwurzelt, daß sehr rasch Regenerationsbestrebungen auftraten – und gerade dies ist unsere These über die Europäische Gemeinschaft. Europa kann nicht in zwei von der ehemaligen Peripherie beherrschte Teile gespalten werden, und Westeuropa kann seine traditionelle Herrschaft über Osteuropa und die Dritte Welt nicht verlieren, ohne jahrhundertealte Rivalitäten zu überwinden, um die alte Macht zu neuem Leben zu erwecken.[6]
Nichtsdestoweniger waren die Veränderungen real und die Erniedrigung des klassischen Europa gründlich. Dies wurde verschleiert durch den Kalten Krieg, durch einen in höchst gefährliche, aber auch sorgsam ausgewogene Bipolarität umgesetzten Bizentrismus. Beide Teile Europas waren aufgefordert, eine neue Rolle als zweitrangige Befehlshaber zu spielen, wobei eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand, daß sie als erste geopfert würden, sollte aus dem Kalten Krieg ein heißer werden. Dies war gewiß nicht im entferntesten die Rolle, die Westeuropa in der Welt zu spielen gewöhnt war. Daß es zu einer gewissen Neuorientierung und Umgestaltung kam, um diese atimia (diesen Statusverlust)[7] ungeschehen zu machen, bedarf wohl keiner besonderen Erklärung – die Beweislast liegt bei all jenen, die meinen, die europäischen Länder hätten sich auf ewig mit der Rolle der Bauern im amerikanisch-sowjetischen Schachspiel abfinden sollen, also mit ihrer Rolle in der pax americana bzw. der pax sowjetica, welche sich zunehmend zu einer gemeinschaftlichen pax condominica[8] entwickeln.
Unsere Interpretation des Europäischen Gemeinsamen Marktes, wie eine der Gemeinschaften einst genannt wurde, lautet also, daß er bedeutend mehr ist als ein „Markt“: Er ist ein Machtkampf, ein Kampf um die Weltmacht für Westeuropa. Er ist auch bedeutend weniger als „europäisch“, denn er gilt nur für diejenigen Mächte in Westeuropa, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wozu vor allem der Verlust von Kolonialgebieten in neuerer Zeit und/oder die NATO-Mitgliedschaft gehören (vgl. die Kapitel zwei und acht). Er ist ein Versuch, die Welt eurozentrisch zu gestalten und das Zentrum Europas im Westen anzusiedeln, und das sogar mit einer expliziten Friedensphilosophie, einer pax bruxellana (neuntes Kapitel) im Hintergrund. Aber innerhalb dieser Grenzen ist er ein „gemeinsamer“ Markt, gemeinsam für diejenigen, die die Rechnung bezahlen. Daß auf der Quittung für diese Rechnung Macht steht, ist für das Verständnis der Europäischen Gemeinschaft unerläßlich. (Eine Analyse des Machtbegriffs wird im dritten Kapitel vorgelegt.) Lassen Sie uns nun zunächst einen kurzen Blick auf einige Merkmale der EG werfen, der EG, wie sie sich entwickelt hat, wie sie sich heute darstellt und wie sie in Zukunft möglicherweise aussehen wird.
Zweites Kapitel Die Europäische Gemeinschaft. Ein kurzer Überblick
Der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Willy Brandt, formulierte auf einer Pressekonferenz am 8. Oktober 1971[1] mit sehr einfachen Worten in etwa die Grundstrategie für das Wachstum der Europäischen Gemeinschaft:
„Wenn die Frage des Beitritts erst einmal geklärt ist, wird auch der Weg für weitere Fortschritte in Richtung auf eine Wirtschafts- und Währungsunion und für eine engere Zusammenarbeit in der Außenpolitik frei sein.“
Die Frage des Beitritts bezieht sich auf das, was in der Sprache der EG als Erweiterung und im Sprachgebrauch der Sozialwissenschaft als Ausdehnung des Bereichs (domain) dieser Ländervereinigung bezeichnet wird. Die von Brandt genannten Themen – Wirtschafts- und Währungsunion, Zusammenarbeit in der Außenpolitik – betreffen das, was im EG-Sprachgebrauch als Vertiefung und im sozialwissenschaftlichen Jargon als Reichweite (scope) der Integration bezeichnet wird.[2]
Dies sind die beiden Achsen, an denen sich die Diskussion über die Europäische Gemeinschaft orientieren kann, und die Brandtsche Äußerung könnte ebensogut zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte der EG und in umgekehrter Form gefallen sein: „Wenn die Frage der Vertiefung erst einmal geklärt ist, wird auch der Weg für weitere Fortschritte in Richtung auf eine Erweiterung frei sein.“
Und so sieht die logische Entwicklung der EG aus: Vertiefung bei gleichbleibendem Bereich, gefolgt von Erweiterung bei gleichbleibender Reichweite, gefolgt von Vertiefung bei gleichbleibendem Bereich usw, Wir könnten dies als Treppenhypothese bezeichnen (siehe Schaubild 1).
Immer eines nach dem anderen, nicht beides – Erweiterung und Vertiefung – auf einmal.[3] Das Erfolgsgeheimnis der EG liegt bisher vielleicht in ihrer Fähigkeit, einen klaren Blick für das Ziel, „une union sans cesse plus étroite entre les peuples Européens“[4], mit Pragmatismus und maßvollen Einschränkungen zu verbinden, damit der Prozeß nicht zu rasch voranschreitet.
Zunächst der Hintergrund: Winston Churchills berühmte Rede 1946 in Zürich, in der er sagte: „Wir sollten eine Art Vereinigte Staaten von Europa aufbauen.“ Das Ergebnis war die Gründung des Europarates im Jahre 1949, der umgehend mit einem großen Bereich und einer großen Reichweite, aber mit wenig realer Macht ausgestattet wurde. Die Beschlüsse seines Ministerrates müssen einstimmig sein[5], d.h., jede Regierung hat ein Vetorecht. Der Europarat ist nur eine weitere zwischenstaatliche Organisation, nichts mehr und nichts weniger.
Ganz anders war der in der Erklärung vom 9. Mai 1950 angekündigte, vom französischen Außenminister Robert Schuman in Zusammenarbeit mit Jean Monnet entwickelte Plan zur Schaffung einer Montanunion.[6] Hier war der Bereich auf zwei Länder, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland, begrenzt, die Reichweite beschränkte sich auf Kohle und Stahl, aber die Organisation war echt supranational. Die Vereinigung ging auf eine Erkenntnis zurück, die häufig Marxisten zugeschrieben wird, nämlich, daß die wirtschaftliche Organisation die Basis sei. Im Werner-Bericht[7] ist dies folgendermaßen ausgedrückt: „Die Wirtschafts- und Währungsunion erscheint somit als ein Ferment für die Entwicklung der politischen Union, ohne die sie (die Gemeinschaft) auf die Dauer nicht bestehen kann.“
Diese Erkenntnis ist in der Tat das gemeinsame Erbe von Konservativen, Liberalen wie Marxisten. Sie stammt aus einer Ära, die vielleicht um die Zeit der Industriellen Revolution begann, und zeigt sich heute noch fast genauso von Produktion und Produktivität fasziniert.
Sodann wurde die Erkenntnis mit schulbuchähnlicher Klarheit in Realität umgesetzt, indem man von etwas sehr Konkretem, nämlich Kohle und Stahl, ausging und um einen festen Kern der Wirtschaftsorganisation herum Macht aufbaute. Der nächste Schritt erfolgte bereits am 18. April 1951, als aus den Zwei die Sechs wurden: Der Vertrag von Paris begründete die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Die Reichweite blieb dieselbe, aber der Bereich wurde beträchtlich und in einer für diesen Prozeß typischen Weise erweitert: Der Kern ist sehr stark (Frankreich und die BRD), während drei der vier neuen Mitglieder (Belgien, die Niederlande und Luxemburg) vergleichsweise schwach und unbedeutend sind. Die gleichzeitige Aufnahme von vier neuen Mitgliedern scheint übrigens fast eine Regel zu sein …
Damit war also die erste der Gemeinschaften gegründet und konnte ihre Arbeit aufnehmen. Dann kam einer der wenigen Fehlschläge in diesem Prozeß, obwohl es beinahe ein Erfolg geworden wäre: Der Versuch einer bedeutenden Vertiefung der Kooperation durch Ergänzung der EGKS durch eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG). In der Nacht vom 30. auf den 31. August 1954 wurde der Vertrag, der bis dahin bereits von den Regierungen der Sechs unterzeichnet und von fünf Parlamenten ratifiziert worden war, von der französischen Nationalversammlung abgelehnt – wenn auch nur knapp, nämlich mit 319 gegen 264 Stimmen (aus bekannten, unterschiedlichen Gründen stimmten Kommunisten und Gaullisten mit Nein). Wir werden darauf im achten Kapitel zurückkommen.
Die Bemühungen um die Vertiefung der Kooperation schliefen deshalb jedoch nicht ein, sondern nahmen lediglich eine andere Richtung. Am 25. März 1957 kamen die zwei Verträge von Rom, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Gemeinschaft für Atomenergie (Euratom) gegründet wurden; seit der Konferenz von Messina im Juni 1955 waren sie gut vorbereitet worden. Als Hauptaufgabe der EWG kristallisierte sich sehr rasch die Errichtung einer Zollunion heraus, die dann bereits 18 Monate früher als vorgesehen (am 1. Juli 1968) mit der Aufhebung der Binnenzölle, der Einführung eines gemeinsamen Außentarifs gegenüber Drittländern und einer gemeinsamen Agrarpolitik vollendet wurde. Am 8. Februar 1967 folgte der Beschluß, in allen sechs Mitgliedstaaten ein einheitliches Mehrwertsteuersystem einzuführen. Am 1. Juli 1967 wurden die Hohe Behörde der EGKS und die Kommissionen von EWG und Euratom zusammengelegt, so daß die Europäischen Gemeinschaften fortan eine gemeinsame Kommission, einen Ministerrat und ein Europäisches Parlament besaßen.
In der Zeit nach den Römischen Verträgen fand aber nicht nur eine beachtliche Vertiefung, sondern auch eine Erweiterung der Mitgliedschaft statt – nur, daß die neuen „Mitglieder“ nicht europäische Vollmitglieder waren, wie im Artikel 238 des Römischen Vertrages vorgesehen, sondern außereuropäische assoziierte, „zweitklassige“ Mitglieder gemäß dem Vierten Teil des Vertrages („Länder und Hoheitsgebiete“). Die am 1. Juni 1964 in Kraft getretene Erste Jaunde-Konvention assoziierte der EWG 18 ehemalige Kolonien der Mitgliedstaaten; davon waren 14 ehemals französisches Gebiet, 3 belgisches und 1 italienisches („Italienisch-Somalia“).
Diese Periode ist in Europa jedoch vor allem wegen eines anderen Vorstoßes in Richtung auf Erweiterung der Gemeinschaft bekannt: wegen der Verhandlungsbemühungen und Beitrittsgesuche Großbritanniens, Irlands, Dänemarks und Norwegens. Die Erklärung des französischen Staatspräsidenten de Gaulle vom 14. Januar 1963, daß England für die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft noch nicht reif sei, ließe sich entsprechend der allgemeinen Treppenhypothese vielleicht auch so interpretieren, daß die Gemeinschaft noch nicht reif genug für den britischen Beitritt war. Die Vertiefung war noch nicht so weit gediehen, daß man eine Erweiterung hätte vornehmen können.
Im Zeitpunkt der Erklärung war es – und ist es sogar heute noch – üblich, die persönlichen Motive de Gaulles hervorzuheben, seine besondere Einstellung zu England usw. Es könnte jedoch ebenso sinnvoll, wenn nicht sogar noch sinnvoller sein, die Haltung de Gaulles als Ausdruck der Tatsache zu werten, daß die Gemeinschaft zur Aufnahme neuer Mitglieder noch nicht bereit war, weil allgemein befürchtet wurde, neue Mitglieder würden einen stärkeren Einfluß auf die Gemeinschaft ausüben als die Gemeinschaft auf sie. Rückblickend kann de Gaulles Absage an England den Integrationsprozeß also durchaus eher gefördert als gehindert haben. Am 27. November 1967 galt dies offenbar immer noch, denn an diesem Tag wurde auf einer Pressekonferenz die zweite Absage de Gaulles an Großbritannien bekanntgegeben. Zu dieser Zeit wußte nicht nur de Gaulle, sondern ganz Frankreich sehr wohl, wovon es sprach. Vom 1. Juli 1965 bis zum 17. Januar 1966 boykottierte Frankreich die Institutionen der Gemeinschaft ganz offensichtlich deshalb, weil die Bemühungen, zu einer Einigung über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik zu kommen, gescheitert waren. Kein Zweifel, das Haus der Gemeinschaft war nicht in Ordnung!
Das erste grüne Licht seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahre 1957 (und seit ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 1958), das erste positive Zeichen dafür, daß die Gemeinschaft endlich bereit war, die Stagnation zu überwinden, war das Abschlußkommuniqué der Haager Gipfelkonferenz vom 1./2. Dezember 1969, in dem die allgemeine Einigkeit über eine Vervollständigung, Vergrößerung und Stärkung der Gemeinschaft zum Ausdruck kam. Seither ist die Erweiterung der EG rascher vorangekommen, und dies gilt auch für ihre Erweiterungspläne. Am 4. März 1970 legte die Kommission einen Dreistufenplan zur Schaffung der vollen Wirtschafts- und Währungsunion bis 1980 vor, und am 31. Juli 1970 übermittelten die Außenminister der Sechs ihren Regierungschefs den Davignon-Bericht, welcher regelmäßige halbjährliche Konsultationen über die politische Zusammenarbeit, vor allem die Harmonisierung der Außenpolitik vorsieht. In Ergänzung dieses Berichts fand am 19. November 1970 in München eine EG-Außenministerkonferenz statt, auf der die Sechs unter anderem erstmals die Notwendigkeit einer einheitlichen Stimmabgabe in den Vereinten Nationen unterstrichen.[8]
Es erübrigt sich zu sagen, daß in der Zeit nach der Haager Gipfelkonferenz auch eine Reihe anderer Fragen behandelt wurde – Kernforschung und nicht-nukleare wissenschaftliche Forschung, die Definition einer mittelfristigen Wirtschaftsplanung, die Schaffung eines kurzfristigen Systems gegenseitiger Finanzhilfe in Höhe von 2 Milliarden Dollar, Schritte zur Schaffung einer gemeinsamen Industriepolitik, Befugnisse für den Europäischen Sozialfonds auf dem Gebiet der Umschulung und Umsiedlung von Arbeitern, eine gemeinschaftliche Fischereipolitik, der Mansholt-Plan zur Modernisierung der Landwirtschaft usw. Aber es ist typisch für die Europäische Gemeinschaft, daß ihr Hauptinteresse langfristigen Plänen gilt, insbesondere dem Zehnjahresplan zur stufenweisen Schaffung der vollen Wirtschafts- und Währungsunion, dessen Zieljahr 1980 ist.
Die Zeit nach der Haager Gipfelkonferenz war auch die Zeit der Verhandlungen mit den vier Beitrittskandidaten England, Irland, Dänemark und Norwegen. Das heißt nicht, daß die Erweiterungsbemühungen damit aufhören. In dieser Zeit zeigte sich am Horizont der Gemeinschaft eine neue Mitgliedsform, sozusagen eine dritte Klasse der Mitgliedschaft, die sich in verschiedenen, lockerer als die Jaunde-Konvention gehaltenen Assoziierungsabkommen niederschlug. Es hatte in Europa bereits eine Vorgeschichte gegeben: die am 9. Juli 1961 mit Griechenland und am 12. September 1963 mit der Türkei gemäß Artikel 237 des Römischen Vertrages geschlossenen Assoziierungsabkommen, in denen eine spätere Vollmitgliedschaft dieser beiden Länder als Möglichkeit vorgesehen war. In diesem Falle konnte der Status eines assoziierten Mitgliedes als Warteraum für die Länder gelten, die aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht genügend Gemeinsamkeiten mit den ursprünglichen Mitgliedstaaten aufwiesen. Nach dem erfolgreichen Militärputsch in Griechenland (1967) wurde das Assoziierungsabkommen praktisch suspendiert. Griechenland wurde innerhalb des EG-Warteraumes in einen Eisschrank gesteckt, behielt aber ein Bein draußen. Daher müssen diese Assoziierungsabkommen von den wesentlich lockereren Vereinbarungen mit Jugoslawien (19. März 1970), Israel und Spanien (1. Oktober 1970) und Malta (1. April 1971) unterschieden werden.
Die eigentliche Erweiterung auf der Ebene unterhalb der Vollmitgliedschaft vollzog sich jedoch außerhalb Europas. Am 16. Juli 1966 unterzeichnete Nigeria ein Assoziierungsabkommen mit der EG, und obwohl dieses Abkommen wegen des in Nigeria wütenden Bürgerkrieges nie in Kraft trat, war es doch bedeutsam, insofern es einen ersten Einbruch in Commonwealth-Gebiet darstellte. Noch wichtiger war das am 26. Juli 1968 zwischen der EG und den ostafrikanischen Staaten Kenia, Uganda und Tansania geschlossene Assoziierungsabkommen von Arusha, das am 24. September 1969 erneuert wurde. Seine Bedeutung soll im sechsten Kapitel erörtert werden.
Damit kommen wir zur gegenwärtigen Situation und der Frage: Was geht auf den beiden Achsen der Vertiefung und Erweiterung vor? Dies ist deshalb die entscheidende Frage, weil ihre Beantwortung die Voraussetzung für ein Urteil darüber ist, inwieweit der Superstaat sich zu einer Supermacht entwickelt, mit anderen Worten, inwieweit der Griff der EG nach der höchsten Macht in der Welt, der sogar so weit geht, die Welt wieder eurozentrisch zu gestalten und ein Europa zu schaffen, dessen Zentrum in der EG liegt, Wirklichkeit werden wird.
Zur Untersuchung dieser Frage sind zwei Methoden denkbar. Einmal könnte man von den Absichtserklärungen der Politiker ausgehen. Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre gab es eine Fülle von Erklärungen über die kommenden Vereinigten Staaten von Europa; viele dieser Erklärungen wurden – vor allem von den Gründern der EG – in die ersten Anfänge der Europäischen Gemeinschaft mit hinübergenommen. Man könnte aber auch die Äußerung eines führenden Staatsmannes der EG, des Kanzlers der BRD Willy Brandt, über die zukünftige Rolle der Europäischen Gemeinschaft als Ausgangspunkt nehmen:[9] „Es belustigt mich manchmal, wenn ich Geschichten über die neue Dreiecksweltlage lese, in die wir angeblich geraten könnten – Washington, Moskau und Peking. Ich persönlich meine, daß es eher eine quadratische oder rechteckige Lage mit Westeuropa als vierter Ecke sein wird – zumindest wenn man bis zum Ende dieses Jahrzehnts vorausschaut.“
Diese Methode wollen wir hier nicht anwenden. Das Verhältnis zwischen offen erklärten Absichten und dem, was in der Welt der Tatsachen geschieht, ist zu lose, als daß sich daraus ein echter Einfluß ergeben könnte. Der Europarat selbst beweist, wie wenig Absichten bedeuten, wenn keine Fähigkeiten dahinterstehen. Außerdem sind erklärte Absichten eine Sache, tatsächliche Absichten eine ganz andere – und gewöhnlich erkennt man sie erst im nachhinein.
Der Haupteinwand ist jedoch, daß die Zitatmethode der Absicht zuviel und der Struktur zuwenig Gewicht beimißt. Sie geht auch von der Annahme aus, daß Politiker sich der Dinge, die sie tun, bewußt sind, daß sie die Kräfte durchschauen, von denen sie getragen werden, die sie einzudämmen oder zu wecken suchen. Aus diesem Grund werden wir uns viel stärker auf eine Analyse der bisher erkennbaren Struktur stützen und davon extrapolieren. Erklärte Absichten können den tatsächlichen Vorgängen zuweilen vorausgehen oder sie vorwegnehmen, es kann aber auch sein, daß sie sie überhaupt nicht berühren.
Die tatsächlichen Vorgänge sind offensichtlich fortschreitende Vertiefung und Erweiterung. Was die Vertiefung angeht, so besteht wenig Anlaß zu bezweifeln, daß die im Werner- und Davignon-Plan angezeigten Ziele erreicht werden, mit einigen Modifikationen möglicherweise schon vor dem Zieljahr 1980. Aber das liegt weder daran, daß es so in den Plänen steht, noch daran, daß es eine erklärte Absicht gibt, sich in dieser oder jener Form an die Pläne zu halten. Vielmehr ist es einfach darauf zurückzuführen, daß der in der Europäischen Gemeinschaft bereits begonnene Fusionsprozeß zu einer Kettenreaktion führen muß. In der Tat werden die Folgen dieses Prozesses viel weiterreichend sein als die in den beiden Plänen ausgesprochenen, welche Gegenstand so vieler öffentlicher Diskussionen, vor allem in den beitrittswilligen Ländern gewesen sind.
Angesichts von Fusionen auf verschiedenen Ebenen der größten Industrieverbände, zum Beispiel in der Automobil- und Flugzeugproduktion[10], liegt es auf der Hand, daß weitere Teile des Kapitals im Hinblick auf eine Wirtschafts- und Währungsunion verschmelzen müssen. Aber wo Kapital fusioniert, muß Arbeit dasselbe tun: eine offensichtliche Konsequenz der europäischen multinationalen Konzerne werden EG-Gewerkschaften sein, die in der Lage sind, gemeinschaftlich Tarifverhandlungen zu führen, gemeinsame Streiks zu organisieren usw.
Zugleich ist zu sagen, daß, wenn all dies sich auf der Ebene der Basis-Interessen vollzieht, die die Individuen auf Grund ihrer Arbeit haben, es auch auf der Ebene der Wertvorstellungen, also in Gestalt einer gemeinsamen Ideologie zustande kommen wird. Mit anderen Worten, die Parteien in der EG werden immer mehr zu auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft organisierten, d.h. zu Gemeinschaftsparteien werden, wodurch sich die Koordination zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EG immer mehr erübrigt. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind schon heute in den „offiziellen“ politischen Gruppen organisiert, bei Christdemokraten, Sozialisten und Liberalen – und zusätzlich in der Europäischen Demokratischen Union, der nur Mitglieder der französischen Gaullisten angehören. Die Kommunistische Partei Italiens ist seit 1969 ebenfalls vertreten, doch hat sie zu wenig Mitglieder, um eine offizielle Gruppe zu bilden. Dieser Prozeß wird sich außerhalb des Europäischen Parlaments fortsetzen.
Freilich ist damit nicht gesagt, daß die Europäische Gemeinschaft sich radikalen Parteien der Rechten oder Linken grundsätzlich verschließen wird. Die EG beruht auf dem festen Kern der allen Mitgliedstaaten gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Struktur. Sollte es in der Mehrzahl der Mitgliedsländer jedoch hinlänglich starke kommunistische Parteien geben, so wird sich dies vermutlich früher oder später auch in der EG in angemessener Weise niederschlagen. Der springende Punkt ist, daß die Parteien tendenziell zunehmend transnationalen Charakter annehmen und direkt mit der EG in Verbindung treten werden, während die nationale Komponente immer mehr verdrängt werden wird. Daraus wird sich dann auch die Tendenz ergeben, daß sich die Parteien in den EG-Ländern immer mehr angleichen.
Diese Kettenreaktionsprozesse sind so offenkundig, daß man eher umgekehrt fragen könnte: Für welche Bevölkerungsgruppen besteht die größte Wahrscheinlichkeit, aus diesem allgemeinen Prozeß der Transnationalisierung ausgeschlossen zu werden? Wir möchten annehmen, daß dies solche Gruppen oder Interessen sind, die
nicht einmal auf nationaler Ebene hinreichend artikuliert sind, oder
in den Mitgliedstaaten nicht in der Mehrheit zu finden sind, oder
nicht genügend Mittel besitzen, sich transnational zu organisieren.
Zur ersten Kategorie würden wir besonders solche Gruppen zählen, die in entlegenen Gegenden bzw. in den nationalen Randgebieten allgemein wohnen, wie z.B. Inselbewohner im Norden Norwegens oder alte und einsame Menschen.
Bei der zweiten Kategorie wäre an solche Gruppen und Interessen zu denken, mit denen große Gruppenkonflikte verbunden sind, so z.B. die Konflikte in Belgien, in Großbritannien (Wales, Schottland und Ulster), in Frankreich (Bretagne, aber auch Südostfrankreich[12]) und bis zum gewissen Grade in einigen anderen Ländern. Da diese Konflikte nicht in allen Ländern und sicherlich nicht in derselben Form anzutreffen sind, wird es für die betroffenen Bevölkerungsgruppen schwierig sein, einander zu finden.
Ein gutes Beispiel für die dritte Kategorie wäre die allgemeine Situation der Studenten an Hochschulen und Universitäten. Für die Europäische Gemeinschaft ist es nicht schwer, Konferenzen über „das Problem der Jugend“, „die Krise an den Universitäten“ und ähnliche Themen zu veranstalten; aber die Teilnehmer dieser Konferenzen sind im Normalfalle Bildungsminister, Bürokraten und andere Vertreter des Ausbildungssystems, Lehrer und Professoren. Denjenigen, die daran interessiert sein könnten, Konferenzen mit Themen wie „die Probleme der Männer im mittleren Alter“, „professorale Ruhe“ statt der ewigen „studentischen Unruhe“ zu organisieren, fehlt es gewöhnlich an den nötigen Mitteln dazu, und zwar nicht nur im banalen Sinne von Reisespesen oder Geldern zum Aufbau einer Organisation, sondern auch in dem Sinne, die richtigen Leute zu finden, die Zeit und Gelegenheit haben, an solchen Konferenzen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit teilzunehmen.
All dies ist schon auf nationaler Ebene schwierig genug, auf der Ebene der EG ist es noch viel schwieriger. Dies bedeutet keineswegs, daß die genannten „Probleme“ überhaupt nicht behandelt werden; das heißt aber, daß sie von denjenigen behandelt werden, die an der Spitze stehen, die eine beherrschende Position haben, und daß die Teilnehmer aus den Reihen der Beherrschten unzureichend vertreten sind, und da nicht einmal deren Ansichten hinlänglich artikuliert werden, ist die Szenerie für einen technokratischen und bürokratischen Typ des „social engineering“ perfekt.
Das wird nicht von Dauer sein. Es werden Gegenkräfte mobilisiert werden, die unteren Schichten der Gesellschaft werden sich organisieren, auch auf der Ebene der Gemeinschaft, wobei ihre Bemühungen, sich zu artikulieren, am Anfang manchmal wohl auch gewalttätige Formen annehmen werden. Und an diesem Punkt wird eine Ironie der Europäischen Gemeinschaft zunehmend deutlich werden: Je mehr Kräfte in den EG-Ländern, die erbitterte Gegner des Brüsseler Zentralismus sind, sich organisieren und effektiv Gegenposition beziehen, unter anderem, um die zentralen Behörden der EG zu schwächen, um so stärker wird die EG werden. Derzeit ist die Europäische Gemeinschaft ein ungeheurer Überbau mit einem europäischen Beamtenapparat von annähernd 10000 Personen (6200 in der Kommission, den Sekretariaten des Rates und des Parlaments, beim Gerichtshof und bei der Investitionsbank; 2500 in den vier Euratom-Forschungsanstalten).[13] Dieser Überbau erhebt sich über sechs Nationalstaaten, in denen die Opposition gegen die Bürokratie zuweilen sehr stark ist.
Aber bislang hat es praktisch überhaupt keine echt transnationale Opposition gegen die Europäische Gemeinschaft als solche gegeben, und dies ist vielleicht der wichtigste Faktor, der die EGvon innen gesehen von einem Superstaat unterscheidet. Sie ist der Konföderation der patries, wie sie im großen und ganzen der französischen Auffassung entspricht, sicherlich immer noch viel näher als der supranationalen Integration in Richtung auf einen Superstaat, wie die anderen ihn sich vorstellen. Tatsächlich kann es durchaus sein, daß die EG am meisten von ihren Gegnern dazu gedrängt wird, sich zu einem Superstaat zu formieren, denn in dem Maße, wie ihre Gegner sich transnational organisieren, werden sich auch die EG-Behörden auf einer festeren und stärker transnationalen Basis neu formieren. An dem Tag, an dem sich – sagen wir einmal – Jugendliche und Arbeiter aus allen Mitgliedstaaten vor dem Hauptquartier der Kommission in Brüssel, dem Berlaimont-Komplex am Schuman-Platz, zu einer machtvollen Demonstration versammeln und es zur Konfrontation mit einer transnationalen Polizeitruppe der Europäischen Gemeinschaft kommt, die zum Beispiel nach jener speziellen französischen CRS-Expertise organisiert ist – an diesem Tag wird der EG-Superstaat Wirklichkeit sein.
Da unser Interesse in diesem Rahmen aber hauptsächlich dem Einfluß der Europäischen Gemeinschaft auf die Außenwelt gilt, liegt unser Hauptschwerpunkt nicht auf ihrer inneren Struktur. Die Proposition „die Europäische Gemeinschaft entwickelt sich zu einem Superstaat“ läßt sich nicht mit dem Hinweis auf einige der schwerfälligen Entscheidungsmechanismen und ein hohes Maß an Dezentralisation widerlegen, da dies sowohl für einen Teil der Brüsseler Eurokratie als auch für die (1969) 188 Millionen Staatsbürger in den Mitgliedstaaten eine Realität ist. Der Aspekt des Superstaates und möglicherweise auch der Supermacht wird sich im Verhältnis der EG zur Außenwelt offenbaren, zum Beispiel als vierte Ecke in dem Quadrat oder Rechteck, von dem Brandt sprach. Die adäquatere geometrische Figur wäre eigentlich ein Fünfeck mit Japan als fünfter Ecke – Präsident Nixon machte in einer Rede vom Juli 1971 bereits eine Andeutung in diesem Sinne, und in den Plänen zur Reorganisation des britischen diplomatischen Dienstes ist dieser Gedanke ebenfalls enthalten.
Dies bringt uns auf die andere Achse und damit die Frage: Was wird in Zukunft mit der Erweiterung geschehen? Hierbei geht es nicht darum, ob aus den Sechs die Zehn werden; unsere Fragestellung geht weiter. Nehmen wir aber um des Arguments willen einmal an, daß die Europäische Gemeinschaft ab 1. Januar 1973 zehn Mitglieder hat; denn selbst wenn es nur acht oder neun sind, werden die restlichen zwei bzw. der eine Nicht-Mitgliedstaat wahrscheinlich so stark an die EG gebunden sein, daß man sie praktisch als Mitglieder betrachten kann. Ob es ein Vorteil ist, nur Adressat der Brüsseler Entscheidungen oder auch Adressant zu sein, wird davon abhängen, ob man die Vollmitgliedschaft als Beteiligung an Entscheidungen ansieht, die überwiegend gut sind, oder an solchen, die auch schlecht sein können. Im letzteren Falle kann die Beteiligung am Entscheidungsprozeß auch zur Teilübernahme von Schuld werden. Dies scheint die schwedische Position zu sein.
Der Vertrag von Rom legt eindeutig fest, daß nur europäische Staaten Vollmitglied werden können. Daraus folgt eine potentielle Mitgliederzahl von 30 europäischen Staaten. Indes gibt es wenigstens zwei einfache Prinzipien, die diese potentielle Mitgliederzahl auf weit unter 20 reduzieren.
Das erste und vorrangige Prinzip verlangt eine grundlegende strukturelle Gleichartigkeit