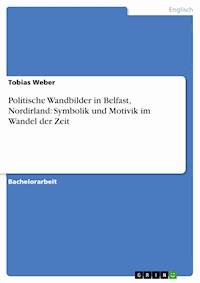19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Inhalt: Dargestellt werden u.a. die kommunalen Rechtssubjekte, ihre Aufgaben und Organisation; Kommunalstreitverfahren; Satzungsrecht; kommunale Einrichtungen; Anschluss- und Benutzungszwang; Kommunalaufsicht. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Kommunalrecht Bayern
von
Tobias WeberRichter am Bayerischen Verwaltungsgericht AugsburgLehrbeauftragter der Universität Augsburg
und
Rechtsanwalt Prof. Dr. Valentin Köppert, LL.M.Hochschule für angewandtes ManagementFH
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9168-7
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre Kenntnisse im bayerischen Kommunalrecht!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
In diesem Skript werden alle unserer Ansicht nach klausurrelevanten Fragen aus dem Kommunalrecht in Bayern behandelt. Die notwendigen Bezüge zu den Grundrechten nach dem Grundgesetz und der bayerischen Verfassung werden ebenso mitbehandelt wie die speziellen bayerischen Rechtsbehelfe gegen Satzungen als Rechtsvorschriften des bayerischen Landesrechts.
Das Skript wendet sich in erster Linie an Studenten zum Erarbeiten des notwendigen materiellen Wissens, aber auch zum Erlernen der Strukturen und dogmatischen Zusammenhänge des Kommunalrechts.
Das Skript ist jedoch in gleicher Weise für Rechtsreferendare geeignet, die sich auf die Zweite Juristische Staatsprüfung vorbereiten. Nachdem mittlerweile sowohl das Widerspruchsverfahren (§§ 68 ff. VwGO) als auch das Kommunalabgabenrecht nicht mehr Prüfungsstoff der Ersten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung in Bayern sind, wurde bei der Neuauflage das in den Vorauflagen noch enthaltene Kapitel zum Kommunalen Finanzwesen nicht mehr in das Skript aufgenommen. Der Verweis auf die Lehr- und Fallbücher sowie die umfangreiche Verweisung auf die Rechtsprechung in den Fußnoten ist dabei bewusst als Vertiefung gedacht, sofern der Leser den Eindruck haben sollte, etwas noch nicht „hundertprozentig“ verstanden zu haben.
Daneben kann das Skript aber auch Praktikern zum schnellen Einstieg in die Materie des bayerischen Kommunalrechts dienen.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an die C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Augsburg, im Juli 2019 Tobias Weber Prof. Dr. Valentin Köppert
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 33, 57, 79, 123, 165, 182, 209, 249, 261, 307, 343, 364
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilGrundlagen des Kommunalrechts
A.Begriff des Kommunalrechts
B.Aufbau der Verwaltung
I.Staatsverwaltung
II.Kommunale Verwaltungsebene
1.Gemeinden
a)Kreisangehörige Gemeinden
b)Kreisfreie Stadt
c)Sonderfall der Großen Kreisstadt
d)Gemeindefreies Gebiet
2.Landkreise und Bezirke
3.Das Verhältnis zwischen der Staatsverwaltung und der kommunalen Verwaltungsebene
a)Doppelfunktion des Landratsamts
b)Richtiger Beklagter in der verwaltungsgerichtlichen Klausur
2. TeilVerfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften
A.Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften
I.Auf der Ebene des Grundgesetzes
II.Auf der Ebene der Bayerischen Verfassung
B.Selbstverwaltungsrecht
I.Begriff der Selbstverwaltungsgarantie der kommunalen Gebietskörperschaft
II.Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden
III.Institutionelle Rechtssubjektsgarantie
IV.Allzuständigkeit der Gemeinde
V.Zuständigkeiten von Landkreis und Bezirk als überörtlichen kommunalen Gebietskörperschaften
VI.Rechtsschutzmöglichkeiten der Gemeinde bei Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverwaltung
1.Vorgehen gegen ein (formelles) Bundesgesetz
2.Vorgehen gegen ein (formelles) Landesgesetz
3.Vorgehen gegen eine untergesetzliche Satzung/Verordnung
4.Vorgehen gegen eine Einzelfallentscheidung (Verwaltungsakt, Art. 35 BayVwVfG)
3. TeilAufgaben kommunaler Gebietskörperschaften
A.Gesetzliche Differenzierung zwischen eigenem und übertragenem Wirkungskreis
I.Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (am Beispiel der Gemeinde)
1.Pflichtaufgaben
2.Sollaufgaben
II.Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises
III.Klausurrelevante Auswirkungen der Differenzierung nach Wirkungskreisen
B.Aufgabenbereiche der einzelnen Kommunen
I.Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinde
II.Aufgaben der Großen Kreisstadt (Art. 9 Abs. 2 GO, GrKrV)
III.Aufgaben der kreisfreien Stadt (Art. 9 Abs. 1 GO)
IV.Aufgabendifferenzierung bei Landkreisen und Bezirken
V.Übungsfall Nr. 1
4. TeilOrgane der Gemeinde und deren Aufgaben
A.Der erste Bürgermeister
I.Rechtsstellung und Begrifflichkeiten
II.Aufgaben des ersten Bürgermeisters
1.Laufende Angelegenheiten
2.Übertragung weiterer Angelegenheiten
3.Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte
4.Ratsvorsitzender und Vollzugsorgan der Ratsbeschlüsse
5.Hausrecht und Dienstaufsicht
III.Außenvertretungsrecht
B.Der Gemeinderat
I.Zusammensetzung des Gemeinderats
II.Aufgaben des Gemeinderats
III.Rechtsstellung ehrenamtlicher und berufsmäßiger Gemeinderatsmitglieder
IV.Ausschüsse
V.Der Begriff der Fraktionen und dessen Relevanz
VI.Übungsfall Nr. 2
C.Der Geschäftsgang der Gemeinde
I.Im Gemeinderat
1.Die Geschäftsordnung als Grundlage der gemeindlichen Beschlussfassung
2.Verfahren im Einzelnen
a)Die Vorbereitung der Sitzung durch den ersten Bürgermeister
b)Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO
c)Sauberkeit und Lauterkeit der Verwaltung
d)Die Beschlussfassung
e)Ordnungsmaßnahmen anlässlich der Gemeinderatssitzung
II.In beschließenden Ausschüssen
III.Übungsfall Nr. 3
D.Die kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit
I.Begriff
II.Differenzierung nach Inter- und Intraorganstreit
III.Rechtsschutz
IV.Prüfungsschema
V.Übungsfall Nr. 4
5. TeilHandlungsformen der Gemeinde
A.Die Satzung als Rechtsetzungsakt im eigenen Wirkungskreis
B.Die Verordnung als Rechtsetzungsakt im übertragenen Wirkungskreis
C.Unterschiede zwischen Satzungen und Verordnungen
D.Rechtmäßigkeitsanforderungen an Satzungen
I.Formelle Anforderungen
1.Zuständigkeit
2.Verfahren
3.Form
II.Materielle Anforderungen
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Vereinbarkeit mit der Ermächtigungsgrundlage und mit höherrangigem Recht
3.Exkurs: Inhaltliche Anforderungen an den Erlass von Rechtsverordnungen
4.Rechtsfolgen bei Verstößen
III.Überprüfung kommunaler Satzungen: Problem der Verwerfungskompetenz
IV.Rechtsschutz
1.Prinzipale Normenkontrolle, § 47 VwGO
2.Die Popularklage, Art. 98 S. 4 BV, Art. 2 Nr. 7, 55 BayVerfGHG
3.Gerichtliche Inzidentkontrolle
4.Bundesverfassungsbeschwerde, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG
5.Bayerische Verfassungsbeschwerde, Art. 120, 66 BV, Art. 2 Nr. 6, 51 ff. VerfGHG
6. TeilDie öffentlichen Einrichtungen
A.Begriff der öffentlichen Einrichtung
I.Organisatorische Möglichkeiten
II.Zugang zur öffentlichen Einrichtung
1.Zulassungsanspruch
2.Grenzen des Zulassungsanspruchs
a)Widmung
b)Kapazität
c)Gefahr von Rechtsverstößen
d)Sonderfall: Zulassung politischer Parteien zu öffentlichen Einrichtungen
III.Die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses der öffentlichen Einrichtung
IV.Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers
1.Rechtswegfrage
2.Statthafte Klageart
B.Der gemeindliche Anschluss- und Benutzungszwang
I.Begriff, Inhalt, Sinn und Zweck
II.Materielle Voraussetzungen
III.Räumliche Begrenzung
IV.Einschränkung von Grundrechten durch Anschluss- und Benutzungszwang
C.Kommunale Unternehmen
I.Organisationsformen
1.Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
2.Privatrechtliche Organisationsformen
II.Zulässigkeitsanforderungen an gemeindliche Unternehmen
III.Rechtsschutz Dritter gegen gemeindliche Unternehmen (Konkurrentenklage)
7. TeilDie Staatsaufsicht über die Gemeinde
A.Prinzip der staatlichen Aufsicht über kommunale Gebietskörperschaften
B.Die Unterscheidung zwischen Rechts- und Fachaufsicht
C.Rechtsaufsicht
I.Die Rechtsaufsichtsbehörden
II.Die rechtsaufsichtlichen Aufsichtsmittel
1.Informationsrecht, Art. 111 GO
2.Beanstandungs- und Aufhebungsverlangen, Art. 112 S. 1 GO
3.Ersatzvornahme, Art. 113 GO
4.Bestellung eines Beauftragten, Art. 114 GO
III.Rechtsschutz der Gemeinde gegen rechtsaufsichtliche Maßnahmen
1.Rechtsnatur der Maßnahmen
2.Statthafte Klageart und Klagebefugnis
D.Fachaufsicht
I.Die Fachaufsichtsbehörden
II.Die fachaufsichtlichen Aufsichtsmittel
1.Informationsrecht, Art. 116 Abs. 1 S. 1 GO
2.Weisungsrecht, Art. 116 Abs. 1 S. 2 GO
3.Ersatzvornahme, Art. 116 Abs. 1 S. 3, 116 Abs. 2 S. 1 GO
III.Rechtsschutz der Gemeinde gegen fachaufsichtliche Maßnahmen
1.Rechtsnatur der fachaufsichtlichen Weisung
2.Statthafte Klageart und Klagebefugnis
3.Begründetheit einer Klage gegen einen aufsichtlichen Rechtsakt
E.Exkurs: Rechtsschutz des Bürgers bei aufsichtlichem Handeln
F.Übungsfall Nr. 5
8. TeilBürgerbegehren und Bürgerentscheid
A.Elemente unmittelbarer Demokratie in Bayern
B.Formelle Voraussetzungen für die Zulassung eines Bürgerentscheids
I.Antrag, Bestimmtheit der Fragen, Begründung
II.Unterzeichner, Vertreter des Begehrens, Quorum
C.Materielle Voraussetzungen für die Zulassung eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides
D.Umfang der gemeindlichen Prüfung nach Art. 18a Abs. 8 GO
E.Rechtsfolgen eines zulässigen Bürgerbegehrens
F.Der Rechtsschutz auf Zulassung eines abgelehnten Antrages auf Bürgerbegehren/Bürgerentscheid
I.Allgemeines
II.Übungsfall Nr. 6
9. TeilKommunale Zusammenarbeit
A.Gesetzliche Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit nach dem KommZG und der VGemO
B.Arbeitsgemeinschaften, Zweckvereinbarungen, Zweckverbände
C.Die Verwaltungsgemeinschaft
I.Allgemeines
II.Aufgabendifferenzierung bei der Verwaltungsgemeinschaft
III.Organe der Verwaltungsgemeinschaft
IV.Aufsicht bei der Verwaltungsgemeinschaft
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Kommentare
Bauer/Böhle/Ecker
(vormals Masson/Samper) Bayerische Kommunalgesetze, 1952 ff., Loseblatt (Stand: September 2018)
Bonengel//Kitzeder
Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverbände, 2010, Loseblatt (Stand: 2018)
Hölzl/Hien/Huber
Gemeindeordnung mit Verwaltungsgemeinschaftsordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung für den Freistaat Bayern, 1968 ff., Loseblatt (Stand: Juli 2018)
Hömig/Wolff
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2018
Jarass/Pieroth
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 15. Aufl. 2018
Kopp/Schenke
Verwaltungsgerichtsordnung, 25. Aufl. 2019
Kopp/Ramsauer
Verwaltungsverfahrensgesetz, 20. Aufl. 2019
Prandl/Zimmermann/Büchner/Pahlke
Gemeinderecht in Bayern, 1974 ff., Loseblatt (Stand: 2019)
Schoch/Schneider/Bier
VwGO, Loseblatt, 36. Aufl. 2019 (Stand: Februar 2019)
Widtmann/Grasser/Glaser
Bayerische Gemeindeordnung, 1986 ff., Loseblatt, 29. Auflage 2018 (Stand: Mai 2018)
Lehrbücher
Becker/Heckmann/Kempen/Manssen
Öffentliches Recht in Bayern, 7. Aufl. 2017
Gern
Deutsches Kommunalrecht, 3. Aufl. 2003
Knemeyer
Bayerisches Kommunalrecht, 12. Aufl. 2007
Lissack
Bayerisches Kommunalrecht, 4. Aufl. 2019
Maurer/Waldhoff
Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Aufl. 2017
Fallsammlungen
Becker/Heckmann/Kempen/Manssen
Klausurenbuch Öffentliches Recht in Bayern, 4. Aufl. 2019
Büchner
Musterfälle zum Kommunalrecht, 5. Aufl. 1996
Knemeyer
Bayerisches Verwaltungsrecht, Übungs- und Examensklausurenkurs, 4. Aufl. 1995
Seidel/Reimer/Möstl
Allgemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht, 3. Aufl. 2019
Seiler
Examens-Repetitorium Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2017
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 3Leistungsfähigkeit, Ernährung und individueller Tagesrhythmus
Jura Lernen ist Kopfarbeit, die mit emotionalen und motivationalen Zuständen verbunden ist. Diese mentalen Prozesse sind physiologisch betrachtet elektrische Aktivität der Hirnzellen - also Körperarbeit. Und Körperarbeit erfordert und verbraucht Energie. Sie brauchen für eine erfolgreiche Lernarbeit eine angemessene Energiezufuhr durch passende Ernährung. Und weil es Tagesschwankungen in der Leistungsfähigkeit gibt, ist es für Sie wichtig, Ihre Lern- und Pausenplanung an einem individuell passenden Rhythmus auszurichten.
Lerntipps
Optimieren Sie Ihre Ernährung!
Zum Lernen ist es günstig, sich gut zu fühlen und geistig konzentriert zu sein. Nudeln zum Beispiel kurbeln das „Glückshormon“ Serotonin an und sind eine Langzeitenergiequelle, da der Körper die Kohlehydrate aus dem Mehl nur langsam abbaut. Aufmunternd wirken Brot, Fisch und Kartoffeln. Bananen wirken leicht beruhigend durch ihren Magnesiumgehalt. Durch zu wenig Nahrung sinkt der Blutzuckerspiegel ab, bewirkt eine Konzentrations- und damit Leistungsabnahme. Für das Gehirn sind daher kleinere Mahlzeiten (am besten fünf) optimal. Nicht umsonst wird von Ernährungsexperten nach wie vor das Schulbrot und ein Apfel empfohlen, auch wenn das bei vielen Schülern als uncool gilt. Denken Sie auch an Vitamine, besonders C, E und B und Mineralien wie Eisen und Calcium. Obst und Gemüse sind hier ideal.
AIso starten Sie mit einem stressfreien, gemütlichen Frühstück mit Zeitung, stehen Sie lieber früher auf. Nach jeder Mahlzeit sollte eine kurze Pause eingelegt werden, da die Energie (Sauerstoff) erst einmal für die Verdauung verbraucht wird und dem Gehirn nicht direkt zur Verfügung steht.
Falsches Essen und Trinken kann das Lernen ausbremsen!
Vermeiden Sie den Geschmacksverstärker Glutamat, der sich z.B. in vielen Fertiggerichten und dem allgemeinen Fast Food wie Hamburger, Würstchen und Chips befindet. Er kann zu Hitzewallungen, Kopfschmerzen und Herzklopfen führen. Und das brauchen Sie in anstrengenden Lernphasen nun wirklich nicht! Kaffee entzieht zwar keine Flüssigkeit wie Tee, wirkt wie Cola kurzzeitig aufputschend, dann aber ermüdend. Wenn Sie gerne Tee trinken – der wirkt positiv anregend – gleichen Sie das unbedingt durch die entsprechende Menge Wasser aus, denn …
… die geistige Leistung wird durch Wasser verbessert!
Wasser ist ein wichtiges Transportmittel zur Stoffverschiebung und für die Zellaktivität. Flüssigkeitsmangel reduziert die Informationsaufnahme, -verarbeitung und den Wissenserwerb, durch vermehrte Wasseraufnahme verbessern sich geistige Leistungen, z.B. erkennbar an besseren Noten. Trinken während einer Lehrveranstaltung erhöht die Aufmerksamkeit für den Lehrstoff (Ergebnisse aus der Rosbacher Studie). Im normalen Alltagsgeschehen sollten wir 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu uns nehmen. Bei größerer Beanspruchung und Hitze entsprechend mehr. Wasser ist ideal auch wegen der Spurenelemente, stilles Wasser durchspült den Körper besser als Wasser mit Kohlensäure. Fruchtsaft kann natürlich dazugemischt werden.
Es gibt erhebliche individuelle Unterschiede in den Tagesleistungskurven!
Die gegenwärtige Forschung relativiert einige Annahmen über „den Bio-Rhythmus“:
•
Tagesrhythmische Schwankungen beziehen sich auf unterschiedliche Leistungsfähigkeiten (körperliche vs. geistige).
•
Die Schwankungen hängen stark von den Rahmenbedingungen wie z.B. der Intensität der Anforderungen ab (z.B. 12 Uhr Leistungsfähigkeit für Prüfungsfach A gering, aber für Sport nicht unbedingt; 3 Uhr Discobesuch hellwach etc.)
•
Die Leistungsfähigkeit hängt stark mit der Motivation zusammen (z.B. Lesen eines Buches über ein Hobby oder über ein kompliziertes Prüfungsthema).
•
Es gibt erhebliche Unterschiede in den tagesablaufbedingten Leistungsschwankungen verschiedener Menschen (u.a. Eulen und Lerchen …), d.h. kein allgemeiner Stundenplan kann diese aus rein organisatorischen Gründen berücksichtigen.
Sie müssen sich auf vorgegebene Rhythmen in Stundenplänen und Vorlesungszeiten einerseits einstellen. Der Körper stellt sich bei Regelmäßigkeit auch um. Das können Sie nutzen. Wenn Sie viele Freiräume zur Gestaltung Ihres Tagesrhythmus besitzen, sollten Sie regelmäßige und feststehende Lern- und Pausenzeiten festlegen. Sie bestimmen Ihren Rhythmus selbst und nicht der Rhythmus Sie. So schöpfen Sie Ihre Leistungsmöglichkeiten besser aus.
Pausen fest einplanen und einhalten!
Nach schwerer Arbeit brauchen Sie generell angemessene Pausen. Viele Studenten lernen täglich zehn oder mehr Stunden und erzielen in Relation dazu minimale Lerngewinne. Unsere „Lernmaschine“ Gehirn benötigt Speicher- und Verarbeitungszeiten und Wartungspausen. Pausen haben arbeitsphysiologische Wirkungen.
•
Häufige Pausen von weniger als 20 Minuten sind besonders effektiv, erfrischend und besser als wenige lange Pausen.
•
Gerade zu Beginn einer Pause ist der Erholungswert am größten.
•
Pausen sollten nicht mit Nebentätigkeiten ausgefüllt werden.
•
Die Freude auf die Pause kann einen positiven Arbeitseffekt bewirken, der bereits vor der Pause eintritt.
•
In den Pausen arbeitet unser Gehirn weiter, es knüpft Verbindungen, startet unbewusste Suchprozesse (deshalb fällt uns nach der Pause häufig plötzlich eine Lösung ein, die wir vorher nicht finden konnten).
•
Pausen werden meist als Belohnung erlebt. Dadurch wirken sie verstärkend auf unser weiteres Lernverhalten.
Nicht von ungefähr haben Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf Pausen von gewisser Dauer. Und der Arbeitgeber die Fürsorgepflicht für deren Einhaltung. Sie haben ein Recht auf Pausen und die Pflicht sie einzuplanen und einzuhalten, unabhängig vom Lernerfolg. Wahrscheinlich werden Pausen so selten fest eingehalten, weil man meint, sie sind vergeudete Zeit. Also, keine Angst vor Zeitverlust.
Nutzen Sie die verschiedenen Pausenarten im Verlaufe eines Arbeitstages!
Zur Unterstützung einer gesunden und effektiven „Pausenmoral“ können Sie verschiedene Arten von Pausen unterscheiden. Alle wollen mit gutem Gefühl ausprobiert und genossen werden. Entwickeln Sie Ihre persönliche, vielleicht „etwas andere“ Pausenstrategie. Sie werden feststellen, dass Sie konzentrierter und effektiver arbeiten können. Allerdings ist ein wenig Vorsicht geboten, wenn Sie Pausen zur „Lernvermeidung“ nutzen.
•
Die Abspeicherpause (Augen zu) von 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration.
•
Die Umschaltpause von 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch Neues besser aufzunehmen.
•
Die Zwischenpause von 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen dient dem Erholen und Abschalten.
•
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z.B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen etc.
Ihre Mittagspause hat für Ihren Tagesrhythmus eine besondere Bedeutung!
Vor und nach dem Mittagessen sollte eine längere Erholungspause von mindestens 30 Minuten eingeplant werden, d.h. insgesamt mindestens 60 Minuten lernfreie Zeit. Ein Power Napping von ca. 20 Minuten nach dem Mittagsessen reicht oft aus. Dann ist man besonders fit. Von Arbeitsphysiologen wird der kurze und tiefe Mittagsschlaf empfohlen, womit dem Leistungstief von 13 bis 14 Uhr entgegengewirkt werden kann. Der Magen wird nach dem Mittagessen mit viel sauerstoffreichem Blut versorgt. Das fehlt ihrem Gehirn in dieser Phase also so oder so. Und durch das Nickerchen werden Aufmerksamkeit und Konzentration wieder gesteigert. Aber es sind alle Tätigkeiten erlaubt, die entspannen, schön sind, das Gehirn nicht belasten und fristgerecht beendet werden können.
Lernen am Abend ist weniger effektiv!
Das Lernen am späten Abend – also nach 22 Uhr ist wenig effektiv, da gemessen am Arbeitsaufwand weniger behalten wird. Vermeiden Sie also die Nachmittage mit Fernsehen, Verabredungen, Freizeit zu verbringen und hier viel Freizeitenergie zu investieren. Danach geistige Energie für Lernleistungen aufzubringen, fällt umso schwerer. Bei spätem Lernen schläft man erfahrungsgemäß auch schlechter und das, obwohl der nächste Tag wiederum Ihren vollen Einsatz erfordert. Seien Sie ehrlich zu sich und schauen Sie einmal, von welcher abendlichen Uhrzeit an die Lerneffektivität nachlässt.
Am Abend gut abschalten!
Planen Sie mindestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen vollkommen zum Entspannen ein. Sie können so mehr Abstand zum Lernen gewinnen und der Schlaf wird umso erholsamer sein. Andernfalls grübeln Sie weiter über Ihren Lernstoff, und Sie stehen am nächsten Morgen mit einem „Lernkater“ auf. Alkohol oder Schlafmittel beeinträchtigen die Lernarbeit im Schlaf erheblich. Nur im erholsamen Schlaf arbeitet das Gehirn gerne für Sie eigenverantwortlich weiter.
Den Schlaf als Lernorganisator nutzen!
Es ist nachgewiesen, dass sich unser Gehirn während des Schlafens nicht ausruht, der Arbeitsmodus schaltet um und das Gehirn wird zum Verwalter und Organisator des Gelernten. Das Gehirn bzw. die neuronale Aktivität sichtet, sortiert und ordnet zu, schafft Verbindungen (Synapsen) zu bereits bestehenden Wissensinhalten und verankert Gelerntes – ohne dass wir bewusst und aktiv etwas tun müssen. Diese Erkenntnisse erklären wahrscheinlich auch die lernförderlichen Wirkungen des Kurzschlafes (Power Napping) und der kurzen und tiefen Entspannung mit Hypnose.
1. TeilGrundlagen des Kommunalrechts
A.Begriff des Kommunalrechts
B.Aufbau der Verwaltung
1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts › A. Begriff des Kommunalrechts
A.Begriff des Kommunalrechts
1
Ein Tipp vorweg: Das Gesetzbuch sollte während der Lektüre des Skripts Ihr ständiger Begleiter sein. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen der Gesetzestext als primäre Rechtsquelle bietet.
Das Kommunalrecht beschäftigt sich mit den kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinde, Landkreis, Bezirk. Einschlägige gesetzliche Regelungen sind deshalb die Gemeindeordnung (GO), die Landkreisordnung (LKrO) und die Bezirksordnung (BezO). Kommunalgesetze sind Querschnittsmaterien,[1] da die Kommunalgesetze sich nicht nur mit der Organisation der Kommunen beschäftigen, sondern u.a. auch Bezüge zum Baurecht (z.B. Organe innerhalb der Bauleitplanung) und allgemeinen Sicherheitsrecht (vgl. Art. 6 LStVG die Gemeinde als Sicherheitsbehörde) aufweisen. Die Organisation und Verfassungsmäßigkeit der Kommunen ist dabei ausschließliche landesgesetzliche Kompetenz, Art. 30, 70 GG.[2]
Die Gemeinde ist z.B. dazu berufen, für ihr Gebiet Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu erlassen. Deren Rechtmäßigkeit beurteilt sich nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB). Welches Organ innerhalb der Gemeinde hierbei handeln muss, bestimmt sich hingegen nach der GO.
Anmerkungen
Lissack Bayerisches Kommunalrecht § 1 Rn. 1.
Lissack § 1 Rn. 1.
1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts › B. Aufbau der Verwaltung
B.Aufbau der Verwaltung
2
Hier gilt es zunächst zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltungsebene zu differenzieren.
1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts › B. Aufbau der Verwaltung › I. Staatsverwaltung
I.Staatsverwaltung
3
Merken Sie sich an dieser Stelle bereits, dass Gemeinden, Landkreise und Bezirke außerhalb des Freistaates Bayern stehende, eigenständige Rechtssubjekte darstellen.
Die Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in Bund und Länder, so dass ein zweistufiger Staatsaufbau festzustellen ist. Dies wird verdeutlicht in Art. 30, 70 ff. GG, sowie in Art. 28 GG. Auch die Gemeinden, die in Art. 28 Abs. 2 GG angesprochen sind, leiten damit ihre Berechtigung in der Aufgabenwahrnehmung von den Ländern ab.[1] Kommunale Selbstverwaltung ist Teil des Staates. Allerdings werden zur Aufgabenerfüllung eigene Rechtspersönlichkeiten geschaffen, nämlich Gemeinde, Landkreis und Bezirk.[2]
4
Auf der Ebene des Freistaates Bayern erfolgt eine weitere Zweiteilung. Es ist zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren Staatsverwaltung und der mittelbaren Staatsverwaltung.
Unmittelbare Staatsverwaltung kennzeichnet sich dadurch, dass der Freistaat Bayern seine ihm obliegenden Aufgaben durch eigene Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit wahrnimmt.[3]
Soweit das Landratsamt eine Baugenehmigung erteilt, handelt es nach Art. 53 Abs. 1 BayBO als untere Staatsbehörde, Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO – Kreisverwaltungsbehörde –. Da das Landratsamt insoweit eine staatliche Aufgabe wahrnimmt, handelt es für das Rechtssubjekt Freistaat Bayern.
Sofern also in der Klausur eine Behörde des Freistaates Bayern handelt (Staatsministerium, Regierung bzw. Landratsamt als Kreisverwaltungsbehörde), ist nicht die Behörde selbst, sondern stets der Freistaat Bayern zu verklagen. § 78 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2 VwGO bestimmt lediglich, dass zur Bezeichnung des Beklagten die Angabe der Behörde genügt. Davon sollte jedoch in der Klausur kein Gebrauch gemacht werden.
Von mittelbarer Staatsverwaltung spricht man dann, wenn der Staat staatliche Verwaltungsaufgaben nicht selbst durch eigene Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit wahrnimmt, sondern wenn eine verselbstständigte juristische Person des öffentlichen Rechts Zuordnungssubjekt ist.[4]
5
Da wir bereits gesehen haben, dass auch Gemeinden, Landkreise und Bezirke außerhalb der eigentlichen Staatsverwaltung stehen, ist es auch denkbar, dass diese Körperschaften Teil der mittelbaren Staatsverwaltung sind. Wir werden das beim Tätigwerden im übertragenen Wirkungskreis (Art. 8 GO) näher kennen lernen (vgl. Rn. 64).
6
Die unmittelbare Staatsverwaltung des Freistaates Bayern folgt einem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau. Oberste Landesbehörde ist nach Art. 43 Abs. 1 BV (= Verfassung des Freistaates Bayern) die bayerische Staatsregierung. Nach Art. 43 Abs. 2 BV besteht sie aus dem Ministerpräsidenten und den jeweiligen Staatsministern (bis zu 17) und den Staatssekretären.
7
Staatliche Mittelbehörden sind die sieben Bezirksregierungen. Untere staatliche Verwaltungsbehörde ist das Landratsamt (für 71 bayerische Landkreise) in seiner Funktion als Kreisverwaltungsbehörde, Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO, d.h. soweit das Landratsamt staatliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt.[5]
8
Das Verhältnis der Staatsbehörden untereinander ist in Art. 55 Nr. 5 BV beschrieben. Es gilt das uneingeschränkte Hierarchieprinzip.
Sie können sich das mit dem Vergleich zu einem Kartenspiel gut einprägen. Wie im Kartenspiel sticht der Ober den Unter, d.h. juristisch kann die höhere Staatsbehörde die rangniedrigere Staatsbehörde anweisen, für rechtswidrig erachtete Verwaltungsakte aufzuheben.
Wenn das Landratsamt z.B. eine Baugenehmigung erlässt, handelt es – wie wir bereits gesehen haben – als Staatsbehörde im Sinne von Art. 53 Abs. 1 S. 1 BayBO. Wenn nun die Regierung als ranghöhere mittlere Staatsbehörde diese Baugenehmigung wegen Verstoßes gegen die Normen des BauGB für rechtswidrig erachtet, kann die Regierung das Landratsamt anweisen, die Baugenehmigung aufzuheben. Dabei handelt es sich um einen reinen Innenrechtsakt ohne Außenwirkung. Ein Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 S. 1 BayVwVfG liegt nicht vor. Das Landratsamt kann diese Weisung auch nicht gerichtlich angreifen, da ihr im Verhältnis der Staatsbehörden untereinander eine Klagebefugnis aus § 42 Abs. 2 VwGO fehlt.
[Bild vergrößern]
9
Wesensmerkmal der unmittelbaren Staatsverwaltung ist, dass die Aufgabenwahrnehmung durch Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit erfolgt.[6] Handelt eine Staatsbehörde der unmittelbaren Staatsverwaltung, ist stets der Freistaat Bayern als dahinter stehendes Rechtssubjekt zu verklagen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).
10
Die mittelbare Staatsverwaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass die von den Ländern zu erfüllende Aufgabe hier durch einen von der staatlichen (unmittelbaren) Behörde zu unterscheidenden selbstständigen Rechtsträger erfüllt wird.[7] Neben den Freistaat Bayern tritt damit ein weiteres selbstständiges Rechtssubjekt (Körperschaft bzw. Anstalt). Dies können u.a. Gemeinden, Landkreise und Bezirke (Gebietskörperschaften) sein, die in Bayern die kommunale Verwaltungsebene darstellen.
1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts › B. Aufbau der Verwaltung › II. Kommunale Verwaltungsebene
II.Kommunale Verwaltungsebene
11
Gemeinden, Landkreise und Bezirke lassen sich als Körperschaft begreifen (vgl. hierzu z.B. Art. 15 Abs. 1 S. 1 GO, wonach Gemeindeangehörige alle Gemeindeeinwohner sind). Ausgehend von Art. 1 GO bzw. Art. 1 LKrO, Art. 1 BezO handelt es sich bei Gemeinden, Landkreisen und Bezirken um sog. Gebietskörperschaften. Die Körperschaft wird hier gebietsmäßig (territorial) erfasst und mit Hoheitsbefugnissen gegenüber den sich in diesem Gebiet befindlichen Personen ausgestattet.
Beachten Sie an dieser Stelle bereits, dass durch die Tatsache, dass Gemeinden, Landkreise und Bezirke eigene Körperschaften außerhalb der Staatsverwaltung darstellen, ein Rechtsinstitut wie die Aufsicht des Staates über die Gebietskörperschaften (z.B. Art. 108 ff. GO) erst ermöglicht wird.
[Bild vergrößern]
12
Kennzeichen jeder Gebietskörperschaft ist, dass ein eigenständiger Rechtsträger zur Aufgabenerfüllung neben dem Freistaat Bayern geschaffen wird. Dieser selbstständige Rechtsträger (Gemeinde, Landkreis, Bezirk) ist mit Organen ausgestattet (vgl. z.B. Art. 29, 37 GO) und wird mit Wirkungskreisen (z.B. Art. 6 Abs. 2, 7, 8 GO) versehen.[8] Infolge der Tatsache, dass ein eigenständiger Rechtsträger zur Aufgabenerfüllung geschaffen wird, ist die Gebietskörperschaft selbst im Verwaltungsprozess zu verklagen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).[9]
13
Gebietskörperschaften sind rechtsfähige juristische Personen des öffentlichen Rechts. Als solche können sie Eigentum erwerben, im Rechtsverkehr rechtserheblich handeln, klagen und verklagt werden. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie geschäftsfähig sind, d.h. sie haben die Möglichkeit, Willenserklärungen abzugeben oder auch Verträge zu schließen.
Schließlich können sie in einem Verwaltungsrechtsstreit Kläger, Beklagter oder Beigeladener sein, § 61 Nr. 1 Alt. 2 VwGO(Beteiligtenfähigkeit).
14
Bei der Prozessfähigkeit der Gebietskörperschaften ist zu beachten, dass diese zwingend über ihre jeweiligen Organe handeln müssen, § 62 Abs. 3 VwGO.
Die Beteiligten- und Prozessfähigkeit sollten Sie in jeder Klausur ansprechen, in der eine Gebietskörperschaft klagt bzw. verklagt wird. Prägen Sie sich die maßgeblichen Normen der §§ 61 Nr. 1 Alt. 2, 62 Abs. 3 VwGO gut ein.
15
Auch die kommunale Verwaltungsebene weist einen dreigliedrigen Aufbau auf.[10] Zum weiteren Verständnis der kommunalen Verwaltungsebene ist es sachgerecht, zwischen der örtlichen Ebene der Gemeinden und der überörtlichen Ebene der Landkreise und Bezirke zu differenzieren.
1.Gemeinden
16
Unterste Einheit zur Wahrnehmung sämtlicher örtlicher Aufgaben ist die Gemeinde. Nach Art. 1 GO ist die Gemeinde eine ursprüngliche Gebietskörperschaft mit dem Recht, alle örtlichen Angelegenheiten zu ordnen und zu verwalten.
Die Gemeinde ist als ursprüngliche Körperschaft damit z.B. zuständig für ihre Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, für ihre Sport- und Freizeitanlagen, für ihre kulturellen Einrichtungen, etc.
17
Die Gemeinden lassen sich weiter unterscheiden in kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte. Die Große Kreisstadt stellt einen Sonderfall einer kreisangehörigen Gemeinde dar. Das keiner bayerischen Gemeinde zugewiesene Gebiet ist gemeindefrei (Art. 10a Abs. 1 GO).
a)Kreisangehörige Gemeinden
18
Art. 5 Abs. 1 GO bestimmt zunächst, dass die Gemeinden kreisangehörig oder kreisfrei sind.
19
Die größte Zahl der bayerischen Gemeinden ist kreisangehörig. Dies entspricht der Grundform der ursprünglichen Gebietskörperschaft. Die historische Bezeichnung Markt, Stadt, Art. 3 Abs. 1 GO, ist für die Differenzierung irrelevant. Kreisangehörige Gemeinden haben wie kreisfreie Gemeinden dieselbe Aufteilung in Wirkungskreise (eigener und übertragener, vgl. Art. 6 Abs. 2 GO), dieselbe Verfassung sowie dieselben Organe (allerdings mit zum Teil unterschiedlicher Bezeichnung). Unterschiede liegen im Umfang und der Art der wahrzunehmenden Aufgaben (Zusammensetzung der jeweiligen Wirkungskreise, Art. 6 Abs. 2 GO) und in der Staatsaufsicht (Art. 108 ff. GO).[11]
Prägen Sie sich an dieser Stelle bereits ein, dass das Aufgabenspektrum zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden variiert, und dass diese Frage bedeutsam ist für den klausurrelevanten Bereich der „Kommunalaufsicht“.
b)Kreisfreie Stadt
20
Maßgebliche Bestimmung ist hier Art. 9 Abs. 1 GO. Dieser stellt die kreisfreie Gemeinde auf eine Stufe mit den Landkreisen.
Es existiert insoweit für das Stadtgebiet der kreisfreien Stadt kein Landratsamt als Staats- oder Kreisbehörde.[12]
Dies hat Auswirkungen auf den Aufgabenumfang der kreisfreien Stadt. Nach Art. 9 Abs. 1 GO muss die kreisfreie Stadt Aufgaben von (fehlendem) Landkreis (als Gebietskörperschaft) und Landratsamt (als unterer Staatsbehörde) erfüllen.[13]
21
Die Kreisfreiheit äußert sich auf folgenden Gebieten:[14]
•
Bezeichnung der Organe, Art. 34 Abs. 1 S. 2 GO
•
Aufgabenumfang, Art. 9 Abs. 1 GO
•
Personelle Ausstattung, Art. 42 Abs. 2 GO
•
Regelungen der Kommunalaufsicht, Art. 110 S. 2, 115 GO
Während bei einer kreisangehörigen Gemeinde für Bauangelegenheiten nach Art. 53 Abs. 1 BayBO regelmäßig (Ausnahme nur die Große Kreisstadt und gewisse besonders leistungsfähige kreisangehörige Gemeinden, § 5 Abs. 1 ZustVBau) das Landratsamt als Staatsbehörde zuständig ist, Art. 53 Abs. 1 BayBO, ist die kreisfreie Stadt selbst zur Entscheidung in Bausachen berufen, Art. 9 Abs. 1 GO, Art. 54 Abs. 1 BayBO. Da es sich eigentlich um eine staatliche Angelegenheit handelt, wird die kreisfreie Stadt insoweit im übertragenen Wirkungskreis tätig.
22
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kreisfreie Gemeinde Verwaltungsaufgaben zweier Ebenen zu erfüllen hat. Sie berührt sowohl die örtliche als auch die überörtliche Verwaltungsebene. Da insofern kein Landratsamt existiert, muss die Aufsicht über die kreisfreie Stadt bei der Regierung als Staatsbehörde angesiedelt sein, Art. 110 S. 2 GO.
c)Sonderfall der Großen Kreisstadt
23
Einen Sonderstatus nimmt im System der Gemeinden die Große Kreisstadt ein.
Für ihr Gebiet existiert daher anders als bei der kreisfreien Stadt ein Landratsamt, das als Behörde Staats- und Kreisaufgaben wahrnehmen kann.
Da das Gesetz in Art. 5 Abs. 1 GO nur zwei grundsätzliche Gemeindetypen schafft (kreisangehörig, kreisfrei), ist die Große Kreisstadt ein Sonderfall einer kreisangehörigen Gemeinde.[15]
24
In ihrer Stellung sind Große Kreisstädte zwischen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten angesiedelt. Ihre Besonderheit liegt darin, dass die Große Kreisstadt einzelne Aufgaben des Landratsamtes als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO) wahrnimmt. Diese Aufgaben sind in der Verordnung über Aufgaben der Großen Kreisstädte – GrKrV[16] abschließend enthalten. Trotz Bestehen eines Landratsamtes als Staatsbehörde werden diese Aufgaben gesetzlich an die Große Kreisstadt delegiert.
Für einen Bauantrag im Gemeindegebiet einer Großen Kreisstadt ist diese nach Art. 9 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrKrV zuständig. Sie wird insoweit gleichfalls im übertragenen Wirkungskreis tätig, Art. 54 Abs. 1 Hs. 2 BayBO. Dies ist insofern wiederum konsequent, als Bauangelegenheiten grundsätzlich Aufgabe des Staates sind, Art. 54 Abs. 1 Hs. 1 BayBO. Wenn der Bauherr gegen die Versagung der Baugenehmigung klagen will, muss er gegen die Große Kreisstadt selbst klagen, da diese auch im übertragenen Wirkungskreis ihr eigener Rechtsträger ist.
Besonders klausurrelevant sind an dieser Stelle die Aufgaben der Großen Kreisstadt aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 (Bauaufsicht) und § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrKrV (eingeschränkte Aufgaben als Wasserrechtsbehörde).
Denken Sie beim Handeln einer Großen Kreisstadt in Klausuren immer an die Problempunkte „Wirkungskreise“ und „Passivlegitimation“, § 78 Abs. 1 VwGO. Prägen Sie sich daneben ein, dass die Große Kreisstadt eine kreisangehörige Gemeinde ist.
25
Weitere Besonderheit ist die Staatsaufsicht über die Große Kreisstadt. Der Sonderfall ist hierbei in Art. 115 Abs. 2 GO geregelt (Näheres dazu unten Rn. 284).[17]
d)Gemeindefreies Gebiet
26
Neben der Aufteilung des Staatsgebietes in Gemeindetypen gibt es Bereiche, die keiner Gemeinde zugewiesen sind. Dieses gemeindefreie Gebiet regelt sich über Art. 10a GO. Hinzuweisen ist hier insbesondere auf Art. 10a Abs. 5 GO, wonach die Hoheitsbefugnisse im gemeindefreien Gebiet vom Landratsamt als Staatsbehörde wahrgenommen werden. Nach Art. 7 LKrO ist das gemeindefreie Gebiet Teil eines Landkreises.
2.Landkreise und Bezirke
27
Für die Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben (d.h. diejenigen, die das Gemeindegebiet übersteigen) hat der Gesetzgeber zwei weitere vom Freistaat Bayern getrennte rechtlich selbstständige Einheiten geschaffen. Zunächst die Landkreise als Gebietskörperschaften (Art. 1 LKrO) sowie die Bezirke als höchste Stufe der kommunalen Verwaltungsebene. In der Bayerischen Verfassung werden Landkreise und Bezirke in Art. 10 BV unter dem Begriff der Gemeindeverbände angesprochen.[18]
Landkreis und Bezirk sind jeweils Gebietskörperschaften, denen als überörtliche Verwaltungsträger diejenigen Aufgaben obliegen, die nicht oder nicht mehr von den Gemeinden als örtliche Verwaltungsträger wahrgenommen werden (können).[19]
28
Die Aufgaben werden den Gemeindeverbänden dabei gesetzlich zugewiesen, während die Gemeinden einen universalen, allzuständigen örtlichen Aufgabenbereich aufweisen. Da der Landkreis als mittlere Stufe der kommunalen Verwaltungsebene (mittelbare Staatsverwaltung) auch das Landratsamt als Verwaltungsbehörde (staatlich, Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO) kennt, zeigt sich hier besonders deutlich die Verzahnung kommunaler und staatlicher Verwaltung. Nach Art. 37 Abs. 1 LKrO ist das Landratsamt sowohl Kreisbehörde (für den Landkreis als Gebietskörperschaft) als auch in seiner Funktion als Kreisverwaltungsbehörde unterste staatliche Verwaltungsbehörde. Hierin ist die Doppelfunktion des Landratsamtes angelegt.[20]
Beachten Sie aber an dieser Stelle bereits, dass anders als bei Staatsbehörden den Landkreisen und Bezirken kein Weisungsrecht gegenüber den Gemeinden zukommt. Die jeweiligen Aufgaben der Gebietskörperschaften grenzen sich nach ihrer Örtlichkeit/Überörtlichkeit ab. Ein Art. 55 BV vergleichbares Hierarchieverhältnis ist hier nicht existent.
3.Das Verhältnis zwischen der Staatsverwaltung und der kommunalen Verwaltungsebene
29
Das Rechtsinstitut, das die staatliche Verwaltungsebene mit der kommunalen verknüpft, ist die in Art. 83 Abs. 4, 6 BV angesprochene Staatsaufsicht. Diese ist Korrelat zur gemeindlichen kommunalen Selbstverwaltung. Je mehr Raum die Verfassung in Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV der kommunalen Selbstverwaltung einräumt, umso eher bedarf die Art der kommunalen Aufgabenerfüllung der staatlichen Kontrolle.
a)Doppelfunktion des Landratsamts
30
Ausgehend von Art. 37 Abs. 1 LKrO ist das Landratsamt sowohl Behörde des Staates (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO), als auch Behörde der Gebietskörperschaft Landkreis (Art. 37 Abs. 1 S. 1 LKrO).
31
Deutlich wird diese Zweiteilung auch in Art. 37 Abs. 6 LKrO, wonach der Landrat beim Vollzug einer reinen Staatsaufgabe als Organ des Staates tätig wird und insofern staatlicher Weisung untersteht (Art. 55 Nr. 5 BV; Hierarchieprinzip). Ebenfalls bestimmt Art. 35 Abs. 3 S. 1 LKrO, dass in Fällen, in denen der Landrat eine ihm gegenüber einem anderen obliegende Amtspflicht verletzt, der Staat haftet, wenn es sich um eine reine Staatsangelegenheit handelt (Funktionstheorie). Im Übrigen haftet der Landkreis (Art. 35 Abs. 3 S. 2 LKrO).
[Bild vergrößern]
b)Richtiger Beklagter in der verwaltungsgerichtlichen Klausur
32
Auswirkungen hat diese Doppelfunktion auch für die Bestimmung der Passivlegitimation in Klagefällen. Steht eine Aufgabe im Mittelpunkt, die gesetzlich eine Staatsaufgabe ist – das Gesetz verwendet hier regelmäßig den Passus „Kreisverwaltungsbehörde“ – so ist die Zurechnung der Rechtsträgerschaft, § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO an den Freistaat Bayern vorzunehmen. Er ist das Rechtssubjekt, welches hinter der Staatsbehörde, die selbst keine Rechtssubjektsqualität besitzt, steht. Handelt das Landratsamt dagegen als Kreisbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 1 LKrO) – das Gesetz spricht hier nun im Regelfall vom „Landkreis“ und nimmt eine weitere Differenzierung nach Wirkungskreisen vor – so muss die Zurechnung an die Gebietskörperschaft, sprich den Landkreis selbst erfolgen.
Soweit das Landratsamt im Gemeindegebiet einer kreisangehörigen Gemeinde (keine Große Kreisstadt!) eine Baugenehmigung erteilt, handelt es als Kreisverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO. Es liegt nach Art. 53 Abs. 1 S. 1 BayBO ein Tätigwerden einer Staatsbehörde vor. Bei Versagung der Baugenehmigung ist in diesen Fällen der Freistaat Bayern mittels einer Verpflichtungsklage in Gestalt der Versagungsgegenklage (§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO) zu verklagen. Anders ist es, wenn der Landkreis zum Beispiel einen Müllgebührenbescheid erlässt. In diesen Fällen ist nach Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayAbfG[21] der Landkreis zum Handeln aufgerufen. Dieser wird dabei nach Art. 3 Abs. 1 S. 2 BayAbfG im eigenen Wirkungskreis tätig.
Zuordnung von Aufgaben des Landratsamts/Landkreises
Bauaufsicht
LRA, staatlich,Art. 53 Abs. 1, 54 Abs. 1 BayBO
Wohngeld
Landkreis, übertragener WK,Art. 6 LKrO i.V.m. § 1 Abs. 1 VO Z/T 965
Kreisstraßenbau
Landkreis, eigener WK,Art. 5 LKrO, Art. 58 Abs. 2 Nr. 2, 41 S. 1 Nr. 2 BayStrWG
Rettungsdienst
Landkreis, übertragener WK,Art. 6 LKrO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 BayRDG
Kommunalaufsicht
LRA, staatlich,Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO
Gewässeraufsicht
LRA, staatlich,
Art. 63 Abs. 1 S. 1 und 2 BayWG
Abfallbeseitigung
Landkreis, eigener WK,Art. 5 LKrO i.V.m. Art. 3 Abs. 1 S. 1, 2 BayAbfG
Katastrophenhilfe
Landkreis, übertragener WK,Art. 6 LKrO i.V.m. Art. 7 Abs. 3 Nr. 2 BayKSG
Ausländerbehörde
LRA, staatlich,§ 71 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 1 S. 1 Nr. 1 ZustVAuslR
Sicherheitsbehörde
Landkreis, übertragener WK bei VO Art. 42 Abs. 1 S. 2 LStVG/LRA, staatlich bei VA, Art. 6 LStVG
Straßenverkehrsbehörde
LRA, staatlich,§ 4 Abs. 1 ZustVVerK
Jagdbehörde
LRA, staatlich,Art. 49 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 3 BayJagdG
Krankenhäuser
Landkreis, eigener WK,Art. 5 i.V.m. Art. 51 Abs. 1, 3 S. 1 Nr. 1 LKrO
Naturschutzbehörde
LRA, staatlich,Art. 43 Abs. 2 Nr.3 BayNatSchG
Widerspruchsbehörde
LRA, staatlich,Art. 119, 110 GO
Genehmigung nach BImSchG
LRA, staatlich,Art. 1 Nr. 3 BayImSchG
Aufgrund dieser Doppelfunktion müssen Sie beim Handeln des Landratsamtes in der Klausur stets differenzieren:Hat das Landratsamt als Staatsbehörde gehandelt (das Gesetz verwendet hier den Terminus Kreisverwaltungsbehörde aus Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO), müssen Sie im Rahmen von § 78 Abs. 1 VwGO den Freistaat Bayern verklagen.Hat das Landratsamt hingegen als Kreisbehörde gehandelt, so ist die Gebietskörperschaft Landkreis zu verklagen.Bei Gemeinden und Bezirken stellt sich diese Abgrenzungsfrage nicht. Gemeinden und Bezirke sind stets ausschließlich ihre eigenen Rechtsträger; eine Überschneidung mit der Verwaltungsebene des Freistaates Bayern findet insoweit nicht statt.
Beachten Sie an dieser Stelle, dass sofern das Landratsamt als Staatsbehörde handlungszuständig ist, es in der Klausur keine Wirkungskreise zu diskutieren gibt und auch keine Organe wie bei Gebietskörperschaften anzusprechen sind. Eine Trennung in Verbands- und Organkompetenz hat in der Klausur zwingend zu unterbleiben.
33
Hat in der Klausur hingegen nicht das Landratsamt gehandelt, sondern eine Gemeinde bzw. ein Bezirk, so ist stets in der Klausur die betreffende Gemeinde bzw. der betreffende Bezirk zu verklagen. Gemeinden (unabhängig vom Typus kreisangehörig oder kreisfrei) haben keine Doppelfunktion. Sie sind niemals Staatsbehörde, sondern ausschließlich Gebietskörperschaft und als solche im Verwaltungsprozess zu verklagen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).
Prägen Sie sich besonders gut ein, dass es eine Doppelfunktion nur beim Landratsamt/Landkreis gibt. Eine Gemeinde bleibt stets ein außerhalb der bayerischen Staatsverwaltung stehender Rechtsträger, der als solcher von Ihnen in der Klausur zu verklagen ist.
Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen. Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite.
Anmerkungen
Vgl. Knemeyer Bayerisches Kommunalrecht 1. Kap. Rn. 4.
Vgl. Lissack § 1 Rn. 54; Prinzip der Dezentralisation.
Vgl. zum Ganzen: Lissack § 1 Rn. 47 ff.
Lissack § 1 Rn. 49.
Vgl. Übersicht in Knemeyer 1. Kap. Rn. 39 (Anhang 1).
Sehr lehrreich in diesem Zusammenhang: BVerfG BVerfGE 79, 127 ff. „Rastede“.
Lissack § 1 Rn. 49; Gern Deutsches Kommunalrecht Rn. 119.
Vgl. Lissack § 1 Rn. 37, 67, 74, § 2 Rn. 1 ff.
Lissack § 1 Rn. 17.
Lissack § 1 Rn. 20.
Lissack § 1 Rn. 22 ff.
Knemeyer 2. Kap. Rn. 50.
Knemeyer 2. Kap. Rn. 51.
Vgl. Knemeyer 2. Kap. Rn. 51.
Knemeyer 2. Kap. Rn. 49; Lissack § 1 Rn. 22, 24.
Ziegler/Tremel Nr. 284.
Knemeyer 2. Kap. Rn. 49, 53.
Vgl. zum Ganzen: Knemeyer 2. Kap. Rn. 58, 64.
Knemeyer 2. Kap. Rn. 56, 58.
Lissack § 2 Rn. 36 ff.
Ziegler/Tremel Nr. 1.
2. TeilVerfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften
A.Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften
B.Selbstverwaltungsrecht
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › A. Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften
A.Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften
34
Die Frage der Grundrechtsfähigkeit einer Gebietskörperschaft (Gemeinde, Landkreis, Bezirk) wird zwischen dem BVerfG und dem BayVerfGH kontrovers diskutiert.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › A. Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften › I. Auf der Ebene des Grundgesetzes
I.Auf der Ebene des Grundgesetzes
35
Das Grundgesetz schließt mit der Bestimmung in Art. 19 Abs. 3 GG nicht aus, dass inländische juristische Personen in den Schutzbereich von Grundrechten einbezogen werden können. Damit ist es rechtstheoretisch denkbar, dass auch die Gebietskörperschaft als juristische Person des öffentlichen Rechts in den Schutzbereich einzelner Grundrechtsbestimmungen fallen kann. Unbestritten ist dies für die Fälle, in denen ein Grundrecht eine juristische Person des öffentlichen Rechts positiv als Grundrechtsträger normiert. Dies ist der Fall für die Kirchen in Art. 4 GG, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Art. 5 Abs. 1 GG sowie die Universitäten in Art. 5 Abs. 3 GG.[1]
36
Außerhalb dieser Fälle hat das Bundesverfassungsgericht die Grundrechtsfähigkeit der Gemeinde generell ausgeschlossen und festgestellt, dass dies sowohl für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben wie auch bei Wahrnehmung privater Rechtsangelegenheiten gelte. Begründet wird dies damit, dass die Gebietskörperschaft nach Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GGGrundrechtsverpflichtete ist, die nicht gleichzeitig Grundrechtsträger sein kann (Identitätsargument). Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Die Gebietskörperschaft ist aber Teil mittelbarer Staatsverwaltung und befindet sich damit in keiner grundrechtstypischen Gefährdungslage.[2]
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › A. Die Grundrechtsfähigkeit der Gebietskörperschaften › II. Auf der Ebene der Bayerischen Verfassung
II.Auf der Ebene der Bayerischen Verfassung
37
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof[3] stellt hingegen im jeweiligen Einzelfall darauf ab, ob sich die auf Grundrechte berufende Gemeinde in einer konkreten „Schutzsituation“ befindet (vergleichbar der grundrechtstypischen Gefährdungslage). Allein aus der Tatsache, dass die Gemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts öffentliche Aufgaben wahrnehmen und in die (mittelbare) staatliche Verwaltungsorganisation eingebunden sind, kann nicht geschlossen werden, dass die Gemeinden generell vom Grundrechtsschutz ausgenommen sind. Auch die Gemeinde kann sich in einer dem Bürger vergleichbaren Situation befinden. Anerkannt hat der BayVerfGH dies regelmäßig für Art. 118 BV (Willkürverbot) und Art. 103 Abs. 1 BV (bei erwerbswirtschaftlichem Handeln der Gemeinde).
Anmerkungen
BVerfG BVerfGE 31, 314 ff.; 18, 395 ff.; 75, 192 ff.; Bauer/Böhle/Ecker Art. 1 Rn. 13.
BVerfG BVerfGE 39, 302 ff.; 61, 82 ff.; BVerfG DVBl 1987, 844, BayVBl. 1988, 400.
BayVerfGH BayVerfGHE 29, 105 ff.; BayVerfGH BayVBl. 1984, 655.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht
B.Selbstverwaltungsrecht
38
Unstreitig ist, dass die Gebietskörperschaft Gemeinde sich auf ihr Recht aus Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV – kommunale Selbstverwaltung – berufen und insoweit Grundrechtsschutz beanspruchen kann (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, Art. 98 S. 4 BV).[1] Durch Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG ist den Gemeinden das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Für die Gemeindeverbände (Landkreise, Bezirke) gilt dieses Recht auf Selbstverwaltung innerhalb der Gesetze nur im Rahmen ihres gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereichs (Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG).
Denken Sie in Klausuren, in denen eine Gemeinde klagt, bei der Klagebefugnis immer an eine mögliche Verletzung des Rechts zur kommunalen Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV. Häufig ist eine derartige Konstellation im Bereich der Kommunalaufsicht zu finden.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › I. Begriff der Selbstverwaltungsgarantie der kommunalen Gebietskörperschaft
I.Begriff der Selbstverwaltungsgarantie der kommunalen Gebietskörperschaft
39
Art. 1 GO bestimmt, dass die Gemeinde eine ursprüngliche Gebietskörperschaft ist, mit dem Recht, die örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze zu ordnen und zu verwalten. Ähnliche Regelungen treffen Art. 1 LKrO, Art. 1 BezO in Bezug auf die überörtlichen Angelegenheiten, die durch Bezirk und Landkreis wahrzunehmen sind. Bei der Ausgestaltung der Rechtsstellung von Gebietskörperschaften sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 11 Abs. 2 BV zu beachten. Von überragender Bedeutung ist dabei für das Verständnis des Wesens der Gebietskörperschaften die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG. Danach muss insbesondere den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Gemäß Art. 11 Abs. 2 S. 2 BV haben die Gemeinden das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten, insbesondere ihre Bürgermeister und Vertretungskörper (Organe) zu wählen. Die örtliche Gemeinschaft soll nach dem Leitbild des Art. 28 Abs. 2 GG ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und in eigener Verantwortung solidarisch gestalten.[2]
Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften, im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner zu regeln und zu gestalten.
40
Damit ist das Selbstverwaltungsrecht funktional zu bestimmen als das durch Grundgesetz und durch die bayerische Verfassung geschützte Recht auf selbstständige, vom Staat unabhängige Regelung der eigenen Angelegenheiten im eigenen Namen, nach eigenem Ermessen, mit eigenem Personal und mit eigenen Finanz- und Wirtschaftsmitteln.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › II. Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden
II.Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden
41
Kennzeichen der kommunalen Selbstverwaltung ist, dass der Selbstverwaltungsträger frei in seiner Entscheidung des „Ob“, „Wann“ und „Wie“ der Aufgabenerfüllung ist.
Art. 83 Abs. 1 BV bestimmt exemplarisch Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinde fallen.[3]
Im Kernbereich bedeutet kommunale Selbstverwaltung für die Gemeinde (fünf Säulen)[4]:
1.
Gebietshoheit: Die Gemeinde hat im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung das Recht, gegenüber allen Personen und Sachen, die sich auf ihrem Territorium befinden, rechtserheblich zu handeln.[5] Dies kann durch Einzelfallmaßnahmen (Verwaltungsakt, Art. 35 BayVwVfG) geschehen oder durch Rechtsetzungsakt (im eigenen Wirkungskreis Satzung; sog. Rechtsetzungshoheit).
2.
Finanzhoheit: Die Gemeinde hat das Recht auf eine eigenverantwortliche Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft, sowie auf eine angemessene Finanzausstattung.[6] An dieser Stelle ist auf das Recht, Abgaben im Rahmen der Gesetze zu erheben, zu verweisen, Art. 1 ff. KAG(Abgabenhoheit).
3.
Personalhoheit: Die Gemeinde ist Dienstherr von Beamten und hat generell das Recht, Personal auszuwählen, anzustellen, zu befördern und zu entlassen.[7]
4.
Organisationshoheit: Die Gemeinde hat die Befugnis, für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten festzulegen. Die Gemeinde darf hierzu auch öffentliche Einrichtungen schaffen und deren Organisation festlegen.[8]
5.
Planungshoheit: Die Gemeinde hat nach § 2 Abs. 1 BauGB das Recht, in eigener Verantwortung die Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) aufzustellen.[9]
[Bild vergrößern]
42
Diese fünf wesentlichen Hoheitsrechte der Gemeinde stellen nach dem Bundesverfassungsgericht den Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung dar.[10] Der Bayerische Verfassungsgerichtshof verweist an dieser Stelle auf Art. 83 Abs. 1 BV und verlangt zur Wahrung der Garantie kommunaler Selbstverwaltung, dass keiner der in Art. 83 Abs. 1 BV bezeichneten Bereiche des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde entzogen wird.[11]
Beachten Sie, dass, sofern sich die Gemeinde gegen eine sie belastende staatliche Maßnahme wendet (z.B. aufsichtlicher Bescheid), sie regelmäßig eine Klagebefugnis nur aus einer möglichen Verletzung ihres Rechtes auf kommunale Selbstverwaltung ableiten kann. Bei dieser Prüfung helfen Ihnen die dargelegten fünf Säulen/Kernbereiche der Selbstverwaltung.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › III. Institutionelle Rechtssubjektsgarantie
III.Institutionelle Rechtssubjektsgarantie
43
Weiter gilt es zu beachten, dass die Gemeinden die ihr durch Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 S. 2 BV zugewiesenen Aufgaben nur dann sachgerecht erfüllen können, wenn überhaupt Selbstverwaltungskörperschaften existieren. Insoweit beinhalten Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 11 Abs. 2 BV eine institutionelle Rechtssubjektsgarantie bezüglich der Gemeinden und Gemeindeverbände.[12]
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › IV. Allzuständigkeit der Gemeinde
IV.Allzuständigkeit der Gemeinde
44
Charakteristisch für die kommunale Selbstverwaltung ist damit die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung. Die Gemeinde entscheidet deshalb als Ausfluss von Art. 28 Abs. 2 GG regelmäßig frei über das Ob, Wann und Wie der Aufgabenerfüllung.[13] Hinsichtlich der Gemeinde ist weiter festzustellen, dass der Ansatz ein universaler ist. Die Gemeinde hat nämlich anders als Landkreis und Bezirk (die nur die Aufgaben in Selbstverwaltung erfüllen, die ihnen gesetzlich zugewiesen sind, Art. 10 Abs. 1, Abs. 2 BV) sämtliche Angelegenheiten wahrzunehmen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln bzw. einen spezifischen Bezug zur Ortsgemeinschaft aufweisen.[14]
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeindeeinwohnern als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben der Menschen in der Gemeinde betreffen.
Denken Sie daran, dass bei Gemeinden von Ihnen in der Klausur stets erwartet wird, im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung darzulegen, warum die Angelegenheit eine örtliche ist. Bei Landkreisen und Bezirken haben Sie es insofern einfacher, da deren Aufgaben sämtlich qua Gesetz zugewiesen sind.
45
Das Gesetz stellt damit in Art. 1 GO die im Einzelfall widerlegbare Vermutung auf, dass die Gemeinde für die Wahrnehmung einer als örtlich zu qualifizierenden Aufgabe verbandskompetent ist.[15] Da eine Gebietskörperschaft nicht handlungsfähig ist, ist weiter in Klausuren darauf zu achten, beim Handeln einer Gemeinde im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit zwingend zwischen Verbands- und Organkompetenz zu unterscheiden.
46
Der Kreis der örtlichen Angelegenheiten ist offen und nicht für alle Zeit feststehend. Er variiert auch von Gemeinde zu Gemeinde.[16] Die Aufgabe besteht darin, im konkreten Einzelfall festzustellen, ob die Angelegenheit örtlich oder überörtlich ist. Hiervon hängt ab, ob die Gemeinde als unterste Stufe der Gebietskörperschaften überhaupt zu deren Bewältigung aufgerufen ist. Relevant wird diese Frage überdies bei der Bestimmung des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde (vgl. Art. 7 Abs. 1 GO). In Art. 7 Abs. 1 GO ist normiert, dass der eigene Wirkungskreis der Gemeinde alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft umfasst.
Wenn es in der Gemeinde zum Absturz von Gesteinsbrocken aus einer in der Mitte des Ortes aufragenden Felswand kommt, ist diese Gefahr eine streng örtlich begrenzte. Die Gemeinde nimmt insoweit eine rein ortsbezogene Aufgabe wahr, nämlich die der örtlichen Gefahrenabwehr aus Art. 6 LStVG (= Landesstraf- und Verordnungsgesetz).
Anders ist dies z.B. bei einer Maßnahme gegenüber einem frei laufenden Kampfhund. Da dieser sich auch außerhalb des Gemeindegebietes aufhalten kann und die Problematik der Kampfhundehaltung eine landesweite Problematik darstellt, ist die Aufgabe überörtlich. Da jedoch Landkreis und Bezirk in Art. 6 LStVG nicht genannt sind, ist die Gemeinde auch zur überörtlichen Gefahrenabwehr berufen.
Denken Sie an dieser Stelle nochmals an das Kommunalrecht als Querschnittsmaterie. Insbesondere in sicherheitsrechtlichen Klausuren ist es erforderlich zwischen örtlichen und überörtlichen Angelegenheiten zu differenzieren. Davon hängt auch die Zuordnung zum jeweiligen Wirkungskreis in Art. 7, 8 GO ab. Näheres dazu später.
47
Vergessen Sie nicht, sich den Art. 83 Abs. 1 BV neben Art. 57 GO zu kommentieren. In der Bayerischen Verfassung sind hier weitere Regelungsgegenstände der örtlichen Kommunalverwaltung genannt.
Zur Lösung der entscheidenden Frage, ob eine örtliche/überörtliche Angelegenheit in Streit steht, helfen nun die Bestimmungen in Art. 57 Abs. 1, Abs. 2 GO und Art. 83 Abs. 1 BV. So enthält Art. 83 Abs. 1 BV eine exemplarische, nicht abschließende Aufzählung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft.[17] Ergänzend zu Art. 83 Abs. 1 BV wird regelmäßig die vom Bundesverfassungsgericht gewählte Formulierung der örtlichen Angelegenheit herangezogen.
48
Indizielle Bedeutung für die Frage, ob eine Angelegenheit als örtlich/überörtlich zu[18] qualifizieren ist, hat daneben die Größe und Struktur der jeweiligen Gemeinde. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist die Verwaltungskraft (praktische Bewältigbarkeit der Aufgaben) der Gemeinde nicht zu berücksichtigen, da ansonsten der Staat die Finanzausstattung der Gemeinde erhöhen könnte, um so deren Aufgabenspektrum zu erweitern.[19]
49
Sofern Schwierigkeiten bestehen, eine Aufgabe als örtliche oder überörtliche zu qualifizieren, ist der Schwerpunkt der Maßnahme zu ermitteln.[20] Kann ein solcher nicht festgestellt werden, spricht Art. 6 Abs. 1 S. 1 GO für die Vermutung einer örtlichen Angelegenheit (aber nur, sofern gesetzlich keine andere Aufgabenzuweisung ausgesprochen ist).[21]
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › V. Zuständigkeiten von Landkreis und Bezirk als überörtlichen kommunalen Gebietskörperschaften
V.Zuständigkeiten von Landkreis und Bezirk als überörtlichen kommunalen Gebietskörperschaften
50
Landkreis und Bezirk (Gemeindeverbände) sind Träger der überörtlichen Aufgabenwahrnehmung. Gemäß Art. 1 LKrO sind Landkreise Gebietskörperschaften mit dem Recht, überörtliche Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht über das Kreisgebiet hinausgeht, im Rahmen der Gesetze zu ordnen. Art. 1 BezO bestimmt, dass Bezirke Gebietskörperschaften mit dem Recht sind, überörtliche Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit von Landkreisen und kreisfreien Städten hinausgehen, im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten.
51
Kennzeichen der Aufgaben von Landkreis und Bezirk ist damit deren Überörtlichkeit im Verhältnis zur Gemeinde.[22] Landkreis und Bezirk sind auch keine ursprünglichen Gebietskörperschaften (vgl. unterschiedlicher Wortlaut in Art. 1 GO einerseits und Art. 1 LKrO, Art. 1 BezO andererseits). Diese Einrichtungen wurden künstlich geschaffen, um einen Rechtsträger zu bilden, der die überörtlichen Angelegenheiten bewältigen kann.[23] Folglich bestimmt auch Art. 10 Abs. 2 BV, dass der eigene Wirkungskreis der Gemeindeverbände (Landkreis, Bezirk) durch die Gesetzgebung bestimmt wird. Nur die Aufgaben die qua Gesetz an Landkreis, Bezirk zugewiesen werden, sind eigene Angelegenheiten des Landkreises bzw. Bezirks. Für die Landkreise geschieht dies z.B. über die Bestimmungen in Art. 5 Abs. 1, 51 Abs. 2, Abs. 3 LKrO.
2. Teil Verfassungsrechtliche Positionen der kommunalen Gebietskörperschaften › B. Selbstverwaltungsrecht › VI. Rechtsschutzmöglichkeiten der Gemeinde bei Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverwaltung
VI.Rechtsschutzmöglichkeiten der Gemeinde bei Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverwaltung
52
Beim Rechtsschutz der Gemeinde ist zu beachten, dass die Gemeinde sich in jeder Ausgestaltung auf das Recht kommunaler Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV berufen kann. Nur dieses Recht räumt der Gemeinde eine wehrfähige Rechtsposition bzw. Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) ein.
53