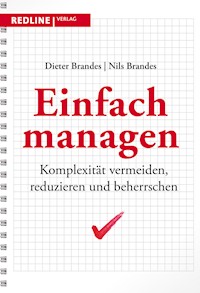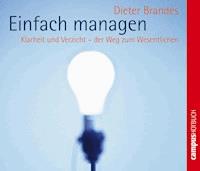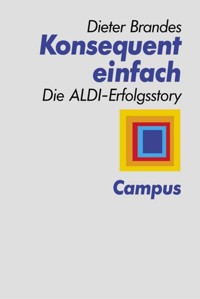
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 1999
Ein Insider gibt Einblick in das Erfolgsgeheimnis von Aldi. Anschaulich schildert Dieter Brandes, wie es den Albrecht-Brüdern mit einem ebenso einfachen wie genialen Konzept gelungen ist, den Einzelhandel in Deutschland neu zu ordnen und ihr Unternehmen für viele Verbraucher zu einem unverzichtbaren Teil der Alltagskultur zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brandes, Dieter
Konsequent einfach
Die Aldi-Erfolgsstory
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 1998. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40003-7
»Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar«
(Der Kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry)
|11|Vorwort
Gleich nach meinem Weggang bei ALDI rief mich ein Redakteur des SPIEGEL an und fragte mich, ob ich bereit sei, über ALDI zu schreiben. Ich lehnte ab, wie es sich für ALDI-Leute, die Diskretion großschreiben, gehört. Diesen kompromißlosen Verzicht auf jegliches öffentliches Auftreten, die typische ALDI-Askese, habe ich immer mitgetragen und erachte ein solches Prinzip auch heute für die überwiegende Zahl der Unternehmen als richtig. Die meisten Äußerungen und Interviews dienen der Selbstdarstellung und befriedigen vor allem die Eitelkeiten der Unternehmensleiter oder Manager. Oft dienen sie auch dazu, den Verkauf des Unternehmens vorzubereiten und dieses nur von der Schokoladenseite zu zeigen. Solche Informationen nützen nur der Konkurrenz, dem Kunden jedoch wenig – aber um den geht es doch eigentlich. Oder?
Heute, wenn das ALDI-Konzept etwa 50 Jahre alt wird und einer der beiden Unternehmensgründer, Theo Albrecht, sein 75. Lebensjahr vollendet, erscheint mir ein guter Zeitpunkt zu sein, über das »Phänomen ALDI« zu schreiben – aus der Distanz, nach einigen Jahren neuer Erfahrungen bei anderen Unternehmen und mit dem Blick für das Wesentliche. Es ist schon erstaunlich, daß es bis heute kein einziges Buch über dieses »Wunder« des Einzelhandels gibt, obwohl sich zahlreiche Wissenschaftler und Journalisten immer wieder damit befassen. Die Prinzipien der Geheimhaltung und die Loyalität der Angestellten haben verhindert, daß die Öffentlichkeit über ein |12|Gesamtbild verfügt. In den letzten Jahren allerdings sind einige Mitarbeiter zur Konkurrenz gewechselt und haben »ihre Zahlen« dabei vermutlich mitgenommen, obwohl das natürlich – wie bei jedem Unternehmen – verboten ist. Auf diese Weise, so ist anzunehmen, haben inzwischen immer mehr richtige Zahlen aus dem Hause ALDI ihren Weg in die Fachpresse gefunden und das quantitative Bild klarer werden lassen. So ist die Öffentlichkeit nicht mehr allein auf Schätzungen angewiesen. Doch im allgemeinen sind diese Zahlen strenger unter Verschluß als die Nachrichtenschlüssel der Geheimdienste, wie der Branchenkenner Hans Otto Eglau bemerkte1 , der ALDI von der Anfangszeit bis heute beobachtete.
Astrid Paprotta und Regina Schneider, die mit ihrem Buch ALDIdente2 eine kleine Hommage an ALDI verfaßt und dem Unternehmen mit ihrem Bestseller fast einen Kultstatus verliehen haben, nennen ALDI »ein seltsames Reich«. Jeder kennt es, aber kaum jemand redet darüber. Vielleicht weil es sich um ein Reich der Selbstverständlichkeiten handelt.
Es ist nicht Anliegen dieses Buches, die sozusagen letzte amtliche Statistik zur quantitativen Beschreibung von ALDI zu liefern. Ich halte dies auch für unwesentlich, obwohl immer wieder gefragt wird, wie hoch der Umsatz ist, wo der Break-even liegt oder wie hoch die Nettomarge ist. Was ist daran im einzelnen so interessant? Ist es nicht von größerer Bedeutung, das Wesen dieses erfolgreichen Unternehmens zu verstehen? In bezug auf die quantitativen Daten sind Unternehmen ohnehin nur schwer vergleichbar; auch konkret beim Benchmarking helfen solche Zahlen nicht viel weiter. Für Mitbewerber sollte es viel wichtiger sein, über den Sinn und die Ziele des eigenen Geschäfts nachzudenken. Denn ausschlaggebend für den Erfolg sind vor allem eine Reihe von Tugenden bzw. die Unternehmenskultur. Aber auch Organisation und Führung sowie wichtige Geschäftsprinzipien werde ich beschreiben. Dabei wird deutlich werden: Das meiste erscheint einleuchtend und im Grunde so einfach, wie es in Wirklichkeit ja auch ist.
|13|Ich halte es für ohne weiteres möglich, wichtige Erkenntnisse über das Unternehmen ALDI auf viele andere Unternehmen der verschiedensten Branchen zu übertragen. Unternehmer, die erkannt haben, daß sie von ALDIs Praktiken einiges ableiten können, fahren damit durchaus erfolgreich.
So bezeichnet sich Möbel Roller, Deutschlands größter Möbel-Filialbetrieb, gerne selbst mit dem Prädikat »ALDI der Möbelbranche«. Das Unternehmen folgt dem Anspruch auf Preisführerschaft an jedem Ort. Hans-Joachim Tessner, der Gründer des Unternehmens, das heute zusammen mit der Asko zur Metro-Gruppe gehört, kam 1969 auf die Idee, einen Möbeldiscount-Laden nach dem Vorbild des Unternehmens der Albrecht-Brüder zu schaffen.3
Auch der geschäftsführende Gesellschafter der Piasten- und Schokoladenfabrik Hofmann GmbH & Co. KG, Thomas Hofmann, sagte in einem Interview einmal über sein Unternehmen: »Wir sind der ALDI unter den Süßwarenherstellern.«4 Damit drückt er seine Anerkennung für den Erfolg von ALDI aus sowie sein geschäftsführendes Prinzip, ALDIs Methoden möglichst zu kopieren.
Indem ich einige Eigenschaften und Prinzipien von ALDI beschreibe, wird auch deutlich werden, wo in der Einzelhandelsbranche entscheidende Fehler gemacht werden. Ich bin sicher, ich mußte ALDI verlassen, um dies erkennen und beurteilen zu können. Mit einer bei ALDI geschärften Brille war es mir möglich, das Andere zu betrachten und genauer kennenzulernen.
Gerade meine Erfahrungen im Ausland haben mir die Besonderheiten von ALDI sehr deutlich vor Augen geführt. Allem voran war für mich der Aufbau einer Discountkette nach ALDI-Vorbild in der Türkei von großer Bedeutung. Besonders erkenntnisreich war auch der Aufbau der ALDI-Gesellschaften in den Niederlanden, Belgien und Dänemark sowie der Erwerb und die Betreuung der Beteiligungen in den USA. Unterschiedlich waren auch meine Erfahrungen in deutschen Unternehmen. Was man dort erlebt, zwingt geradezu, darauf hinzuweisen |14|, wie man es – mit Blick auf ALDI – viel besser machen kann.
Meine Ausführungen basieren im wesentlichen auf Erkenntnissen, die ich als Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates bei ALDI Nord gewonnen habe und die ich durch viele Gespräche in den vergangenen Jahren ergänzen konnte. Ich werde in diesem Buch auch manch Bekanntes darstellen, das jedoch nur von einer Teilöffentlichkeit wahrgenommen oder bisher nicht richtig gewichtet und eingeordnet wurde.
Als ich vor Drucklegung einige Passagen dieses Buches Monika Linde, die als hervorragende Supervisorin in bezug auf Hintergründiges besonders sensibel ist, zum Lesen gab, sagte sie, das würde ja ein moralisches Buch werden. Zunächst war ich verunsichert und habe meine Ausführungen überprüft. Ihre Einschätzung ist aber durchaus richtig. In der Wirtschaft gilt auch Moral. Und ALDI ist in vielerlei Hinsicht ein moralisches Unternehmen. Das zeigt, daß man auch mit Moral viel Geld verdienen kann. Ohnehin ist Geldverdienen und Geld an sich nichts Unmoralisches. Die Lateiner sagten: »Pecunia non olet« (Geld stinkt nicht). Insofern ist dieses Buch durchaus ein moralisches Buch und ein »Kulturbuch«, denn die Unternehmenskultur von ALDI ist als Erfolgsfaktor nicht zu unterschätzen. Im Grunde leben mit der Beschreibung über ALDI auch alte Tugenden wieder auf. Interessant ist dabei: Diese können Gewinn bringen. Man wird sehen, welche Bedeutung und welchen Nutzen Ethik und Moral neben vielen – mehr technischen – Einzelheiten in einem so hemdsärmelig erscheinenden Unternehmen haben.
ALDI war für mich die beste Schule im Hinblick auf Unternehmensführung. Dafür danke ich. Ich danke Theo Albrecht, dem ich dieses Buch nachträglich zu seinem 75. Geburtstag widme. Und wenn wir von den Daten aus Karl Albrechts Vortrag von 1953 ausgehen, dann soll es auch eine Hommage zum 50jährigen Bestehen des Unternehmens sein. Wegen der ungeliebten Öffentlichkeitswirkung werden die Albrecht-Brüder dieses Buch allerdings nicht uneingeschränkt begrüßen.
|15|Ich danke dem ehemaligen Mitglied des Verwaltungsrates, Otto Hübner. Trotz einer Reihe von Differenzen im Laufe der Jahre habe ich immer seine Prinzipientreue geschätzt. Er, der »bibelfeste« Lordsiegelbewahrer, der 1984 im manager magazin durchaus treffend als Theo Albrechts Hausmeier charakterisiert wurde, hatte mich als »junges Talent« 1971 von der coop Kiel zu ALDI Nord nach Herten in Westfalen geholt. Später setzte er mich als Geschäftsführer in Nortorf ein, einer kleinen 6.000 Einwohner-Gemeinde in Schleswig-Holstein, die später auch Sitz der Albrecht-Stiftung werden sollte. 1975 wurde ich schließlich neben Theo Albrecht und Otto Hübner drittes Mitglied des Verwaltungsrates in Essen.
Ich danke auch Aziz G. Zapsu, der dieses Projekt unbewußt förderte, weil er begierig war, ALDI und das Einfache zu verstehen.
Dieses Buch soll nach den typischen ALDI-Prinzipien funktionieren: Es ist, wie ich hoffe, einfach zu verstehen. Es soll weder scheinbare Bedeutung dadurch erlangen, daß es mit modernen Managementbegriffen gespickt wird, noch soll es den Leser mit unnötigem Beiwerk belasten. Ich will nur das Wesentliche beschreiben: das Wesentliche aus der Praxis.
Für die Unterstützung und viele gute Eingriffe danke ich dem Campus Verlag, vor allem Frank Schwoerer, Karin Beiküfner und Britta Kroker.
Dieter Brandes
|23|Wenig ist besser als zuviel
Aus Not und notwendiger Sparsamkeit wurde Verschwendung vermieden. Es galt das Prinzip: Wenig ist besser als zuviel. Und man meinte damit Kapital, Personal, Räumlichkeiten. Resultat dieses »Notprogramms« war schließlich das ALDI-Konzept. Der Mangel an den genannten Ressourcen setzte Phantasie frei und schuf, ohne zu übertreiben, die Idee des Jahrhunderts im Einzelhandel.
In der Lebensmittel-Zeitung, dem angesehenen und kompetenten Fachblatt der Branche, erschien am 11. 4. 1980 ein Leserbrief des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der AVA/Marktkauf (heute mit fast 10 Milliarden Umsatz eines der größten Einzelhandels-Unternehmen in Deutschland), Karl H. Kuhlmann. Er sagte über ALDI: »ALDI ist der erfolgreichste Lebensmittel-Einzelhändler aller Zeiten.« Der ehemalige Oetker-Direktor, Dieter Baader, ein im deutschen Lebensmittelhandel allseits bekannter Fachmann und Debattenredner auf vielen Kongressen, formulierte es im Marketing-Club Köln/Bonn einmal so: »ALDI ist der größte handelspolitische Markenerfolg in der westlichen Welt.«
… vorantasten wie Albert Einstein
Eine bestimmte Unternehmensphilosophie oder strategische Marketinguntersuchung lag dem ALDI-Konzept nicht zugrunde. Eher handelte es sich um eine Anpassung an die Bedingungen von Wettbewerb und Märkten. Die Erkenntnisse, die man daraus ableitete, wurden konsequent umgesetzt. Das ursprüngliche Konzept wurde im Laufe der Jahrzehnte nie grundsätzlich verändert, es erfolgten immer nur schrittweise Anpassungen an verschiedenste innere und äußere Entwicklungen. Daher kann man auch nicht – wie hin und wieder in der Fachpresse geschehen – von alten und neuen Strategien bei ALDI sprechen.
|24|Die ALDI-Strategie war das Ergebnis eines dynamischen Prozesses, geleitet von Intuition, unbewußtem wie bewußtem Handeln und einer wachsenden Reflexion darüber. Aus einem Krämerladen mit einem »einfachen Konzept der Not« wurde der erfolgreichste Einzelhändler der Welt. Wie so oft in der Wirtschaftsgeschichte stand am Anfang nicht der geniale, wissenschaftlich begründete Entwurf, sondern eine gute unternehmerische Idee, die sich im Laufe der Jahre zu einem stabilen Erfolgskonzept entwickelte. Das ALDI-System war nicht eine plötzliche Erfindung, sondern Karl und Theo Albrecht haben sich mit ihren ersten »Mini-Läden in drittklassigen Lagen« an ihr Verkaufssystem im wahrsten Sinne des Wortes herangetastet.6 So wie auch Albert Einstein seine Arbeitsweise beschrieb: »Ich taste mich voran.«
In jüngster Zeit gibt es jedoch interne und externe Anzeichen für einen zunächst graduellen Wandel. Während ALDI über Jahrzehnte hinweg an einem streng begrenzten Warenangebot festhielt, gibt es nun eine Sortimentsausdehnung – und zwar besonders bei ALDI Nord. Die »sturen« und prinzipienfesten Mülheimer von ALDI Süd folgen dieser Aufweichung des Konzepts erst behutsam.
Aber auch andere Veränderungen finden statt, die zu Bedenken Anlaß geben. Trotz aller tief verwurzelten Geschäfts und Führungsprinzipien verändert sich jedes Unternehmen mit den entscheidenden und handelnden Personen. Auch bei ALDI ist heute eine Führungsmannschaft im Amt, die sich deutlich unterscheidet von den Managern der 60er, 70er und 80er Jahre. In diesen Jahren wurde das ausgereifte Konzept gelebt und verfeinert. Strenge Prinzipien brachten den einzigartigen Erfolg. Askese, Bescheidenheit, Detailarbeit und unglaubliche Konsequenz machten das Wesen von ALDI aus.
Theo Albrecht wird mehr und mehr von seinen Söhnen abgelöst. Seine früher so harte Hand und die Prinzipientreue der früheren Mitglieder der Geschäftsführungen und des Verwaltungsrates scheinen heute an Gewicht zu verlieren. Gewichtige |25|Veränderungen kann das für ALDI – hier besonders für die Gruppe Nord – bedeuten. Auf die an manchen Details erkennbaren Veränderungen wird an den entsprechenden Stellen in diesem Buch hingewiesen.
Entscheidend aber für den Erfolg von ALDI und für viele andere Unternehmen auch aus anderen Branchen sind die in diesem Buch dargestellten grundsätzlichen Einsichten und Methoden von ALDI, die im wesentlichen bis heute gelten. Sie sind noch immer modern und gewinnen an Gewicht in einer Zeit, in der sich viele Unternehmen und teilweise ganze Branchen neu orientieren müssen, um dem weltweiten Wettbewerb standhalten zu können. Mit den Einsichten und Methoden von ALDI kann manches andere Unternehmen einen Spitzenplatz in seiner Branche einnehmen.
Hätten die Mitbewerber den Ausführungen Karl Albrechts damals mehr Aufmerksamkeit geschenkt, sähe die Handelslandschaft heute möglicherweise ganz anders aus. Aber wie 1953 glaubte auch 30 Jahre später noch kaum jemand an den Erfolg dieses Konzepts.
1983 stellte die Lebensmittel-Zeitung fest7 :
»Kaum ein Marketingkonzept ist so gründlich analysiert worden, kaum eines liegt so nachvollziehbar offen – und dennoch hat beinahe eine ganze Branche dem Aufstieg eines Unternehmens und dem damit verbundenen Wachstum dieses Vertriebssegments tatenlos und phantasielos zugesehen.«
Aber da war eben viel mehr als ein »Marketingkonzept«. Jene Nachahmer, die versucht haben, das ALDI-Konzept zu kopieren, hatten offensichtlich das von Marie Ebner-Eschenbach beschriebene Problem: »Die meisten Nachahmer lockt das Unnachahmliche.«
Und wenn jemand kopierte, dann wollte er es noch besser machen. Dabei mußte er erkennen: Das Know-how von ALDI ist so einfach, daß niemand es glauben mag. Darum ist das Nachahmen so schwer.
|26|Geheimhaltung aus Prinzip
Von ALDI ist sehr wenig bekannt. Aufgrund der klugen Firmenkonstruktion unterlag ALDI bisher nicht der Publizitätspflicht. Diese Pflicht zur Veröffentlichung von Bilanzen würde dann entstehen, wenn zwei der drei Kriterien Umsatzgröße (mindestens 250 Mio. DM), Mitarbeiterzahl (ab 5.000) und Bilanzsumme (ab 125 Mio. DM) erfüllt wären. In bezug auf Geheimhaltung gibt es große Ähnlichkeiten mit C&A, Ikea und bis vor kurzem auch mit der Metro-Gruppe. Diese Unternehmen, insbesondere die Metro, zeichnen sich wie ALDI durch ein hervorragendes Konzept, durch eine sehr eigene Unternehmenskultur, aber auch durch einen ähnlich großen Erfolg über viele Jahre hinweg aus.
In einer Vielzahl von Presseartikeln wurde ALDI diskutiert, in Imagestudien und in streng vertraulichen Abhandlungen versuchten Konkurrenten, Marktforschungsinstitute und Markenartikelhersteller mehr über ALDI zu erfahren. So wurde also immer nur spekuliert. Für ALDI war es nützlich, über solche Studien, die man über Lieferanten zugespielt bekam oder die in der Fachpresse diskutiert wurden, einiges über den eigenen Absatzmarkt, seine Kunden oder über die Einschätzungen von Lieferanten und Mitbewerbern zu erfahren, ohne daß man hierfür Geld ausgeben mußte. ALDI selbst hat für Marktforschung nie Geld ausgegeben. Bei ALDI wird mehr darüber nachgedacht, was die Kundenwünsche sein könnten, und man handelt einfach, indem unmittelbar etwas ausprobiert wird.
Dieser Verzicht auf Publizität geschieht bewußt und ist Teil der Unternehmenspolitik. Die Konkurrenz erhält dadurch wenig Informationen. Wenn Unternehmen etwas veröffentlichen über ihre organisatorischen Lösungen oder stolz über ihre Umsatzsteigerungen oder ihre besonders hohe Personalproduktivität und entsprechend niedrigen Kosten berichten, so kann das nur der Konkurrenz helfen. Diese kann die Informationen nutzen, um ihre eigenen Leistungen zu verbessern. Das kann für ein Unternehmen wie ALDI nicht vorteilhaft sein, |27|und für ALDIs Kunden, die die Fachpresse nicht lesen, bringt es auch keine Vorteile. Die Kunden wollen gute Qualität zu niedrigen Preisen.
Die Kritik an der »fehlenden öffentlichen Kontrolle«, die zuweilen erhoben wird, überschätzt die Einflußmöglichkeiten: Die Veröffentlichung von Unternehmensentwicklungen, etwa durch Berichterstattung in den Zeitungen, hat noch nie verhindert, daß große Publikumsgesellschaften zusammenbrachen oder interne Probleme verhindert werden konnten. Erinnern wir uns an die coop AG, an den Bremer Vulkan, an die Metallgesellschaft oder an das jüngste Beispiel von schlechtem Management bei der Konsumgenossenschaft Dortmund.
Geschichte und Entwicklung
1913 eröffneten die Eltern von Karl und Theo Albrecht ein kleines Lebensmittelgeschäft auf 35 Quadratmetern in Essen. Ab 1946 betrieben die Brüder Albrecht nach ihrer Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft ein 100 Quadratmeter großes Geschäft in Essen-Schonnebeck, einem Bergarbeiter-Viertel. 1950 war daraus schon eine kleine Kette von 13 Läden entstanden, damals natürlich noch mit Bedienung. Karl Albrecht datiert den Beginn der eigentlichen Geschäftstätigkeit auf das Jahr 1948. Das ALDI-typische Discountprinzip bildete jedoch erst ab 1950 die Basis des Geschäftes, als man neben dem kleinen Warenangebot den Grundsatz des niedrigen Preises zu verfolgen begann. Der erste »echte« ALDI nach heutigen Maßstäben wurde 1962 in Dortmund eröffnet – eine Schöpfung von Theo Albrecht im Norden, die später von Bruder Karl übernommen wurde.
Im Jahre 1961 trennten die Brüder ihr kleines Imperium in einen Nord- und einen Südbereich. Man zog die »Einzelführung« der »Kollegialführung« vor: ein Prinzip der Dezentralisierung, das die Albrecht-Gruppe entscheidend geprägt und |28|gefördert hat. Wesentlicher Grund für die Trennung war der dadurch mögliche Verzicht auf permanente Einigung in allen wesentlichen oder auch unwesentlichen Fragen. Jedoch wurden alle Informationen, Leistungs- und Kostenzahlen ausgetauscht, auch die Konditionen verschiedener Lieferanten wurden miteinander verglichen, und teilweise führte man auch gemeinsame Einkaufsverhandlungen. Nur über den tatsächlichen Jahresgewinn der jeweiligen Gruppe wurde unter den Brüdern nicht gesprochen.
Klare Strukturen
Die Gesellschaftsstruktur von ALDI ist keineswegs, wie vielfach behauptet wurde, undurchsichtig. Im Gegenteil: Sie ist sehr klar und im Grunde auch sehr einfach (siehe Abb. S. 30).
Die »Klammer« sowie Führungs- und Kontrollgröße der Unternehmensgruppe ist der Verwaltungsrat, der sich zusammensetzt |29|aus formal völlig unabhängigen freiberuflich tätigen Managern, die zuvor erfolgreich als Geschäftsführer einer ALDI-Gesellschaft tätig waren. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind keine Vorstandsmitglieder oder Angestellte einer übergeordneten Gesellschaft oder Holding. Der Verwaltungsrat fungiert als Aufsichtsrat bei jeder der operativen Gesellschaften im In- und Ausland. Wie auch sonst üblich, sind hier die Aufsichtsratsmitglieder unabhängige Personen. Charakteristisch für die ALDI-Gesellschaftsstruktur ist, daß es keine Holding oder Dachgesellschaft gibt, die andere Gesellschaften beherrscht, und somit ein Konzern konstruiert werden könnte, mit allen entsprechenden Konsequenzen wie Mitbestimmung und Veröffentlichungspflichten. Da es sich bei ALDI nicht um einen Konzern im klassischen Sinne handelt, gibt es folglich auch keinen Konzernbetriebsrat; eine Tatsache, die von den Gewerkschaften immer beklagt wurde. Entscheidend für diese Konstruktion ist jedoch die konsequente Dezentralisation – ein Kernprinzip der ALDI-Unternehmensführung.
Die Gesellschaftsstruktur von ALDI (Nord)
ALDI hat eine übersichtliche Gesellschaftskonstruktion, die nur durch die heute etwa 30 Einzelgesellschaften bei ALDI Nord kompliziert erscheint.
Zu dieser Grundkonstruktion gehört darüber hinaus eine kleine Zahl wichtiger Gesellschaften, die zur Unternehmensgruppe gehören: Kaffeeröstereien in Herten/Westfalen und Weyhe bei Bremen, die Albrecht Immobilienverwaltung GbR, die A+G Grundstücksvermietungs und -verwaltungs GmbH sowie die Alva Versicherungsvermittlung GmbH & Co KG. Die Errichtung der Kaffeeröstereien und die Produktion des Albrecht-Kaffees war eine frühe Idee, die sich als sehr lohnend und imageprägend erwies. Mit der Kaffeemarke konnte ALDI immer besonders deutlich sein hohes Qualitätsniveau und |31|seine niedrigen Preise demonstrieren. Kaffee blieb auch das einzige Produkt, das selbst hergestellt wurde.
|30|
|31|Die Grundstücksgesellschaften dienten der Abwicklung von Grunderwerb und der Verwaltung eigenen Grundbesitzes, über die Versicherungsgesellschaft konnten die üblichen Maklerprovisionen für Versicherungsvermittlungen kassiert werden.
Die Konstruktion der Familienstiftung wurde gewählt, um die Interessen der Familienangehörigen zu wahren und zu fördern. Da eine Stiftung grundsätzlich nicht auflösbar ist, sollte so der Unternehmensbestand dauerhaft gesichert werden, und zwar unabhängig von Familienstreitigkeiten und Erbschaftsauseinandersetzungen. Mit einer Familienstiftung kann in der Regel die Zerlegung ganzer Unternehmen nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen vermieden werden. Wenn zwei Söhne Alleinerben wären, so hätten sie Anspruch auf jeweils eine Hälfte des Erbes. Doch bei einem Unternehmen handelt es sich um eine komplexe Einheit, die sich nicht einfach halbieren läßt wie ein Bankkonto. Da die Familienmitglieder – Eltern Theo und Cilly sowie die Söhne Theo Jr. und Berthold – nur mit insgesamt 40 Prozent am Unternehmen beteiligt sind, bleibt der Fortbestand gesichert. Probleme, wie sie in jüngster Zeit bei dem großen Hannoveraner Kekshersteller Bahlsen bekannt wurden, können so vermieden werden. Bei Bahlsen konnte erst nach langwierigen Erbauseinandersetzungen eine Lösung gefunden werden, indem ein wesentlicher Unternehmensteil in den USA abgetrennt und einem Erben übertragen wurde.
Gute Noten von Verbrauchern und Fachpresse
Selbst für Insider ist der sagenhafte ALDI-Erfolg bei den Verbrauchern überraschend. Nach einer im Jahr 1996 durchgeführten Kommunikationsanalyse der Zeitschrift Brigitte sprechen 55 Prozent der westdeutschen und 44 Prozent der ostdeutschen Konsumenten ALDI ihre Sympathie aus. Zum Vergleich: die Rewe-Handelsgruppe finden nur 15 Prozent sympathisch. Für einen schlichten, schmucklosen Discounter ist das schon ein erstaunliches Ergebnis. Von den Befragten kaufen 82 bzw. 71 Prozent bei ALDI ein, bei Rewe, dem bis 1997 noch |35|umsatzstärksten Anbieter in Deutschland, sind es nur 27 Prozent.
Die Einschätzung der Verbraucher spiegelt sich auch im Ergebnis einer Spontanbefragung wider, veröffentlicht 1995 in der ALDI-Studie der Gesellschaft für Konsumforschung. Einige Auszüge daraus:
»ALDI ist der mit Abstand bekannteste ›Markenname‹ in der deutschen Einzelhandelslandschaft.«
56 Prozent der Befragten dachten zuerst an ALDI, als sie nach Namen von Einkaufsstätten gefragt wurden. Mit weitem Abstand folgten dann Edeka mit 29 Prozent, Plus mit 21, Spar mit 20 und Lidl mit 18 Prozent.
»Zu ALDI haben die Verbraucher das größte Vertrauen.«
Auf die Frage nach Lebensmittel-Einkaufsstätten, zu denen besonders hohes Vertrauen besteht, nannten 26 Prozent spontan ALDI, mit weitem Abstand folgten Edeka mit 13 und Plus mit 10 Prozent sowie Spar mit 8 und Lidl mit 6 Prozent.
»ALDI ist nicht nur billig, sondern hat auch ein sehr hohes Preis-Leistungs-Verhältnis.«
46 Prozent nannten als Einkaufsgrund bei ALDI »billig«, 44 Prozent lobten das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, womit offenbar die gute Qualität gemeint ist.
»Es gibt keine eindeutig negativen Punkte.«
Nur 10 Prozent der Befragten meinten, es gebe zu wenig Markenartikel, 8 Prozent hielten die Auswahl für zu gering, und nur 5 bis 7 Prozent nannten Kritikpunkte, die für den gesamten Handel gelten könnten, wie »Kassenschlangen«, »Ladengestaltung«, »Warenpräsentation« oder »Freundlichkeit des Personals«.
|36|»Leute aller Klassen und Schichten kaufen bei ALDI.«
Das meinten 48 Prozent aller Befragten. Auch andere Untersuchungen haben immer wieder bestätigt, was die Kunden selbst bei ihren Mit-Einkäufern und im Nachbarschafts- und Freundeskreis beobachten. 90 Prozent aller Befragten bekannten sich als ALDI-Kunden. Dabei gehörten 84 Prozent zur niedrigsten und 15 Prozent zur höchsten Einkommensgruppe.
»10 bis 15 Prozent ›müssen‹ bei ALDI einkaufen«
Die Studie schätzt das Gewicht von ALDI-Kunden mit großen Haushalten, von Kinderhaushalten und von preisbewußten Haushalten auf 10 bis 15 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Diese Gruppe der »Muß-ALDI-Käufer« wird weiter zunehmen.
»ALDI beeinflußt nicht unwesentlich die generelle Preisgestaltung im Lebensmitteleinzelhandel.«
Der Markt orientiert sich an den ALDI-Preisen. Sogar die Industrie gestaltet ihre Produktion teilweise entsprechend. 1981 waren ausgewählte Hersteller-Marken nahezu doppelt so teuer wie die vergleichbaren ALDI-Artikel (96 Prozent höherer Preis). 1994 waren die Markenartikel noch 74 Prozent teurer. Nicht ALDI ist teurer geworden – die anderen haben sich angepaßt.
ALDIs Überzeugungskraft basiert nicht zuletzt darauf, daß es vernünftig ist, Geld zu sparen. »Wer seinem Geld nicht böse ist«, so Theo Albrecht, »der kann doch ruhig bei ALDI kaufen.« Das tat auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Als er seinerzeit als Bundesfinanzminister anläßlich eines Treffens der G7-Finanzminister in sein Wochenendhaus am Schleswig-Holsteinischen Brahmsee einlud, konnte man in den Fernsehberichten die Herren an Schmidts Bar vor einer Reihe von ALDI-Eigenmarken sehen. Die kaufte Schmidt selbst im ALDI-Markt |37|Nortorf ein. Obwohl es mittlerweile auch Champagner und Lachs preisgünstig bei ALDI gibt, meinen einige Kunden nach wie vor, betonen zu müssen, daß sie sich nicht schämen, bei ALDI einzukaufen.
Nicht nur bei den Kunden, auch in Fachkreisen schneidet ALDI gut ab. In einer Untersuchung zur Einschätzung der Krisenanfälligkeit von 66 Unternehmen (davon 7 Handelsunternehmen) aus den zehn größten Branchen Deutschlands, die das manager magazin im Februar 1992 publizierte, ergab sich bei einer Bewertungsskala von 0 (niedrigstes Risiko) bis 100 (höchstes Risiko) folgendes Bild:
1. Deutsche Bank
30,83
2. Metro
30,83
3. ALDI
31,50
4. Nestlé
33,50
5. Otto Versand
36,00
6. Philip Morris
36,67
Interessant dabei sind die guten Einzelnoten für ALDI:
Geschäftsrisiko
1. Platz
Marktrisiko
2. Platz
Finanzrisiko
5. Platz
Beim Finanzrisiko wird ALDI sicherlich noch unterschätzt, muß doch beachtet werden, daß die Gruppe konstant seit vielen Jahren ein Ergebnis von etwa 1 Milliarde DM vor Steuern erwirtschaftet und wesentlicher Grundbesitz unbelastet im Eigentum der Gruppe ist. Es wird sogar behauptet, das ALDI-Unternehmen sei der größte Immobilienbesitzer Deutschlands. Sicherlich ist es wahr, daß ALDI zu den Großen gehört.
Seit Jahren wird ALDI auch bei den jährlichen Imageuntersuchungen des manager magazins hervorragend beurteilt. 1996 |38|nahm ALDI in der deutschen Gesamtwirtschaft den 21. Platz ein, vor immerhin so hochkarätigen Unternehmen wie Dresdner Bank, Allianz, Unilever oder Esso.
ALDI im Wettbewerb
Wie entwickelte sich ALDIs Marktposition national und europaweit? ALDI ist bisher nicht gewachsen durch die Übernahme von Mitbewerbern. Nur in einigen anderen Ländern hat man sich eines in der Regel kleinen Unternehmens als Vehikel für den Start bedient. Bei ALDI Süd waren das Hofer in Österreich und Benner Tea in den USA. Bei ALDI Nord ging es um die Unternehmen Combi in den Niederlanden und Lansa in Belgien, an deren Akquisition ich wesentlich beteiligt war.