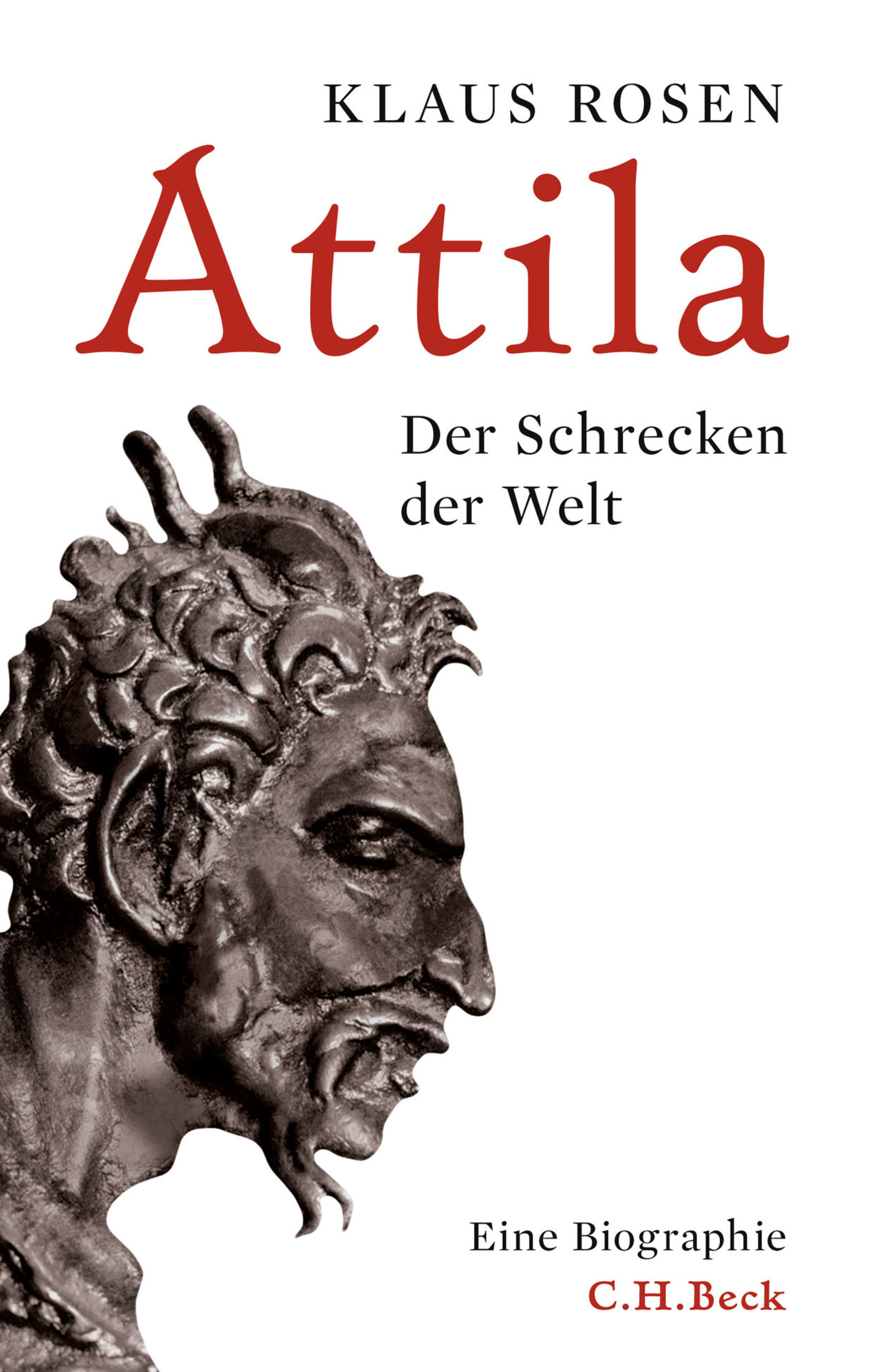23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Seit der Antike ist das Verhältnis von Macht und Religion im Leben des römischen Kaisers Konstantin umstritten. Die Biographie von Klaus Rosen befragt dazu die griechische und römische Überlieferung. Zugleich bietet sie eine Geschichte des Römischen Reiches im 4. Jahrhundert. Klaus Rosen analysiert durchgehend die umfangreiche Überlieferung und räumt mit mancher eingefahrenen Vorstellung auf, die über dem Christen Konstantin vergaß, dass er bis zum Ende seines Lebens der Machtpolitiker blieb, als der er angetreten war. Selbst der Christ schreckte nicht vor brutalen Mitteln zurück, wenn seine Macht bedroht war. In der Politik und auf dem Schlachtfeld musste er kaum eine Niederlage einstecken. Doch scheiterte er so manches Mal, wenn er nach der "Konstantinischen Wende" seinen Willen im neuen Verhältnis von Kirche und Staat durchzusetzen suchte. Eine umfangreiche und spannend geschriebene Darstellung eines Machtmenschen und einer Epoche, die Europas Geschichte geprägt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 984
Ähnliche
KLAUS ROSEN
Konstantin der Große
KAISER ZWISCHEN MACHTPOLITIK UND RELIGION
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung des Fotos »Konstantin I., der Große, Kopf einer Kolossalstatue aus der Konstantinsbasilika, Rom, Innenhof des Konservatorenpalastes« von akg-images/Erich Lessing
Vorsatzkarte: Gertrud Seidensticker
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94050-3
E-Book: ISBN 978-3-608-10432-5
Dieses E-Book beruht auf der 1. Auflage 2013 der Printausgabe
Inhaltsverzeichnis
Das römische Reich im 4. Jahrhundert
Vorwort
1. Konstantins Ziel: die Alleinherrschaft
Was die zeitgenössischen Historiker meinten
Was die Redner verkündeten
Was Konstantin selbst sagte
2. Eine lange Vorgeschichte
3. Diokletian, »der sorgfältigste und geschickteste Princeps«
Die Tetrarchie
Innenpolitik und Reichsverteidigung
Der Kampf um die alte Religion
4. Der junge Konstantin
Abstammung und frühe Jahre
Die ersten militärischen Sporen
Sein religiöses Weltbild
Die väterliche Machtbasis
5. Die bröckelnde Tetrarchie
Der Sohn und Nachfolger des Constantius
Konstantin in Gallien 306–
6. Das lange Jahr 312
Das Vorgeplänkel
Der Krieg
Religiöse Begleiterscheinungen
7. Der Befreier seiner Stadt Rom
8. Der Verteidiger von Toleranz und Religionsfreiheit
Der Störenfried Maximinus Daia
Licinius und Maximinus Daia
Die Zweierherrschaft – der Lohn des Höchsten Gottes.
9. Die Mailänder Verhandlung und das Edikt von Nikomedia
10. Der Vermittler I: Konstantin zwischen Donatisten und Katholiken
Kaiserliche Hilfe zur Selbsthilfe
Das Konzil von Arles 314 und der Abstand zwischen Kaiser und Katholiken
Konstantin greift selbst durch und gibt am Ende auf
11. Der erste Krieg der Schwäger um die Alleinherrschaft 316
12. Die Alleinherrschaft im Blick 317-323
Rechtschaffene Gesetze für die Zukunft
Der Krieg rückt näher
13. Der Endkampf 324
14. Der Alleinherrscher
Die Bekehrung.
Licinius, der halbe Christenverfolger
15. Die Vision eines christlichen Römischen Reiches
16. Der Vermittler II: Konstantin zwischen Arianern und Katholiken
Erste Bemühungen
Das Konzil von Nicaea und der kaiserliche Schiedsrichter
Kirchenpolitik macht Ärger
17. Die Sicherung der Macht
Das Heer
Herrschaft ist Verwaltung plus Kontrolle
18. Eigenwilligkeit ist tödlich
19. Bauen zum Ruhm des Siegers und zur Ehre Gottes
Rom
Konstantinopel
Jerusalem
20. Toleranz und Intoleranz
21. Außenpolitik mit Kreuz und Schwert
22. Noch zwei Jahre
Die Nachfolgeordnung.
Tod und Begräbnis
Ein Blutbad als Totenopfer
Der tödliche Streit ums Erbe.
23. Konstantin der Große? Der Große!
Tafelteil
Genealogie: Die konstantinische Dynastie
Anhang
Anmerkungen
Zeittafel
Abkürzungen
Quellen
Literatur
Karten- und Abbildungsnachweis
Orts- und Sachregister
Personenregister
Meiner Frau zum 23. Juli
Vorwort
Seine Herkunft war bescheiden: Der Vater war Soldat, die Mutter Stallmagd. Niemand hätte ihnen und ihrem Sohn Konstantin prophezeit, dass man in wenigen Jahrzehnten überall im Römischen Reich Inschriften lesen werde, die verkündeten, Kaiser Konstantin sei »zum Wohl des Staates geboren«, er sei »der größte Sieger und dauernde Triumphator«, »der fromme, glückliche und unbesiegte Augustus«.
Groß war die Überraschung, als der neue Herr des Reiches seinen Untertanen verkündete, der Gott der Christen habe ihn dazu berufen, »das Menschengeschlecht« zu seiner Religion zu bekehren, zu der Religion, der nur ein kleiner Teil der Reichsbevölkerung anhing und die so mancher frühere Kaiser am liebsten mit Stumpf und Stil ausgerottet hätte. Bald darauf schockierte der erste Christ auf dem Kaiserthron die Öffentlichkeit erneut: Seinen ältesten Sohn, in dem schon viele den Nachfolger sahen, ließ er hinrichten und seine Frau, die Kaiserin und Mutter seiner drei nachgeborenen Söhne, im Bad ersticken.
Ein solcher Mann faszinierte die Zeitgenossen im 4. nachchristlichen Jahrhundert, und er faszinierte die Menschen der nachfolgenden Jahrhunderte, die sich angewöhnten, Konstantin mit dem Beinamen »der Große« auszuzeichnen. Die Faszination durchzog das Mittelalter, und sie hat bis heute nicht nachgelassen. Die Beschäftigung mit Konstantin scheint sich zu einem eigenen Zweig der Geschichtswissenschaft entwickelt zu haben. Die zahlreichen Konstantinbiographien, die allein in den vergangenen Jahren erschienen sind, belegen es ebenso wie Sammelbände, die Aufsätze zu Einzelproblemen der Persönlichkeit und ihrer Zeit vereinigen. In jüngster Zeit haben sich in mehreren europäischen Ländern Konferenzen eigens mit Konstantin beschäftigt und ihre Ergebnisse publiziert. Große Ausstellungen von York über Trier bis Mailand und Rom, die von Jahrestagen in Konstantins Leben veranlasst wurden, zogen Besucherscharen an und riefen der Öffentlichkeit den ersten christlichen Kaiser ins Gedächtnis. Begleitet wurden die Ausstellungen von dicken Katalogen, deren Essays den historischen Rahmen zu den gezeigten Gegenständen lieferten. Film und Fernsehen haben Konstantin als dankbares Thema entdeckt, und ein gutgemachtes Kinderbuch, das in 2. Auflage vorliegt (»Hallo, mein Name ist Conny«), will schon die Grundschüler mit der historischen Gestalt vertraut machen.
Eines hat die lebhafte Konstantinforschung nicht fertiggebracht: ein einheitliches Bild des Kaisers. Konstantin war zu seiner Zeit umstritten, und er ist bis heute umstritten geblieben. Auf eine Farbskala aufgetragen würde seine Persönlichkeit in allen Schattierungen schillern, von strahlend hell bis tiefschwarz. Misst man den Kaiser an seiner Zeit und fragt nach den Antworten, die er auf deren politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen gab, so fällt unter Kennern der Spätantike die Bilanz ebenfalls unterschiedlich aus. Hat Konstantin mit seinen Maßnahmen dazu beigetragen, das Reich nach den Wirren des 3. Jahrhunderts zu festigen? Hat er ihm, wenn nicht eine Blüte, so doch wenigstens eine Ruhepause vor dem Niedergang verschafft? Oder hat er im Gegenteil den Untergang beschleunigt? Erweitert man den Rahmen und fragt nach Konstantins universalhistorischer Bedeutung, stehen sich erneut die Meinungen gegenüber: War er der letzte Kaiser der römischen Antike oder der erste mittelalterliche Herrscher, der die Verbindung von Kirche und Staat einleitete, die für das christliche Mittelalter grundlegend war? Verdient er, noch heute »der Große« genannt zu werden, oder fällt er gegenüber anderen ab, denen die Nachwelt diesen Beinamen gegeben hat? All diese Fragen wurden mit guten Gründen bejaht wie verneint.
Immer wieder entzündet sich die Diskussion auch an Konstantins Wende zum Christentum, ihren persönlichen und allgemeinen Voraussetzungen, ihrem Zeitpunkt und ihrer Wirkung. Nicht verwunderlich ist, dass die Christen und Nichtchristen im 4. Jahrhundert über diesen tiefgreifenden Einschnitt in die römische Geschichte gegensätzlicher Meinung waren. Aber nicht einmal die Christen bejubelten damals einhellig die »Konstantinische Wende«. Da sie noch keine einheitliche Kirche bildeten, gab es Parteiungen, und wenn Konstantin sich auf die eine Seite stellte, so zog er sich den Widerspruch der anderen Seite zu.
Was soll nun auf dem Markt der Konstantinforschung und der Konstantinliteratur eine weitere Konstantinbiographie? Ich habe zunächst nur die eine Rechtfertigung, die jeder Historiker ausgesprochen oder unausgesprochen für einen Aufsatz oder ein Buch hat: Ich habe die antiken Quellen zu Konstantin, die griechischen und lateinischen, gelesen, übersetzt und analysiert. Dabei ist mir Einiges aufgefallen, das ich in bisherigen Biographien und Untersuchungen nicht gelesen, vielleicht auch überlesen habe oder wo ich zu einer anderen Auffassung als meine Vorgänger gekommen bin.
Ich gestehe allerdings vorweg, dass ich von der Masse der Literatur zu Konstantin und dem 4. Jahrhundert nur einen kleinen Teil, die Spitze des Eisbergs, studiert habe. Mag sein, dass mir daraufhin mancher das ebenso elegante wie bissige Bonmot vorhalten wird, das der Historiker Hermann Heimpel in einer Rezension geprägt hat: »Literaturkenntnis schützt vor Neuentdeckungen.« Das war im Jahr 1954. Was aber tun, wenn eine 2012 erschienene Spezialarbeit zu Konstantin von über 650 Seiten, die ich der Liebenswürdigkeit des Verfassers verdanke, in der Bibliographie etwa 800 Titel auflistet, die sich per Tastendruck auf die modernen Suchmaschinen gewiss leicht vermehren ließen? Möglicherweise würde Heimpel heute den nicht ganz ernst gemeinten Rat erteilen: »Nur noch lesen, nicht mehr schreiben.« Denn in seiner Rezension entgegnete er dem betroffenen Autor: »Niemand ist gezwungen worden, gerade in dieser Zeit Bücher zu verfassen, die viel Literatur verbrauchten.« Das Problem ist uralt. Im 1. vorchristlichen Jahrhundert blickte der römische Historiker Titus Livius auf Vorgänger zurück, die umfangreiche Werke über Rom geschrieben hatten. Seine eigene Römische Geschichte eröffnete er daher mit der bangen Frage: »Ob ich den Lohn für meine Mühen erhalten werde?« Ich mache mir Livius’ Frage gern zu Eigen. Wenige Zeilen später tröstet sich der Römer: »Wie es auch immer sein mag, es wird mir trotzdem Freude machen« (utcumque erit, iuvabit tamen). Auch mit diesem Geständnis ist mir Livius vorausgegangen.*
Der Einfachheit halber bleibe ich ohne abschätzige Wertung bei herkömmlichen Begriffen wie Heiden und Heidentum, Monotheismus und Polytheismus, Donatismus und Arianismus, obwohl ich weiß, wie vielfältig die Erscheinungsformen sind, die sich hinter solchen Sammelwörtern verbergen. Ebenfalls zur Vereinfachung benutze ich bei den griechischen Wörtern nur den Akut.
Als Helfer habe ich an erster Stelle Frau Sandra Otto und Herrn David Hamacher zu nennen, studentische Hilfskräfte an der Abteilung für Alte Geschichte des Instituts für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. Frau Otto hat mit ihrem Computer unermüdlich mein manu scriptum in Form gebracht, unterstützt von meiner früheren Sekretärin Frau Edelgard Pfeiler. Herrn Hamacher war keine Mühe zu viel, um mir Literatur zu beschaffen. Dass mir, dem Emeritus, die beiden Hilfskräfte zur Hand gehen konnten, verdanke ich dem Entgegenkommen meiner Bonner Kollegen im Institut für Geschichte. Meinem Text zugute kam das Sprachgefühl meines ehemaligen Assistenten Dr. Jörg Fündling, Aachen, und meines Lektors Dr. Christoph Selzer. Herr Fündling hat außerdem die mühselige Arbeit auf sich genommen, zahlreiche griechische und lateinische Quellenangaben zu überprüfen. Dr. Selzer sorgte mit sanftem Druck dafür, dass das Buch nicht Ad Kalendas Graecas erschienen ist – nach der schönen Übersetzung im Lateinbuch »am St. Nimmerleinstag«. Herrn Selzer half Dr. Johannes Czaja. Versehen jäteten Frau Renate Warttmann, Beuren, und Frau Marion Winter, Esslingen, die auch das Register erstellt haben. Meine Frau hat ihren eigenen Anteil am Entstehen der Konstantinbiographie.
Ihnen allen danke ich von Herzen.
Bonn, im Juli 2013
Klaus Rosen
1. Konstantins Ziel: die Alleinherrschaft
Was die zeitgenössischen Historiker meinten
»Schon als Kind wurde sein gewaltiger und machtvoller Geist von brennendem Verlangen nach Herrschaft getrieben.«
Es war ein gewichtiges Urteil, das der Historiker Aurelius Victor über Kaiser Konstantin fällte. Kam es doch von einem kritischen Augenzeugen, der unter Konstantins Alleinherrschaft 324–337 in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen war und sich unter dessen Sohn und Nachfolger Constantius II. bis zum Statthalter einer Provinz emporgearbeitet hatte.1
Gut 50 römische Kaiser behandelte Aurelius Victor um das Jahr 360 in kurzen Biographien, von Augustus, dem Begründer des Kaiserreiches, angefangen bis zu seinem Förderer Constantius II. Aber selbst den bedeutendsten unter ihnen schrieb er keinen »gewaltigen und machtvollen Geist« zu, weder Augustus noch Trajan, weder Marc Aurel noch Septimius Severus, auch nicht Konstantins wichtigem Vorgänger Diokletian. Als er jedoch zu Konstantin kam und auf das letzte halbe Jahrhundert zurückblickte, sah er im frühen Machtstreben dieses Kaisers die treibende Kraft, die nicht nur sein Leben bestimmte, sondern die Geschichte des Römischen Reiches bis in die Gegenwart des Historikers.
Bemerkenswert ist der Zusammenhang, in den Aurelius Victor die Charakteristik Konstantins stellte: Es war der 1. Mai 305. Die Kaiser Diokletian und Maximian, die Seniores Augusti, dankten an diesem Tag ab. Zu ihren Nachfolgern ernannten sie die Iuniores Galerius und Constantius, Konstantins Vater. Sie waren vorher Unterkaiser mit dem Titel Caesar gewesen. Zu deren Nachfolgern bestimmte Diokletian die beiden Offiziere Severus und Maximinus Daia. Noch nie hatte das Römische Reich einen so friedlichen Wechsel mehrerer Herrscher erlebt. Auch war bisher noch kein Kaiser freiwillig vom Thron gestiegen. Jetzt aber wurde die erste Viererherrschaft – die Tetrarchie, wie sie moderne Historiker nennen – ohne Schwierigkeiten von einer zweiten Viererherrschaft abgelöst, und die beiden älteren Kaiser zogen sich zurück.2
Im ganzen Reich war das Erstaunen groß. Nur Konstantin war verärgert. Der Sohn des neuen Kaisers Constantius, damals etwa 33 Jahre alt, hatte gehofft, er werde als Caesar die bisherige Stellung seines Vaters übernehmen dürfen. Mehrere Jahre hatte er an Diokletians und Galerius’ Hof gelebt, hatte sie auf Reisen und Feldzügen begleitet und sich unter ihren Augen als Soldat bewährt. Jetzt überging ihn sein Oberkaiser und enttäuschte sein »brennendes Verlangen nach Herrschaft«.3
In der alten Frage, ob menschliche Eigenschaften angeboren sind, ob sie sich mit der Zeit entwickeln oder ob sie je nach den Umständen plötzlich auftreten, entschied sich Aurelius Victor bei Konstantin für die erste Erklärung: Das Verlangen nach Herrschaft habe er »von Kindesbeinen an« gehabt. Sieben Jahrhunderte vor dem Historiker bemerkte Aristoteles, der Tugenden wie Laster für angeboren hielt: »Denn wir sind auch irgendwie selbst mitverantwortlich für unsere Eigenschaften und je nachdem setzen wir uns unser Ziel.«4 Aurelius Victor hätte den Satz des griechischen Philosophen für Konstantin umso eher bejaht, als nach seiner Ansicht schon der Knabe das Endziel klar vor Augen gehabt hatte, lange bevor er ihm durch den Aufstieg des Vaters nahe kam. Er hatte nicht nur vom Ziel geträumt. Die Überlieferung wusste von keinem Traum, der ihm, wie vielen seiner Vorgänger und Nachfolger, die künftige Herrschaft prophezeit hätte.5
Ein Autor des 6. Jahrhunderts, Johannes Lydus, stimmte Aurelius Victor zu und ergänzte, Konstantin habe frühzeitig auf sein Ziel hingearbeitet, indem er sich eifrig in Rhetorik und im Waffengebrauch geübt habe. Denn er habe gewusst: »Wer sich nicht durch eine Ausbildung auf beiden Gebieten auszeichnete, wurde nicht zum Kaiser der Römer berufen.«6 Begabte Schüler konnten schon als 14-Jährige den Rhetorikunterricht, die letzte Stufe der Schulzeit, besuchen, und beim Sport mit Altersgenossen lernten sie noch vor der Militärzeit, mit Waffen umzugehen.
Doch waren solche Rückblicke auf Konstantins Jugendjahre mehr als nur einleuchtende Vermutungen, um die Neugier der Leser zu befriedigen, denen die Historiker wegen mangelnder Überlieferung sonst nichts zu bieten hatten? Begründeter war die Annahme, Konstantin habe sich Gedanken über eine künftige Kaiserherrschaft seit dem 1. März 293 gemacht; das war der Tag, an dem sein Vater zum Caesar und damit zum Nachfolger des regierenden Kaisers Maximian ernannt worden war. Umso größer war seine Enttäuschung zwölf Jahre später, am 1. Mai 305. Es war die erste Niederlage in seinem Leben.
Von seinem Lebensplan ließ sich Konstantin deswegen nicht abbringen, sondern näherte sich ihm Schritt um Schritt. In den folgenden zwei Jahrzehnten vernichtete er alle, die seiner künftigen Alleinherrschaft im Weg standen. Aurelius Victor berichtet in seinem biographischen Abriss von den drei großen Kriegen, die ihn unaufhaltsam ans Ziel brachten: Unter den Mauern Roms schlug er im Jahr 312 Maxentius, den Sohn von Diokletians ehemaligem Mitherrscher Maximian. Der Sieg machte ihn zum Herrn über den Westen des Römischen Reiches. Im Krieg des Jahres 316, den er gegen Licinius führte, seinen Mitkaiser in der Osthälfte des Reiches, erweiterte er sein Machtgebiet um fast den gesamten Balkan. Die Entscheidungsschlacht gegen Licinius im Jahr 324 verhalf ihm schließlich zur Herrschaft über das gesamte Reich. Das Ziel war erreicht. »So begann der Staat nach dem Willen eines Einzigen regiert zu werden«, lautete das Resümee des Aurelius Victor.7
Seine Kaiserbiographien hatte dieser Historiker mit dem Satz eröffnet, seit dem Jahr 31 v. Chr., »dem 722. Jahr der Stadt«, habe sich Rom daran gewöhnt, einem Einzigen zu gehorchen. Konstantins Machtpolitik befand sich folglich im Einklang mit drei Jahrhunderten römischer Kaiserzeit, die nur von Diokletians tetrarchischer Ordnung unterbrochen wurde. Doch die Frage bleibt, ob Aurelius Victor den Lebensplan Konstantins nicht nur aus einer Rückschau von mehr als zwei Jahrzehnten erschlossen hat. Der Historiker berief sich zwar einmal auf seine eigene Erinnerung an den Kaiser, aber er ist ihm gewiss nie persönlich begegnet, geschweige denn, dass er ihn über seinen Ehrgeiz hätte befragen können. Überzeugend war sein Schluss trotzdem, weshalb ihm der Historiker Eutropius folgte, der um 370 für Kaiser Valens ein Breviarium, einen Abriss über römische Geschichte verfasste. Aus dem Abstand von 35 Jahren hätte seinen Worten weder der Empfänger noch ein anderer Zeitgenosse widersprochen: »Ein gewaltiger Mann, der sich anstrengte, alles zu vollbringen, was er sich vorgenommen hatte, und der zugleich nach der Herrschaft über das ganze Reich strebte.« Für Eunapius, einen Historiker der folgenden Generation, trug Konstantin ganz im Sinn Aurelius Victors »den Gedanken an die Kaiserherrschaft in sich«, und »sein Wunsch danach wurde noch größer, seit Severus und Maximinus die Caesarenwürde erlangt hatten«.8
Eine Generation vor Aurelius Victor, zu Lebzeiten Konstantins, hatte sich auch der junge athenische Adlige Praxagoras Gedanken über den anscheinend unaufhaltsamen Aufstieg des Kaisersohnes gemacht. Der Sturz des Licinius im Wendejahr 324 beeindruckte ihn so tief, dass er wenig später in seiner griechischen Muttersprache eine Biographie des Siegers in zwei Büchern verfasste. Sie sind verlorengegangen. Doch dank eines knappen Auszugs, den der byzantinische Patriarch Photius im 9. Jahrhundert anfertigte, kann man dem roten Faden des Werks noch folgen: Alle Mitkaiser Konstantins unterdrückten ihre Untertanen; deshalb fühlte er sich herausgefordert, die Gewaltherrschaft eines jeden zu beenden. Er war also nicht nur der militärische, sondern auch der moralische Sieger, der nie aus Herrschsucht einen Krieg vom Zaun brach. In Lobreden auf siegreiche Kaiser war das eine beliebte Deutung. Praxagoras steigerte sie zu der feierlichen Aussage, das große Römische Reich habe den großen Konstantin als den Würdigsten gesucht, der alle Einzelherrschaften wieder in seiner Hand vereinigte. Der Biograph brach damit zugleich den Stab über Diokletians Tetrarchie. Sie hatte sich nicht bewährt. Das Reich selbst wollte wieder zur Monarchie in ihrer ursprünglichen Form, dem Principat, zurückkehren: Der beste und würdigste Römer sollte als Erster, als princeps, an der Spitze des Imperium Romanum stehen. Konstantins Siege waren der Beweis, dass das Imperium den Richtigen gefunden hatte. Der naheliegende Vorwurf erledigte sich, sein Machtwille habe ihn getrieben, die Mitkaiser und Konkurrenten zu beseitigen. Bewundernd sprach Praxagoras vom »großen Konstantin« und stellte ihn neben Alexander den Großen, dem er später ebenfalls eine Biographie widmete. Der Superlativ »der Größte« hätte nichts besagt, weil Maximus längst zum stehenden Beiwort römischer Kaiser geworden war. Auch Konstantin trug es auf vielen hundert Inschriften.9
Mit der Personifikation des Reiches, dessen Ruf der Kaiser folgte, näherte sich Praxagoras der kultisch verehrten Göttin Rom, der dea Roma. Der Athener, dessen Heimatstadt sich als heidnisches Bollwerk gegen das Christentum verstand, dürfte auch auf die christliche Deutung von Konstantins Aufstieg geantwortet haben. Sicher zu weit geht die Vermutung, Praxagoras habe dem gefeierten Kaiser die Biographie persönlich überreicht, etwa bei der Einweihung seiner neuen Hauptstadt Konstantinopel am 11. Mai 330. Wahrscheinlich war auch er vorher nie mit Konstantin zusammengetroffen. Wie bei Aurelius Victor bleibt daher der Einwand, Praxagoras habe aus dem Rückblick geurteilt und seinen Helden auf einem allzu geraden Weg zur Alleinherrschaft gelangen lassen.10
Umso wertvoller ist das Zeugnis des Kirchenschriftstellers Lactanz, der nicht nach dem Jahr 324, sondern ein Jahrzehnt früher schrieb. Er und Konstantin haben sich persönlich gekannt. Diokletian hatte den aus einer Provinz des römischen Africa stammenden Lehrer der lateinischen Rhetorik nach Nikomedia berufen, in seine südwestlich des Schwarzen Meeres gelegene Residenzstadt. Es wäre merkwürdig, wenn sich in der griechischsprachigen Stadt der Professor von Kaisers Gnaden und der bildungsbeflissene Sohn des Constantius, dessen Muttersprache ebenfalls Latein war, nicht gelegentlich am Hof oder in der Stadt begegnet wären. So erklärt sich zwanglos, warum Konstantin, nachdem er im Jahr 312 Herrscher über den Westen des Reiches geworden war, Lactanz bat, die Erziehung seines ältesten Sohnes Crispus zu übernehmen.11 In Trier, das schon unter Maximian und Constantius Residenz war, dürfte der Lehrer seinen Unterricht aufgenommen haben. Hier könnte der Lehrer um 314 auch seine kleine Schrift Über den Tod der Verfolger verfasst haben.12 Breit behandelte er die letzte große Verfolgung, die Diokletian und sein Caesar Galerius im Februar 303 in Nikomedia eröffnet hatten. Dem Vater seines Zöglings zuliebe ging er auch ausführlich auf den Übergang von der ersten zur zweiten Tetrarchie ein, was nicht unmittelbar zu seinem Thema gehörte. Es war das Ereignis, das Aurelius Victor zu seinem Urteil über Konstantins frühes Streben nach der Alleinherrschaft veranlasste.
Lactanz wagte eine Prophezeiung: »Konstantin ist liebenswert, und er wird so herrschen, dass man ihn für noch besser und milder halten wird als seinen Vater.« Dem Lob gab der Verfasser besonderes Gewicht: Er legte es in einem fiktiven Gespräch Diokletian in den Mund, als sich der alternde Augustus mit seinem Caesar Galerius über ihre Nachfolger und die künftige Ordnung des Reiches beriet. Von Constantius hatte Lactanz zuvor bemerkt, er sei mehr als alle anderen würdig, allein über das Römische Reich zu herrschen. Wenn folglich der Sohn den Vater noch übertraf, verdiente er erst recht, Alleinherrscher zu werden. Das rundheraus zu behaupten wagte der Autor nicht. Denn damals teilte sich Konstantin die Herrschaft noch mit Licinius, dem er kurz zuvor seine Schwester Constantia zur Frau gegeben hatte. Was Lactanz sich im Stillen für seinen Kaiser wünschte, das hatte seiner Meinung nach Galerius schon früh gefürchtet. Der Chronist der Verfolgung sah im Caesar und späteren Augustus Galerius, den er gewiss ebenfalls in Nikomedia erlebt hatte, Diokletians bösen Geist. Galerius war für ihn nicht nur der eigentliche Urheber der Christenverfolgung, sondern als Caesar hatte er den Senior Augustus auch bestimmt, den Christenfreund Konstantin bei der Nachfolge zu übergehen.13
Waren es nur Gerüchte, die in Nikomedia aus der Residenz in die Stadt drangen und die der Redelehrer nach den Regeln seines Faches zu einem Dialog zwischen Kaiser und Caesar verarbeitete? Oder hatte Lactanz zuverlässige Nachrichten, dass Galerius Konstantins »gewaltigen und machtvollen Geist« erkannt und Diokletian vor seinem »brennenden Verlangen nach Herrschaft« gewarnt hatte? Man erzählte sich von lebensgefährlichen Abenteuern, die der misstrauische Caesar für den Sohn seines Kollegen Constantius ausgedacht habe, weil er in ihm den kommenden Konkurrenten witterte und sich selbst Hoffnung auf die Gesamtherrschaft machte.14 Gegen einen Löwen ließ Galerius ihn kämpfen und schickte ihn auf einem Feldzug gegen die Sarmaten an der Donau als Vorreiter durch ein Sumpfgebiet. Damit nicht genug, drängte er ihn zum Zweikampf mit dem feindlichen Häuptling, den Konstantin besiegte und an den Haaren vor den Feldherrn zog. Stets durchkreuzte der tapfere jugendliche Held die bösen Absichten seines hinterlistigen Vorgesetzten. Er wurde zum Liebling der Soldaten, die auch genauso wie er enttäuscht waren, dass ihm Diokletian und Galerius die Nachfolge seines Vaters verweigerten.15
Lactanz dachte noch nicht an Konstantin, als er die philosophisch-theologische Grundlage für ein christliches Kaisertum legte. Das war bald nach 303. In diesem Jahr hatte er aus nächster Nähe erlebt, wie Diokletian die letzte große Christenverfolgung eröffnete. Im ersten Buch seines Hauptwerks, den Göttlichen Unterweisungen, wies er mit zahlreichen Belegen aus der paganen Literatur nach, dass die Welt durch die Vorsehung eines einzigen Höchsten Wesens regiert werde. Auf Erden spiegle sich seine Herrschaft im monarchischen Prinzip. Wo es verletzt werde, könne es keine Dauer geben. Für jeden zeitgenössischen Leser war das ein stummer Verweis auf Diokletians Tetrarchie. Sie störte die göttliche Ordnung und würde daher eines nicht allzu fernen Tages zerfallen. Wenn aber der Höchste Gott kein anderer war als der, den die Christen verehrten, würde er dann nicht nach dem Ende der Tetrarchie dafür sorgen, dass ein Christ an die Spitze des Römischen Reiches träte? Auch dieser Schluss blieb dem Leser überlassen. Dass er ganz im Sinn des Verfassers war, bestätigte Lactanz in der zweiten Fassung seines Werks. Er widmete sie Konstantin, nachdem dieser im Jahr 324 Licinius besiegt und sich als Alleinherrscher öffentlich zum Christentum bekannt hatte. Gegen Ende des siebten und letzten Buches schob Lactanz eine Adresse an den ersten christlichen Kaiser ein und bestätigte ihm: »Dich hat die Vorsehung der Höchsten Gottheit zum Gipfel der Herrschaft emporgeführt …, sodass allen deutlich wurde, was wahre Majestät sei«.16
Was die Redner verkündeten
Befanden sich Lactanz und sein Schüler Crispus unter der Hofgesellschaft, die sich an einem Tag des Jahres 313 in der kaiserlichen Residenz in Arles oder Trier versammelte, um eine Lobrede auf den Kaiser in ihrer Mitte zu hören? Nach seinem Sieg über Maxentius war Konstantin nach Gallien zurückgekehrt. Sein Feldzug vom Vorjahr war für den Redner, dessen Namen die Überlieferung nicht bewahrt hat, das gegebene Thema.17 Er beschloss es mit einem Gebet für den Geehrten, das er an den »höchsten Schöpfer des Seins« richtete. Bewusst wählte er einen Gottesbegriff, mit dem er keinen Anstoß erregte, weder bei den Götterverehrern noch bei den Christen, die es mittlerweile am Hof gab. Einig waren sich beide Gruppen auch in der alten Vorstellung, dass die monarchische Himmelsordnung mit einem höchsten Gott an der Spitze das Vorbild der irdischen Monarchie sei und diese im römischen Kaisertum ihre einzigartige geschichtliche Form gefunden habe.18
Waren folglich nicht nur die bisherigen Tetrarchien, sondern selbst die augenblickliche Doppelherrschaft Konstantins mit Licinius, dem Kaiser des Ostens, nur ein zeitlich begrenztes Zwischenspiel? Der Redner sprach diesen Schluss nicht aus. Aber seine Bitte an den Schöpfergott, dem der Idealherrscher Konstantin zu verdanken sei, und sein kühner Ausblick auf die Zukunft, mit dem er seine Rede beendete, waren ein unüberhörbarer Hinweis: »Sorge also dafür, dass das Beste, was du dem Menschengeschlecht gegeben hast, ewig dauern und Konstantin für alle Zeiten auf Erden bleiben werde.« Dann mit einer Wendung zum Kaiser: »Denn obwohl du, unbesiegter Herrscher, mittlerweile einen göttlichen Spross als Nachfolger hast und für die Zukunft Hoffnung auf eine noch zahlreichere Nachkommenschaft besteht, wird die Nachwelt erst dann glücklich sein, wenn du deinen Söhnen die Herrschaft über den Erdkreis übergeben hast, sodass du der größte aller Kaiser sein wirst.«19
Die Herrschaft über den Erdkreis, der seit der späten Republik mit dem Imperium Romanum gleichgesetzt wurde, sollte das Erbe sein, das Konstantin seinem Sohn Crispus und seinen späteren Nachkommen hinterließ. Die Voraussetzung, dass der Erblasser erst noch Herrscher über den Erdkreis werden musste, schien dem Redner so gewiss zu sein, dass er sie nicht eigens erwähnte. Der höchste Schöpfer des Seins konnte gar nicht anders, als den besten Herrscher, den er je dem Menschengeschlecht geschenkt hatte, zu diesem Gipfel zu führen. Man musste ihn nur noch bitten, der Herrschaft seines Schützlings in seinen Söhnen Dauer zu verleihen. Für alle Zeiten sollte die Weltherrschaft in Konstantins Familie bleiben. Das war der unwiderrufliche Abschied von der künstlichen Nachfolgeordnung Diokletians, dem vom Schöpfergott keine Söhne beschieden waren und der den Mangel zum Verfassungsprinzip erhoben hatte. Was aber war natürlicher als der Wunsch eines Vaters, sein Erbe an leibliche Nachkommen weiterzugeben?
Acht Jahre später führte der gallische Redner Nazarius das Thema fort, als er in Rom eine Rede auf die Konstantinssöhne Crispus und Constantinus II. hielt, um ihr fünfjähriges Caesariat zu feiern. Es war die Zeit, in der es zwischen ihrem Vater und Licinius zu kriseln begann und man absehen konnte, dass es demnächst zum Entscheidungskampf um die Alleinherrschaft kommen werde. Deutlicher als die Vorgänger nahm Nazarius das Ergebnis vorweg. Im Schlussteil der Rede feierte er die Blüte des Gesamtreiches, die Konstantin zu verdanken sei und die in der Herrschaft seiner Söhne und Nachfolger ihre Fortsetzung finden werde. Sogar die Perser, nach Rom die zweitmächtigste Nation auf Erden, suchten ängstlich um die Freundschaft des Kaisers nach. Kein Wort über den zwischen Persien und dem Westen regierenden Licinius. Für den Redner gab es ihn schon nicht mehr und erst recht nicht seinen gleichnamigen Sohn, der 317 mit Crispus und dem jüngeren Constantinus ebenfalls zum Caesar ernannt worden war. Ihre Zeit und mit ihr Diokletians tetrarchisches System war endgültig abgelaufen. Laut davon zu sprechen war allerdings zu früh. Schließlich musste dazu erst ein Bürgerkrieg geführt werden. Aber Nazarius war doch deutlicher geworden als sein Vorgänger im Jahr 313.20
Noch größere Zurückhaltung war drei Jahre früher geboten. Doch der Redner, der 310 in Trier einen Panegyrikus auf den Kaiser hielt, fand eine ebenso elegante wie unverdächtige Lösung, um den kommenden Alleinherrscher anzukündigen. Konstantin hatte sich in Massilia (Marseille) gerade Maximians entledigt, Maxentius’ Vater. Als er auf dem Rückweg in seine Residenz war und einen gallischen Tempel besuchte, empfing er eine Vision. Der Gott Apollo, begleitet von der Siegesgöttin Victoria, erschien ihm und überreichte ihm Lorbeerkränze, von denen jeder für 30 Lebensjahre stand. Es war sicher das bedeutende Heiligtum des Apollo Grannus in Andesina, dem heutigen Grand in den Vogesen, wo Konstantin diese Erscheinung hatte. Der Kult des ursprünglich keltischen Heilgottes hatte in der Kaiserzeit weite Verbreitung gefunden. Konstantin habe sich im Bild des Gottes erkannt, so der Redner. Zwei Götter begegneten sich. Zuvor hatte er sich in die Soldaten versetzt, die Konstantin gegen Maximian führte: Überzeugt von Konstantins Göttlichkeit glaubten sie, einem Gott zu folgen, »dem gegenwärtigsten Gott«, wie der Redner später beteuerte und die alte Vorstellung vom Herrscher als gegenwärtigem Gott zum Superlativ steigerte.21
Scheinbar nur als gebildeter Literat warf der Redner dann mit Apollos Hilfe einen Blick auf die politische Welt: Von Apollo sagen »die göttlichen Lieder der Dichter, dass ihm die Herrschaft über die ganze Welt gebührt«. Mit den Dichtern, einem rhetorischen Plural, war allein Vergil gemeint. In seiner Vierten Ekloge, die er in Rom während der revolutionären Verhältnisse des Jahres 40 v. Chr. verfasste, prophezeite er die Geburt eines Knaben, unter dem die Welt in ein goldenes Zeitalter eintreten werde. »Schon regiert dein Apollo«, heißt es dort in einem Halbvers, den der Redner aufnahm: »Denn du, Konstantin, sahst, glaube ich, deinen Apollo.«22 Der Redner konnte sicher sein, dass seine Anspielung und ihre bedeutungsvolle Aussage sofort verstanden wurden. Vergil war der wichtigste Schulautor, und die Vierte Ekloge war so bekannt, dass selbst die Buchstabenfolge INPCDA, die Anfangsbuchstaben eines Eklogenverses, den Lesern kein Rätsel aufgab. Carausius, der Gegner von Konstantins Vater Constantius, hatte sie in Britannien auf eine Münze gesetzt, um seine Usurpation zu rechtfertigen.23
War Vergil auch Konstantins Lieblingsdichter, und hatte der Redner davon erfahren? Die Vermutung ist nicht so abwegig. Denn 15 Jahre später wird der Kaiser vor einer Versammlung von Christen fast die ganze Vierte Ekloge zitieren und interpretieren, um nachzuweisen, dass der Dichter die Geburt Jesu prophezeit habe.24 Vergil konnte den Knaben vor seiner Geburt noch nicht mit Apollo vergleichen. Hier übertrumpfte der Redner den Dichter: Konstantin erkannte sich in der Erscheinung des Gottes, weil auch er selbst so »jung, froh, heilbringend und wunderschön« war, wie man Apollo von zahlreichen Darstellungen her kannte.
Panegyriker ließen ihrer Phantasie so manches Mal die Zügel schießen. Ein Handbuch der Rhetorik, das ein sonst unbekannter Redelehrer namens Menander einige Jahrzehnte zuvor veröffentlicht hatte, empfahl dem Redner, falls er von einem Kaiser keine bedeutungsvollen Träume oder andere wunderbare Ereignisse zu berichten habe, möge er sich nicht scheuen, sie »in überzeugender Weise« zu erfinden.25 Doch dem möglichen Vorwurf, er habe Konstantins Vision erfunden, wollte der Trierer Redner von vornherein begegnen. Nachdrücklich verbürgte er sich für deren Echtheit. Ein erstes »ich glaube« (credo) bekräftigte er kurz darauf noch einmal: »Ja wahrhaftig, was sage ich, ›ich glaube‹ – du hast die Vision gehabt.«26 Damit noch nicht zufrieden, fährt er im nächsten Satz fort: »Ich für meine Person bin der Meinung, arbitror, dass sich das jetzt endlich zugetragen hat …«
Wollte der Redner mit seinen auffälligen Beteuerungen Stellung beziehen in einer Auseinandersetzung, ob Konstantin in Grand wirklich Apollo und Victoria erschienen sind? Die ›Bibel‹ der Rhetoren, Quintilians Lehrbuch der Redekunst, führt weiter. Sie erklärt: »Was die Griechen Phantasien nennen und wir wohl richtig mit Visionen wiedergeben dürften – durch sie stellen wir uns in unserem Geist in solcher Weise Bilder von abwesenden Dingen vor, dass wir sie mit unseren Augen zu sehen und vor uns gegenwärtig zu haben scheinen.« War es eine solche ›eingebildete‹ Vision, von der Konstantin nach dem Besuch des Tempels berichtete?27
Zweimal bemerkte der Redner des Jahres 310 an hervorragender Stelle, im Eingangssatz und im Schlusskapitel, Konstantin selbst habe ihn für seinen Vortrag ausgewählt.28 Doch von ihm kann er die Vision nicht erfahren haben. Sonst hätte er sich zunächst nicht mit einem vorsichtigen »ich glaube« begnügen dürfen. Denn Äußerungen eines Kaisers waren »himmlische Worte« und hatten »göttlichen Sinn«.29 Schon einen Zweifel anzudeuten kam einem Sakrileg gleich. Die Gewährsleute für Konstantins Vision waren daher am ehesten diejenigen, die ihm, wie er einleitend verriet, Ratschläge für seine Rede erteilt hatten. Mit ihnen hatte Konstantin über seine Vision gesprochen. Man konnte ein solches Erlebnis so eindrucksvoll schildern, dass die Zuhörer es selbst vor Augen sahen und den Dichtern recht gaben, die seit Homer Göttererscheinungen ausgemalt hatten. Doch Konstantin war kein Dichter. Es blieben skeptische Stimmen, die hinter dem Rücken des Kaisers die Vision als durchsichtiges Propagandamittel verunglimpften. Hier bezog der Redner auf Bitten seiner Ratgeber Stellung. Daher seine nachdrückliche Versicherung, dass auch er glaube, was Konstantin gesehen habe. Nachdem der Unruhestifter Maximian tot und die erste Tetrarchie endgültig zu Grabe getragen war, trat er auf die Seite derer, die den Sieger Konstantin schon auf dem Weg zur Alleinherrschaft sahen. Der Redner gab ihrer Erwartung mit Hilfe des Vergilverses eine poetische Einkleidung, bei der sie die literarische und historische Parallele genießen und die absehbaren politischen Verwicklungen ausblenden konnten. Dahinter trat die Frage zurück, die sich die modernen Historiker immer wieder stellten: Was hatte es mit der Vision tatsächlich auf sich?
Als Zeugen für eine Himmelserscheinung, eine Doppelsonne oder einen Halo in seinen verschiedenen Formen, kann man den Redner mit seinem im Grunde Unsicherheit verratenden »ich glaube«, »ich bin der Meinung« nicht beanspruchen. Seine Gewährsleute, gewiss Begleiter Konstantins darunter, hätten ihm das Phänomen nicht verschwiegen, zumal es stets als bedeutsames Vorzeichen galt. Danach wären seine eigenartigen Vorbehalte unverständlich gewesen. Auch hätte ihn andernfalls ihr Bericht an mancherlei Vorbilder in der Literatur erinnert, mit denen er sonst gern seine Rede schmückte. Wegen des Vergilzitats hätte ein Anklang an den berühmtesten Halo über Rom im Jahr 4 4 v. Chr. nahegelegen, als der spätere Augustus nach der Ermordung seines Adoptivvaters Iulius Caesar erstmals die Stadt betrat. Das Schweigen gerade bei einem solchen Erlebnis wäre gegenüber Konstantin und seinem Gefolge unter den Zuhörern ein Versäumnis gewesen, dessen sich der Redner nicht schuldig gemacht hätte. Doch er sprach kein einziges Mal von der Sonne oder vom Sonnengott. Dieses Verschweigen wäre nicht einmal durch die stumme Annahme aufgewogen worden, alle setzten Apollo mit dem Sonnengott gleich, wie das seit den Vorsokratikern verbreiteter Glaube war und durch den kosmologischen Kontext der Vierten Ekloge nahegelegt wurde. Auch scheint der Redner noch nicht Konstantins Trierer Münzemission mit der Legende »dem Sonnengott, dem Unbesiegten, dem Gefährten« (SOLI INVICTO COMITI) gekannt zu haben. Sie setzte wohl erst in der zweiten Hälfte des Jahres 310 ein, und der Anlass war gewiss keine Himmelserscheinung. Folglich erledigt sich die häufig vermutete Verbindung zum bekanntesten Zeichen, das Konstantin am Firmament erschienen ist, dem des Jahres 312.30
Unter dem frischen Eindruck von Maximians Tod näherte sich der Redner Konstantins Monarchie noch von einer anderen Seite. Dem rhetorischen Lehrbuch folgend eröffnete er nach der Einleitung den ersten Hauptteil der Rede mit der Abstammung des Geehrten. Überrascht erfuhren die Zuhörer, sein Vorfahr sei Claudius Gothicus, der Kaiser, der nur knapp drei Jahre, von 268 bis 270, regiert hatte. Der Redner sicherte sich auch für diese Neuigkeit ab. An Konstantin gewandt erläuterte er, von dieser Verwandtschaft wüssten nur die Menschen, »die dich am meisten lieben«. Es war ein exklusiver Kreis am Hof, dem sich der Redner zurechnete. Größer war die Zahl derer, die sich noch an Claudius’ Sieg über die Goten erinnerten. Der Redner frischte ihr Gedächtnis zusätzlich auf und feierte den Toten als den Retter und Erneuerer des wankenden Reiches, den die Götter nur allzu früh zu sich gerufen hatten. Von der historischen Rückschau ging er zur Gegenwart über.31
Man konnte Konstantin nicht absprechen, dass er sich wie die Tetrarchen vor ihm den Thron schon jetzt durch seine kriegerischen Leistungen verdient hatte. Aber als Sohn eines Kaisers, der einen zweiten Kaiser im Stammbaum hatte, war er von Geburt der »designierte legitime Thronfolger« (designatus legitimus successor). »Denn kein Zweifel bestand, dass demjenigen das Erbe zustand, den das Schicksal einem Kaiser als Erstgeborenen gab.«32 Der Redner verband seine Rhetorik mit präzisen staatsrechtlichen Begriffen und Vorstellungen. Das Erstgeburtsrecht war ein Grundprinzip nicht nur des römischen Kaisertums, sondern vieler Monarchien. Durchbrochen wurde es nur, wenn das Schicksal einem regierenden Kaiser wie Diokletian den Sohn versagte. Dagegen bedurfte Konstantin, der einen über mehrere Generationen zurückreichenden dynastischen Anspruch besaß, keiner von Zufällen abhängigen Proklamation.33
Der Redner fuhr gegen die Tetrarchen, Constantius ausgenommen, schweres Geschütz auf. Im Vergleich zu Konstantin waren sie Usurpatoren. Nie wären sie zu kaiserlichen Würden gelangt, wenn Claudius Gothicus länger gelebt und den Thron auf den Blutsverwandten Constantius vererbt hätte. Konstantins Vater war allerdings nur wenig mehr als ein Jahr in der höchsten Stellung vergönnt gewesen. Um das Leben des Sohnes brauchte man sich dagegen keine Sorgen zu machen, wenn man hörte, welche Bedeutung Apollos und Victorias Lorbeerkränze hatten. Die Kränze und das Vergilzitat waren zugleich die Versicherung, dass dem Imperium Romanum endlich das von Vergil versprochene Goldene Zeitalter bevorstehen werde unter einem »jugendlichen Kaiser«, in dessen Adern das Blut des Gotensiegers und Reformers Claudius floss.34
Der Redner steigerte sich noch: Konstantin sei »ein Geschenk der unsterblichen Götter«. Was zunächst wie ein Topos der Kaiserpanegyrik klang, bekam durch die Erscheinung Apollos und Victorias seinen individuellen Rang.35
Das Zitat aus Vergils Vierter Ekloge stellte darüber hinaus eine Verbindung Konstantins zu Augustus her, dem Patron und Bewunderer des Dichters. Ihm war während der Seeschlacht von Actium im Jahr 31 v. Chr., der militärischen Geburtsstunde des Principats, ebenfalls Apollo erschienen und hatte ihm den Sieg verkündet. Nach Rom zurückgekehrt errichtete der künftige Princeps der Siegesgöttin Victoria in der Curia, dem Versammlungslokal des Senats, einen Altar, »weil er von ihr die Herrschaft erlangt hatte«. Kündigte folglich die Erscheinung des Götterpaars Apollo und Victoria nicht auch Konstantin die Alleinherrschaft an?36
Die prophetischen Stimmen in der Umgebung des Kaisers könnten Lactanz und dem Redner von 313 zu Ohren gekommen sein und sie angeregt haben, sich auf ihre Weise Gedanken über den künftigen Alleinherrscher Konstantin zu machen.
Wie verhielt sich Konstantin zu den Entwürfen, die die Redner ihm und einem aufmerksamen Publikum über seine Zukunft vortrugen? Selbstverständlich wollten sie dem Geehrten keinen Anlass liefern, während des Vortrags die Stirn zu runzeln. Daher empfahl es sich, vorher am Hof Rat zu holen, wie das der Redner im Jahr 310 tat: Bevor er sich näher auf Konstantins Auseinandersetzung mit Maximian einließ, erbat er sich ausdrücklich ein zustimmendes Kopfnicken des Kaisers.37
Erwartete der Redner unausgesprochen dasselbe, als er seine künftige Alleinherrschaft andeutete, einen Gegenstand, der sehr viel heikler war? Der nachfolgende Redner, der im Jahr 312 vor Konstantin in Trier einen Festvortrag hielt, zählte auf, wer sich bei solchen Gelegenheiten versammelte: »die gesamte Hofgesellschaft deiner Freunde und der ganze Herrschaftsapparat ist anwesend, alle Leute aus fast allen Städten sind hier, weil sie entweder offiziell gesandt wurden oder persönliche Bitten an dich haben.«38 Ein Jahr später, beim Redner von 313, war es nicht anders: Hohe Hofbeamte, Provinzstatthalter, Offiziere und viele gallische Bürger kamen zusammen, um zu verfolgen, wie der nächste in der Reihe der kaiserlichen Lobredner das panegyrische Genus variierte, um den Sieg ihres Herrn über Maxentius zu feiern.39
Konstantin war es folglich nicht unlieb, dass von seiner späteren Alleinherrschaft nicht nur in seiner Residenz die Rede war, sondern dass das Thema ohne sein Zutun auch ins Land hinausgetragen wurde. Gab er je selbst den Anstoß, davon zu sprechen? Aus dieser Zeit ist dazu keine Äußerung von ihm überliefert, was nur heißen kann: Er hielt sich klug zurück. Denn bei jeder Andeutung hätten alle Hörer oder Leser sofort an den Bürgerkrieg oder an die Bürgerkriege gedacht, die seine Alleinherrschaft kosten würde. Diese Kriege waren zudem gegen Mitkaiser zu führen, deren Stellung in der tetrarchischen Ordnung genauso legitim war wie die Konstantins. Wenn jemand so kühn gewesen wäre, ihn nach den Reden seiner Verehrer auf die Alleinherrschaft anzusprechen, hätte er vielleicht ironisch geantwortet, seit Platon wisse doch alle Welt, welche Kluft zwischen Rhetorik und Wirklichkeit bestehe.
War es so ungewöhnlich, dass sich schon vor dem Herrscherwechsel des Jahres 305 die Blicke bisweilen auf den Sohn des Constantius richteten und mancher in ihm, der diokletianischen Nachfolgeordnung zum Trotz, den künftigen Kaiser sah? Der Bischof Eusebius von Caesarea gehörte zu ihnen. Im Leben Konstantins berichtet er, er habe Kaiser Diokletian auf seinem Zug durch Palästina gesehen, und an seiner Rechten habe sich, »höchst eindrucksvoll«, Konstantin befunden. Eusebius war zwar in seiner Lebensbeschreibung oft mehr Panegyriker als Historiker, aber wenn er im Folgenden Konstantins äußere Erscheinung schildert – es ist das früheste authentische Zeugnis –, braucht man nicht allzu viele Abstriche zu machen: An jugendlicher Schönheit und altersgemäßer Größe war keiner mit dem jungen Prinzen zu vergleichen, der damals den Rang eines Tribuns Ersten Ranges (tribunus primi ordinis) hatte. An Kraft und Stärke war er seinen Altersgenossen so überlegen, dass er ihnen Furcht einflößte. Solche äußeren Merkmale waren für den Beobachter leicht zu erkennen. Wenn Eusebius dann aus ihnen Konstantins Tugenden und geistige Anlagen abliest, so spricht allerdings eher der spätere Bewunderer: »Durch seine seelischen Eigenschaften stach er noch mehr hervor als durch seine körperlichen Vorzüge, wobei er vor allem durch Besonnenheit für den Schmuck seiner Seele sorgte und sich ferner durch rhetorische Bildung, angeborene Vernunft und gottgegebene Weisheit besonders auszeichnete.« Nach Ansicht des Bischofs »zeigte er von da an kaiserliche Gesinnung«.40
Eusebius vermied, sich nachträglich als Prophet darzustellen, der schon vor 305, als Konstantins Vater noch Caesar war, die Alleinherrschaft des Sohnes vorausgesehen habe. Er schwieg auch deswegen, weil er nie erfahren hatte, ob Konstantin sich in dieser oder in der folgenden Zeit je selbst zu seinen Wünschen und Plänen geäußert hatte.
Was Konstantin selbst sagte
Offen sprach Konstantin von seiner Alleinherrschaft nicht eher, als bis er sie im Jahr 324 mit dem Sieg über Licinius errungen hatte. Wenig später sandte er an die neugewonnenen Provinzen im Osten des Reiches einen Rundbrief, mit dem er die verfolgten Christen in ihre früheren Rechte einsetzte. Er nutzte die Gelegenheit, um sich erstmals der nichtchristlichen Öffentlichkeit als Anhänger des Christentums vorzustellen. Sein Gott war nun dasselbe Höchste Wesen, das auch die Christen verehrten und von dem er im Verlauf des Briefs bekannte: »Es hat meinen Dienst zur Erfüllung seines Willens gesucht und mich erwählt, der ich von jenem Meer bei den Britanniern aufbrach und von den Gegenden, wo die von einer höheren Ordnung gelenkte Sonne untergeht, und der ich das Elend, das alles umfangen hielt, vertrieb und vernichtete, damit einerseits das Menschengeschlecht, durch meinen Einsatz belehrt, die Verehrung des erhabensten Gesetzes zurückgewönne, sich aber andererseits zugleich der seligste Glaube unter höherer Führung ausbreite.«41
Konstantins Vater Constantius war noch von den Göttern zu seinem letzten Feldzug nach Britannien gerufen worden, »an den äußersten Rand der Welt«, wie der Panegyriker von 310 den Sohn erinnerte. Von Britannien aus fuhr Constantius dann wenig später in den Himmel auf, und Juppiter selbst streckte ihm die Rechte entgegen. Gefragt, wer sein Nachfolger auf Erden werden solle, empfahl er dem Göttervater seinen Sohn. Der Panegyriker stellte daraufhin einen kühnen Zusammenhang zwischen Britannien im hohen Norden und Konstantin her: »Wahrlich, Gegenden, die in der Nachbarschaft des Himmels liegen, sind heiliger als die mittelländischen, weshalb ein Kaiser dort, wo die Erde endet, den Göttern, von denen er gesandt wird, näher ist.«42 Nachdem Konstantin Alleinherrscher geworden war, rückte er den Redner von 310 zurecht: Sehr wohl verdankte er seine Stellung einem Höchsten Gott. Nur war es nicht Juppiter, den die Heiden verehrten, sondern der Gott der Christen.
Nicht die göttliche Berufung an sich erstaunte die neugewonnenen Untertanen Konstantins. Schon frühere Kaiser hatten sich auf den Befehl eines Gottes oder der Götter berufen. Die Behauptung war so verbreitet, dass Redelehrer sie ihren Schülern als geeignetes Ersatzthema empfahlen, falls sie einen Kaiser zu loben hatten, von dessen Abkunft sie nichts Besonderes zu erzählen wussten.43
Überrascht waren die Leser von Konstantins Brief, dass der Auftrag von einem Gott gekommen sein soll, dessen Religion so lange als unvereinbar mit dem Götterkult gegolten hatte und dessen Anhänger daher immer wieder von Konstantins Vorgängern bekämpft wurden. Doch einen Schlag versetzte den Verehrern der alten Götter erst der letzte Teil des Satzes, über den die Christen jubelten: Der neue Alleinherrscher wollte das Imperium Romanum zu einem Imperium christianum machen. Gottes Auftrag hatte kein anderes Ziel, als ein Reich zu schaffen, das unter einem christlichen Monarchen eine politische und religiöse Einheit bildete. Dem ersten Schock dürfte bei so manchem der Spott gefolgt sein: Zum ersten Mal gab es in der römischen Geschichte einen Kaiser, der angeblich keinerlei persönliche Machtgelüste hatte, sondern sich nur als Erfüllungsgehilfe eines eigenwilligen Gottes sah.
Konstantin verriet nicht, wo und wie er Gottes Willen erkannt und ihn sich zu Eigen gemacht hatte. Hätte er es getan, so wäre seinen späteren Bewunderern wie seinen Kritikern der bis heute andauernde Streit erspart geblieben, wann der genaue Zeitpunkt seiner Wende zum Christentum war. Da sich das Höchste Wesen erst auf die Suche begab, verging einige Zeit, bis es den geeigneten Vollstrecker seines Willens gefunden hatte, der sich dann erst noch bekehren musste.4 4 Längst vorbei war die Zeit eines Kaisers Trajan, der im Jahr 97 »nicht durch die geheime Macht des Schicksals, sondern von Juppiter selbst in der Öffentlichkeit und vor aller Augen gefunden und ausgewählt wurde«.45
Begonnen hatte die Suche des Christengottes im Jahr 306, als Konstantin »von jenem Meer bei den Britanniern aufbrach«. Kein Wort verlor der Briefschreiber über seinen Vater, dem er seine dynastische Legitimität verdankte, kein Wort auch über das Heer, das ihn zu dessen Nachfolger ausrief. Allein der Wille des Allmächtigen schien ihn zu lenken. Vor diesem Lenker verblassten alle Voraussetzungen im Götterhimmel und auf Erden, die seine früheren Panegyriker so begeistert gepriesen hatten.46
Dem ersten Brief ließ Konstantin bald darauf einen zweiten folgen, den er an alle Provinzen im Osten und Westen des Reiches richtete.47 Erneut rechnete er mit den Christenverfolgern ab, namentlich mit Diokletian. Etwa in der Mitte des Briefes wandte er sich in einem Gebet an seinen göttlichen Führer: »Dich nun, den größten Gott, bitte ich, sei deinen Provinzialen im Osten, sei allen deinen Provinzialen, die unter langem Unglück zu leiden hatten, mild und gnädig, der du durch mich, deinen Diener, Heilung wünschst. Und das verlange ich nicht unbilliger Weise, Herrscher des Alls, heiliger Gott. Denn unter deiner Führung habe ich heilbringende Taten unternommen und vollendet, und habe, überall dein Zeichen vorantragend, ein siegreiches Heer geführt.« Der Beter war der Feldherr Gottes, und Kriege hatte er allein in seinem Namen unternommen. Auch sein Heer hatte er in den Dienst des Christengottes gestellt. Diesem Gott verdankte er seine Siege, nicht der Göttin Victoria, die der Redner von 310 hatte auftreten lassen und die so oft auf seinen Münzen erschienen war. Diesen Zusammenhang stellte allerdings erst der rückblickende Alleinherrscher her, der sein Ziel erreicht hatte.48
Das Unglück, unter dem die Provinzialen in Ost und West allzu lang zu leiden gehabt hatten, waren nicht nur die Christenverfolgungen, sondern ihre eigentliche Ursache, die jahrhundertealte Herrschaft der Götter. Konstantin hat diese Herrschaft endlich gebrochen, und folglich war der Christengott fortan der Herr der Reichsbewohner. »Deine Provinzialen« war sein kühnster Vorgriff auf ein kommendes Imperium christianum und zugleich die entschiedenste Absage an jede persönliche Machtpolitik in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Frühere Kaiser hatten das Römische Reich bis an die Ränder der Erde ausgedehnt. Sie hatten Juppiters berühmte Prophezeiung in Vergils Aeneis wahr gemacht, er habe den Römern eine Herrschaft ohne Grenzen verliehen (imperium sine fine dedi). Jetzt ging es nicht mehr um die weitere Ausdehnung des Reiches, sondern um dessen innere Verwandlung. Eine neue Epoche der römischen Geschichte hatte begonnen.49
Mit der göttlichen Legitimation seiner Alleinherrschaft und dem künftigen Imperium christianum eröffnete Konstantin noch einen dritten Brief, den er im ersten Halbjahr 325 an Bischof Alexander von Alexandria und seinen Presbyter Arius schrieb. Die beiden hatten sich über das Wesen des Gottessohnes zerstritten. Da sich der Streit unter den Bischöfen des Ostens, den Mitadressaten des Briefes, ausgebreitet hatte, suchte der Kaiser zu vermitteln.50
Plötzlich sah Konstantin sein Ziel gefährdet, ein religiös und staatlich geeintes Reich zu führen. Daher äußerte er sich diesmal deutlicher als in den Briefen an die Provinzialen zu den Ursprüngen seiner Politik: »Zwei Gründe waren es, deretwegen ich mein Amt übernommen habe, und es ist nur recht, dass ich dafür Gott, den Helfer meiner Unternehmungen und Retter in allen Dingen, zum Zeugen anführe. An erster Stelle beabsichtigte ich nämlich, die Einstellung aller Völker zum Göttlichen zu einer einzigen Glaubenshaltung zusammenzuführen, als Zweites aber, den Körper des allumfassenden Erdkreises, der gleichsam an einer schweren Wunde litt, wieder aufzurichten und zu vereinheitlichen. Um das zu erreichen, machte ich mir zu Ersterem im Stillen vor meinem geistigen Auge meine Gedanken, das andere aber suchte ich mit Heeresmacht zu erreichen, wobei ich mir bewusst war, dass, wenn ich bei allen, die Gott verehren, die gemeinsame Eintracht nach meinen Wünschen herstelle, auch das Staatswohl seinen Nutzen aus dem Wandel ziehen werde, der mit der allgemeinen frommen Einstellung einhergeht.«51
Zwei Aufgaben will Konstantin also vor sich gesehen haben, als er im Jahr 306 sein Amt übernahm.52 Sie bedingten einander, hatten aber unterschiedlichen Rang, ganz im Sinn des Gottes, der ihm half, beide Aufgaben zu erfüllen. Schon der junge Herrscher betrachtete es als sein höchstes Ziel, das Imperium, »alle Menschen«, im christlichen Glauben zu einen. Voraussetzung dafür war, dass er zunächst die nachgeordnete zweite Aufgabe erfüllte und mit militärischen Mitteln das an einer Wunde leidende Reich, »den allumfassenden Erdkreis«, politisch einte. Die Wunde war Diokletians tetrarchische Ordnung, die das Reich gespalten habe. Das brauchte Konstantin den Klerikern nicht eigens zu erklären.
Doch warum hatte man vor 324 nie davon gehört, er habe sein Amt nur übernommen, um letztlich ein Imperium christianum zu schaffen? Warum schwieg davon auch seine Propaganda im Entscheidungskampf gegen Licinius? Eusebius von Caesarea, sein wichtigster Lobredner, hätte gewiss davon erfahren und voller Begeisterung das künftige christliche Reich des Siegers zum großen Finale seiner Kirchengeschichte gemacht, deren letzte Ausgabe bald nach Licinius’ Niederlage erschien. Stattdessen begnügte er sich damit, abschließend die neue Freiheit nicht nur der Christen, sondern aller Reichsbewohner im Osten unter dem christenfreundlichen Herrscher und seinen Söhnen zu feiern.53
Als habe Konstantin die Zweifel geahnt, verteidigte er sein bisheriges Schweigen mit der Auskunft, er habe sich über die religiöse Einheit des Reiches »im Stillen vor seinem geistigen Auge seine Gedanken gemacht«. Aber dass er das seit dem Jahr 306 fast 20 Jahre lang getan habe, werden ihm selbst die frömmsten Bischöfe nicht abgenommen haben. Man musste vielmehr die Gründe, die er für seinen Aufstieg anführte, umkehren: Noch bevor ihn die Truppen seines Vaters in Britannien zum Kaiser ausgerufen hatten, machte er sich »im Stillen vor seinem geistigen Auge seine Gedanken«, wie er das Reich unter seiner Herrschaft einen konnte. Die Historiker, die von seinem frühen Streben nach der Alleinherrschaft sprachen, hatten folglich recht, ebenso die Redner, die sein Streben andeuteten.
Wie alle Kaiser vor ihm hoffte Konstantin auf göttliche Hilfe, schließlich auch auf den Beistand des Christengottes. Ihn erhob er vor dem Entscheidungskampf gegen den Götterverehrer Licinius zu seinem Schlachtenhelfer. Das war im Jahr 321. Zum ersten Mal bezeichnete er sich in diesem Jahr gegenüber den Christen in den africanischen Provinzen als ihr Glaubensgenosse. Von einem künftigen christlichen Reich sprach er damals noch nicht. Nur »im Stillen vor seinem geistigen Auge« kam ihm der Gedanke, er werde, falls er mit Hilfe des Christengottes endlich das Ziel erreichte, nach dem er »von Kindesbeinen an« strebte, als Diener dieses Gottes seine Religion im ganzen Reich verbreiten. Die Vermutung drängt sich auf, er habe mit dem Christengott eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit getroffen. Vor ihm bekannte der dankbare Sieger in seiner »Rede an die Versammlung der Heiligen«: »Mein eigenes Glück und das all der Meinigen schreibe ich deiner Güte zu. Zeuge dafür ist der Ausgang all dessen, worum ich gebetet habe, meine tapferen Taten, meine Siege und die Zeichen der Siege über meine Feinde.«54
Doch auf das künftige christliche Reich kam Konstantin hier wie auch sonst nicht mehr zu sprechen. Die Briefe an die Provinzialen und an Alexander und Arius sind die einzigen ausdrücklichen Zeugnisse. Fast scheint es, als habe er im Überschwang der gerade errungenen Alleinherrschaft die Realität für kurze Zeit vergessen. Denn noch hing die überwiegende Mehrheit seiner Untertanen den alten Göttern an und ließ sich höchstens auf dem geduldigen Papier zu Untertanen des Christengottes bekehren. Widerstand aus ihren Reihen, der sich bis zum Kaiserhof fortpflanzte, ist die naheliegende Erklärung für sein Schweigen. Aber das Imperium christianum blieb sein Fernziel.
Mit Blick auf das Fernziel förderte der Alleinherrscher Konstantin das Christentum noch nachdrücklicher, als er es bisher schon getan hatte. Doch die Förderung war keine Vorgabe, mit der er seit 306 die politischen Aufgaben anging, die sich ihm im Innern des Reiches und an den Grenzen stellten. Man darf sich von der eindrucksvollen literarischen Hauptquelle, Eusebius’ Leben Konstantins, nicht täuschen lassen. Wenn Aurelius Victor und die übrigen Historiker, die in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts Geschichtsabrisse verfassten, über Konstantins Bekehrung stillschweigend hinweggingen, zollten sie nicht nur ihrer Distanz zum Christentum Tribut. Politik und insbesondere die Machtpolitik, mit der der Kaiser seine Alleinherrschaft sicherte, folgte ihren eigenen Gesetzen und ihrem eigenen Gang. Die Bedeutung der Religion für den Herrscher, der sich göttlicher Hilfe versicherte, hätten sie nicht bestritten. Doch für sie war das Hauptthema des Bischofs Eusebius ein Nebenthema, und sie ließen die Frage offen, wie wichtig dieses Thema für Konstantin selbst im Regierungsalltag war. Sie hätten dem Verfasser des Buchs der Sprüche im Alten Testament recht gegeben: »Das Herz der Könige ist unerforschlich« (cor regum inscrutabile).55
Etwa im Jahr 336 verfasste Firmicus Maternus, ein Liebhaber der Literatur über Astronomie, Astrologie und Horoskope, eine Mathesis, in der er in acht Büchern sein Wissen zusammenfasste. Er widmete das Werk seinem Freund Egnatius Lollianus Mavortius, der nicht nur comes Orientis, sondern zugleich proconsul Africae war. Obwohl Heide, hatte er unter Konstantin diese außergewöhnliche Stellung erreicht und war schon für ein Consulat vorgesehen. In einem Gebet für das Herrscherhaus, mit dem er das erste Buch schloss, wandte sich Firmicus Maternus an die sieben Planetengötter, deren Reigen der Sonnengott eröffnete: »Sorgt dafür, dass Konstantin, der größte Kaiser, und seine unbesiegten Söhne, unsere Herren und Caesaren, dank eurer einhelligen Führung und eurem Gehorsam gegenüber dem Urteil des Höchsten Gottes, der für sie dauernde Herrschaft beschlossen hat, dass sie also noch über unsere Nachkommen und die Nachkommen unserer Nachkommen herrschen, damit das Menschengeschlecht, nachdem alle bitteren Übel vertrieben sind, die Geschenke eines ruhigen und dauernden Glücks erlange.«56
Zuvor hatte der Verfasser in einem Rückblick auf Konstantins Leben und Leistungen die Grundlagen beschrieben, auf der die dauernde Herrschaft der Kaiserfamilie ruhte. Es waren die Siege, die Konstantin über die Gewaltherrscher, also über Maxentius und Licinius, errungen hatte. Sie befreiten die Reichsbewohner aus der Sklaverei und bescherten ihnen Ruhe und Sicherheit. Nie habe den Kaiser »die unsicherste Sache im Menschenleben getrogen: das Kriegsglück«.57
Noch zehn Jahre nachdem sich Konstantin offen zum Christentum bekannt hatte, konnte sich Firmicus Maternus also gegenüber einem hohen kaiserlichen Beamten und den Römern, für die er sein Werk mitverfasste, die Freiheit nehmen, ein Dank- und Bittgebet für den Kaiser und seine Familie an die Planetengötter und ihren Höchsten Gott zu richten, der nicht der alleinige Gott der Christen war. Kluge Christen gaben ja längst zu, der Gott, den sie verehrten, sei der Höchste Gott, den auch alle anderen verehrten. War es nicht dieser Höchste Gott, der den Kaiser zur Herrschaft bestimmt und an sein Ziel geführt hatte? Und hatte Konstantin selbst das je anders gesehen, angefangen von seiner frühen politischen Laufbahn bis zu der Zeit, als er sein Ziel erreichte? Firmicus Maternus griff noch weiter zurück: »In Naïssus geboren, behielt er sich von der ersten Altersstufe an die Herrschaft über das Reich vor, und nachdem er sie unter günstigen Vorzeichen gewonnen hat, bewahrt er nun den römischen Erdkreis durch sein heilsames Lenken und Leiten zu immer größerem, ewigem Glück.« Gab es für einen zufriedenen Untertan, der auf die etwa 63 Lebensjahre und die 30 Regierungsjahre Konstantins zurückblickte und der weder Historiker noch Panegyriker war, Besseres und Schöneres über Leben und Leistung seines Herrschers zu sagen?58
2. Eine lange Vorgeschichte
Unter Gottes Führung habe er »heilbringende Taten« vollbracht, rühmte sich Konstantin im zweiten Brief an die Provinzialen. Dann gab er Gott das Versprechen: »Und wenn irgendwo ein öffentlicher Notstand ruft, werde ich denselben Losungen deiner Macht folgen und gegen die Feinde ziehen.«Da der Briefschreiber zuvor allein auf die Kriege gegen seine heidnischen Mitherrscher anspielte, die die Christianisierung des Reiches verhindert hatten, standen ihm bei einem möglichen »öffentlichen Notstand« zunächst ebenfalls innere Kriege vor Augen, weniger Feldzüge gegen äußere Feinde, die die Grenzen überschritten. Doch wer konnte im Innern den Alleinherrscher gefährden, der mittlerweile über die vereinigten Heere des Ostens und des Westens verfügte? Aus Konstantins Voraussicht sprach eine weit zurückreichende historische Erfahrung, die schon in Diokletians Tetrarchie eingeflossen war, also auch seinen Vater und ihn selbst seit vielen Jahren beschäftigte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!