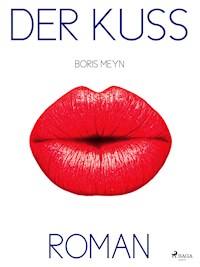7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Sonntag, Herbst und Jensen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der Tod wohnt in der Elbmarsch. Seine Hintermänner kennen keine Skrupel. Nahe der alten Dynamitfabrik Nobel an der Elbe wird eine Leiche gefunden. Der Tote war Heimatforscher und Vater einer an Leukämie verstorbenen Tochter: ein unbequemer Mann. Bei der Recherche stößt Kommissar Herbst bald auf unter den Teppich gekehrten Dreck aus sechs Jahrzehnten: immer noch sehr geheim, immer noch tödlich. Und er erfährt von einem Amerikaner, der im Frühjahr 1945 mit dem Fallschirm über Feindesland abspringt, einen Geigerzähler im Gepäck ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Ähnliche
Boris Meyn
Kontamination
Kriminalroman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Prolog
Der Krieg ist noch lange nicht verloren, mein Lieber. Sie werden schon sehen …» Mit einem zackigen Hitlergruß hatte Feldwebel Krüger die Wachstube verlassen. Anton hockte vor dem Bullerofen und starrte auf seine Kleidung. Die Wehrmachtsuniform war das Erste, was er verschwinden lassen musste, wenn sie kamen. Er hatte sich schon einen Satz unverfänglicher Kleidung zur Seite gelegt.
Die Tommys marschierten ungehindert auf die Elbe zu. Die Russen standen vor den Toren Berlins. Norddeutschland wurde zum Auffangbecken der aus dem Osten Flüchtenden. Der Krieg war verloren, daran gab es nichts zu rütteln. Wer jetzt noch an den Endsieg glaubte, dem war nicht zu helfen. Nur aussprechen durfte man es immer noch nicht. Das war tabu, wie so vieles. Nichts sehen, nichts hören und schon gar nicht über das sprechen, was doch jeder wusste. Auch Krüger musste es wissen. Er würde sich wahrscheinlich eine Kugel in den Kopf schießen, wenn es so weit war. Das war die naheliegendste Lösung für all diejenigen, die das Desaster mitzuverantworten hatten.
Anton hatte die Hasstiraden noch im Ohr, die Krüger bei seinen ersten Kampfreden in Möllers Gasthof herausgeschrien hatte. Dabei war er selbst nur ein kleines Rädchen in einer großen Maschine, die zu verstehen er nie genug Intelligenz besessen hatte. Dennoch war er einer der Ersten gewesen, die die Parolen der Partei wieder und wieder verbreitet hatten. Vielleicht gerade deshalb.
An sich hätte er das Geschäft seiner Eltern übernehmen sollen. Die Fischhandlung Krüger war ein Begriff gewesen in der Stadt. Aber der Glanz der Partei hatte ihn nach Höherem streben lassen, nach Macht und Ansehen. Vor allem nach Macht. Ohne Parteiabzeichen und Uniform war er ein Nichts gewesen, eine mickrige Figur mit zu kurz geratenem Hals und einer Visage, die ihm nicht einmal drittklassige Chancen bei der Damenwelt eingeräumt hätte. Vor allem nicht mit dem penetranten Geruch nach Fisch an den Händen. Uniform und gelackte Stiefel waren ihm da gerade recht gekommen.
Anton erinnerte sich noch genau daran, wie Krüger mit den Gesinnungsgenossen der ersten Stunde durch die Möllner Straßen gezogen war. Wer keine Zukunft hatte, der brauchte leere Versprechungen, die etwas verhießen. Und wenn es nur eine zwölfjährige Luftblase war. Nun drohte sie zu zerplatzen, unweigerlich. Dennoch hatten die Gedanken darüber noch keinen freien Lauf. Noch nicht. Die ständige Angst vor der Schutzhaft schwebte noch über den Menschen. Auch jetzt, wo alle, die mitgemacht und dieses System erdacht hatten, sich nun selbst vor Denunzianten fürchteten. Schon bald würde sich niemand mehr an Siegfried Krüger erinnern. Es war Zeit, dass es zu Ende ging.
Aber noch war es nicht so weit. Noch gab es einen Auftrag, den es offiziell zu erfüllen galt.
Wer war nur auf die Idee gekommen, diesen verdammten Zug hier abzustellen, den sie bewachen sollten? Jahrelang war die Fabrik verschont geblieben. Aber nun? Anton machte sich keine Illusionen. Wenn die feindlichen Fliegerverbände kamen, war alles zu spät. Sie würden wie ein Silvesterfeuerwerk in die Luft fliegen, alle. Mitsamt den Vergeltungswaffen, die man hier versteckt glaubte.
Allein der Name der Waffen war Programm. Vergeltung, wofür? Waren es nicht die überfallenen Nachbarstaaten, die sich zur Wehr setzten? War es jetzt nicht die Allianz, die Vergeltung wollte? Ein Überfall war es gewesen, nichts anderes, auch wenn Goebbels’ Brandreden jedem Deutschen das Gegenteil eingeimpft hatten. Es war doch nur Suggestion gewesen. Genau wie die Vergeltungswaffen.
Kapitel 1
Die wenigen Häuser am Ostufer waren der letzte Hinweis darauf, dass die gegenüberliegende Seite früher den deutsch-deutschen Grenzverlauf markiert hatte. Das mit Schilf gesäumte Ufer zeigte eine Idylle, wie sie wohl sehr lange schon bestand. Beobachtungstürme, künstlich angelegte Schneisen oder sonstige Kontrollstellen hatte es hier nie gegeben. Die hatten weiter im Hinterland gelegen. Wer hier wohnen oder zum See vordringen durfte, hatte Privilegien genossen. Hatte zur Führungselite gehört oder war zumindest ein zuverlässiger Funktionär gewesen. Von den Begünstigten des Systems war in der Regel keine Fluchtgefahr ausgegangen.
Eine seichte Morgenbrise verwirbelte das Spiegelbild auf der glatten Oberfläche des Sees. Das Schwanenpaar, das mit seinem Jungen am Ufer entlangschwamm, machte einen ausweichenden Bogen um den kurzen Steg. Außer dem Angler, der in seinem Ruderboot einsam inmitten des Sees trieb, war keine Menschenseele zu sehen. Während Gero sein Müsli auslöffelte, umschwirrte ihn eine große Libelle mit hektisch aussehender Flugakrobatik, bis sie einen geeigneten Platz für ein morgendliches Sonnenbad gefunden hatte. Fasziniert beobachtete er den schimmernden Glanz ihrer filigranen Flügel.
Die drei freien Tage würden ihm guttun. Lena hatte Verständnis dafür gehabt, dass er die Tage für sich allein haben wollte. Sie wusste nur zu genau, wann er eine Auszeit brauchte. Seicht plätscherte das Wasser gegen den hölzernen Schiffsrumpf. Gero nahm den Kessel vom Gaskocher und löste das Schokoladenpulver. Drei Tage ohne Kaffee, drei Tage keine Zigaretten und kein Alkohol. Fastenzeit am Ratzeburger See. Zum Seele-baumeln-Lassen war ihr Bootshaus genau der richtige Ort.
Wie lange war es her, dass sie hier gemeinsam ihre Wochenenden verbracht hatten? Die kleine Blockhütte war ihr Rückzugsort gewesen, abseits vom Trubel und Lärm der Stadt. Ein Refugium der Ruhe und der Entspannung. Erst seit sie ganz aus der Stadt geflohen und in Geros ehemalige Heimat im Lauenburgischen gezogen waren, hatten ländliche Abgeschiedenheit und die Arbeit am alten Hof das Bootshaus in Vergessenheit geraten lassen. Jetzt diente die kleine Hütte nur noch zum Lagern von Segeln und Bootsutensilien sowie als Notunterkunft, falls man von einem Gewitter überrascht wurde oder einen Platz zum Trocknen klammer Sachen benötigte.
Tatsächlich erschienen ihm die Räumlichkeiten viel beengter als vor zwanzig Jahren. Das mochte am vergleichbar üppigen Raumangebot ihres Hofes liegen – oder am fortgeschrittenen Alter. Die Sitzecke mit der kleinen Pantry, die winzige Veranda, die gerade eben zwei Stühlen Platz bot, und das offene Giebelgeschoss mit den beiden Matratzen, das man über eine angestellte Leiter erreichen konnte. Stehhöhe? Fehlanzeige. Aber immer noch komfortabler als die Kajüte und die Kojen auf dem kleinen Jollenkreuzer. Selbst den Kindern war die Hütte inzwischen zu spartanisch. Da sei ja nicht mal eine Dusche, hatte seine Tochter gemeint, als er ihr vorgeschlagen hatte, mit ihrer Clique an den Wochenenden doch einmal das Bootshaus zu beziehen.
In Gedanken sah er Charlotte noch als Kleinkind über den Steg krabbeln. Dieses Jahr wurde sie volljährig, was nichts daran änderte, dass sie vom Erwachsensein noch weit entfernt war. Zickig und launisch war sie, besserwisserisch und trotzig, voller romantischer Flausen. Spätpubertär eben. Gab es einen romantischeren Ort als diese Hütte? Gero seufzte. Hoffentlich brachte Charlotte von ihrem einjährigen Aufenthalt in Edinburgh neben ein klein wenig Lebenserfahrung auch eine Portion Reife mit nach Hause.
Einen Monat noch waren sie zu dritt. Auch Max hatte an der Hütte kein sonderliches Interesse. Sein Sohn bevorzugte die stickigen Gruppenräume der Ruderakademie. Momentan gab es nur Rudern und den Computer für ihn. Schule war lästiges Pflichtprogramm und Rudern mehr sportliche Gruppendynamik mit abendlichem Alkoholanschluss als Leistungssport oder Freizeit in der Natur. Auch das war heutzutage wahrscheinlich normal für einen Sechzehnjährigen. Nur keine falschen Freunde. Bislang hatten sie Glück gehabt. Gero hatte sich geschworen, den Kindern keine Vorhaltungen zu machen. Er selbst hatte in dem Alter auch nur Blödsinn im Kopf gehabt. Die kleinen Sticheleien am Rande konnte er sich dennoch nicht verkneifen. Vor allem beim morgendlichen Beisammensein am Frühstückstisch, wenn Max ihm eine Steilvorlage nach der anderen lieferte.
Der Adler, der bereits gestern seine Kreise über ihm gezogen hatte, suchte auch an diesem Morgen das Ufer ohne einen einzigen Flügelschlag ab. Geros Blick folgte dem schwerelosen Gleitflug, bis ihm die benachbarten Baumwipfel die Sicht auf den Vogel nahmen. Zeit zum Aufbruch. Nur nicht an die Dienststelle denken, keine Berichte, keine statistischen Auswertungen, kein bürokratischer Papierkrieg. Stell das Positive in den Vordergrund, hatte ihm Lena geraten. Du bekommst jetzt A13, das sind netto immerhin zwei Tankfüllungen mehr im Monat. Ein bitteres Grinsen hatte auch sie sich bei dieser Feststellung nicht verkneifen können.
Natürlich hatte Lena recht, er hatte überhaupt keinen Einfluss. Nachdem die Ratzeburger Polizeiinspektion im Laufe der Organisationsreform in Schleswig-Holstein zur Polizeidirektion geworden war, hatte sich so gut wie alles verändert. Er war zwar nach wie vor Leiter der Kriminalpolizeistelle und sogar zum Kriminalrat aufgestiegen, was jedoch nichts zu bedeuten hatte. Bis auf ebenjene zwei Tankfüllungen. Viel gravierender war, dass er einen Großteil des Arbeitstags nun mit verwaltungstechnischen Aufgaben füllen durfte. Eine Arbeit, die ihm nicht fremd war, deren zeitlicher Umfang allerdings alles bislang Dagewesene sprengte. Wie hatte es der Innenminister auf einer Pressekonferenz so schön formuliert? Die Halbierung der Dienststellen mit Führungs- und Stabsaufgaben käme vor allem der operativen Arbeit der Polizei zugute. Davon hatte Gero bisher noch nichts gemerkt, aber in Ratzeburg hatte es ja auch bislang keine Führungs- und Stabsaufgaben gegeben. Wie sollte er davon also Ahnung haben? Und da diese Aufgaben natürlich nur von Polizeidirektoren bewältigt werden konnten, hatte man ihm gleich zwei davon direkt vor die Nase gesetzt. Nicht dass er grundsätzlich ein Problem mit Hierarchien gehabt hätte, dafür war er einfach schon zu lange dabei. Was ihn jeden Tag aufs Neue fuchste, war der Umstand, dass Ahloff und Hennemann so leidenschaftliche Uniformträger waren. Bei öffentlichen Auftritten war nichts dagegen einzuwenden, aber im täglichen Innendienst mit allen Rangabzeichen über die Flure zu stolzieren kam Gero einfach albern vor.
Da hatte vor der Reform doch eine vergleichsweise entspannte und lockere Atmosphäre geherrscht. Anscheinend zu locker, jedenfalls nach Ansicht der Neuen. Nach einer Woche hatte es für die Kollegen der Kripo ein internes Rundschreiben mit der auffordernden Bitte gegeben, soweit Einsatz und Sachlage es zuließen, doch bitte Hemd und Krawatte zu tragen. Und das ihm, der gewöhnlich in den Sommermonaten nicht einmal Socken trug. Da half nur eins: Segel setzen und so schnell wie möglich aufs Wasser, bevor die Rentnerkapitäne mit ihren Dickschiffen das schmale Gewässer unsicher machten.
Gero inspizierte Plicht und Schwertkasten. Der nächtliche Schauer hatte keine Spuren hinterlassen. Er schlüpfte in seine Segelhose, löste die Leinen und schob das Boot behutsam am Steg entlang. Was für ein Tag. Noch eine Windstärke mehr, dann schaffte er es vielleicht bis zum Dom und wieder retour. An der Stegspitze zog er die Segel nach oben und nahm die Pinne in die Hand. Der Verklicker signalisierte Nordwest. Und immer noch kein Segel auf dem See. Gemächlich schob sich der alte Jollenkreuzer durch die Binsengräser aus der Uferzone. Gero ließ Schwert und Ruderblatt herunter, dann machte er es sich hinter dem Traveller bequem und legte die Beine auf die Grätings.
Gerade in dem Moment, als er feststellte, dass es doch eigentlich nichts Schöneres gab, als auf einem Segelboot allein über das Wasser zu gleiten, vernahm er das Piepen aus der Kajüte. Das SOS-Signal, das eine eingehende SMS signalisierte, war nicht zu überhören. Gero suchte nach seiner Lesebrille, ohne die er auf dem Display nichts lesen konnte. In der Ablage hinter dem kleinen Kartentisch fand er sie schließlich. Die Nachricht kam von Rörupps Diensthandy: Leichenfund auf dem Gelände der Kieswerke von Kirst in Weiningenhaus. Gruß Matthias.
Kapitel 2
Gordon Peacock klappte das Norden-Visier zur Seite und nickte stumm. «Good job», kommentierte der Navigator und beugte sich wieder über den Kartentisch. Peacock sagte nichts. Er hatte gerade Tonnen von Bomben ins Ziel geführt. Es war sein Job. Ob es gut gelungen war, wusste er in diesem Moment nicht zu sagen. Langsam tastete er sich aus der engen Kanzel nach hinten. Die Luke zum Fußraum des Cockpits stand offen. Der Lärm der Sternmotoren übertönte die immer noch anhaltenden Explosionen unter ihnen. Gleich würde es ernst werden, das ahnte er. Ein solches Geschwader würden sich die Krauts nicht entgehen lassen, zumal am helllichten Tag.
Als die Maschine nach Nordost abschwenkte, konnte er die Rauchschwaden am Hang sehen. Auf der anderen Seite blickte ihn der leere Bombenschacht wie ein zahnloses Gebiss an. Peacock dachte an Denver, an Lucy und die Kinder. Es waren nicht nur militärische Ziele, die sie anflogen. Er versuchte, seine Gedanken zu verdrängen. Immer noch kein Flakfeuer. Bisher waren sie kaum auf Gegenwehr gestoßen, es wirkte fast unheimlich. Peacock musste unweigerlich an ihren letzten großen Einsatz im Februar denken. Die Luft über Berlin war voller Jäger gewesen. Achtzehn Maschinen hatten sie verloren. Es wurde Zeit, dass die Sache zu Ende ging.
Wie verabredet schwenkte Larry Hartwell aus dem Verband aus und legte seine Gaylord auf neuen Kurs. Bis jetzt waren sie ungeschoren davongekommen, und es war eher unwahrscheinlich, dass sie einen einzelnen Bomber angriffen, wo doch ein ganzer Verband zu haben war. Dennoch hatte er kein gutes Gefühl bei der Sache. Ohne Begleitjäger war es auf dieser Höhe immer ein riskantes Unterfangen. Aber noch konnte er keine Höhe machen, was die Gefahr eines Angriffs vom Boden aus erhöhte. Noch einmal warnte er Jack ausdrücklich vor der verdammten Brücke am Kanal, um die der Verband einen Bogen machen sollte. Bei seinem letzten Rückflug waren sie am Hochdonn in ein massives Abwehrfeuer geraten. Hartwell wünschte den Jungs einen guten Rückflug, dann legte er die Kettenpanzer ab, die ihn an schnellen Bewegungen hinderten. Das Anschließen der elektrischen Heizung für Overall und Handschuhe konnte er noch etwas aufschieben. Er blickte auf Leutnant Steward Jackson, der abermals seine Ausrüstung kontrollierte. Ein Absprung am Tag war kein Kinderspiel, auch wenn das Zielgebiet abgelegen war. Einen verdammten Fallschirm sah man über viele Kilometer. Es war Wahnsinn, was Jackson vorhatte, aber der Mann wusste, was er tat. Es blieben ihm nur noch wenige Minuten.
Das Rattern der beiden Brownings des Heckschützen riss ihn aus seinen Gedanken. Hartwells Puls schnellte in die Höhe. Sie kamen also doch, um sich den Eindringling zu holen. Sollten sie es nur versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, in das Dauerfeuer einer der dreizehn Brownings zu geraten, war immer ein Risiko, aber sie versuchten es anscheinend dennoch. An Bord wurde es hektisch. Peacock stürzte zurück an den vorderen MG-Turm. Außer den Piloten hatte jetzt jeder Mann seinen Platz hinter den Bordmaschinengewehren. So behutsam wie möglich zog Hartwell eine enge Rechtskurve. Wenn er die Kiste nur endlich auf Höhe bringen konnte. Sein Blick fiel auf die Sauerstoffmasken, dann auf die Instrumententafel. Der Höhenmesser zeigte knapp 2000 Fuß. Nur noch wenige Meilen bis point zero. Egal, was auch geschah, Jackson würde springen. Das hatte er ausdrücklich betont. Hartwell hoffte, dass es nicht zum Äußersten kommen würde. Jetzt konnte er seinen Feind sehen. Ein Strahljäger. Ein einzelner, verdammter Strahljäger. Er flog ungefähr 200 Fuß unter ihnen. Die Biester waren so gut wie nicht zu treffen. Noch hatte er keinen einzigen Schuss abgegeben.
Steward Jackson kontrollierte ein letztes Mal die schützende Verpackung seiner Ausrüstung. Das Geschehen um ihn herum nahm er wie in Trance wahr, seine Gedanken waren allein bei seinem Auftrag. Auch wenn der Bombenschütze guter Dinge war, dass sie ihr Ziel getroffen hatten, endgültige Sicherheit hatten sie erst, wenn man die Sache am Boden überprüfte. Und dafür musste er runter. Es stand einfach zu viel auf dem Spiel. Sein Blick fiel auf Hartwell, der als Einziger eingeweiht war. Er wusste, wie wichtig diese Mission war. Vielleicht noch ein, zwei Minuten bis zum Absprung. Die Tür hatte er bereits entriegelt. Jackson wartete auf das «Go!» des Navigators. Es gab einen Schlag, dann nahm er einen unheimlichen Schatten wahr. Die Boeing kippte sofort zur Seite, und Jackson verlor das Gleichgewicht. Er rutschte über die Laufstege in Richtung Bombenschacht.
Kapitel 3
Das Gelände von Kirst war zerklüftet und unübersichtlich. Rund um den alten Baggersee war die Landschaft terrassiert, steile Rampen und unwegsame Fahrstrecken markierten das Gebiet. Über die Jahrzehnte hatte der Kiesabbau einen riesigen Krater in der sonst flachen Landschaft hinterlassen. Wo der Boden keine Schätze mehr hergab, reihten sich Berge von angehäuftem Schutt und Sand, Erdhaufen sowie Steine und Geröll in den unterschiedlichsten Sortiergrößen. Kies und Kieselsteine, wohin man auch blickte, aufgeschichtet zu einer bizarren Mondlandschaft. Dazwischen überdimensionierte Transportfahrzeuge, Bagger und Bulldozer sowie martialisch anmutende Sortier- und Zerkleinerungsmaschinen, verbunden mit einem Geflecht aus Förderbändern. Über allem lag eine gespenstische Stille.
Gero parkte seinen Wagen neben den anderen Einsatzfahrzeugen. Er nickte den beiden Beamten zu, die damit beschäftigt waren, zwei aufdringliche Reporter und ein Kamerateam vom Betreten des Geländes abzuhalten, dann hob er das Absperrband und machte sich zu Fuß auf den Weg nach unten. Die Leute der Spurensicherung waren dabei, Reifenabdrücke auf der Zufahrtsrampe zu sichern. Wer ihn kannte, grüßte freundlich. Von weitem schon konnte Gero die füllige Gestalt von Dr.Vetter erkennen, der mit tapsigem Schritt auf einem Laufband zu balancieren schien. Die anderen hatten sich an einer der riesigen Maschinen versammelt, in die das Laufband mündete. Matthias Rörupp nahm ihn als Erster wahr und kam Gero entgegen.
«Danke für die Benachrichtigung», sagte Gero und schüttelte dem Kollegen die Hand. «Ich hoffe, du interpretierst mein Erscheinen nicht falsch, aber ich hätte keine ruhige Minute gehabt.» Er blickte Rörupp entschuldigend an, doch der schien Geros Anwesenheit eher mit Erleichterung zu sehen. Spätestens übermorgen hätte er die Verantwortung an seinen Vorgesetzten abgetreten, und Geros Kommen ersparte ihm einen ausführlichen schriftlichen Bericht. Jedenfalls signalisierte das sein Gesichtsausdruck.
«Männlicher Toter, Alter schätzungsweise zwischen fünfzig und sechzig. Schussverletzung am Kopf. Wurde heute Morgen gegen sieben von einem der Arbeiter entdeckt.» Rörupp deutete auf eine Gruppe von Männern, die etwas abseitsstanden und neugierig zu ihnen herüberschauten. «Auf dem Förderband direkt vor dem Zerkleinerer. Wir haben ihn noch nicht heruntergeholt. Vetter ist gerade oben bei ihm.»
«Gut. Was sagt unser Trüffelschwein?» Gero schaute sich suchend nach Peter Schweim, dem Chef der Spurensicherung, um.
«Keine Ahnung, wo der steckt», entgegnete Rörupp. «Eben war er noch vorne an der Maschine. Das Interessante ist nämlich, dass sie kaputt ist. Nur deshalb hat man den Toten entdeckt. Wenn er zwischen die Walzen geraten wäre, hätte die Maschine Hackfleisch aus ihm gemacht.»
Gero schaute auf den Geröllhaufen unter der Maschine. Die Stücke, die aus dem Mahlwerk des Häckslers kamen, hatten maximal die Größe eines Spielwürfels.
«Also der Versuch einer Entsorgung?», fragte Gero. Im gleichen Moment merkte er, wie unpassend das Wort war, aber angesichts dieser martialischen Maschine fiel ihm auf Anhieb kein anderer Begriff ein.
«Die misslungene Entsorgung einer Leiche, ja. Bis auf Blutgruppe, Geschlecht und DNA hätten wir keine verwertbaren Spuren mehr gehabt. Wenn man überhaupt bemerkt hätte, was da aus der Maschine kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Männer bei ihrem Job ständig im Auge haben, was da aus dem Schredder purzelt. Nach ihrer Aussage laufen die Maschinen den ganzen Tag. Gefüttert werden sie quasi automatisch über die Laufbänder. Nur der Zufall wollte es, dass der Körper des Toten nicht in die Maschine geraten ist. Normalerweise drücken die Arbeiter morgens den Startknopf, und die Walzen fangen an, sich zu drehen. Da die Maschine aber gestern Nachmittag kaputtgegangen ist und man annahm, dass sich irgendetwas im Inneren verkeilt hat, wollten sie heute Morgen alles inspizieren.»
«Und dabei hat man die Leiche entdeckt», ergänzte Gero. «Dann brauchen wir Vetter und Schweim wohl nicht danach zu fragen, wie lange der Tote da schon liegt. Wann haben die Arbeiter denn gestern Feierabend gemacht?»
«Der Mann im Bürocontainer an der Waage sagt, um fünf Uhr seien alle weg gewesen. Er ist kurz darauf auch nach Hause.»
Gero schaute sich um. «Wie viele Leute arbeiten hier?»
«Zehn bis fünfzehn», antwortete Rörupp. «Gestern waren vormittags zwölf Angestellte hier, zwei sind am frühen Nachmittag vorzeitig in den Feierabend gegangen. Bis auf einen von ihnen haben wir schon alle durch. Keinem ist irgendetwas auffällig vorgekommen. Weder was die Lieferungen oder Transporte betrifft noch die Klientel. Manchmal kommen wohl Privatleute und suchen sich ein paar besondere Steine zusammen, hin und wieder auch mal ein Trupp von Hobbygeologen oder Archäologen von der Uni. Aber gestern sind hier nur wie üblich Lastwagen von unterschiedlichen Baustellen, Entsorgungsbetrieben und Landschaftsbauunternehmen im Werk gewesen. Wir haben schon eine Liste bekommen.»
«Was sagt der Besitzer?»
«Den Firmenchef haben wir natürlich informiert. Wenn wir Fragen haben, steht uns Herr Kirst jederzeit zur Verfügung.»
«Abgelegener Ort», murmelte Gero. «Keine direkte Nachbarschaft, keine Zäune … Der ideale Platz, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Oder für eine Abrechnung. Hier hört keiner einen Schuss. Was meinst du? Kommt vielleicht eine Tat aus dem Milieu in Frage?»
Rörupp schüttelte den Kopf. «Dafür gibt es keine Indizien. Auch Alter und Kleidung des Toten passen irgendwie nicht dazu.»
«Wissen wir schon, ob das Verbrechen hier geschah? Wurde der Mann in der Grube erschossen?»
«Keine Ahnung. Frag Vetter. Da kommt er gerade.»
Der Gerichtsmediziner brummelte irgendetwas Unverständliches, dann schaute er auf seine Armbanduhr. Ein kurzer Blick zu Rörupp, ein Kopfnicken, mehr nicht. Wie immer außer Atem, blieb er vor Gero stehen und musterte ihn. Schließlich sagte er lakonisch: «Etwa vierundzwanzig, mindestens zwölf, und genau neun.»
Gero blickte etwas gereizt zu Rörupp. «Was wollen uns diese Worte sagen?» Vetter und seine medizinischen Berichte waren immer für ein Rätsel gut. Der Mann hatte eine unvergleichliche Art, die Routine seiner Arbeit spannend wie ein Überraschungsei zu verpacken. Es hatte keinen Sinn, darauf einzugehen oder Kritik zu äußern. Man musste ihn so nehmen, wie er war. Das wusste auch Matthias. Die beiden Polizisten blickten ihn fragend an, und er lächelte, weil er das Unverständnis erwartet hatte.
«Der Mann hat vor etwa vierundzwanzig Stunden aufgehört zu atmen, liegt seit mindestens zwölf Stunden da oben und wurde mit sehr genau 9 mm erschossen. Das wird euch auch Peter Schweim gleich bestätigen. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher. Das war die Kurzversion. Der Rest, wie immer, später.»
«Dann brauchen Peter und seine Leute also nicht nach Projektil und Hülse zu suchen. Du meinst, Fundort ungleich Tatort?»
«Müsste mich schon sehr irren», brummte der Mediziner. Wenn er sich zu einer solchen Aussage hinreißen ließ, hieß das in der Regel, dass es so war. «Nein, ich korrigiere: Das ist eigentlich ausgeschlossen.» Er hielt einen Augenblick inne. «Das heißt … es sei denn, die Arbeiter hier wollten …» Vetter blickte die beiden verwirrt an. «Hey, was soll das? Das ist euer Job.» Er zog eine hämische Grimasse, drehte sich ertappt um und zog schnaufend davon.
Kurz darauf kam Peter Schweim auf die beiden zu. Sein Kopfschütteln signalisierte schon von weitem, dass er so gut wie nichts gefunden hatte. «Kaum verwertbare Spuren», meinte er zerknirscht. «Es muss hier in der Nacht ziemlich geschüttet haben. Vielleicht fördert das Labor etwas zutage. An der Maschine hat sich wohl jemand versucht, aber die vorhandenen Fingerabdrücke und Spuren sind kaum zu gebrauchen. Nicht ein einziger Abdruck, der eine eindeutige Identifizierung zuließe. Auch die Reifenspuren taugen nichts.» Er blickte Gero an. «Alles Matsch. Ihr solltet herausfinden, um welche Uhrzeit es hier heute Nacht gegossen hat. Der Mann wurde auf jeden Fall vorher hierhergebracht.»
«Eine Befragung im Nachbardorf scheint mir so oder so notwendig», sagte Rörupp. «Vielleicht hat doch jemand etwas gesehen oder gehört. Und wenn es nur die Scheinwerfer eines Autos waren. Die Ortsdurchfahrt ist sehr kurvenreich, und nachts herrscht hier bestimmt kein großer Verkehr.»
Gero nickte zustimmend. «Hast du irgendwas, das uns die Identifizierung erleichtern kann?»
Schweim schüttelte den Kopf. «Nein, ich habe eigentlich überhaupt nichts. Was wir an möglichen Spuren gefunden haben, wandert ins Labor. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nichts dazu sagen. Wenn es nach mir geht, können wir die Zelte hier abbrechen.»
«Gibt es noch etwas, das dagegenspricht?», fragte Gero in Matthias’ Richtung. Er erntete ein Schulterzucken. «Gut, dann könnt ihr meinetwegen abrücken.» Gero schaute zur Uhr. «Ich schlage vor, wir treffen uns in vier Stunden zur Lagebesprechung in der Dienststelle. Es wäre schön, wenn wir bis dahin einen Abgleich mit den aktuellen Vermisstenmeldungen haben und vielleicht schon erste Ergebnisse, was die Zeugenbefragung im Nachbarort betrifft. Die Staatsanwaltschaft informiere ich. Und … Matthias?» Er musterte seinen Kollegen und legte die Stirn in Falten. «Was die Lagebesprechung betrifft: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Direktion bei einem Tötungsdelikt anwesend sein wird. Also bitte denk daran, eine Krawatte umzubinden.»
Wider Erwarten fand die Sitzung im Ratzeburger Kommissariat ohne die Führungsebene statt. Auch Staatsanwältin Ines Wissmann sah zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, aus Lübeck anzureisen, bat Gero allerdings, sie auf dem Laufenden zu halten und sofort zu benachrichtigen, wenn erste Ergebnisse vorlägen. Conni Sonntag hatte noch zwei Wochen Urlaub, in dem sie ihren Umzug von Schwerin nach Lübeck organisieren wollte, und Jörn Lüneburg war wegen einer Sommergrippe seit einer Woche krankgeschrieben. So fand sich ein arg dezimierter Einsatzstab zur vereinbarten Zeit im großen Besprechungszimmer des Kommissariats ein. Matthias Rörupp gab das knappe Protokoll der Zeugenbefragung im Nachbardorf zum Besten, das allerdings kaum verwertbare Hinweise enthielt.
Von den 35 Anwohnern hatte man etwa die Hälfte angetroffen, aber niemandem war am Abend oder in der Nacht etwas Außergewöhnliches aufgefallen. Viele hatten vom Leichenfund in der benachbarten Kiesgrube noch gar nichts mitbekommen. Die meisten hatten vor ihrem Fernseher gesessen. Uneinigkeit herrschte darüber, wann es angefangen hatte zu regnen. Während die einen meinten, gegen zehn Uhr abends seien die ersten Tropfen gefallen, sprachen andere von einem heftigen Gewitterregen, der zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens eingesetzt habe. Auch zur Identität des Toten hatte keiner etwas beitragen können. Das vorgelegte Bild des Mannes hatte bei vielen zwar Entsetzen hervorgerufen, aber der Mann war hier anscheinend unbekannt.
Der Abgleich mit der Datei vermisster Personen, so hatte Paul Dascher danach erklärt, sei zwar noch nicht abgeschlossen, aber in den letzten drei Tagen seien weder in Schleswig-Holstein noch in den angrenzenden Bundesländern männliche Personen dieses Alters als vermisst gemeldet worden. Auch die Anfrage beim Erkennungsdienst hatte nichts ergeben. Die Fingerabdrücke des Toten waren in keiner Datenbank gespeichert. Sie mussten also abwarten, was Gerichtsmedizin und Kriminaltechnik an verwertbaren Hinweisen lieferten. Vielleicht ließ die Kleidung des Mannes Rückschlüsse auf dessen Identität zu. Mit Ergebnissen war jedenfalls nicht vor morgen Mittag zu rechnen.
Einig waren sich alle, dass der Täter oder die Person, die den Toten auf das Laufband gelegt hatte, über gute Ortskenntnisse verfügt hatte. Zumindest waren die Anlage und die Funktion der Maschinen vor Ort bekannt, woraus man wiederum schließen konnte, dass diese Person aus der Umgebung kam oder ihr die Anlage vielleicht aus beruflichen Gründen geläufig war. Vom Defekt der Maschine hatte die Person aber sehr wahrscheinlich keine Kenntnis gehabt. Dadurch schieden die meisten der dortigen Arbeiter als Verdächtige aus. Was vorerst blieb, waren die Listen der ankommenden Fahrzeuge im Werk. Die Berufsfahrer mussten ihre Ladung an der Waage gegenzeichnen, was eine Identifizierung relativ einfach machte. Aber im Durchschnitt rollten mehr als hundert Lkws täglich auf die Anlage, und der Gesuchte musste in den letzten Wochen nicht unbedingt vor Ort gewesen sein. Die systematische Auswertung dieser Listen war von daher beim jetzigen Stand der Dinge kaum zielführend, da auch viele Privatfahrzeuge aus der Umgebung, die nicht registriert wurden, auf die Anlage fuhren. Wer ein paar Steine oder einen Anhänger mit Mutterboden oder Sand holte, der zahlte meistens bar und ohne Quittung – davon war jedenfalls auszugehen, auch wenn die Vorschriften anders aussahen.
Für eine hitzige Diskussion sorgte das Vorgehen des Täters, sich des Leichnams zu entledigen. Verschleierung einer Straftat durch Vernichtung der Indizien.
«Das ist für mich ein deutlicher Hinweis auf eine brutale Mentalität des Täters», erklärte Dascher. Einige Kollegen stimmten ihm zu. «Das Zerstückeln eines menschlichen Körpers setzt eine ganz andere kriminelle Energie voraus als das Vergraben, Verbrennen oder Versenken einer Leiche.»
Andere widersprachen. «Der Täter wollte die Zerstückelung aber nicht selbst ausführen», gab ein junger Kollege zu verstehen. «Er wäre ja nicht mal dabei gewesen, wenn die Maschine den Plan in die Tat umgesetzt hätte.»
Gero fand, dass es beim derzeitigen Stand der Ermittlungen noch zu früh sei, an ein Täterprofil zu denken. «Was für Erkenntnisse gibt es denn über den Fundort?», fragte er in die Runde. Auch hier herrschte Uneinigkeit. «Können wir davon ausgehen, dass der Ort des Geschehens und damit die Art und Weise der Entsorgung gezielt ausgesucht gewesen ist, oder war das Areal nur die schnellste, weil örtlich naheliegendste Lösung?»
«Die Statistik legt jedenfalls den Verdacht einer Tat in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität nahe», meinte Matthias. «Streitigkeiten rivalisierender Banden mit Todesfolge enden sehr häufig an ähnlichen Schauplätzen, an verlassenen und einsamen Orten. Dafür spricht auch, dass man dem Toten sämtliche Papiere und Wertgegenstände abgenommen hat.»
«Das mag sein», konterte Dascher. «Aber die gleiche Statistik weist ein Durchschnittsalter der beteiligten Personen von 20 bis 30 Jahren, im Höchstfall ein Alter von Mitte 40 aus. Auch die äußere Erscheinung des Toten, Frisur und Kleidung, passen nicht ins Bild. Das Opfer ist mit Sicherheit über 50, hat fast schulterlange, graue Haare, und auch die Kleidung ist eher untypisch: lässige Turnschuhe, eine ausgewaschene Jeans, die Marke gibt es schon gar nicht mehr, schlichtes graues T-Shirt und ein beiges Cordsakko mit ledernen Aufnähern an den Ärmeln. Leute aus dem Milieu tragen so etwas nicht.»
Die Mehrheit der Anwesenden stimmte Daschers Einwand zu. Nichts passte wirklich zusammen, und Gero überkam eine Vorahnung, dass sie dieser Fall länger beschäftigen würde.
Die anderen mussten es ähnlich sehen. Vor allem weil das von ihm vor einiger Zeit eingeführte Brainstorming während der ersten Lagebesprechung noch nie zuvor in so unterschiedliche Richtungen geführt hatte. Jeder schien etwas anderes vor Augen zu haben. Auch nach vielen Jahren Kriminaldienst konnte sich Gero nicht daran erinnern, am Anfang eines Mordfalls, bei dem man die Identität des Opfers noch nicht kannte, jemals so unwissend dagestanden zu haben. Erfahrung und Intuition hatten bislang immer eine grobe Richtung vorgegeben, auf die sich die Ermittler konzentrieren konnten. Beziehungstaten, Tötungsdelikte aus Habgier, solche aus niederen Beweggründen – für alle diese Taten gab es Erkennungszeichen. Zum ersten Mal fühlte er sich, als habe er nichts in den Händen.
«Immer noch der alte Saab?» Die markige Stimme von Bernd Ahloff riss Gero aus seinen Gedanken. «Ich dachte, Sie hätten sich ein paar Tage freigenommen?» Auf dem Hof des Kommissariats quälte sich der Polizeidirektor umständlich aus dem tiefen Sitz seines deutschen Mittelklassefahrzeugs. Gehobene Mittelklasse, oder gehörte das neue Modell schon zur mittleren Oberklasse? Der Stern auf der Haube strahlte jedenfalls mit den Rangabzeichen an Ahloffs Uniform um die Wette. Gero lächelte stumm in sich hinein. Es gab nichts, was den Wagen aus der Masse moderner Mitkonkurrenten herausgehoben hätte. Alles sah mehr oder weniger gleich aus, und alle Hersteller versuchten, jede erdenkliche Nische mit einer gigantischen Modellpalette zu besetzen. Dennoch: Wer einen Mercedes in seinem Carport parkte, der hatte es geschafft. In kleinstädtischen Neubausiedlungen gab es keine Steigerung.
Gero hatte bereits einen bissigen Kommentar zur Abwrackprämie auf den Lippen, konnte es sich aber gerade noch verkneifen, schließlich war deren Inanspruchnahme momentan ein Indiz dafür, dass die automobile Nation dabei war, den Verstand zu verlieren. Anders war es für ihn nicht zu erklären, wenn Menschen für einen Zuschuss in der Größenordnung eines Monatslohnes reihenweise ihre intakten Fahrzeuge in die Schrottpresse beförderten.
«Gerade erst eingefahren», entgegnete Gero auf Ahloffs Feststellung, der Wagen habe ja auch schon einen beachtlichen Kilometerstand. Eine viertel Million war nichts für so einen alten Schweden.
Der Polizeidirektor rang sich ein Lächeln ab. Dann wurde er ernst. «Ich komme gerade von den Kollegen aus Geesthacht. Ich bin natürlich informiert worden. Ein Mordfall also … Gibt es denn schon Anhaltspunkte?»
«Wir kennen noch nicht einmal die Identität des Toten.»
«Sie haben also auch noch keine Presseerklärung aufgesetzt?»
«Nein. Ich denke, das macht erst Sinn, wenn wir etwas vorzuweisen haben.»
«Sehr vernünftig. Also erst einmal eine Nachrichtensperre.» Ahloffs Worte klangen gewohnt dramatisierend. Er reckte den Hals. «Wenn Sie in irgendeiner Form Unterstützung brauchen … Ich weiß ja, dass Ihre Abteilung momentan personell etwas gehandicapt ist.»
«Es ist ja nicht so, dass wir sonst Däumchen gedreht hätten. Sie kennen ja die Statistiken … Aber dennoch glaube ich, dass wir vorläufig ausreichend besetzt sind.» Gero wartete darauf, dass sich Ahloff verabschiedete; er hatte keine Lust mehr auf dieses formelle Geplänkel.
Endlich machte der Polizeidirektor Anstalten zu gehen, drehte sich aber abrupt wieder um.
«Ach, wissen Sie, Herbst … Das brennt mir ja doch auf der Seele. Solche Dinge … Also, die Sache mit Ihrem Sohn. Da sollten Sie aber dringend ein Wörtchen mit ihm reden.» Er blickte ihn erwartungsvoll an.
Gero war wie vom Schlag getroffen. «Max?», fragte er und versuchte vergeblich, seine Überraschung zu verbergen.
«Na ja, dass er erkennungsdienstlich erfasst wurde, wissen Sie ja sicherlich. Ich denke, das wirft kein gutes Licht auf …»
Geros Hals zog sich immer enger zusammen. Wovon redete Ahloff, verdammt nochmal? Was war los, und warum wusste er nichts davon?
«Also, es geht ja viel mehr um die Männer, in deren Begleitung sich Ihr Sohn befand.» Ahloff machte eine abwertende Handbewegung. «Nun, mit sechzehn, da passiert so etwas schon mal. Wenn ich da an meinen Ältesten denke, der hat mir in dem Alter auch Sorgen bereitet. Aber jetzt ist er ja in Kingston und studiert Wirtschaftswissenschaften.»
Komm zur Sache, du Lackaffe, dachte Gero. Sein Magen verkrampfte sich. Jetzt nur keine voreiligen Äußerungen. Nicht, bevor er genau wusste, was wirklich vorgefallen war. Aber wahrscheinlich musste er erst einmal noch die Glückseligkeit der Familie Ahloff über sich ergehen lassen. Das kannte er schon zur Genüge, die Geschichten von deren Wunderkindern, die gleich mehrere Jahrgänge in der Schule übersprungen hatten, ihre sportlichen Glanzleistungen und musischen Begabungen. Das letzte Mal hatte ihm Ahloff ausführlich von ihren Hausmusikabenden vorgeschwärmt. Zu Gesicht bekommen hatte Gero bislang keines der Kinder. Hubert und Käthe. Allein die Namen. Vor seinem geistigen Auge sah Gero eine pickelige Blockflötenspielerin mit Wollstrümpfen und langen Zöpfen, die vom bürgerlichen Pflichtprogramm der Eltern um die eigene Jugend gebracht wurde.
Ahloff genoss Geros Unwissenheit sichtlich.
«Antifa. Wenn ich das schon höre. Gegen welche Faschisten kämpfen die denn hier?» Er schüttelte demonstrativ den Kopf. «Da fehlt mir ein bisschen das Verständnis. Ziehen vermummt durch Geesthacht und brüllen irgendwelche unsinnigen Parolen. Und dann wundern sie sich, wenn die Ordnungshüter einschreiten. Der Junge von Stadtrat Neubauer war auch mit dabei. Er soll da sogar eine ganz aktive Rolle spielen. Immerhin hat er versucht, sich der Feststellung seiner Personalien zu entziehen. Der hat doch überhaupt keine Ahnung, was er seinem Vater damit antut. Also wenn Sie mich fragen, da muss doch was grundlegend falsch gelaufen sein bei der Erziehung. Aber egal. Was ich sagen wollte, ich fände es schön, wenn sich Derartiges nicht wiederholt. Das macht sich nicht gut, wenn die Presse davon Wind bekommt. – Nun, ich habe noch einen Haufen Arbeit auf dem Schreibtisch.»
Ahloff setzte seine Dienstmütze auf und nickte Gero zu. «Wir sehen uns dann morgen.»
Auch Lena wusste von nichts, was Gero noch mehr beunruhigte. Andererseits war beiden klar, dass sich solche Momente wohl nicht vermeiden ließen, schließlich wurden ihre Kinder langsam flügge, und in dem Alter erzählte man seinen Eltern eben nicht mehr alles. Dennoch verbrachten sie den Abend recht angespannt, bis Max endlich den Kopf zur Tür hereinsteckte.
«Ich glaube, wir müssen ein paar Worte reden», sagte Gero, bevor sich Max in sein Reich des allabendlichen Chats zurückziehen konnte. Der Tonfall, den er angeschlagen hatte, signalisierte, dass weder er noch Lena einen Aufschub duldeten.
Schuldbewusst und mit gesenktem Kopf setzte sich Max zu ihnen, sagte aber nichts.
«Gestern … in Geesthacht. Was war da los?», fragte Lena schließlich. «Meinst du nicht, dass wir das erfahren sollten?»
«Anscheinend wisst ihr’s ja schon», entgegnete Max, ohne den Kopf zu heben. Sein modischer Beatles-Pilzkopf verhinderte es so oder so, dass man ihm in die Augen schauen konnte.
«Also, was war los?», wiederholte Gero. «Wir haben dir noch nie den Kopf abgerissen, wenn du irgendwelchen Mist gebaut hast.»
«Was heißt Mist?», erwiderte Max nun aufgebracht. «Wir waren auf der Demo gegen die Wiederinbetriebnahme von Krümmel. Dieser Schrottreaktor darf nicht wieder ans Netz. Das ist doch eine Riesensauerei, was da passiert.»
«Mit wem warst du denn da?», fragte Lena.
«Mit Ole und Dennis. Selbst Herr Schaffner, unser Physiklehrer, war da. Da ist doch nichts dagegen einzuwenden, oder?»
«Im Prinzip nicht», meinte Gero. «Nur wüssten wir trotzdem gerne vorher Bescheid, wenn du auf eine Demo willst. Glaub nicht, dass deine Eltern so etwas früher nicht gemacht haben.» Er warf Lena einen Blick zu.
Nachdem klar war, dass keine elterlichen Sanktionen zu erwarten waren, brach das Eis, und Max berichtete, was im Anschluss an die Demo geschehen war. Demnach hatten sie neben vielen Bekannten und Mitschülern auch Lenny Neubauer aus der Dreizehnten getroffen. Der war mit einer Gruppe Hamburger Freunde gekommen, die schon etwas älter waren und wohl häufiger auf Demonstrationen gingen. Als er das hörte, hatte Gero sofort die schwarz vermummten Gestalten aus den Hamburger Krawallvierteln Hafenstraße, Schanze und ähnlichen Kulminationspunkten vor Augen, sagte aber nichts, sondern ließ Max weitererzählen. Nach der Demo seien sie mit Lenny und seinen Freunden noch nach Geesthacht in die Fußgängerzone gegangen, um ein Eis zu essen. Gero dachte an die Jugendgangs in der Geesthachter City, die bei ihren Zusammenkünften in der Regel eher Bierflaschen als Eistüten in den Händen hielten. Er konnte sich schon vorstellen, wie das gestern ausgesehen hatte, wollte aber den Redefluss seines Sohnes nicht unterbrechen.
«Okay, und wir saßen da ganz friedlich in lockerer Runde, das Wetter war super und die Stimmung auch ganz cool, als Weezel, das ist ein Kumpel von Lenny, von zwei so Fascho-Typen wegen seiner orangen Haare angemacht wird.»
«Fascho-Typen?», hakte Gero nach.
«Ja – keine Glatzen, sondern eben so Deutsch-Russen, die einen auf Klitschko machen.»
«Russen? Fascho-Typen? Sag mal, wie redest du eigentlich? Und seit wann findet man dich auf Demonstrationen? Habe ich was verpasst? Ich dachte bislang eigentlich …»
Lena signalisierte mit einer Handbewegung, dass Gero seinen Tonfall etwas mäßigen musste, wenn er das Gespräch weiterführen wollte.
«Und dann?», fragte sie mit sanfter Stimme.
Max zuckte die Schultern wie ein Unschuldslamm. «Irgendwer muss dann die Polizei informiert haben. Die kamen dann auch mit einem Mannschaftswagen von der Demo angerollt. Volles Bürgerkriegs-Outfit, sag ich euch. Aber nicht, dass die sich um die Faschos gekümmert hätten – unsere Ausweise wollten die.»
«Feststellung der Personalien», erklärte Gero überflüssigerweise.
«Das mag ja sein», hielt ihm Max entgegen, «aber das kann man auch freundlich abwickeln, ohne einen gleich auf den Boden zu zerren. Lenny ist dann völlig ausgerastet, hat die Typen beschimpft und um sich getreten. Tja, das war’s dann eigentlich auch schon. Nachdem sie unsere Namen notiert hatten, haben sie uns ziehen lassen. Also, alles nicht der Rede wert.»
«Bis auf den Umstand, dass dein Vater auch bei dem Verein ist.»
«Na, das ist ja wohl was anderes. Du bist bei der Kripo.»
Gero machte einen tiefen Seufzer. «Das macht doch im Prinzip keinen Unterschied. Und das weißt du eigentlich auch. Jedenfalls wurde ich heute von Polizeidirektor Ahloff auf die Sache angesprochen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Ich hatte nichts, was ich ihm hätte entgegenhalten können. Keine Info – ich wusste von nichts. Ich stand da wie ein kleiner Junge, dem man eine Standpauke hält und der nicht weiß, was er ausgefressen hat. Richtig vorgeführt hat der Typ mich. Und das, wo ich den Kerl so oder so gefressen habe … Das war absolut grenzwertig. Wenn du uns etwas erzählt hättest, was glaubst du, wie ich ihm die Meinung hätte sagen können. Aber so? Ich stand da wie ein Vollidiot.»
Max presste die Lippen aufeinander und schaute seinen Eltern nacheinander in die Augen. «Kommt nicht wieder vor», sagte er schließlich. «Versprochen.»
Kapitel 4
Der Jäger hatte noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Der Pilot schien seine Überlegenheit zu genießen. Wie eine Katze, die zuvor noch mit ihrem Opfer spielen wollte, umkreiste er sie. Er musste versuchen, den Jäger von unten angreifen zu lassen. Die größte Chance des Kugelturmschützen war es, ihn im Anflug frontal unter Feuer zu nehmen, da verfiel der Vorteil seiner enormen Geschwindigkeit. Hartwell zog die Boeing langsam in den Steigflug. Er hatte die ME nur für einige Sekunden aus den Augen verloren, aber was er jetzt sah, verschlug ihm den Atem. Als er gewahr wurde, was der Pilot der Messerschmitt vorhatte, war es auch schon zu spät. Mit einem schrecklichen Krachen bohrte der Jäger seine Nase von hinten in die rechte Tragfläche.
«Out! Out of here!», schrie Hartwell in das Kehlkopfmikro des Bordfunks. Im gleichen Augenblick kippte der Horizont, und die B-17 schmierte mit einem jaulenden Kreischen nach links ab. Hartwell dachte an den Mann im Kugelturm, der in seiner gläsernen Kanzel gefangen war und sich ohne fremde Hilfe nicht befreien konnte. Dann dachte er an ihre Mission. Aber für irgendwelche Handlungen war es längst zu spät. Er musste schleunigst raus aus der Maschine.
Wie gebannt starrte Steward Jackson auf den zweigeteilten Rumpf der fliegenden Festung, der eine regelrechte Schneise in den Wald gerissen hatte. Kurz war ihm, als hätte er einen weiteren Fallschirm gesehen, bevor ihm der Aufprall alle Sinne raubte. Natürlich waren sie für einen geordneten Absprung viel zu niedrig gewesen. Jackson wusste nicht, in welcher Höhe sie sich befunden hatten, es grenzte an ein Wunder, dass er aus dem Bomber herausgekommen war. Der Schirm hatte sich gerade vollständig geöffnet, als die Boeing in den Wald stürzte. Wenige Sekunden später war der Sprung bereits zu Ende gewesen.
Erleichtert stellte Jackson fest, dass er sich nichts gebrochen hatte. Alles nun Folgende war genauestens einstudiert. So schnell wie möglich raffte er den Fallschirm zusammen und stopfte das Bündel tief unter die Wurzeln eines umgekippten Baumes. Dann hastete er durch das Unterholz und hielt nach einem geeigneten Versteck Ausschau. Wenn man seinen Schirm am Himmel gesehen hatte, würden sie sich auf die Suche nach ihm machen, so viel war sicher. Aus der Ferne konnte er bereits Stimmen vernehmen. Gut hundert Meter trennten ihn vom Wrack des Flugzeugs. Dorthin würden sie als Erstes rennen. Jackson versuchte, sich zu erinnern, was er aus der Luft hatte sehen können. Sie waren in der Nähe dieses Kanals gewesen, der von der Elbe zur Ostsee führte, aber er wusste nicht, auf welcher Seite und auf welcher Höhe er sich befand. Die Stimmen wurden lauter. Offenbar hatten sie das Flugzeug erreicht.
Das Versteck lag zwar verdächtig nah am Waldrand, aber die alte Futterkrippe sollte ihm genug Deckung geben. Wenn er den Kopf in die Höhe reckte, konnte er durch das hohe Gras sogar den Weg sehen, über den die Leute gekommen sein mussten. Dahinter lagen Wiesen und Felder, aber kein Wasser. Stück für Stück setzte sein Orientierungssinn die Bilder, die er von oben in Erinnerung hatte, zu einem sinnvollen Ganzen zusammen. Jackson zog die Karte aus seiner Jacke, faltete sie aber rasch wieder zusammen. Er war viel zu weit östlich. Ein Kanal oder ein Fluss waren nicht eingezeichnet. Jetzt erinnerte er sich. Eine Bahnlinie. Er hatte auch eine Bahnlinie gesehen. Seine Beine schmerzten. Er presste seinen Körper dichter an den Boden, als erneut Gestalten auf dem Weg auftauchten, aber niemand blickte in seine Richtung. Das plötzlich einsetzende Gejohle kündete davon, dass man auf etwas gestoßen war. Kurze Zeit später konnte Steward Jackson erkennen, was man gefunden hatte. Es war Hartwell. So, wie es aussah, hatte auch er noch rechtzeitig aussteigen können. Was war mit den anderen? Hatte sich noch jemand aus der Maschine retten können?
Hartwell schien ebenfalls unverletzt zu sein. Aber das waren keine Soldaten, die ihn mit sich führten. Er konnte die Männer gut verstehen. Die wenigen Worte Deutsch, die er kannte, reichten aus, um ihr Vorhaben zu erahnen. Es waren aufgebrachte Zivilisten, die sich an der Besatzung eines feindlichen Bombers rächen wollten. Jackson tastete nach seinem Revolver, aber die Tasche war leer. Er musste ihn beim Aufprall verloren haben. Dann dachte er an seinen Auftrag. Hauptsache, die Instrumente hatten keinen Schaden genommen. Aber das konnte er hier an Ort und Stelle nicht kontrollieren. Er musste ausharren, bis ihm die Dunkelheit Schutz gab.
Ein Knacken hinter ihm ließ ihn schlagartig herumfahren.
Kapitel 5
Die Schatten der Rotoren flogen in aberwitziger Geschwindigkeit über Straße und Felder. Es schien, als ermahnten ihn die großen Windräder, die er auf dem Weg von Gudow in die Dienststelle passierte, das morgendliche Gespräch über Kernenergie und deren Risiken nicht zu vergessen. Das Thema Energiepolitik war zu komplex, als dass man es am Frühstückstisch hätte abhandeln können. Außerdem war Gero nicht mehr in der Materie. Max hatte die sicherheitsrelevanten Störfälle und Daten des Reaktors sofort parat gehabt und wie ein Politiker gebetsmühlenartig aufsagen können, schließlich hatten sie das Thema im Physikunterricht behandelt. Genau das war es wohl, was Gero stutzig gemacht hatte. Bislang war es noch nicht vorgekommen, dass Max sich von einem schulischen Stoff so hatte beeindrucken lassen. Jedenfalls nicht so, dass er sich auch während seiner Freizeit mit einem Thema befasste.
Wie er diesmal jedoch darüber gesprochen hatte, war es für ihn deutlich mehr als die Faszination, die für einen Jugendlichen von der aufwühlenden Gruppendynamik einer Demonstration ausgehen konnte. Er hatte sich offenbar ernsthaft mit der Problematik der Kernenergie befasst, und da blieb es natürlich nicht aus, dass Max mit Aktivisten und Kritikern Tuchfühlung bekam. Etwas Sorge bereitete Gero lediglich die Vorstellung, dass Max durch sein Engagement eben auch mit Leuten zusammentraf, für die Demonstrationen nur ein inhaltsleerer Raum waren, der die Möglichkeit zu Randale bot.
Dennoch nahm er sich vor, diese Gefahr nicht in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr wollte er die Gelegenheit nutzen, mit seinem Spross ein paar ernsthafte, themengebundene Gespräche zu führen. Dazu hatte er in letzter Zeit kaum Gelegenheit gehabt, weil alles, womit sich Max sonst so beschäftigte, eher die typischen pubertären Probleme waren, bei denen ein elterlicher Rat erfahrungsgemäß kaum akzeptiert wurde. Energiepolitik bot da schon eine ganz andere Gesprächsgrundlage, immerhin gehörte er selbst der ersten Generation an, die sich zwangsläufig mit den Gefahren der Kernenergie auseinandergesetzt hatte.
Gero war im Schatten dieses Atommeilers aufgewachsen. Als das Kernkraftwerk 1984 ans Netz ging, hatte er zwar nicht mehr dort gewohnt, aber die Bauzeit und die damit einhergehenden Proteste seit 1973 hatte er hautnah miterlebt.