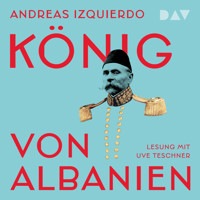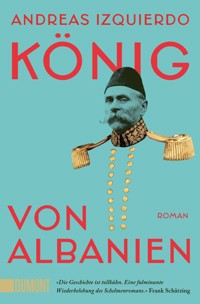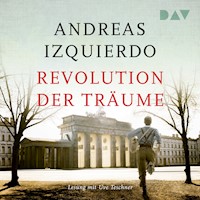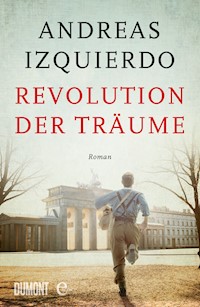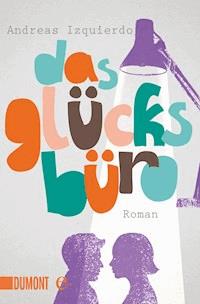9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wege-der-Zeit-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Berlin 1922: Die Weimarer Republik steuert auf die Inflation zu, die Nachwehen der Revolution haben sich noch nicht ganz gelegt – und die Feinde der Demokratie stehen längst in den Startlöchern. Artur, Isi und Carl entgehen nur knapp einem Mordanschlag. Eine Gruppe rechter Verschwörer will sie tot sehen. Der Feind scheint übermächtig, aber er hat sich mit dem Falschen angelegt: Artur schlägt gnadenlos zurück und treibt die Verschwörer vor sich her. Carl leidet derweil unter Regisseur Fritz Lang, für den er an Dr. Mabuse arbeitet, und trifft drei deutsche Ingenieure, die der UFA eine bahnbrechende Idee präsentieren: den Tonfilm. Doch die Widerstände gegen die neue Technik sind groß. Und dann ist da noch die Sorge um Isi, die seit dem Anschlag Streit mit jedem sucht, der sich ihr in den Weg stellt. Die Ereignisse überschlagen sich: Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Bei einer Verurteilung droht ihr die Todesstrafe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Ähnliche
BERLIN 1922: Die Weimarer Republik steuert auf die Inflation zu, die Nachwehen der Revolution haben sich noch nicht ganz gelegt – und die Feinde der Demokratie stehen längst in den Startlöchern. Artur, Isi und Carl entgehen nur knapp einem Mordanschlag. Eine Gruppe rechter Verschwörer will sie tot sehen. Der Feind scheint übermächtig, aber er hat sich mit dem Falschen angelegt: Artur schlägt gnadenlos zurück und treibt die Verschwörer vor sich her.
Carl leidet derweil unter Regisseur Fritz Lang, für den er an Dr.Mabuse arbeitet, wird bei der UFA aber immerhin Zeuge einer echten Revolution: Der sprechende Film startet seinen Siegeszug. Doch die Widerstände gegen die neue Technik sind groß. Und dann ist da noch die Sorge um Isi, die seit dem Anschlag Streit mit jedem sucht, der sich ihr in den Weg stellt. Ihr kompromissloses Verhalten führt schließlich in die Katastrophe …
›Labyrinth der Freiheit‹ ist ein Buch, das einen nicht loslässt. Dicht erzählt, temporeich, spannend, genauestens recherchiert zeigt es das Berlin jenseits der Goldenen Zwanziger.
© Katrin Lorenz
ANDREAS IZQUIERDO ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, unter anderem ›Das Glücksbüro‹ (2013), den SPIEGEL-Bestseller ›Der Club der Traumtänzer‹ (2014) und ›Fräulein Hedy träumt vom Fliegen‹ (2018). Zuletzt erschienen ›Schatten der Welt‹ (2020), ausgezeichnet mit dem bronzenen Homer, und ›Revolution der Träume‹ (2021). ›Labyrinth der Freiheit‹ setzt die darin begonnene Geschichte der drei Freunde Carl, Artur und Isi fort. Andreas Izquierdo lebt in Köln.
ANDREASIZQUIERDO
LABYRINTHDER FREIHEIT
Roman
Von Andreas Izquierdo sind bei DuMont außerdem erschienen:
Das Glücksbüro
Der Club der Traumtänzer
Schatten der Welt
Revolution der Träume
E-Book 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: © Maggie Brodie/Trevillion Images,
© Mark Owen/Trevillion Images,
© Magdalena Russocka/Trevillion Images,
© ullstein bild Dtl./Kontributor
Karte: © Rüdiger Trebels
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8255-7
www.dumont-buchverlag.de
DER ANRUF
1
Noch Sekunden vor dem Anruf ist es, als hätte die Welt aufgehört zu sein.
Alles ist schwarz, alles ist still. Draußen strecken sich die Straßen leer und verlassen der gefrorenen Stadt entgegen. Kein Mensch geht, kein Wind weht, und in ihrem Zimmer verdichtet sich die Stille zu einer Finsternis, die alles auflöst: Da ist weder Stuhl noch Schrank noch Boden noch Wand.
Es ist drei Uhr in der Früh, als das Böse ins Haus schleicht und sich in ihrem Traum langsam aufrichtet: Es sucht das Zimmer ohne Licht, das Bett, das ihr endlich Bahre werden soll.
Sie träumt.
Sie träumt nicht.
Silberfunkelnd streichen ihre Fingerkuppen über die Grenze zum Bewusstsein.
Im Krieg überlebten meist die, deren Sinne unentwegt auf den Tod ausgerichtet waren. Die, die es schafften, sich ihn zum Verbündeten zu machen, dessen verborgene Zeichen sie im entscheidenden Moment einen Schritt zur Seite treten ließen, damit er einen anderen statt ihrer mit sich reißen konnte. Der Preis für das Überleben war ein Gefühl der Schuld. Man entkam dem Tod und landete zur Belohnung im Fegefeuer des Seins.
Plötzlich das Telefon.
Eigentlich schnurrt es, aber das Haus, in dem Isi lebt, ist recht groß. Sie hat das Klingeln so oft überhört, dass Artur chromblitzende Schellen hat anbringen lassen. Ein hartes, schmetterndes Geräusch ertönt, so laut, dass es sogar noch in den Pausen die Luft erzittern lässt und die heimlichen Schritte auf spitzen Zehen unhörbar macht.
Sie aber fährt auf in ihrem Bett, aus dem Traum gefallen wie durch dünnes Eis. Ihr Herz pocht hart, leise keuchend stößt sie Atem aus, während sie mit aufgerissenen Augen versucht, ruhig zu bleiben, klar zu denken.
Sie sind da!
Wie naiv anzunehmen, dass sie sie, bei allem, was in den letzten Monaten passiert ist, einfach übersehen würden. Ausgerechnet Isi, die keiner Konfrontation aus dem Weg geht – nicht einmal, wenn ihre Gegner übermächtig und kaltblütig sind.
Was soll sie tun?
Sie ist allein.
Sie hat keine Waffen.
Und die Zimmertür lässt sich nicht verschließen.
Vorsichtig setzt sie die nackten Füße auf den Boden und spürt, wie ihr Nachthemd an den Fesseln ausschwingt. Es ist eiskalt, das Zimmer unbeheizt, irgendwo vor ihr muss die Tür sein. Sie könnte einen Stuhl unter die Klinke klemmen und hoffen, dass das, was draußen ist, nicht hineinkommt. Sie könnte zum Fenster eilen und in die eisige Dezembernacht hinausklettern, ein Gedanke, der sie unwillkürlich ihren Arm schützend über ihren schwangeren Bauch legen lässt.
Tastend findet sie den Lichtschalter am Eingang und drückt ihn mit einem sanften Klicken herab: kein Strom mehr.
Da weiß sie, dass es nur einen Weg gibt.
Es hat für sie immer nur einen Weg gegeben.
Sie wird kämpfen.
Lautlos drückt sie die Klinke nach unten, die Tür springt auf, ein schwacher Luftzug weht hinein.
Vor ihr liegt die Treppe.
Und unten schrillt der Tod.
Doch nicht überall herrscht nachtschwarze Stille.
Im Arcasi toben der Polizeistunde zum Trotz die Ruchlosen, deren Gejohle dumpf bis auf den Bürgersteig zu hören ist, wo wie zum Hohn die Leuchtreklame blinkt, während das restliche Viertel der Sparzwänge wegen im Dunkeln liegt. Strom gibt es nur für Gewinner. Hier am Schlesischen gibt es davon nur wenige, dafür aber unendlich viele Verlierer.
Das Arcasi.
Tempel der Spaßgesellschaft.
Palast der Glücksritter, deren Amüsiersucht kein Morgen kennt. Die zum wilden Rhythmus der Kapelle tanzen, sich in den Armen liegen, wohl wissend, dass sie alles Geld verprasst haben und ab Tagesanbruch hungern werden.
Vor dem Arcasi schleichen die Huren herum, picken auf, was die Nacht ihnen an Resten lässt, und steuern unter den scharfen Pfiffen ihrer Zuhälter mit den armseligen Gestalten ins nächste Stundenhotel: zu sehen, was noch übrig ist.
Drinnen dagegen verlangen sie nach mehr: mehr Musik, mehr Alkohol, mehr Vergnügen. Bald wird Weihnachten sein, das vierte nach dem großen Krieg, und nichts hat sich gebessert. 1922 naht, und alle ahnen, dass es nur noch schlimmer wird. Was also könnte man anderes tun, als dieses Elend zu feiern?
Artur steht mit verschränkten Armen an einer Ecke des Tresens, blickt wie der Kapitän eines verrückt gewordenen Piratenschiffs über das Deck derer, die ihn, den Zeremonienmeister mit der Gesichtsmaske, ebenso verehren wie fürchten.
Auf der Bühne stampft die Kapelle Gassenhauer und neuerdings auch den neusten Jazz aus Übersee, den die Musiker von importierten Schallplatten dem Gehör nach für ihre Instrumente transkribiert haben.
Von den Spiegeln rollt der Schweiß, Pärchen knutschen, und Harry, unermüdlicher Conférencier, nutzt die Pausen des Orchesters für lockere Sprüche und derbe Witze, was die, die eigentlich müde sind, wieder munter macht. Und durstig.
Plötzlich das Telefon.
Es ist das gleiche, das auch Isi besitzt, genauso umgebaut, nur dass in diesem Lärm der Anruf zunächst ins Leere geht. Niemand hört das metallische Geschepper der Klingel, bis Artur zufällig das Hämmerchen wild auf die Schellen trommeln sieht.
Er geht ran und ruft: »JA?!«
Das Fräulein vom Amt antwortet wie durch ein tiefes Rohr: »Anruf von einer Frau von Torstayn. Soll ich durchstellen?«
»JA!«, ruft Artur gegen den Lärm zurück.
Er lauscht, aber die Leitung bleibt still.
»ISI?«
Schweigen.
Einige Sekunden lauscht Artur noch, hält sich dabei einen Finger gegen das freie Ohr. Dann ruft er: »IST NOCH JEMAND IN DER LEITUNG?«
Das Fräulein vom Amt meldet sich wieder: »Die Leitung ist frei, mein Herr.«
»ISI?«, ruft Artur wieder.
Wieder nur Schweigen.
»HALLO? SIND SIE SICHER, DASS FRAU VON TORSTAYN ANGERUFEN HAT?«
»Ja, mein Herr. Obwohl …«
»OBWOHL WAS?«
»Nun, sie klang seltsam, mein Herr. Irgendwie schwach, würde ich meinen …«
Artur ist augenblicklich alarmiert: »WAS HEISST DAS?!«
»Als ob sie sehr krank wäre. Ich konnte sie kaum verstehen.«
Artur legt auf.
In seinem Kopf platzen die Gedanken wie Regentropfen auf einen See: Ist etwas mit dem Kind? Aber würde sie dann nicht einen Arzt rufen? Oder ist eingetreten, womit zu rechnen war? Haben sie das Feuer eröffnet? Die Boysens? Die von Torstayns? O.C.? Das ganze rechte Pack?
Alle wissen, wie hart Artur zurückschlagen kann, wenn er muss. Jeder kennt die Geschichten von Silber-Kurt oder der Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Haben sie es trotzdem gewagt? Haben sie ihn wirklich dort angegriffen, wo er am verletzlichsten ist?
Artur sucht Arnies Blick, winkt ihn rasch zu sich und setzt ihn in Kenntnis.
Dann stürzt er nach draußen und springt in seinen Wagen.
Bitte nicht, fleht er in Gedanken.
Bitte nicht.
Kurz vor drei Uhr in der Früh erwache ich aus einem Traum.
Es ist immer derselbe Traum, und er verfolgt mich seit dem Tag, an dem ich Ernst Lubitsch am Lehrter Bahnhof habe stehen lassen. Ausgerechnet ihn, meinen Förderer, den Mann, der mir das Tor zur Welt aufstoßen wollte.
In diesem Traum stehe ich auf einem Schlachtfeld hinter einer Kamera und sehe auf die bizarren Bombentrichter, auf die windschiefen Stacheldrahtverhaue und schnurgeraden Gräben, das zerschossene Material, die Pferdekadaver und Soldaten. Jemand hat ein Strohfeuer entzündet, sodass Rauchschwaden geheimnisvoll über die aufgeworfene Erde treiben, und überall eilen Schauspieler und Komparsen herum, um die Kriegsszenerie möglichst akkurat nachzustellen. Alles vor mir ist nur Staffage: eine Bühne für einen Film. Nur die Pferdekadaver sind echt, eigens vom Schlachthof für diese Aufnahmen eingekauft.
Lubitsch läuft zwischen Schauspielern und Komparsen hin und her, wie immer eine Zigarre im Mundwinkel, eine lustige kleine Lokomotive, die Rauch in Wolken auspafft, während er erklärt, gestikuliert, ja dirigiert, als hätte er die Berliner Philharmoniker vor sich.
Dann winkt er mir zu.
Durch das Objektiv visiere ich die Szenerie an, drehe die Kurbel meiner Kamera, aber statt des vertrauten Surrens spüre ich plötzlich Maschinengewehrfeuer und sehe bereits im nächsten Moment die Geschosse in die Gruppe einschlagen. Ich will die Kurbel loslassen, aber ich kann nicht, drehe nur umso schneller, wobei Salve um Salve die Menschen vor mir bestreut und sie in absurden Todestänzen zu Boden gehen lässt.
Lubitsch steht ganz still da – die Zigarre kraftlos im Mund.
Seinem Gesicht, seinen Augen sehe ich an, dass er den Verrat begreift, dann schlagen die Kugeln auch in seinen Körper, und ich erwache mit einem Schrei.
Seit zwei Wochen quält mich dieser Traum.
Leise schleiche ich rüber zu Hans, der in dem Zimmer schläft, das früher einmal Isis war. Als alle dachten, ich würde Lubitsch nach Amerika folgen, war sie ausgezogen, auch um mir ihre Schwangerschaft zu verschweigen und mich mit den damit zu erwartenden Komplikationen zu verschonen. Da stehe ich nun am Bettchen von Hans, dessen Leid uns so zusammengeschweißt hat, und blicke auf ihn hinab, während ich weiß, dass ich die Chance meines Lebens nicht ergriffen habe. Gegen den Willen Isis und Arturs.
Plötzlich das Telefon.
Irritiert eile ich nach unten, hebe ab, beunruhigt von der Tatsache, dass jemand um diese Zeit anruft.
»Ja?«, flüstere ich, weil ich Hans nicht wecken will.
»Ein Herr Arnie will Sie sprechen!«, sagt das Fräulein vom Amt. Ihrer Stimme ist anzumerken, dass sie pikiert ist, weil Arnie ihr nicht seinen Nachnamen genannt hat. »Soll ich durchstellen?«
»Ja.«
Mir fällt auf, dass auch ich Arnies vollen Namen nicht kenne, genauso wenig wie die einiger anderer aus Arturs Truppe, dieser verschworenen Gemeinschaft von Heimlichtuern und Ganoven.
»Carl?«, ruft es aus der Ohrmuschel heraus, und ich höre im Hintergrund einen tobenden Mob im Rhythmus einer lauten Musikkapelle.
»Arnie?«, zische ich. »Weißt du, wie spät es ist?«
»Carl!«, ruft Arnie. Er klingt aufgebracht. Unwillkürlich spannt sich jeder Muskel in meinem Körper an. »Es stimmt was nicht mit Isi!«
»Was ist passiert?!«, erwidere ich erschrocken.
»Ich weiß es nicht! Artur ist auf dem Weg. Aber du wohnst nur drei Straßen von ihr entfernt. Kannst du rüber?«
»Natürlich!«
»Carl?«
»Ja?«
»Hast du eine Waffe im Haus?«
Ich schlucke: »Nein, warum?«
Arnie zögert, dann sagt er: »Vielleicht ist nichts, aber bitte sei vorsichtig!«
Aufgelegt.
Mein Herz hämmert wie wild, als ich die Treppe hinaufstürme, in meinen Anzug springe und meinen Hut aufsetze.
Das Telefon schrillt.
Es ist so laut, dass es in ihren Ohren schmerzt. Mit dem rechten Fuß sucht sie den Treppenabsatz. Zwar haben sich ihre Augen mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt, dennoch sieht sie so gut wie nichts: Das hier ist das Haus der Schatten. Das Einzige, was sie vage erkennen kann, ist das Geländer, das wie durch tiefe Schleier knochenweiß schimmert und sich kalt anfühlt, als sie ihre Hand danach ausstreckt. Leicht wie eine Feder schwebt sie die Stufen hinab, ihren Atem unterdrückend, die Augen tränend vor Anstrengung.
Sie hat das Erdgeschoss beinahe erreicht, als sie einen Lufthauch spürt.
Hat sich da jemand bewegt?
Sie sieht nichts, aber sie riecht etwas: Rasierwasser.
Ein schwacher Duft treibt zu ihr herüber, jemand steht nur knapp vor ihr. Sie duckt sich, lauscht nach einem verräterischen Atemzug, aber dieses elende Schmettern des Telefons zerschneidet alle drei Sekunden die Luft, macht jede Ortung unmöglich.
Er kann mich nicht sehen, denkt sie, genau wie ich ihn nicht sehen kann.
Vielleicht ist er unschlüssig, was gerade zu tun ist. Er weiß, dass das Telefon sie geweckt haben muss. Vielleicht wartet er, ob sie ahnungslos herabeilt, um den Hörer aufzunehmen, mit Sicherheit das Letzte, was sie in diesem Leben noch tun würde. Dort im Dunkeln versteckt er sich, ein Raubtier, das seinem Opfer am einzigen Wasserloch weit und breit auflauert. Wie lange kann sie hier noch stehen, bevor er Verdacht schöpft? Bevor er annimmt, dass sie möglicherweise übers Fenster geflohen ist? Bevor er hinaufstürmt und sie gleich hier zu packen kriegt?
Da!
Ein leises Rumpeln links von ihr: Das muss der Wohnzimmertisch gewesen sein.
Es sind zwei.
Jetzt gerät vor ihr die Luft in Bewegung, das Rasierwasser weht auf sie zu …
Mit beiden Händen umgreift sie das Treppengelände, spürt ihre Füße auf dem nackten Holz, schnellt hoch und springt mit den Beinen voran ins Nichts: ein Satz wie von einer Klippe in ein schwarzes Loch. Für Bruchteile von Sekunden fliegt sie durch die Nacht.
Verfehlt sie ihn, ist alles verloren.
Schon spürt sie einen Körper und drückt instinktiv die Knie durch: Der unsichtbare Mann schreit überrascht auf, bevor er gegen die Wand hinter sich kracht, offenbar mit dem Kopf zuerst, denn er bleibt liegen, schreit nicht mehr, rührt sich nicht mehr.
Isi landet auf ihm, rappelt sich rasch wieder auf und stürzt der Haustür entgegen. Der Schlüssel steckt, sie muss ihn drehen, die Tür aufreißen, hinausspringen, bevor der andere sie erwischt.
Es sind nur vier oder fünf Meter.
Eine Unendlichkeit.
Auf dem Bürgersteig glitzert der Frost.
Mit drei schnellen Sätzen sitzt Artur hinterm Steuer und betätigt den neumodischen Starterknopf. Der Wagen springt an, ohne dass man ihn mit der Anlasserkurbel anschmeißen muss und damit auch ohne die Gefahr, dass der mitdrehende Stahl Arme bricht.
Der kürzeste Weg zu Isi führt über die Andreasstraße hinauf zur Frankfurter und von dort Richtung Bahnhof Frankfurter Allee. Doch schon auf der Kreuzung Paul-Singer- und Andreasstraße hat sich ein Lastkraftwagen auf der eisglatten Straße quergestellt, sodass Artur rechts ab in Richtung Küstriner Platz fährt. Vor ihm schießen zwei Wagen rechts und links aus der Diestelmeyerstraße und versperren den Weg.
Eine Falle.
Artur sieht im Rückspiegel, dass der Lkw unterdessen die Paul-Singer-Straße blockiert hat.
Dann eröffnen sie das Feuer.
Die Windschutzscheibe zerbricht in große, scharfe Scherben, genau wie die Heckscheibe. Auf die Karosserie prasseln Geschosse und reißen mit metallenem Tacktacktack Löcher ins Blech. Mündungsfeuer blitzt in der dunklen Straße, Querschläger singen davon, die Reifen von Arturs Benz platzen und lassen den Wagen auf das Kopfsteinpflaster absinken.
Ein Inferno.
Nach einer gefühlten Ewigkeit stellen die Männer das Feuer ein.
Fünf Silhouetten mit langen Wintermänteln und dunklen Hüten schleichen dem Autowrack entgegen, die Pistolen immer noch in der Vorhalte, bereit, bei auch nur der kleinsten Bewegung erneut das Feuer zu eröffnen. Hier und da flammen Lichter in den Häusern auf, Neugierige spinksen hinter sanft wallenden Gardinen auf die Straße, aber ein paar Warnschüsse später ist keiner mehr der Meinung, dass das, was da unten passiert, etwas sein könnte, das ihn anginge.
»Siehst du ihn?«, ruft einer der Schatten.
Hände greifen nach der Fahrertür, reißen sie auf, aber zu ihrer Verblüffung ist da nur ein durchlöcherter Fahrersitz: Das Auto ist leer.
»Wie hat er das gemacht?!«, zischt ein anderer wütend.
Artur hätte es ihm sagen können.
Er hätte ihnen auch zu ihren wohldurchdachten Absichten gratulieren können, denn Artur weiß immer zu schätzen, wenn jemand seinen Verstand benutzt, bevor er zur Tat schreitet. Und ihn mit einem fingierten Anruf in Panik zu versetzen, ihn zu isolieren und alle Vorsichtsmaßnahmen vergessen zu lassen, war mehr als geschickt.
Ein perfekter Plan.
Eigentlich.
Denn jetzt sind sie es, die wie auf dem Präsentierteller dastehen, und Artur antwortet dem Unbekannten auf seine Art: Wieder blitzt Mündungsfeuer auf, wieder brechen Schüsse, diesmal allerdings aus einem stillen Gässchen, in das sich Artur geflüchtet hat, als das Trommelfeuer begann. Der halbe Kopf eines der Angreifer klatscht gegen das Seitenfenster der Karosse, wo Blut, Gehirn und Knochenstücke dampfend am Glas hinablaufen, noch ehe er zu Boden sinken kann.
Sie wirbeln alle herum, und während sie das tun, platzen drei weitere Treffer in die Brust eines Zweiten, bevor sich die anderen endlich links und rechts auf den Boden werfen und blindlings das Feuer erwidern. Kriechend suchen sie Schutz hinter Arturs Auto, dann springen sie davon, zwei zurück zum Lkw, einer zu einem der Autos, die Artur den Weg versperrt hatten.
Artur leert sein Magazin, aber er trifft keinen der Fliehenden.
Dann aber rennt er dem einen hinterher, der fast schon sein Auto erreicht hat. Er muss nur zwei Meter zurücksetzen, den ersten Gang einlegen und dann das Gaspedal voll durchtreten.
Schon reißt er die Fahrertür auf.
Legt einen Gang ein.
Kratzend und schnarrend drehen sich die Reifen wild auf der glatten Straße.
Ich schlittere über glattes Kopfsteinpflaster, stürme die Voigtstraße hinab Richtung Rigaer. Es sind nur ein paar Hundert Meter, aber die Sohlen meiner Schuhe sind glatt, und mehr als einmal gerate ich so ins Trudeln, dass ich einen Sturz nur mit größter Mühe verhindern kann. Die Luft ist eisig und trocken, trotzdem klebt mir mein Hemd auf der Haut, und ich denke kurz, dass ich mir eine Lungenentzündung holen werde, wenn ich stehen bleibe. Aber ich bleibe nicht stehen, und im Vergleich zu dem, was mich gleich erwartet, wäre mir jede Lungenentzündung höchst willkommen.
Endlich erreiche ich die Rigaer, steche rechts hinein und sehe schon das hübsche Gründerzeithaus, in dem Isi jetzt wohnt. Artur hat es gekauft und ihr geschenkt, genau wie er mir das Haus in der Voigtstraße geschenkt hat.
Artur, der Unglaubliche.
Es ist finster in der Straße, nur die Lichter der weit entfernten Innenstadt hellen das Firmament schwach auf. Schemenhaft sehe ich die drei Stufen zur Haustür, die sich unerwartet einen Spalt öffnet, um sofort wieder hart zugeschlagen zu werden.
Ich springe vor, werfe mich dagegen, aber das Türblatt ist massiv und die Tür von außen ohne Schlüssel nicht zu öffnen.
Drinnen höre ich Isi schreien.
»ISI!!«
Ich hämmere gegen die Tür.
»CARL!«, höre ich dumpf, dann wieder einen Schrei.
Rasch suche ich einen anderen Weg ins Haus, bin mit wenigen Schritten vor einer der Wohnzimmerscheiben, klettere auf das Fensterbrett, drehe mich mit dem Gesicht zur Straße, halte mich mit beiden Armen im Sturz fest und trete wie ein Muli mit dem Absatz gegen den hölzernen Rahmen.
Einmal, zweimal.
Es kracht laut, die Flügel schwingen auf, Glas geht klirrend zu Bruch.
Ich springe hinein ins Dunkel.
»ISI!«, schreie ich.
Das Telefon schrillt.
Ein Schatten fliegt mir entgegen und reißt mich zu Boden. Er ist über mir, sein Gesicht kann ich nicht sehen, die Klinge, die er in der rechten Hand führt, schon.
Mit aller Kraft stößt er zu.
Sie dreht den Schlüssel um, zieht die Haustür ein Stück auf, als sie schon dagegen geworfen wird und, nur weil sie stolpert, dem Messer entgeht, das knapp über ihrem Kopf in das Holz jagt.
Draußen schreit Carl, während der Mann über ihr im Begriff ist, die Klinge wieder aus dem Holz herauszuziehen. Schnell ballt sie eine Faust und boxt blind nach oben: Ein dumpfer Schmerzenslaut sagt ihr, dass sie ihn mit voller Wucht in die Weichteile getroffen hat. Er sackt vor der Tür zusammen, presst beide Hände in den Schritt. Sie muss zurück zur Treppe, weil er den Weg nach draußen blockiert.
Das Telefon schrillt ohrenbetäubend.
Mit ausgestreckten Händen wankt sie durch absolute Dunkelheit, hört sich selbst Carls Namen rufen, spürt aber an einem Luftzug, wie sie damit den, der im Wohnzimmer herumgeirrt war, wieder anlockt, wie seine Hände vor ihrem Gesicht herumwedeln, um sie endlich zu packen. Da erwischt er ihr Haar, reißt daran, bis sie schreit und ihrerseits wie wild um sich schlägt. Mit einem lauten Klatschen erwischt sie ihn im Gesicht, was ihn laut fluchen lässt.
Dann klirren Scheiben.
Der Mann lässt von ihr ab, eilt Carls Stimme entgegen, die sie im Wohnzimmer hört. Sie erreicht die Treppe, fühlt den Lauf des Geländers in ihren Händen und eilt nach oben, das schnelle Stapfen schwerer Schritte hinter sich, bevor der andere sie an den Fesseln zu fassen kriegt und von den Füßen zieht. Isi fällt, wird über die Stufen hinabgezogen, krümmt sich schützend über ihrem Bauch zusammen, tritt dann aber wütend zu und trifft den Mann am Kopf. Für einen kurzen Moment ist sie frei, springt erneut auf, doch schon sind seine Hände wieder an ihrer Hüfte. Er zieht sie unerbittlich zu sich.
Sie stehen jetzt Auge in Auge, aber sie sehen sich nicht.
Es ist so dunkel, dass sie nur seinen Atem im Gesicht spürt. Da hebt er seine rechte Hand zu ihrem Kopf, während sie instinktiv nach seinem Handgelenk schnappt. Die Klinge ist so nah, dass sie den kühlen Stahl auf der Haut spüren kann.
Für Sekunden halten die beiden sich dort fest im Arm, wie ein fieberndes, erschöpftes Tanzpaar. Dann jedoch führt der Mann die Klinge weiter gegen ihren Hals, und sosehr sich Isi auch gegen ihn wehrt: Er ist zu stark.
Schlitternd setzt das Auto zurück, krachend legt der Fahrer nun den Vorwärtsgang ein und gibt so stark Gas, dass sich der Wagen mit durchdrehenden Reifen kaum von der Stelle bewegt. Wer in Panik ist, trifft schlechte Entscheidungen, und Arturs Gegner ist so sehr in Panik, dass er das Pedal fast durchs Bodenblech tritt, verzweifelt, dass sein Auto nicht zu reagieren scheint.
Endlich gerät der Wagen in Bewegung, als etwas auf das Autodach prallt. Jetzt in den zweiten Gang. Merklich spürt er den Vortrieb. Vor sich sieht er bereits die langen Schatten des Küstriner Platzes, ein hübsches, mit ein paar Bäumen begrüntes Dreieck vor der ebenso hübschen klassizistischen Rückseite des Schlesischen Bahnhofs, die hier und dort schwach beleuchtet wird. Um diese Zeit und im gnädigen Dämmerlicht weniger Gaslaternen wirkt die Gegend weder verroht noch verarmt, die einsamen Passagiere, die jetzt noch in Berlin ankommen oder es verlassen wollen, werden zumeist am schmucklosen Haupteingang auf der gegenüberliegenden Seite von den Huren und Gaunern begrüßt.
Für einen Augenblick glaubt der Fahrer, ihm entkommen zu sein, er atmet erleichtert durch, doch dann rutscht Artur vom Dach auf die Kühlerhaube. Entsetzt starrt der Mann in diese Maske, die Arturs Gesicht so rätselhaft und unheimlich macht: das mit einem halben Männergesicht bemalte, dünne, anatomisch korrekt geformte Kupferblech, das die schrecklichen Kriegswunden, den weggesprengten Kieferknochen, das fehlende Jochbein und Auge, überdeckt.
Jetzt aber starrt das aufgemalte Auge der Maske den Mann reglos an, während das andere wütend funkelt. Dann sieht er nur noch, wie Artur ausholt und mit der Faust das dünne Windschutzglas zertrümmert, spürt erst die Splitter und dann eine eiserne Faust an seinem Hals.
Es ist das Letzte, was er fühlt.
Blitzschnell findet Artur seinen Kehlkopf und bohrt seine Eisenfinger so tief ins weiche Fleisch, dass er ihn vollständig umfasst. Er drückt zu, der Mann verliert sofort das Bewusstsein. Artur weiß, dass er gleich tot sein wird, aber er ist außer sich und ballt die Faust nur umso stärker.
Der Wagen schießt über den Bürgersteig in die Grünfläche, Artur wird wie von einem wilden Gaul abgeworfen und landet auf gefrorenem Rasen, während der Wagen selbst gegen einen Baum prallt.
Mit einem hässlichen Scheppern bleibt er dort stehen.
Heißer Dampf steigt friedlich aus dem Kühler in die Nachtluft.
Das Messer jagt hinab und bleibt gleich neben meinem Ohr im Boden stecken. Ich schlage in die Luft und treffe ein Gesicht, aber meine Faust streift daran vorbei. Mein Angreifer zieht das Messer aus dem Boden, während ich fast gleichzeitig sein Handgelenk zu fassen bekomme. Dennoch: Er ist im Vorteil, muss sich jetzt nur noch mit seinem ganzen Körper von oben in die Klinge stemmen, was er auch macht. Er ist zu stark, ich fühle es, ich kann ihn nicht halten, wir beide keuchen vor Anstrengung. Mit meiner Linken kriege ich eine Scherbe zu fassen, spüre, wie sie mir die Hand aufschneidet, und stoße ihm das Glas in den Oberarm.
Er schreit, der Druck auf der Klinge lässt sofort nach.
Endlich kann ich mich unter ihm wegrollen.
Scherben knirschen.
Isi spürt die Schneide, etwas Warmes läuft ihr am Hals entlang ins Nachthemd, als sie einen letzten, verzweifelten Versuch wagt: Sie schnellt vor und beißt dem Angreifer ins Gesicht. Erst schmeckt sie salzige Haut, dann quillt es ihr warm und metallisch in den Mund, während der Mann schreit und das Messer von ihrem Hals löst.
Sie nutzt die Sekunde, stößt ihn von sich, rennt zur Tür, verschwindet im Schlafzimmer und klemmt rasch einen Stuhl unter die Klinke. Das Türblatt erzittert, sie hört, wie er sich zornig von außen dagegen wirft. Die Scharniere krachen in der Zarge, die Türklinke klappert auf der Stuhllehne.
Sie wird ihn nicht aufhalten können.
Noch einmal, vielleicht zweimal, dann bricht er durch, und es ist vorbei.
Hinter ihr ist das Fenster.
Vielleicht fünf Schritte.
Dann passiert alles auf einmal: Sie hechtet von der Tür weg, die er gleichzeitig durchschlägt. Ein Messer jagt ihr durch die Dunkelheit nach, ritzt durch ihr Nachthemd, während sie auf das Fenster zurennt, er gleich dahinter, aber vom eigenen Schwung ins Taumeln geraten.
Zwei, eins …
Sie reißt die Arme vor das Gesicht und springt.
Ich rappele mich auf, irgendwo vor mir muss der Mann sein, ich sehe immer noch nichts, aber ich höre seine Schritte über die Scherben auf mich zukommen. Alles, was mir einfällt, ist die Hände vorzustrecken, ein lächerlicher Versuch, das Messer abzuwehren, das er sicher vor sich hält.
Dann spüre ich seine Hände, umgreife sie, verliere das Gleichgewicht, stolpere mit ihm rückwärts. Die Brüstung des Wohnzimmerfensters schlägt gegen meine Oberschenkel, und in der nächsten Sekunde schon sind meine Schuhe über mir, bevor ich hart auf dem Bürgersteig lande.
Die Luft bleibt mir weg.
Klirren.
Nur einen Augenblick später ist Isi über mir.
Sie schwebt.
Für einen unwirklichen Moment scheint sie in der Luft zu stehen, bevor sie über mich hinwegstürzt und mit einem lauten Krachen hinter mir einschlägt.
Scherben regnen auf mich herab.
Mühsam komme ich auf die Beine: Isi liegt auf dem Dach eines parkenden Autos.
Leblos.
Drinnen drehen sich die Schatten und verschwinden.
Und immer noch schrillt das Telefon.
FEME
2
Manchmal, wenn man in ein Schneegestöber hineinblinzelt, bleibt der eigene Blick auf unerklärliche Art und Weise an einer einzelnen Flocke hängen, die plötzlich anders ist als ihre Millionen und Abermillionen Brüder und Schwestern, obwohl jede von ihnen weiß und grazil schimmert, jede sechs Kristallarme besitzt und jeder gefrorene Winkel an ihr entweder sechzig oder hundertzwanzig Grad misst. Und doch ist da die eine, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, die man anstarrt, mit der zusammen man über den Boden schweben möchte.
Manchmal, wenn man in einem solchen Schneegestöber steht, überkommt einen der Gedanke, dass wir nichts als Flocken in einem nicht enden wollenden Winter sind, alle gleich und doch so verschieden, dass einige sämtliche Blicke auf sich ziehen, während die anderen lautlos und vollkommen unbeachtet zu Boden sinken, um zu Schnee zu werden, ihrer Einzigartigkeit beraubt.
Es war der Tag vor Heiligabend, als sich ein stiller Trauerzug zwischen den Grabsteinen des Friedhofs Friedrichsfelde wie eine schwarze Schlange durch weiße Watte wand. An der Spitze der Sarg, wankend wie ein Schiff auf hoher See, vor uns ein Loch in gefrorener Erde, in das all das Weiß fiel, das niemand sonst beachtete. Hinter uns die Trauergemeinde: gesenkte Köpfe, dunkle Mäntel, schmucklose Hüte.
So erreichten wir schließlich das aufgebrochene Grab, wo sich die Trauernden in Zweier- oder Dreierreihen auf gefrorener Erde zusammenschoben, während wir den Sarg sanft auf den Boden stellten.
Da blickte ich auf und sah plötzlich eine dieser Schneeflocken durch das kalte Himmelsgrau herabsegeln, bis sie sanft auf dem silbernen Kreuz landete, das den Sargdeckel zierte, obwohl Isi nie an Gott geglaubt hatte. Aber für diesen Sarg wollte sie ein Kreuz, in der vagen Hoffnung, dass das Kind, das darin lag, seinen Weg in den Himmel finden würde.
Ihr Kind.
Wir hatten uns für sie gefreut, hatten mit ihr zusammengesessen und Namen vorgeschlagen, die sie allesamt grinsend abgelehnt hatte. Sie wollte ihn selbst aussuchen und uns erst mitteilen, wenn das Kleine geboren sein würde. Wenn sie es uns eingewickelt in ein weiches Tuch, schreiend und plärrend oder vielleicht auch nur erschöpft von seinem ersten Auftritt in der neuen Welt, präsentierte. Wenn sie uns sagte: Seht es an! Ist es nicht ein hübsches Kind? Und hat es nicht einen schönen Namen?
Henry von Torstayn.
Ein schlichter Schriftzug auf einem schmucklosen Holzkreuz.
Kein Geburtsdatum.
Kein Sterbedatum.
Sie stand zwischen Artur und mir, starrte blass und betäubt auf den Kindersarg, während um uns herum die waren, die ihrem Sohn die letzte Ehre erweisen wollten: Arnie und Arturs andere Männer, Kino-Paule und der gesamte Ringverein Vergissmeinnicht, unser Anwalt Friedemann Fromm mit seiner aktuellen Liebschaft, deren Namen sich niemand merken würde, Anna, die Nachtigall, der kleine Hans an ihrer Hand sowie ein paar Stammgäste und Säufer aus dem Arcasi.
»Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub!«
Der Pfarrer sprach, aber niemand hörte ihm zu, sodass er bald schon verstummte und den beiden Messdienern mit einem Kopfnicken signalisierte, dass er aus der Kälte herauswollte.
Der Sarg wurde an zwei Tauen hinabgelassen.
Die Trauergäste defilierten am Grab vorbei, warfen etwas Erde oder eine Blume hinein, sprachen Isi ihr Beileid aus oder umarmten sie kurz. Sie jedoch ließ das alles reglos über sich ergehen, als wäre nur ihr Körper anwesend, nicht aber sie selbst. Schließlich standen nur noch Artur und ich bei ihr.
Schnee fiel.
Irgendwann trugen wir davon Häubchen auf den Köpfen und eine weiße Decke um die Schultern. Da nahmen wir Isi an den Händen und brachten sie nach Haus.
Die Tage nach dem Überfall lebte auch ich in Schockstarre, doch im Gegensatz zu Isi erholte ich mich langsam, während sie, die mutige, angriffslustige, zuweilen leichtsinnige, aber immer optimistische Isi, in tiefes Schweigen verfiel. Wie verletzt musste sie sein, wie getroffen! Nach ihrem Sturz durchs Fenster gebar sie Henry, wissend, dass sein Herz da schon nicht mehr schlug.
Ihre Schreie im Kreißsaal waren von einer solchen Verzweiflung, dass Artur und ich, die wir draußen auf dem Flur warteten, wussten, nicht körperlicher, sondern seelischer Schmerz riss sie gerade in Stücke. Später dann, als der Junge fortgetragen und ihre Schnittwunden verbunden worden waren, wachten wir an ihrem Bett, in dem sie sich trotz des starken Beruhigungsmittels im Schlaf unruhig mal auf die eine, mal auf die andere Seite warf. Artur und ich waren glimpflich davongekommen, meine linke Hand war genäht und verbunden worden, Artur selbst hatte lediglich ein paar Schürfwunden an Knien und Ellbogen abbekommen, wobei er sich unentwegt die rechte Hand rieb, die, wie mir im Dämmerlicht des Krankenzimmers schien, voller Blut war.
In dieser ersten Nacht fragte ich ihn, was passiert war, und er erzählte mir von der Falle, die man ihm gestellt hatte.
»Was ist mit deiner Hand?«, fragte ich.
Erst jetzt schien er sein unentwegtes Kneten zu bemerken und ließ davon ab.
»Nichts.«
»Artur«, mahnte ich.
Da ballte er beide Hände zu Fäusten und sagte: »Ich werde mir einen nach dem anderen holen.«
»Wir wissen nicht, wer es war«, antwortete ich matt.
Artur nickte grimmig. »Aber ich werde es herausfinden.«
»Und dann?«
Er sah mich an: »Was glaubst du?«
Ich starrte auf meine Füße.
Draußen ging gerade die Sonne auf, ein herrlicher Wintertag deutete sich an. Hier in Isis Krankenzimmer aber war mir, als würde die Nacht nicht enden wollen.
»Vielleicht …«, begann ich zögernd, wagte dann aber nicht, den Satz zu beenden.
»Vielleicht was?!«, fauchte Artur.
Ich schwieg.
»Du meinst, wir sollten es der Polizei überlassen?!«
Ich schluckte und antwortete: »Bitte beruhig dich, Artur. Es war nur ein Gedanke. Du hast Oberkommissar Kennel doch in der Hand. Er tut, was du ihm befiehlst.«
»Und dann?«
»Sie finden die Männer. Da bin ich sicher.«
»Und dann?«, fragte Artur drängender.
»Dann kommen sie für immer in den Knast.«
Einen Moment schwieg er, schüttelte aber rasch den Kopf: »Das ist nicht genug.«
»Ich finde schon, Artur. Sie würden nie wieder frei sein.«
Artur schnaubte: »Hast du wirklich vergessen, wie es hier bei uns in Berlin läuft? Wir haben eine Demokratie, aber wir haben keine Gerechtigkeit.«
Ich wusste, dass er recht hatte, aber auf eine kindische Art und Weise wollte ich widersprechen: »Ich will aber nicht so sein wie die, Artur.«
»Du bist ganz sicher nicht wie die, Carl.«
»Wenn du sie auf deine Art bestrafst und ich davon weiß, aber schon …«
Artur stand auf, und an seiner Körperhaltung konnte ich schon sehen, dass es ihn große Mühe kostete, sich zu beherrschen.
»Carl, ich sags dir jetzt im Guten, und ich hoffe wirklich, dass du mir zuhörst, denn ich werde es nicht noch einmal erklären: Man kann sich nicht aus allem heraushalten in der Hoffnung, das Leben lässt einen dann in Ruhe. Sieh dich an: Du hast dich entschieden, in Berlin zu bleiben, anstatt nach Amerika zu gehen. Das war deine Entscheidung, und völlig unabhängig davon, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht, hat diese Entscheidung Konsequenzen nach sich gezogen.
In Amerika hättest du mit Lubitschs Hilfe eine große Karriere machen können. Du wärst ein berühmter Kameramann geworden, und wer weiß, vielleicht hättest du auch eines Tages den Mut gefunden, Regisseur zu sein. Du hättest in einem Land gelebt, in dem immer die Sonne scheint, du hättest die schönsten Frauen kennengelernt, die interessantesten Menschen. Du hättest ein Glanz sein können – umgeben von Sternen. Mit Geld, mit einem Haus und Anerkennung.
Du hättest diesen Weg gehen können, Carl, aber du bist ihn nicht gegangen.
Du bist hiergeblieben. In einem Land, das noch lange nicht zur Ruhe gekommen ist. Wo gekämpft, gehungert und gestorben wird. Du bist hiergeblieben, bei uns, die wir umgeben sind von Feinden.
Das war deine Entscheidung.
Und jetzt versuchst du, dich abzukapseln. Versuchst, irgendwie in Deckung zu gehen, und hoffst, dass das alles vorbeizieht wie schlechtes Wetter. Aber es wird nicht vorbeiziehen, Carl! Das Einzige, was wir jetzt noch selbst entscheiden können, ist, ob wir uns diesem Sturm ergeben oder ob wir selbst der Sturm sind.«
Er beugte sich tief zu mir hinab und sagte ruhig: »Ich werde dieser Sturm sein, Carl.«
Er schob mir die Faust, an der er zuvor ständig gerieben hatte, unter die Nase: »Ich werde sie an der Kehle packen und sie zerquetschen. Und wenn ich falle, werde ich sie festhalten und mit mir reißen! Verstehst du mich?«
Schluckend nickte ich, während schreckliche Bilder durch meinen Kopf spukten.
Er zog mich an den Schultern auf die Füße und stellte mich ans Bettende, von wo wir beide auf die unruhig schlafende Isi blickten.
»Sieh sie dir an, Carl! Sieh, was sie getan haben! Sie haben eine schwangere Frau angegriffen und ihr ungeborenes Kind getötet.«
Er drehte mich zu sich.
In seinem gesunden Auge schimmerten Tränen, bevor es donnernd aus ihm herausbrach: »EINE FRAU UND IHR UNGEBORENES KIND!«
Ich wagte nichts zu sagen.
Dieser Anschlag war nicht nur ein Angriff auf uns, sondern berührte die wundeste Stelle in Artur selbst, einen Schmerz, den er nie würde verwinden können: Falk Boysens Mord an seiner großen Liebe Larissa und an seinem Kind. Ebenso feige wie der Überfall auf Isi.
»Und jetzt, mein treuer Freund, frage ich dich: Wirst du an meiner Seite sein? Wirst du an Isis Seite sein? Wirst du kämpfen, so gut du kannst? Für dich selbst und für uns?«
Beschämt liefen mir die Tränen über die Wangen, während ich herauswürgte: »Das weißt du doch, Artur.«
Er nahm mich in die Arme und drückte mich fest an sich.
»Wir drei, Carl! Nur wir drei!«
3
Am Ende jener Nacht also erneuerten wir unseren Schwur, den wir, als wir fast noch Kinder waren, am großen Schneidertisch meines Vaters in Thorn in unbeschwerter Laune abgelegt hatten. Als wir das erste Mal Wein getrunken hatten, berauscht von unserer hinreißenden Gaunerei rund um den Kometen Halley, und wussten, dass wir immer füreinander da sein wollten.
Ohne Artur hätte ich mich wohl verkrochen und gehofft, dass die Attacken verpuffen würden. Schon zu Schulzeiten hatte ich mich ohne ihn nicht sicher gefühlt, schon damals war er mir immer Fels in der Brandung gewesen. Jetzt war mir unwohl, aber solange es ihn gab, wollte ich mutig sein.
Noch vor der Morgenvisite traten wir aus Isis Krankenzimmer, vorbei an zwei bulligen Männern, beide bewaffnet, die vor der Tür Wache standen. Mit einem Blick machte Artur mir klar, dass wir beide, Isi und ich, keine Sekunde mehr allein sein würden.
Dann nahm er mich mit zum Küstriner Platz, an dem das Polizeirevier Fünfzig unter der Leitung von Oberkommissar Kennel immer noch Zeugenaussagen aufnahm. Gerade wurden zwei zerstörte Automobile abgeschleppt, alles unter den neugierigen Blicken der Anwohner, Huren und Gauner, für die die Schießerei in der Nacht eine aufregende Abwechslung in ihrem elenden Dasein gewesen war.
Reporter trieben sich am Rand der Absperrung herum, riefen Kennel ihre Fragen zu oder spendierten Schutzpolizisten Zigaretten, um von ihnen ein paar Informationen zu erhalten. Wahrscheinlich würde der Anschlag schon am Mittag die Schlagzeilen beherrschen und neue Empörung über die Zustände am Schlesischen Bahnhof schüren. Der Sittenverfall seit dem Sturz des Kaisers hatte dazu geführt, dass viele begannen, die Zeiten vor 1914 zu glorifizieren. Zeiten, in denen nichts gerechter war, aber zumindest der Schein gewahrt wurde, dass man selbst, wenn einen schon sonst nichts Gutes im Leben mehr erwartete, wenigstens Teil einer großen, unbesiegbaren Nation war. Der Krieg freilich hatte diesen Mythos in Stücke gesprengt und gleichzeitig die Fäulnis freigelegt, die schon lange hinter den Fassaden gegärt hatte. Eine Wahrheit, die sich viele nicht eingestehen wollten oder konnten.
Artur gab Kennel ein kleines Zeichen, und wir trafen ihn ein paar Minuten später in der Rüdersdorfer Straße, abseits des Tumults, geschützt vor neugierigen Blicken.
»Was wissen Sie?«, fragte er harsch.
Kennel, blass und unscheinbar, der Artur mit bigottem Hass zu vernichten versucht und auch vor Hans nicht haltgemacht hatte, bevor seine frömmelnde Verlogenheit ihm dann zum Verhängnis geworden war. Statt über Artur zu triumphieren, war er jetzt dessen Büttel. Auf gewisse Art und Weise gab er damit ein trauriges Sinnbild unserer Zeit ab: Oberkommissar Kennel – Gendarm der Gosse.
»Ein wirklich schönes Schlachtfeld haben Sie da angerichtet!«, zischte Kennel.
»Ich wurde angegriffen.«
»Leute wie Sie werden immer angegriffen!«, gab Kennel wütend zurück. »Das Problem ist, dass solche Aktionen zu viel Aufsehen erregen. Da sind zu viele, die Fragen stellen!«
»Sie armer Tropf«, höhnte Artur. »Wären Sie doch nur Priester geworden.«
Kennels Kieferknochen arbeiteten, während er Artur mit kaltem Hass ansah.
»Also, was wissen Sie?«, fragte Artur erneut.
»Drei Tote. Keiner von ihnen hatte Ausweispapiere bei sich.«
»Weiter!«, herrschte ihn Artur an.
»Nichts weiter!«, fauchte Kennel.
»Wem gehört das Auto?«
»Sie meinen den Kerl, dessen Kehle Sie zerfetzt haben, Sie widerwärtiges Tier?!«, spuckte Kennel förmlich aus.
»Wem gehört es?«, wiederholte Artur ungerührt.
»Wilhelm Leyschulte.«
»Und der wohnt?«, fragte Artur ungeduldig.
»Lassen Sie mich das machen, Burwitz! Die Leyschultes sind eine angesehene und sehr wohlhabende Kaufmannsfamilie. Der alte Leyschulte war sogar mal Reichstagsabgeordneter. Ich bin sicher, die haben damit absolut nichts zu tun!«
Artur ging nahe an ihn heran und tippte schmerzhaft mit dem Zeigefinger gegen Kennels Brust: »Und wo wohnen die Leyschultes nun?«
»Wenn Sie dort so etwas wie hier anrichten, kann ich nichts mehr für Sie tun«, antwortete Kennel.
»Ich werde nichts anrichten. Ich will nur sichergehen, dass Sie mir keine Scheiße erzählen, Kennel!«
»Was für ein Poet Sie doch sind!«
»Die Adresse! Ich kriegs eh raus.«
Kennel zögerte, dann sagte er: »Königin-Augusta-Straße vier.«
»Am Landwehrkanal?«
»Ja. Und bitte: Die Leyschultes haben Verbindungen.«
Artur lächelte. »Keine Bange, Kennel. Solange Sie mir als Polizist nutzen, halte ich Sie aus allem raus.«
Kennel schluckte, schwieg aber.
Artur befahl: »Sobald Sie die Namen der anderen haben, rufen Sie mich an. Und damit meine ich: noch in derselben Sekunde. Haben Sie mich verstanden?«
Kennel nickte mit verkniffenen Lippen.
Artur klopfte ihm aufmunternd auf die Schultern: »Warum so geknickt? Freuen Sie sich doch, dass ich Ihnen dieses Pack vom Hals schaffe.«
»Es gibt Gesetze, Burwitz!«
»Tatsächlich? Gabs die auch, als Sie mich umbringen wollten? Oder Carls Sohn verschleppt haben?«
»Ein Jammer, dass ich Sie damals nicht erwischt habe«, antwortete Kennel wütend.
»Tun Sie, was ich sage! Dann dürfen Sie weiter von einer Karriere bei der Polizei träumen, gehen sonntags mit Ihrer wunderschönen Nachtigall Anna in die Kirche und genießen die bewundernden Blicke der anderen Heuchler, von denen jeder, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort mit ihr ins Bett gehen würde. Muss ja keiner wissen, dass sie Sie nicht ranlässt!«
»Scheißkerl!«
»Rufen Sie mich an, Kennel! Übrigens: Mein Auto wurde gestern Nacht gestohlen. Schreiben Sie doch bitte eine Anzeige!«
Kennel hob die Augenbrauen.
»Je weniger ich im Licht stehe, desto besser für Sie!«
Ohne weiteren Gruß kehrten wir um und setzten uns in Arturs Wagen.
»Vielleicht solltest du ein wenig netter zu ihm sein, Artur. Wenn du ihn zu sehr demütigst, dann kommt er vielleicht auf die Idee, reinen Tisch zu machen.«
Artur schüttelte den Kopf. »Es gibt nichts, was ihm so wichtig ist wie sein guter Leumund. Er würde lieber sterben, als sich zu kompromittieren.«
»Was ist mit denen, die uns überfallen haben?«, fragte ich.
»Das regeln wir selbst. Dafür brauche ich Kennel nicht.«
»Weiß er überhaupt davon?«
»Nein.«
»Und was hast du jetzt vor?«, fragte ich.
»Wir werden sie suchen. Meine Leute. Kino-Paules Leute. Jeder, der sich etwas verdienen will. Ich habe ein Kopfgeld von hundert Dollar für jeden von ihnen ausgesetzt.«
»Du zahlst in Devisen?«
»Würdest du Mark nehmen?«
Ich räusperte mich: »Nein.«
»Hundert Dollar sind ein Vermögen in diesen Zeiten. Und bei der Inflation wird es jeden Tag mehr wert sein.«
Ich nickte.
Es würde im Viertel niemanden geben, der sich diesen Schatz nicht verdienen wollte. Wenn die beiden Attentäter noch in der Stadt waren, würde man sie finden. Sie mussten nur Ausschau halten nach einem Mann mit einem Stich im linken Oberarm und einem mit einer Bisswunde im Gesicht.
4
Tatsächlich waren die Leyschultes an den Vorfällen am Schlesischen unbeteiligt, was ich von einem der Dienstmädchen erfuhr, das die herrschaftliche Villa am idyllischen Ufer des Landwehrkanals verließ, um einkaufen zu gehen. Wir hatten dort bereits eine ganze Weile frierend im Wagen gesessen und das hohe, wuchtige wilhelminische Haus mit dem kurzen Spitzgiebel ganz in der Nähe des Reichmarineamts im Auge behalten, aber nichts erkennen können, was in irgendeiner Form verdächtig war. Als die junge Frau schließlich aus dem Haus trat, schubste Artur mich aus dem Auto und beauftragte mich, sie auszuhorchen und, wenn es sein musste, ihrer Mitteilsamkeit mit ein wenig Geld auf die Sprünge zu helfen.
Unbeholfen tapste ich ihr hinterher und zermarterte mir den Kopf, wie ich mich ihr nähern könnte. Sicher würde sie misstrauisch werden, wenn sie aus heiterem Himmel von einem Fremden auf ihre Dienstherren angesprochen würde. Würde sie freundlich sein? Mich schnöde stehen lassen? Oder gar nach einem Schutzpolizisten rufen und diesem erklären, dass sie belästigt werde?
Artur hätte mit seiner bloßen Erscheinung schon dafür gesorgt, dass das Mädchen wie ein Wasserfall plapperte, allein er wollte sich im Hintergrund halten und niemanden unnötig auf sich aufmerksam machen.
Somit lief ich ihr nach, verkürzte Stück für Stück den Abstand und war gerade dabei, sie einzuholen, als sie in eine Fleischerei eintrat und dort auf andere Dienstmädchen traf, die im Auftrag ihrer Herren unterwegs waren. Einfache Hausfrauen sah man hier nicht, keine von ihnen hätte sich die Preise hier leisten können.
Zu meinem Glück und meiner großen Erleichterung konnte die Magd mit ihren Neuigkeiten nicht an sich halten und begann gleich, mit einer anderen zu tratschen. Nämlich, dass der alte Leyschulte höchstselbst bei der Polizei angerufen habe, um einen Autodiebstahl anzuzeigen. Stelle man sich so etwas einmal vor: gestohlen aus der Vorfahrt der Villa! Unerhört! Die gnädige Frau sei daraufhin ganz außer sich gewesen und habe sich mit einer aufziehenden Migräne gleich wieder ins Bett gelegt, während der junge Herr Wolfgang am Frühstückstisch darüber gescherzt habe. Seine älteren Schwestern Hedwig und Agnes hätten deswegen mit ihm geschimpft und die unmöglichen Zustände in der Stadt beklagt.
Beide Dienstmädchen waren aufrichtig darüber erschüttert, dass das Verbrechen selbst vor so respektablen Herrschaften nicht haltmachte, worauf sich das Gespräch dem überaus leicht zu erschütternden Nervenkostüm der gnädigen Frau Leyschulte zuwandte, die einfach zu zart für diese Welt sei und mehr Zeit im Bett verbrachte als Spitzwegs armer Poet.
Für mich war es ein geeigneter Zeitpunkt, die Fleischerei wieder zu verlassen, um Artur Bericht zu erstatten. Der war sehr zufrieden mit meinen Spionagediensten, und so sah ich denn auch keinen Grund, ihm mitzuteilen, dass nicht charismatische Durchsetzungsvermögen, sondern purer Zufall Vater meines kleinen Erfolgs war.
Die folgenden Tage verliefen dann ohne nennenswerte Neuigkeiten, außer dass Isi, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zu mir und Hans in die Voigtstraße zog. Sie verbrachte viel Zeit in ihrem Zimmer, verließ es nur zu Essenszeiten, um dann lustlos auf dem Teller herumzukratzen und so gut wie nichts zu essen. Ich hatte mir ein paar Tage freigenommen, um für sie da zu sein, aber obwohl sie diese Geste sicher zu schätzen wusste, verweigerte sie jedes Gespräch mit einem entschuldigenden Lächeln. So verbrachte ich meine Zeit mit Hans und den Leibwächtern, die Tag und Nacht anwesend waren und auf jedes Geräusch auf der Straße reagierten.
Die Beerdigung war schließlich der absolute Tiefpunkt.
Als wir Isi an jenem verschneiten Wintertag nach Hause brachten, weinte sie nicht. Während dieser ganzen Zeit hatte sie nicht ein einziges Mal geweint. Sie war wie ein lebender Leichnam, ungemein verstörend für uns, die wir sie nun wirklich vollkommen anders kannten.
Tags darauf feierten wir das deprimierendste Weihnachten aller Zeiten, und das auch nur wegen Hans, der mit seiner kindlichen Aufregung Isis Trauer konterkarierte. Nicht nur einmal staunte ich, wie sehr die beiden ihre Rollen getauscht hatten: Die freche, witzige Isi war verstummt, der stumme, traumatisierte Hans hatte Zutrauen zum Leben gefunden und sein Verhalten ins Gegenteil verkehrt.
Für Artur dagegen gab es auch an den Feiertagen einiges zu tun.
Dutzende Spitzel wollten koordiniert sein.
Es war, als entließe er jede Nacht einen Schwarm Fledermäuse in den Himmel, um am nächsten Morgen zu hören, was sie gesehen, erlauscht und gefühlt hatten. Überall stießen sie ihre nur für Spitzel hörbaren Rufe aus, sie waren die Schatten in den Armenvierteln des Nordens und Ostens und die Lebemänner in den Spielclubs des Westens.
Sie bestachen die Spanner vor den Amüsierbetrieben, die Ausschau nach den lackierten Tschakos der Schutzpolizisten hielten und in der Dunkelheit nach klirrenden Kettchen lauschten, an denen ihre Gummiknüppel baumelten. Sie bestachen auch die Schlepper, die die Vergnügungssüchtigen durch verborgene Türen in die Spielhöllen, Clubs und Bordelle schleusten, waren allerorts und nirgends, und glaubte man sie eben noch entdeckt zu haben, waren sie schneller verschwunden als die Schlepper, wenn die Spanner wegen der Polizei pfiffen.
Auch Kennel fahndete.
Nicht nur, weil Artur ihm im Nacken saß, sondern auch, weil die Schießerei am Schlesischen wie erwartet die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzt hatte. So gab es eine ganze Weile jede Nacht Razzien, füllten sich die Zellen im Polizeipräsidium am Alexanderplatz, obwohl alle natürlich wussten, wie sinnlos diese Aktionen waren und wie schnell die wegen vielerlei Dingen Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Es wurde eine harte Linie demonstriert, unzählige Verhörprotokolle wurden erstellt und abgeheftet, doch nichts gefunden, was mehr Klarheit in den Fall gebracht hätte – zumal Kennel Arturs Namen weitestgehend raushielt.
Das Ergebnis aller Bemühungen ernüchterte. Grund der Auseinandersetzung: unbekannt; Teilnehmer der Auseinandersetzung: unbekannt.
Zeugen: keine.
Wobei es am Morgen nach dem Vorfall tatsächlich einige wenige Beobachter gegeben hatte, die in erster Befragung grobe Mitteilungen machen konnten. Tags darauf jedoch erinnerte sich niemand mehr oder gab vor, sich nur wichtiggemacht zu haben. Denn da wussten mittlerweile alle von Arturs Dollarversprechen, sodass der Wunsch nach Kooperation mit der Polizei in einer Gegend, die grundsätzlich mit ihr auf Kriegsfuß stand, auf einen Wert unter null sank.
Dennoch fand Kennel tatsächlich eine Spur.
Man ermittelte die Identität desjenigen, dessen halber Kopf auf dem Seitenfenster von Arturs Mercedes gelandet war: Seine Fingerabdrücke fanden sich in einem der Karteikästen der Berliner Kriminalpolizei. Dass sie so schnell aufgespürt wurden, war pures Glück, denn der Abgleich war normalerweise eine mühsame Fleißarbeit und dauerte zuweilen Wochen.
Der Mann hieß Otto Streeck, dreiundzwanzig Jahre, wohnhaft in Weißensee, und hatte es im Krieg immerhin bis zum Leutnant gebracht. Nach dem Krieg gehörte er, wie viele andere auch, zu denen, die am Wiedereinstieg in die Zivilgesellschaft gescheitert waren. Er wurde mehrmals wegen Landfriedensbruchs verhaftet, immer in Zusammenhang mit nationalistischem Protest, der vor Gericht jedes Mal geradezu lächerlich glimpflich geahndet worden war.
Zuletzt hatte er in der Marinebrigade Ehrhardt gedient, was Artur als Information vollkommen ausreichte. Für ihn stand fest, dass Streeck Mitglied der Organisation Consul war, einem verborgenen Syndikat, gegründet von Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt, das die Republik mit weißem Terror überzog. Eine ganze Reihe von politischen Morden ging auf das Konto dieses Bündnisses, der prominenteste: der an Staatssekretär Matthias Erzberger, dem Mann, der die Waffenstillstandsbedingungen im Wald von Compiègne unterschreiben musste.
Artur gab Kennel die Abschrift einer Liste mit Mitgliedern von O.C.., in deren Besitz Isi ein paar Monate zuvor gekommen war und mit deren Hilfe man im Sommer eine ganze Reihe Männer hatte verhaften können. Nur um die allermeisten kurze Zeit später wegen Mangels an Beweisen wieder freizulassen. Mit dieser Liste aber konnte die Identität des Attentäters geklärt werden, dessen Kehle Artur herausgerissen hatte. Er hieß Kurt Benner, zweiundzwanzig Jahre, gebürtig aus Oldenburg, ehemaliger Gefreiter des VII. Armeekorps, 1918 ehrenhaft entlassen und bis vor sechs Monaten in seinem Elternhaus in Oldenburg gemeldet. Seitdem galt er als verschollen und wurde verdächtigt, sich O.C.. angeschlossen zu haben.
Wer der Mann war, dem Artur in die Brust geschossen hatte, konnte nie ermittelt werden, aber es spielte auch keine Rolle mehr, denn zwei der drei Toten waren offensichtlich rechtsnationale Geheimbündler, und damit war uns auch klar, dass O.C.. den Mordversuch an Isi und Artur durchgeführt hatte. Ich nahm durchaus zur Kenntnis, dass O.C.. mich bei dieser Operation entweder vergessen oder schlichtweg für zu unwichtig befunden hatte. Wie lange aber würde es dauern, bis sie begriffen, dass sie meinen Freunden schaden konnten, wenn sie mich ebenfalls ins Fadenkreuz nahmen?
»Aber in wessen Auftrag?«, fragte ich Artur, als er mir die Ergebnisse kurz vor Silvester präsentierte.
Wir saßen in meinem Wohnzimmer, tranken Wein und hörten leise Musik aus dem Grammofon. Isi war oben in ihrem Zimmer, worüber ich froh war, denn weder Artur noch ich wollten sie in ihrer jetzigen Verfassung mit zu vielen Informationen belasten.
»Sie könnten es aus Rache getan haben, weil wir ihre Leute an die Staatsanwaltschaft verraten haben.«
»Es könnten auch die von Torstayns gewesen sein«, mutmaßte ich. »Wendell und Victoria hassen Isi. Und sie wissen, dass du sie beschützt.«
»Ja, vor allem Victoria ist ein harter Brocken. Die brennt eher ihr Gut in Ostpreußen nieder, als dass sie Isi als eine von Torstayn anerkennt.«
Ich goss uns beiden einen Schluck Wein nach.
»Und dann ist da noch Aldo …«
Offiziell waren Aldo und Isi immer noch verheiratet: der Hochadlige und die Bürgerliche. Wendell hatte seinem Ältesten nach der Hochzeit den Geldhahn zugedreht, und Aldo war die Sorte verwöhnter Schwerenöter, die ohne Prunk, Verschwendung oder Dienerschaft morgens nicht einmal aus dem Bett kam. In seiner Verzweiflung über sein unerträgliches Dasein ohne Pomp und Gloria hatte er mit Isi gebrochen und ihr gleichsam seine neue Verlobte präsentiert: Helene Boysen.
Ausgerechnet die.
Verzogenes Miststück. Isis Erzfeindin seit Kindertagen.
»Aldo ist zu schwach. Er könnte das nicht.«
»Er nicht«, antwortete ich. »Helene auf jeden Fall! Isi steht ihr im Weg, und ihr Bruder Falk ist bei O.C.«
Artur nickte. »Ja, sie hat eindeutig das beste Motiv. Und sie kennt keinerlei Skrupel. Genau wie Falk.«
»Und jetzt?«, fragte ich.
Artur stellte sein Glas ab. »Komm!«
»Wohin?«
»Wir holen uns Aldo.«
5
Aldo hätte Artur wohl keine zwei Minuten widerstanden, allein: Wir waren zu spät. Als wir das repräsentative Gründerzeithaus in der Victoriastraße fünf erreichten, die wenigen Treppen zum Haupteingang hinaufgesprungen waren und an der Klingel Sturm geläutet hatten, waren Aldo und Helene bereits fort. Das jedenfalls teilte uns ein robust wirkendes Dienstmädchen mit.
Artur schob die Frau einfach zur Seite und trat ein, um sich selbst davon zu überzeugen. Während er die Treppen in die Beletage hocheilte, rannte sie zum Telefon, um die Polizei zu rufen.
»Das würde ich nicht tun!«, warnte ich, nahm ihr den Hörer aus der Hand und hängte ihn wieder ein. »Oder wollen Sie, dass mein Freund runterkommt und sich mit Ihnen beschäftigt?«
Ihrem immer blasser werdenden Gesicht war anzusehen, dass sie darauf absolut keinen Wert legte. Arturs Maske schüchterte jeden ein, der sie zum ersten Mal sah.
Oben hörte ich Arturs schwere Schritte, Türknallen und laute Rufe anderer Bediensteter. Unverschämtheit! oder Flegel! Schließlich eilte Artur wieder die Treppen hinab in die kleine Eingangshalle und stellte sich so nahe vor das Mädchen, dass es instinktiv den Kopf senkte und auf seine Füße starrte.
»Wo sind sie?«
»W-wer?«
»Wo sind Aldo und Helene?«
»Die Herrschaften sind verreist, mein Herr«, gab die junge Frau kleinlaut zurück.
Artur schob ihr zwei Finger unter das Kinn, hob es an und zwang sie so, ihn anzusehen.
»Wohin?«
»Bitte tun Sie mir nichts!«, wimmerte sie.
»Wo sind Aldo und Helene?«, fragte Artur erneut.
»Wir wissen es nicht, mein Herr. Sie sind schon vor knapp zwei Wochen abgereist und haben niemandem gesagt, wohin sie fahren oder wie lange sie weg sein werden. Das ist die Wahrheit! Wirklich!«
»Vor zwei Wochen …«, wiederholte ich nachdenklich.
Kurz nach dem Anschlag.
»Ja, mein Herr. Sie können jeden fragen.«
»Schon gut.« Artur nickte.
Er glaubte ihr.
Unverrichteter Dinge verließen wir das Haus wieder und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Wenn die Nachbarn diverse Botschafter oder die Reichskanzlei selbst waren, durfte man getrost davon ausgehen, dass die Polizei nach einem Alarmruf in weniger als einer Minute vor Ort sein wird.
»Was nun?«, fragte ich Artur.
Der zuckte mit den Schultern: »Die werden sich nicht ewig verstecken können. Jetzt holen wir uns erst mal die anderen.«
An Silvester tobte im Arcasi das Leben.
Isi und ich dagegen blieben zu Hause, sie in ihrem Zimmer, ich im Wohnzimmer, bei zu viel Wein und Musik aus dem Grammofon. Unsere beiden Leibwächter standen meistens vor der Tür und rauchten, sodass es mir an Gesellschaft mangelte und ich mit jedem Schluck tiefer in den dunklen Brunnen meiner Erinnerungen stieg. Ich dachte an Papa und seine Geschichten von Mama. An Masha in Brest-Litowsk und an das, was wir hätten sein können ohne diesen verdammten Krieg. Und natürlich an Marlies, Hans’ Mutter. Wir hatten uns an Silvester kennengelernt. War das wirklich erst drei Jahre her? Wie sehr ich sie vermisste und wie sehr ich mir wünschte, damals aus diesem Zug nach Weimar ausgestiegen zu sein, anstatt zuzusehen, wie sie winkend im Wasserdampf einer stampfenden Lokomotive für immer verschwand.
Kurz nach Mitternacht beschloss ich, eine weitere Flasche zu öffnen, und nestelte gerade mit einem Korkenzieher daran herum, als ich plötzlich deutlich entschlossene Schritte auf der Treppe hörte. Im nächsten Moment flog die Tür zum Wohnzimmer auf: Isi stand im Raum.
Erstaunt sah ich sie an.
»Was ist?«, fragte ich.
Doch sie marschierte nur auf mich zu, nahm mir die Flasche aus der Hand, entkorkte sie und trank in großen Schlucken.
»Frohes Neues!«, sagte sie anschließend und gab mir einen Kuss auf den Mund.
»Was?«, fragte ich sie verdattert.
»Frohes Neues!«, wiederholte sie, als ob das alles erklären würde.
»Was ist denn los mit dir?«, fragte ich irritiert.
»Mir ist was klar geworden, Carl!«
»Was denn?«
»Mir ist klar geworden, dass ich so nicht weiterleben kann.«
»Was meinst du damit?«, fragte ich unsicher. Sie sah immer noch blass aus, und ihr Blick verriet nichts Gutes. Ich hoffte, dass ihr angegriffener Gemütszustand sie nicht zu sehr, sehr dummen Handlungen verleiten würde. Wieder griff sie nach der Flasche und trank in großen Schlucken.
Dann sagte sie: »Ich meine damit, dass ich wieder ich sein muss!«
Stirnrunzelnd antwortete ich: »Vielleicht bin ich schon zu betrunken, aber ich verstehe kein Wort.«
»Henry ist tot. Ich bin es nicht. Und ich werde denen nicht die Genugtuung geben, mich am Boden zu sehen.«
»Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich.
Statt zu antworten, schenkte sie mir ein, leerte dann den Rest der Flasche und fragte: »Haben wir noch was?«
Ich nickte, holte aus der Küche neuen Wein, den sie öffnete, um wieder gierig zu trinken.
Endlich setzte sie ab und zischte: »Die machen mich nicht fertig! Die nicht!«
Sie gab mir die Flasche und nickte. »Artur wird sie finden und …«
Den Rest des Satzes ließ sie vielsagend aus.
»Jedenfalls werde ich weitermachen! Da draußen gibt es viele, die meine Hilfe brauchen!«
»Du meinst dein Büro?«, fragte ich vorsichtig.
»Ich meine mein Büro«, bestätigte sie und nahm die Flasche an sich.
Sie hatte vor ein paar Monaten eine Anlaufstelle für Arme, Kriegskrüppel, Dienstmädchen und kleine Angestellte gegründet, die half, berechtigte Forderungen gegen Staat oder Arbeitgeber durchzusetzen. Bezahlen mussten die Klienten zunächst nichts, gaben aber, wenn der Fall gewonnen wurde, einen Teil des Streitwertes zurück. Friedemann Fromm betreute die Fälle für kleines Geld und verrechnete die geringen Verdienste mit den sehr hohen, die er mit Artur oder dem Ringverein Vergissmeinnicht einspielte.
Und Fromm gewann seine Fälle, zum großen Ärgernis der Berliner Staatsanwaltschaft, die ihn, den mit allen Wassern gewaschenen Ganovenanwalt, aufrichtig hasste, weil er sie in schöner Regelmäßigkeit am Nasenring durch den Gerichtssaal führte.
»Das … das finde ich gut! Wirklich gut!«
Sie trank abermals, und als sie absetzte, verriet ihr glasiger Blick, dass ihr der Alkohol rasant zu Kopf gestiegen war.
»Die krieg’n mich nich!«, murmelte sie mit schwerer Zunge und zischte in gereiztem Ton: »Die nich!«
»Vielleicht schalten wir jetzt lieber mal einen Gang runter, was denkst du?«, fragte ich sanft.
Statt einer Antwort nahm sie erneut einen ordentlichen Schluck und stieß kräftig auf: »So siehssu aus, Carl Schneiderssohn. Wir fahr’n Vollgas! Wir fahr’n immer Vollgas! Klar?«
Wieder küsste sie mich auf den Mund.
Dann grinste sie. »Frohes Neues!«
6
Das neue Jahr begann also mit einer scheinbar wiedererstarkten Isi, aber auch mit einer wenig ermunternden Überraschung für mich. Im November hatte die UFA, mein Arbeitgeber und mit uneinholbarem Abstand unumstrittene Königin aller Filmproduktionen, die Decla-Bioscop übernommen. Und offensichtlich wollte die Geschäftsführung zügig umstrukturieren: Wir Mitarbeiter wurden neu eingeteilt.
Ernst Lubitsch und Paul Davidson waren nach Amerika gegangen, mit dem Kauf der Decla bekam die UFA Erich Pommer als neuen geschäftsführenden Produzenten und mit Fritz Lang einen neuen Regisseur, dessen Bekanntschaft ich schon hatte machen dürfen.
Leider.
Vor allem aber bekam die UFA mit der Übernahme ein gewaltiges neues Produktionsgelände: die Filmstudios in Neu-Babelsberg.
Am zweiten Januar 1922 trat ich nun nichts ahnend in die Glashäuser am Tempelhofer Feld, als ich, kaum hatte ich meinen Mantel abgelegt, schon ins Büro gerufen wurde, wo man mir erklärte, dass man mir einen neuen Arbeitsplatz zugeteilt hatte. Auf meinen sehr vorsichtigen Protest hin gab man mir deutlich zu verstehen, dass man mich zwar schätzte, aber dass niemand unersetzlich wäre, vor allem die nicht, die zwei Wochen freigenommen hätten, während alle anderen ihrer Arbeit nachgegangen wären. Die Kosten für Bahn oder S-Bahn nach Neu-Babelsberg durfte ich immerhin in Rechnung stellen, hieß es, dann wünschte man mir noch gutes Gelingen und einen schönen Tag.
So kam es, dass ich, mit einem stillen Seufzer wegen der zukünftigen elend langen Anreisen, nach Neu-Babelsberg fuhr, über die Stahnsdorfer Straße ging und endlich vor meiner neuen Arbeitsstätte stand: einem dreistöckigen Fabrikgebäude mit weiten Rundbogenfenstern und eigenartigen, gebogenen Zacken auf dem Giebel, die aussahen wie gemauerte Krallen.
Einst hatte hier die Firma Hachmeister versucht, mit künstlichen Blumen und Pflanzen sowie Dekorationsartikeln erfolgreich zu sein, und war ebenso daran gescheitert wie die Victoria Kraftfutterwerke