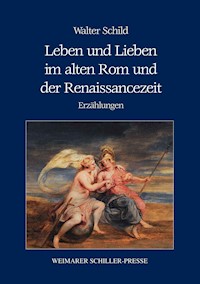
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die im Titel dieses Buches aufscheinenden zwei Zeitalter der europäischen Geschichte sind insofern miteinander verknüpft, dass in der Renaissance (= Wiedergeburt) vom Bürgertum der frühen Neuzeit die Sprachen des antiken Roms und Griechenlands sowie ihre Literatur, Philosophie und Kunst wiederentdeckt wurden. Die feudale Ritterschaft und die Kirche, die das dazwischenliegende Mittelalter bestimmt hatten, gerieten dadurch in eine Krise. Schon im Römischen Kaiserreich hatte es eine ähnliche Krise gegeben, als die antike Götterwelt durch den Glauben an nur einen Gott im aufkommenden Christentum infrage gestellt wurde. Die Erzählungen, die in beiden Zeitaltern angesiedelt sind, schildern, wie sich die geschichtlichen Veränderungen auf das Alltagsleben der Menschen, auf Frauen und Männer in diesen Umbruchzeiten auswirkten – auch auf ihr Verhältnis zueinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Einführung
Einführung in die Zeit der Erzählungen im alten Rom
Leben und Lieben
im alten Rom
Olivenernte
Julia
Marcellus oder Eine römische Hochzeit
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Novius
Winter
Einführung in die Renaissancezeit
Leben und Lieben
in der Renaissance
Patricia
Der Maler
I
II
III
IV
V
Olivia und Bartolomeo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Der Chorherr
Der letzte Ritter
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Inhaltsverzeichnis
Walter Schild
Leben und Lieben im alten Rom und der Renaissancezeit
Erzählungen
Weimarer Schiller-Presse
FRANKFURT A.M. LONDON NEW YORK
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit.Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2020 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE GMBH
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.public-book-media.de
www.august-goethe-literaturverlag.de
www.fouque-literaturverlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de
www.haensel-hohenhausen.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
Lektorat: Andreas Berger
ISBN 978-3-8372-2244-9
Allgemeine Einführung
Wir wissen viel vom eindrucksvollen Rechts- und Verwaltungssystem des antiken Römischen Reiches und haben oft auch Anlass, seine Architektur, Philosophie oder Kunst zu bewundern. Viel weniger anschaulich ist heute, nach so vielen hundert Jahren, wie damals der Alltag für den einzelnen Menschen in der Hauptstadt Rom oder auf dem Lande aussah.
Die fünf Erzählungen zu dieser Epoche konzentrieren sich auf dieses private Leben in der damaligen Zeit, besonders auf das Verhältnis von Männern und Frauen zueinander.
Verdeckt von 1 000 Jahren „Mittelalter“, erkundete das Bürgertum in den Städten der frühen Neuzeit langsam die Antike wieder in ihrer Sprache, ihren Werken und Werten. Zuerst geschah das in den norditalienischen Städten, für die damit auch ein Stück ihrer Frühgeschichte anschaulicher wurde. Als Renaissance (Wiedergeburt) dienten die antiken Vorbilder bald europaweit als vielseitige Anregungsquelle.
Die in dieser Zeit handelnden fünf Erzählungen versuchen, deutlich zu machen, wie sich die antiken Vorbilder und Einflüsse auf das private Leben der Bürgerinnen und Bürger in der Renaissancezeit auswirkten.
Einführung in die Zeit der Erzählungen im alten Rom
Die Stadt Rom wurde im 8. Jahrhundert v. Chr. der Sage nach von Romulus und Remus auf sieben Hügeln gegründet und beherrschte bald auch ihre nähere Umgebung. In Kämpfen gegen die ebenfalls auf dem italienischen Stiefel beheimateten Volksstämme und Kulturen, zum Beispiel die Etrusker, gewannen sie die Vorherrschaft über sie. Ein Charakteristikum der ausgreifenden römischen Herrschaft war, dass sie sich in den religiösen und kulturellen Zusammenhalt der besiegten Völker nicht einmischten, jedoch Abgaben verlangten, sie durch Verkehrswege verbanden und durch die Einführung ihres Rechts beherrschten.
Das familiäre und öffentliche Leben im alten Rom wurde – wie bereits bei den griechischen Stadtstaaten– von den Männern bestimmt. Das drückte sich bereits in der Bezeichnung der Oberhäupter der bestimmenden Familien als „Patrizier“ aus. „Sklaven“ dagegen benutzte man für jede Art von praktischer Arbeit in der Stadt, auf den Landgütern, aber auch für alle häuslichen Dienstleistungen. Sie waren Eigentum ihres jeweiligen Besitzers und rechtlos. Oft handelte es sich um Kriegsgefangene, Schiffbrüchige, ausgemusterte Menschen aus den besiegten Völkern, die auf Sklavenmärkten verkauft wurden. Waren sie gebildet, konnten sie auch als Lehrer der Heranwachsenden in reichen Familien eingesetzt werden. Erwarben sie sich Verdienste, konnten sie von ihren Besitzern freigelassen werden und sich – mit ihren erworbenen Fähigkeiten – auch wirtschaftlich selbstständig machen. Selbst wenn sie jedoch zu Reichtum gekommen waren, blieben sie als „Freigelassene“ doch Bürger zweiter Klasse.
Die Stadt Rom selbst und auch das von ihr beherrschte Reich hatten viele Jahrhunderte lang eine republikanische Verfassung und wurden von den einflussreichen Familien der Stadt regiert, die im Senat ihre gemeinsame Politik festlegten. Durch seine militärischen Qualitäten beherrschte Rom bald alle an das Mittelmeer grenzenden Staaten und die Mittelmeerinseln. Durch berühmte Feldherren wie Cäsar versuchte es anschließend auch, das nördliche Europa, das heutige Frankreich, England und Deutschland zu erobern. Nach der Ermordung Cäsars, der sich zum Alleinherrscher Roms machen wollte, durch Anhänger der Republik, gelang es im folgenden Machtkampf Augustus, als Kaiser das Reich aus diesen Wirren zu führen und zu befrieden – er lebte zur Zeit von Christi Geburt.
Die Erzählungen handeln in der frühen Zeit seiner Nachfolger, die die Macht fest in ihrer Hand hatten. Der römische Senat bestand als repräsentatives Gremium weiter und konzentrierte sich in der Kaiserzeit auf die Verwaltung der Metropole Rom.
Die zentrale Erzählung handelt in der Hauptstadt Rom der frühen Kaiserzeit und beleuchtet das Werben um eine Ehefrau, die Heiratssitten und das Eheleben innerhalb einer angesehenen römischen Familie.
In den einleitenden kürzeren Erzählungen begeben wir uns in die ländliche Umgebung der römischen Hauptstadt. Einmal tauchen wir in die Lebenswelt der Sklaven ein, die auch für die Arbeit in der Landwirtschaft gebraucht wurden. In der zweiten Geschichte geht es um die Tochter einer bedeutenden römischen Familie, die sich in einen sie unterrichtenden Sklaven verliebt hatte und auf den Landsitz der Familie verbannt wurde.
In den beiden letzten Kurzgeschichten spielt das aufkommende Christentum im Römischen Reich eine wichtige Rolle. Das war auch dann noch der Fall, als die Herrschaft Roms am Ende des fünften Jahrhunderts zusammengebrochen war und germanische Völker den Norden Italiens regierten.
Leben und Lieben
im alten Rom
Olivenernte
Pico war als junger Gehilfe dem Pan zugeteilt, um mit ihm eine größere Ziegenherde zu hüten. In der Herde befanden sich junge und ältere Tiere, auch solche, die gerade trächtig waren, und Muttertiere mit Zicklein. Pico und Pan teilten das Melken und das Beaufsichtigen der Herde unter sich auf. Manchmal waren verirrte Tiere zurückzuholen. Das alles lernte Pico vom alten Pan, dem erfahrenen Hirten. Doch so viel Pan über Kräuter, Krankheiten der Tiere und ihre Behandlung auch wusste, so wenig wusste er von Frauen oder dem fernen Rom – Dinge, die den jungen Pico brennend interessierten.
Und auch sonst war Pico wissbegierig. „Wieso heißt du Pan?“
„Wieso heißt du Pico?“, fragte dieser zurück. „Die Namen haben wir Sklaven von unserem Herrn bekommen, dem es irgendwann einfiel, uns so zu nennen.“
Ihr Herr war ein inzwischen greiser Pächter mit seinem Weibe, der mithilfe seiner Sklaven das Landgut bewirtschaftete. Die beiden Alten waren gerecht und mild, und ihre Untergebenen lebten gerne bei ihnen. Der Herr achtete auf gute Sitten, und so wohnten die Männer und die Sklavinnen streng getrennt. Unter den älteren Arbeitern gab es auch Paare, die zusammenlebten. Bei ihnen wurde darauf geachtet, dass sie ihre Kinder gut erzogen. Pico, der mit fünf etwa Gleichaltrigen in einem großen Raum des Stallgebäudes lebte, hatte deshalb wenig Gelegenheit, die Mädchen, die ihre Männergespräche so stark bestimmten, genauer kennenzulernen.
Wenn Pico die Krüge mit der Milch von der Weide zum Hof trug, ergab es sich gelegentlich, dass er an dem einen oder anderen der jungen Mädchen vorbeiging. Er musterte sie dabei genau und versuchte, sie wie seine Tiere an bestimmten Merkmalen zu unterscheiden. Eines Tages fiel ihm ein Mädchen auf, das auch ihn kurz musterte und dessen Augen ihn freundlich anblitzten. Diese Szene beschäftigte ihn bis in seine Träume. Doch so oft er in den nächsten Tagen auch Ausschau hielt – sie ließ sich einfach nicht mehr sehen. Das nahm ihn so in Anspruch, dass Pan ihn wegen Unaufmerksamkeiten rügen musste. Doch er konnte nicht anders, als an sie zu denken. Als er zu zweifeln begann, ob es sie überhaupt gegeben habe, sah er sie etwa an der gleichen Stelle wieder stehen. Über ihr Gesicht ging ein Wiedererkennen, und sie lächelte ihn an. Zu aufgeregt, um zurückzulächeln, hatte er danach das Gefühl, sich dumm angestellt zu haben. Er hatte wieder ihre Augen gesucht – sie waren schwarz und sehr lebendig – und hatte sonst nichts von ihr gesehen.
Der Herbst war fast vorüber, und es nahte die Olivenernte. Dabei mussten alle mithelfen. Pan hatte mit Picos Hilfe die Herde in einen Pferch getrieben. Beide kannten die Ölbaumfluren gut, da ihre Ziegen in den vergangenen Wochen das Gras unter den Bäumen abgefressen hatten, um die Ernte zu erleichtern. Der Herr versammelte alle auf dem freien Platz vor dem Gutshause, dankte den Göttern für das gute Wachstum der Oliven und forderte sie auf, an deren Ernte zu gehen und sie dabei sorgfältig zu behandeln. Zwei Männer und drei Helferinnen sollten jeweils einen Baum abernten. Pico sah nun die lang ersehnte Gelegenheit gekommen, in der Nähe seines Mädchens zu sein: Er wollte sich für ihre Gruppe einteilen lassen. Doch ach, wie sollte er sie wiederfinden, kannte er doch nur ihre Augen? Als er suchend umherging, schauten ihn recht viele Mädchen freundlich an. Aber keine war – nach seiner Erinnerung – die Richtige. Schließlich wurde er vom Aufseher der letzten Gruppe zugeteilt. Betrübt nahm er eine der Stangen mit dem runden Haken auf und schloss sich den anderen an.
Die Aufgabe der Männer war es, durch Rütteln der Äste die Früchte herunterzuschütteln. Sie nahmen dafür entweder Leitern oder die Stangen zu Hilfe. Die Weiber, Mädchen und die Kinder sammelten die heruntergeschüttelten Oliven in Körbe und leerten diese in zweirädrige Kastenwägen aus, vor die, wenn sie voll waren, ein Esel zum Abtransport angeschirrt wurde.
Pico war so in sein Unglück versponnen, dass er es zunächst gar nicht bemerkte, dass ihn Oliven auch dann trafen, wenn nicht geschüttelt wurde. Schließlich sah er sich um, erblickte allerdings nur hinuntergebeugte Sammlerinnen, die viel miteinander lachten. Er wandte sich wieder der Arbeit zu, und prompt traf wieder eine Olive seinen Rücken. Nun wollte er es wissen: Da er die fröhlichen Mädchen in Verdacht hatte, tippte er einem nach dem anderem auf die Schulter, um es zum Aufschauen zu bewegen. Doch wie auf Verabredung wandten sie sich dem Wagen zu, um ihre Körbe zu leeren. Aber sie mussten ja wieder zurückkehren! Und hier erkannte er in der Mittleren sein schwarzäugiges Mädchen. Sein Herz tat einen Sprung. Sie näherte sich ihm, während die beiden anderen wieder mit dem Sammeln begannen. Nun standen sie sich gegenüber.
Er nahm seinen Mut zusammen und sagte ihr: „Ich habe dich heute gesucht. Ich musste oft an dich denken.“
Sie lächelte ihn an. „Jetzt haben wir uns gefunden“, entgegnete sie nur und begann, wieder aufzusammeln.
Pico sah über ihr noch einen Zweig, an dem eine vergessene Olive hing. Er schüttelte ihn, und die Frucht fiel auf ihren Rücken. Sie lachte.
Der alte Pan sah nach ihm: „Alles in Ordnung, Kleiner?“
„Ja, alles in Ordnung.“ Er spürte, es war viel mehr, fühlte er sich doch beschenkt und glücklich. Sein Auge schweifte über die abgeweideten, braungrünen Fluren bis zu den fernen Bergen hinüber. Über die Berge spannte sich ein blassblauer Himmel bis ins Unendliche. Er sah das alles wie zum ersten Mal: Es war einfach schön.
Julia
Wenn sie zurückblickte, musste sie sich eingestehen, dass es nicht anders hatte kommen können, als es gekommen war. Sie saß auf „ihrer“ Steinbank im Park des elterlichen Landhauses in den Albaner Bergen. Diese Bank stand an einem rechteckigen Bassin, das von einem Säulengang und marmornen Figuren umgeben war. Sie sah auf eine nackte Nymphe, die in etwa ihre Figur hatte, und dachte für sich: „Wie leicht ist es doch, tugendhaft zu sein und seine schlanke Figur zu behalten, wenn man aus Stein ist.“ Sie selbst war nicht aus Stein und war deshalb in dieses Idyll verbannt worden. Als Verbannung empfand sie die Entscheidung des Vaters, der sie nach ihrem „Fehltritt“, zusammen mit der Mutter, der Amme und Dienerinnen hierhergeschickt hatte. Hier würde sie ihr Kind bekommen, entfernt aus der Gesellschaft Roms und geschützt vor ihrem Klatsch. Ihr Kind, das sie in fünf Monaten erwartete, würde von ihrem Vater – das sah sie voraus – nicht anerkannt; es würde ausgesetzt und von Sklavenhändlern eingesammelt werden oder sterben. Welchen Zweck hatte dann noch ihre Schwangerschaft mit ihren Mühen und dem Fehlen jeder Hoffnung? Wäre es nicht besser gewesen, das Kind abzutreiben, sobald das möglich gewesen wäre? Doch dagegen hatte sie sich innerlich gewehrt in der wahnwitzigen Hoffnung, dass ihr Vater Lucius freilassen und ihre Verbindung akzeptieren würde.
Lucius war bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr einer ihrer Erzieher gewesen. Der Vater hatte ihn für teures Geld erworben, damit er seine Kinder unterrichte. Aus einer griechischen Familie in Vorderasien stammend, hatte er eine ausgezeichnete Bildung in Ephesos genossen. Als er nach Rom reisen wollte, um seine Studien fortzusetzen, war das Schiff von Seeräubern gekapert und die erbeuteten Reisenden in Alexandria als Sklaven verkauft worden. Der Käufer, ein Händler, hatte ihn nach Ostia gebracht, wo ihn der Vater gekauft hatte. Sie selbst war mit ihren Brüdern, ihrer Amme und Bediensteten, unter anderen auch mit Lucius, sommers hier aufgewachsen. Als ihre Erziehung mit fünfzehn Jahren abgeschlossen war und sie überwiegend in Rom lebte, begegnete sie Lucius in dem geräumigen elterlichen Hause immer wieder; er unterrichtete ihre Brüder nun in Rhetorik und griechischer Literatur. Sie hatte beim Vater erreicht, an der Einführung in die griechische Poesie, die Tragödien und die Werke Homers teilnehmen zu dürfen. Da ihr Griechisch ausgezeichnet war, besser als das der Brüder, hatte der Vater zugestimmt. Daneben lernte sie die Kithara spielen. Da Lucius eigene poetische Übungen empfahl, hatte sie Gedichte an einen Geliebten verfasst und dabei mehr und mehr an ihren Lehrer gedacht. Da auch ihre Blicke zu ihm sprachen, ahnte er bald, dass er selbst mit dieser Lyrik gemeint war. Diese ihre Schwärmerei hatte sich bei ihnen in eine heimliche Liebe gewandelt. Wenn sie ihre Verse rezitierte und mit ihrem Instrument begleitete, sang es in ihr, und sie sah sich mit Lucius zusammen in einer schönen Zukunft. Irgendwann hatte er ihr Antwortgedichte zugesteckt. Als sie sich dann außerhalb des Unterrichts trafen, war das nur nachts möglich gewesen, da während des Tages den Bediensteten und den wachsamen Augen der älteren Frauen im Hause kaum eine Kleinigkeit entging. Es war eine furchtbare Szene gewesen, als der Vater, auf dessen besonderes Wohlwollen sie bis dahin bauen konnte, zwischen Zorn und Enttäuschung ihre „Verbannung“ hierher angeordnet und den Lehrer sofort aus seinem Hause entfernt hatte. Wie sie hörte, war Lucius vom Vater zu schwerer Arbeit in einem seiner Marmorbrüche im fernen Etrurien verurteilt worden.
Ihre eigenen Chancen waren auf dem römischen Heiratsmarkt durch den Verlust ihrer Jungfräulichkeit gesunken. Ihr war das nur recht, da sie sich keinen anderen Mann als Lucius an ihrer Seite vorstellen mochte. Sie hatte einen ehrerbietigen Brief an ihren Vater verfasst, in dem sie ihn bat, Lucius freizugeben und ihnen ein kleines Landgut zur Bewirtschaftung zu überlassen. Bis heute hatte sie keine Antwort erhalten. Hatte ihr Vater noch die Hoffnung, sie vorteilhaft zu verheiraten? Solange eine Antwort auf sich warten ließ, konnte sie sich ihrem Traum noch hingeben: Sie sah sich nach der Geburt unter den Frauen, die Hebamme legte ihr Kind auf den Boden, und Lucius hob es auf, um es als seines anzuerkennen. Wie einfach, wie schön könnte das Leben doch sein!
Marcellus oder Eine römische Hochzeit
I
Erzählt wird hier aus dem Leben eines jungen Römers der frühen Kaiserzeit. Während seiner Erziehung und in seinen Studien waren ihm die Lehren der Stoa vermittelt worden, die das Ideal der Ehe hochhielten. Das Zusammenleben mit der Gattin sollte auf Freundschaft und gegenseitiger Hilfe fußen und die körperliche Liebe ausschließlich dazu dienen, für gesunden Nachwuchs zu sorgen. Alles war von der Vernunft her zu steuern; Lust oder gar Ausschweifungen sollten im ehelichen Verhältnis keine Rolle spielen. Unter diesen Bedingungen konnte sich Marcellus ein Leben sehr gut auch ohne eine Gattin vorstellen, zumal das, was er aus bestehenden Ehen hörte, viel mehr mit Verdruss und Streitereien zu tun hatte als mit einem Zustand, den man anstreben und für den man Opfer bringen sollte. Seinem Vater gegenüber hatte er sich nicht getraut, dieser Skepsis der Ehe gegenüber Ausdruck zu geben. Für den Vater war der Lebensweg des Sohnes klar vorgezeichnet gewesen: Nach der Verehelichung mit einer Tochter aus bestem Hause sollte der Sohn es, wie er selbst, einmal zum Senator bringen. Marcellus hatte sich diesem väterlichen Zugriff einerseits fügsam gebeugt, war jedoch andererseits dort, wo er selbstständig entscheiden konnte, einem Weg gefolgt, der ihm bei Bekanntwerden den Vorwurf der Verschrobenheit eingebracht hätte: Er ertüchtigte seinen Körper mit gymnastischen Übungen griechischer Art wie ein Sportler oder Kämpfer. Das gehörte sich, wenn man nicht eine militärische Laufbahn anstrebte, für einen Angehörigen seiner Kreise nun wirklich nicht. Und andererseits frönte er der Frauenliebe, was – wie man allgemein fand – zur Verweichlichung führte. Für ihn selbst jedoch war beides bis vor Kurzem seine Art des Protestes gegen die in seiner Familie gelebte Prüderie gewesen, wie auch gegen die Zurückstellung aller persönlichen Wünsche hinter die ehrgeizige Familienpolitik.
Der Tod des Vaters vor wenigen Wochen machte diesen Protest, was seine innerfamiliäre Seite anging, nun gegenstandslos. Denn er war damit Herr des Hauses geworden und somit in eine Machtposition gerückt, auf die die meisten männlichen Nachkommen der großen Familien oft ein Leben lang warten mussten. Zu seinem Erstaunen bemerkte er seither bei sich Veränderungen in seinem Urteil und seiner Weltsicht. Wirtschaftliche Notwendigkeiten übten einen fast diktatorischen Einfluss auf Entscheidungen aus, von denen er vorher gedacht hatte, sie stünden in seinem freien Ermessen. Auch die vermutete Außensicht auf sein Haus nahm er nun viel ernster. In vielem verstand er seinen Vater erst jetzt. Nun war es zu einer seiner wichtigsten Aufgaben geworden, die Reputation seines Hauses aufrechtzuerhalten, zumal wenn er sich um das Amt eines Senators bewerben wollte, wie es sowohl von Freunden als auch von Gegnern erwartet wurde.
Dazu gehörte – wohl oder übel – auch das Eingehen einer Ehe. Seine Skepsis würde er überwinden müssen. Aufgrund der Zugehörigkeit seiner Familie zu den obersten Kreisen des kaiserlichen Roms galt er – davon konnte er ausgehen – als ausgezeichnete Partie und würde keine Schwierigkeiten haben, eine Tochter aus einer der einflussreichen Familien für sich zu gewinnen. Da auch seine Tante, die nach dem frühen Tod seiner Mutter den Haushalt leitete, ihn zu diesem Schritt drängte, entschloss er sich, Rufinus als engen Freund seines Vaters zu bitten, für ihn in den infrage kommenden Häusern in dieser Sache vorzufühlen.
II
Als er sich am späteren Abend mit Lydia, einer jungen Sklavin, der er seine persönliche Bedienung übertragen hatte, in sein Schlafgemach zurückzog, ging ihm diese notwendige Verehelichung noch durch den Kopf. Wie müsste er es anstellen, um sich die Nächte mit Lydia auch in der Ehe zu erhalten?
„Löse dein Haar“, bat er sie.
Sie kam seiner Bitte nach und zog die Kämme heraus, die ihr Haar zusammengehalten hatten. Dann suchte sie für ihn aus der Fruchtschale eine besonders reife Feige heraus. Noch in seine Gedanken versunken, nahm er die Frucht und legte sie wieder zurück.
„Was habt Ihr, Herr?“, wollte Lydia nun wissen.
„Ich denke daran, dass ich mich verheiraten sollte“, entgegnete er.
„Dann werdet Ihr Eure Nächte bald mit einer Gattin verbringen?“, fragte Lydia bekümmert weiter.
Beide ahnten sie, dass ihr lustvolles Beisammensein damit ein Ende haben würde. Noch rechtzeitig erinnerte er sich an den Rat des Epikur, doch das Heute nicht um eines unbekannten Übermorgens willen zu versäumen.
Dieses Heute, das waren das warme Licht der Öllämpchen, das weiche Lager, der gewürzte Wein und das süße Obst, vor allem aber seine reizende junge Gespielin, ihm ganz ergeben. Sie saß am Fußende des mit Kissen und Fellen bedeckten Betts, stützte ihr Kinn auf das Knie und sah ihn an.
„Mische mir den Wein, du weißt schon: Nicht zu viel Wasser!“, bat er sie.
Sie schien auf diese Bitte gewartet zu haben. Geschickt hantierte sie mit den Krügen, kniete sich zu ihm hin und reichte ihm den vollen Pokal.
„Trink du zuerst!“
Sie tat einen kleinen Schluck.
„Mehr!“, befahl er.
Sie trank und schaute ihn dabei über den Becherrand hinweg an. Dann trank er den Wein in einem Zuge aus und reichte ihr den Pokal. Sie füllte ihn, und er trank.
Marcellus bemerkte, dass ihm leichter wurde. „Zieh dich aus, Lydia.“
Sie schüttelte die Locken des langen dunklen Haars vor ihr Gesicht, wie um sich zu verbergen, bevor sie, bei jedem Handgriff zögernd, die Spangen löste und ihr Obergewand schließlich herunterglitt.
„Darf ich zu Euch kommen?“, fragte sie.
Es war ihm bisher wichtig gewesen, in seinem Liebesleben möglichst gegen alle Tabus zu verstoßen, die ihm bekannt waren. Zum Beispiel liebte er die Frauen auch bei Tageslicht oder in erleuchteten Zimmern und veranlasste die Frauen, sich völlig zu entkleiden. An die Lämpchen hatte Lydia sich gewöhnt, das Entkleiden war indessen durch ihren sanften Widerstand zu einem Spiel mit ungewissem Ausgang geworden, lag es doch nicht in der Natur von Marcellus, sie zu nötigen oder Gewalt anzuwenden. So auch jetzt.
„Nein, warte, gieße Öl in das hintere flackernde Lämpchen dort.“
Nun musste sie aufstehen, und er sah durch das dünne Untergewand die Konturen ihres Körpers.
„Mische uns noch einen Wein. – Bring die Obstschale her.“ Es gefiel ihm, dieses anmutige Mädchen zu beschäftigen und sich an ihren Bewegungen zu erfreuen. Nun erst bat er sie, zu ihm zu kommen und auch ihr Untergewand abzulegen.
„Muss das sein?“
„Es muss sein.“
„Vielleicht ein wenig später?“
„Na gut.“
Sie lächelte ihn an und streifte es nun freiwillig ab. Allerdings drapierte sie es so, dass es die intimen Teile ihres Körpers bedeckte. Sie tranken wieder. Lydia, sonst temperamentvoll und voller Ideen für lustige Neckereien, blieb an diesem Abend verhalten.
„Ihr werdet mich nicht mehr rufen lassen, Herr.“
„Warte es ab und mach dir nicht heute schon Sorgen deswegen.“
„Sie wird es nicht zulassen.“
„Diese ‚sie‘ gibt es noch nicht.“
„Es wird sie bald geben, ganz gewiss.“
Marcellus, dem Lydias Wehmut jetzt nicht passte, auch weil seine eigene dadurch geweckt wurde, ließ etwas von seinem Wein in ihren Schoß tropfen. Sie zog schnell ihr Gewand weg und versuchte, den Wein mit den Fingern wegzuwischen, doch je mehr sie sich bemühte, umso reichlicher machte er sie nass. Nun musste auch sie lachen. Sie gab ihre Mühe, sich trocken zu halten, auf und verteilte den Wein über Bauch und Schenkel. In seinem Bemühen, die Abschiedsgedanken aus ihren Köpfen zu vertreiben, nahm er die reife Feige von vorhin und zerdrückte sie am festen Busen Lydias. Dann beugte er sich über sie und aß sie von ihrem Körper. Nach anfänglichem Zögern gewann Lydia selbst Spaß an diesem Treiben, streifte die Reste der Früchte, die er zerdrückte, von ihrem Körper und naschte daran. Sie genoss es auch, dass Marcellus sie mit seinen noch fruchtigen Lippen küsste. Lydia hatte den Einfall, dass sie eine Frucht gleichzeitig, ohne Zuhilfenahme der Hände, zu essen versuchen sollten. Fast gelang die gewohnte Unbeschwertheit.
Noch manche hervorgehobenen oder verschwiegenen Orte ihrer Körper fanden sie an diesem Abend zum Platzieren und Genießen der reifen Früchte geeignet. Unmerklich kamen sie so zu ihrem ersten Höhepunkt. Es sollte nicht der letzte in dieser Nacht bleiben. Als sie sich zuletzt eng umschlungen ausruhten, klebten die Reste ihres Liebesmahles sie so unzertrennlich aneinander, als wären sie nur ein Leib. Erst das anschließende Bad machte sie wieder zu Einzelnen, durchwärmt und in jeder Hinsicht gesättigt.
III
Nach einer Nacht wie dieser mochte Marcellus nicht daran denken, Lydia aufzugeben. Doch Rufinus hatte seinen Auftrag ernst genommen und berichtete ihm bereits nach wenigen Tagen von den Ergebnissen: Die Töchter dreier „Häuser“ schienen infrage zu kommen. Eine Familie mit besten Verbindungen zum Kaiserhaus besaß ein Einzelkind, eine Tochter, von der allerdings ein Gerücht wusste, dass sie nicht sehr ansehnlich sei. Die Mitgift würde bei dieser Partie allerdings hoch ausfallen. Dann gab es noch das Haus des Claudius, mit dem sein Vater befreundet gewesen war. Dessen Tochter kenne er ja. Sie sei wohl mit Rücksicht auf ihn noch nicht anderweitig versprochen worden. Schließlich komme auch die Familie des Antonius infrage, zu deren Vorfahren ein Senator gehört habe. Antonius besitze Mietshäuser in Rom und Ostia, auch einige Landgüter, habe jedoch zwei Töchter auszustatten, sodass die Mitgift wohl kleiner ausfallen werde. Von den Töchtern, Zwillingen, war zu erfahren gewesen, dass sie wohlerzogen und wohlgebaut seien. Marcellus dankte Rufinus für seine Erkundigungen – er wolle sich das Gehörte durch den Kopf gehen lassen. Bei einer ersten gefühlsmäßigen Einschätzung schied für Marcellus die erste Option wegen der Hässlichkeit des Mädchens aus – wenn schon Ehekrieg, dann wenigstens mit einer attraktiven Amazone! Die Tochter der Familie, zu der ein freundschaftlicher Kontakt bestand, hatte er als schnippisch und oberflächlich erlebt – es sollte in einer Ehe doch auch möglich sein, sich vernünftig über ernsthafte Themen zu unterhalten. Da er alles Schöne liebte, kam für Marcellus wirklich nur die Familie des Antonius in Betracht. Denn was gab es Schöneres als wohlgebaute Mädchen? Kurz entschlossen bat er Rufinus, wenn möglich weitere Erkundigungen über diese Familie einzuholen. Auch er selbst wolle sich in seinen Kreisen dazu umhören.
Mit Priscilla, der Schwester seiner Mutter, die ihn schon eine Weile zu einer Verheiratung drängte, überlegte er, welche Schritte er seinerseits noch tun könne. Sie schlug für weitere Erkundungen die Einbeziehung seiner Freunde und Klienten in einem Gastmahl vor, das sie gern für ihn ausrichten wolle. Da sie dem Haushalt der größeren Stadtvilla seiner Familie, die der Vater bewohnt hatte, vorstand, stimmte er gern zu. Sie planten die Einladung für den nächsten Tag. Seine Villa, in der er noch immer lebte, wäre für diesen Zweck zu klein. Der Vater hatte sie ihm seinerzeit großzügig „für den flotteren Lebensstil eines heranwachsenden Römers aus gutem Hause“ zur Verfügung gestellt. Freilich musste er sich mit weniger Bedienstetenbegnügen, die er allerdings für seine Bedürfnisse gut ausgesucht hatte. Es war eine lange Leine gewesen, an der ihn der Vater hatte laufen lassen. Da er mit diesem Rahmen zufrieden gewesen war, hatte es mit dem Vater wenig Ärger gegeben. Welcher seiner Bediensteten hatte den Vater wohl über ihn auf dem Laufenden gehalten? Der Vater hatte nie erkennen lassen, dass er ihn überwachte, obwohl dies naheliegend war.
Ein Teil des Tages war bisher seiner ehrenamtlichen Aufgabe in der öffentlichen Verwaltung gewidmet gewesen. Sie bestand in der Aufsicht der städtischen Bäder. Heute waren einige Betreiber dieser hygienischen Anstalten für die Bevölkerung zur Berichterstattung bei ihm. Er hörte sie an und konfrontierte sie mit Beschwerden, die ihm zugetragen worden waren. Da sich die aufgezeigten Mängel immer auf dieselben Einrichtungen konzentrierten, drohte er mit dem Entzug der Pacht, wenn sie nicht umgehend beseitigt würden. Das wolle er in allernächster Zeit persönlich kontrollieren. Die Betroffenen verteidigten sich, wussten jedoch, dass sie ihre einträglichen Posten auch in Zukunft nur mit dem Wohlwollen des Marcellus behalten könnten. Sie sahen deshalb keine andere Möglichkeit, als ihre auch bisher nicht geringen Abgaben an ihn noch zu erhöhen. Marcellus hatte dieses Amt durch die Fürsprache des Vaters erhalten. Bis vor Kurzem waren die „freiwilligen Zuwendungen“ aus dieser Tätigkeit neben dem Peculium, das der Vater ihm gewährt hatte, die einzigen Einnahmen gewesen, über die er verfügte. Nachdem er den Pächtern noch ins Gewissen geredet hatte, verabschiedete er sie – mit seinem Auftreten ganz zufrieden.
Nach dem vielen Sitzen hatte er den Wunsch, sich zu entspannen. Er suchte deshalb zunächst sein häusliches Bad auf und ließ Marcus, seinem „Kampfgenossen“, Bescheid geben, dass dieser sich bereithalten solle. Er hatte eine Leidenschaft für das Kämpfen Mann gegen Mann entwickelt, weil er stark sein wollte und der Kitzel des Kämpfens ihm auch Freude machte. Seine Freunde hatten dafür kein Verständnis und fanden diese Anwandlungen plebejisch. So musste er es für sich selbst organisieren. Er hatte deshalb zeitweise einen Lehrer verpflichtet, der ihn im Ringen unterrichtete, wie es die Griechen für ihre sportlichen Kämpfe entwickelt hatten. An diesem Unterricht hatte er auch einen etwa gleichaltrigen jungen Sklaven teilnehmen lassen, mit dem zusammen er seine gymnastischen Übungen machte und auch kämpfte. Außerdem hatte er ihn zum Masseur ausbilden lassen. Er liebte es, seine Kraft, seine Wendigkeit und das Reaktionsvermögen zu trainieren – das verschaffte ihm ein gutes Körpergefühl.
Bald meldete sich Marcus zur Stelle. Er war mittelgroß wie Marcellus, etwas dunkelhäutiger, wirkte sehnig und wohlproportioniert. Auf seinem freundlichen Gesicht lag ein Lächeln. „Wir haben länger nicht geübt“, stellte er fest.
„Ja, ja, du hast recht. Heute können wir ein wenig nachholen“, entgegnete Marcellus.
Sie begannen mit ihren Aufwärmübungen.
Marcus hatte auf einer größeren Terrasse des Gartens bereits weiche Matten ausgebreitet.
„Hast du dafür gesorgt, dass wir ungestört bleiben?“
„Das ist bereits geschehen, Herr.“
Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, begannen sie nun ihre Dehn- und Streckübungen, bevor sie zu dem Krafttraining übergingen. Für eine Stärkung zwischen den Übungen standen Erfrischungsgetränke, kleine Fladen und Obst bereit. Marcellus nahm davon und schlenderte auf den sandigen Wegen durch den kleinen Park. Da Marcus auch den Park und die Außenanlagen pflegte, folgte er ihm in einiger Entfernung, um eventuelle Anordnungen aufzunehmen. Marcellus war jedoch in seiner zufriedenen Stimmung mit allen Änderungen, auf die er von Marcus hingewiesen wurde, einverstanden.
Er freute sich bereits auf das Ringen, das sich wie gewohnt an die Übungen anschließen würde. Der Brauch erforderte es, sich vorher mit Olivenöl einzureiben; sie erwiesen sich diesen Dienst gegenseitig. Die Kämpfer traten nun einander gegenüber, beobachteten sich aus den Augenwinkeln und überlegten, mit welchem Griff sie den anderen überraschen könnten. Marcellus gefiel die bis in die letzte Faser sichtbare Anspannung seines Gegenübers, die alle Muskeln und Sehnen des Körpers modellierte. Dann erfolgte sein Angriff, der sich auf die Hüften des Gegners konzentrierte, um ihn seines festen Standes zu berauben. Marcus konterte jedoch mit einem Vorschnellen des Oberkörpers, und so fanden und verschränkten sich ihre Arme. Obwohl sie alle Kraft einsetzten, einander nach unten zu zwingen, war es dennoch eine Pattstellung, die sie schließlich beendeten. Beim neuen Angriff umklammerten sie sich Brust an Brust. Da Marcellus etwas stärker war, konnte er alle Befreiungsversuche von Marcus verhindern; er ließ ihm dann und wann ein wenig Freiraum, doch presste er ihn immer wieder fest an sich. Dann gelang es Marcus mit einer überraschenden Wendung doch, herauszuschlüpfen und Marcellus in den „Schwitzkasten“ zu nehmen. So wogte der Kampf mit wechselnden Vor- und Nachteilen hin und her, bis die Sanduhr abgelaufen war. Wie schon oft hatte keiner den anderen in dieser Frist niederringen können. Marcellus war keineswegs enttäuscht, ging es ihm doch um das Kämpfen selbst. Sie umarmten sich freundschaftlich und ruhten sich aus.
Als bei der abschließenden Massage Marcellus seine Muskeln und Sehnen genussvoll den geübten Griffen des Marcus überließ, dachte er nach, warum er das Ringen und Massiertwerden so liebte. Dabei verlor er sich in frühe Jahre: Als Herrenkind hatte er gern raufen wollen, doch da war kein Spielkamerad, und hätte es einen gegeben, hätte dieser sich wahrscheinlich nicht getraut, ihm ernsthaft wehzutun. Die Krankheit und der Tod der Mutter sowie die distanzierte Haltung des Vaters ließen ihn menschliche Nähe vermissen. Offenbar hatte er das Bedürfnis danach behalten. Kam daher seine Vorliebe für das Ringen, diese ruppige Form der Nähe und zu den intensiven Formen der Erotik, zuletzt mit Lydia? Es war ihm scheinbar gelungen, sich mit diesen Neigungen einen Ersatz zu schaffen. War der nun durch eine Ehe nach stoischem Muster wieder infrage gestellt? Marcellus rief sich zur Ordnung, weil er schon wieder dabei war, den so schönen gegenwärtigen Augenblick an Zukunftsbefürchtungen zu verlieren. Deshalb nahm er nun die warmen Hände auf seiner Haut wieder wahr und ihr festes und dann zartes Nachspüren der Kraftlinien und Tiefenspannungen. Auch dies war für ihn eine uneingestandene Form der Erotik, die bestehen bleiben durfte.
IV
Am nächsten Morgen beschloss Marcellus, auf das Forum und in die Basilica Iulia zu gehen, um Gerichtsverhandlungen mitzuerleben. Hier konnte er berühmte Redner hören, Rede und Gegenrede abwägen und damit die eigene Rhetorik verbessern. Da man dort fast immer Gleichaltrige traf, war der Aufenthalt im Schatten der Säulengänge zudem unterhaltsam. Als sich schließlich der Hunger meldete und er bereits in der Nähe der Thermen des Nero war, beschloss er, dort eine Kleinigkeit zu essen und den frühen Nachmittag im Bade zu verbringen. Bereits im Frigidarium traf er einen Bekannten: den aus Athen stammenden Leonidas. Er betätigte sich als Schriftsteller, unterrichtete aber auch als Privatlehrer Philosophie und kannte durch diese Lehrtätigkeit viele Häuser der besten Gesellschaft. Leonidas war auch sein Lehrer gewesen. Inzwischen gehörte er zu seinen Klienten. Marcellus lud Leonidas zu einem Imbiss ein. Beiläufig fragte er ihn, ob er das Haus des Antonius kenne. Ja, entgegnete Leonidas, er habe das Vergnügen gehabt, die reizenden Töchter in die Literatur einzuführen. Ob es denn stimme, dass diese Jungfrauen so ansehnlich seien, fragte Marcellus weiter. O ja, das stimme, zudem seien sie geistvoll und lustig, obwohl ein alter weiblicher Drache keinen Zentimeter von ihrer Seite weiche. Wer denn die Glücklichen seien, denen diese Schmuckstücke versprochen wurden? Davon wisse er nichts; seien doch beide gerade erst heiratsfähig geworden; er wünsche beiden jungen Damen jedoch glückliche Verbindungen. Danach wandte sich ihr Gespräch belangloseren Themen zu.
Da es ein heißer Tag gewesen war, hatte Priscilla die Speiseliegen im offenen Teil des Atriums platzieren lassen. Sie kontrollierte gerade, ob alles wohlvorbereitet sei und ob die Knaben, die die Gäste bedienen sollten, sorgfältig gekleidet waren. Marcellus hatte eine Auswahl aus Freunden der Familie, Klienten des Hauses und Freigelassenen, deren Patron er ja geblieben war, unter dem Gesichtspunkt getroffen, sich von ihnen über den aktuellen römischen Heiratsmarkt informieren zu lassen. Nicht nur die Tante, sondern auch bereits sein Vater hatte ihm geraten, alle wichtigen Entscheidungen einen solchen Kreis wissen zu lassen. Damit könne er das, was über ihn verbreitet werde, am ehesten selbst beeinflussen. Er würde also auch seinen Entschluss, sich eine Frau zu nehmen, zur Sprache bringen. Da alle Geladenen an dem Wohlergehen seines Hauses interessiert sein mussten, da sie von ihm profitierten, konnte er davon ausgehen, von ihnen hilfreiche Auskünfte zu bekommen. Als nüchtern denkender Gastgeber, dem alle Gäste Wichtiges sagen wollten, durfte er diese Auskünfte allerdings nicht überbewerten. Hier halfen ihm seine Erfahrungen mit bisher ausgesprochenen Einladungen.
Die ersten Gäste stellten sich ein. Marcellus begrüßte jeden. Man stand in kleinen Gruppen zusammen und unterhielt sich. Getränke wurden gereicht, und die Mensa zwischen den Liegen wurde mit den Schüsseln der verschiedenen Vorspeisen gedeckt; Diener gingen mit Wasserschalen zum Waschen der Hände und Füße umher, andere bekränzten die Gäste. Da alles wohlvorbereitet war, konnte Marcellus nun zu Tisch bitten. Die jungen Sklaven füllten die Schälchen der Gäste mit den Speisen, die diese ausgesucht hatten. Mundschenke füllten die Gläser und Pokale. Danach blieben die Knaben, hinter den Gästen stehend, zu deren Verfügung. Den Vorspeisen folgten die Hauptgerichte; danach wurde den Hausgöttern geopfert. Der Nachtisch bestand aus Obst und Kuchen. Da die Runde rein männlich war, ging sie bald zum Trinken über. In der folgenden „Comissatio“ wurde das Mischungsverhältnis der Getränke und die Trinkmengen für alle festgelegt.
Die Gespräche umkreisten sehr bald die offensichtliche Notwendigkeit des Gastgebers, sich eine Gattin zu wählen. Die infrage kommenden Familien wurden beleuchtet, Gerüchte kolportiert und Vorschläge unterbreitet. Marcellus konnte sich im Wesentlichen auf das Zuhören beschränken und sich seinen Reim auf das Gehörte machen. Er lernte zum Beispiel, dass der Heiratsmarkt breiter war, als er angenommen hatte, weil die Töchter reicher Freigelassener mit einbezogen wurden. Für ihn kamen diese freilich nicht infrage. Man verbreitete sich über Eigenschaften, die eine gute Gattin auszeichnen sollten: Fügsamkeit und Tugend, Zurückhaltung in der Öffentlichkeit, Fertigkeiten in Handarbeiten. Erwähnt wurden heldenhafte Frauen, die ihren Gatten in die Verbannung gefolgt oder mit ihnen sogar in den Tod gegangen waren. Damen der römischen Gesellschaft wurden genannt, die solche idealen Eigenschaften verkörperten. Geschichten, eigene Erfahrungen und Ratschläge sollten Marcellus Mut machen, sich eine Gattin ins Haus zu holen. Diese Berichte sparten die Möglichkeit des Scheiterns freilich so erkennbar aus, dass Marcellus sie als Beschönigungen durchschaute. Die Wirklichkeit beurteilte er aus eigener Anschauung viel kritischer. Er war deshalb erleichtert, als sich das Gespräch, anlog zum gestiegenen Weinkonsum, den Freuden der Liebe zuwandte. Diese hatten nichts mit Ehefrauen zu tun. Vielmehr wurde an reiche junge Witwen erinnert, die von einem Schwarm von Freiern umgeben waren und sich im Bett nach allen Regeln der Kunst verwöhnen ließen. Der alte Ovid hatte dafür sehr nützliche Hinweise gegeben. Erotische Vorlieben einer Reihe dieser Damen waren bekannt und wurden in allen Einzelheiten erörtert. Da keine Mädchen zugegen waren, die den Übersprung vom Reden ins Tun ermöglicht hätten, wurden die hübschen Knaben zum Trinken animiert. Marcellus erlaubte diesen deshalb mit einem Wink, sich zurückzuziehen, wenn sie nicht gerade einschenkten. Dennoch kam es zu Übergriffen, wie oft, wenn sich das Ende eines Gastmahls abzeichnete. Diese Übergriffe mussten der Gastfreundschaft zuliebe in Kauf genommen werden. So auch an diesem Abend.
V
Zum Umkreis seiner Heiratspläne gehörten auch Überlegungen, wie er das ererbte Patrimonium besser überblicken und schließlich auch mehren könnte. Sein Erbe bestand aus Ländereien, Landgütern und Stadthäusern, Steinbrüchen, Bergwerken und Walkmühlen. Um diese Besitztümer musste man sich weniger kümmern: Waren sie gut verwaltet, warfen sie regelmäßig Gewinne ab. Das Verleihen von Geld war aufwendiger und mit größeren Risiken behaftet, allerdings auch ertragreicher. Hier hatte er gerade einen ungetreuen Verwalter in das Schuldgefängnis werfen lassen müssen. Um diese heiklen Geldgeschäfte besser zu beurteilen, hatte er beschlossen, sie selbst eine Zeitlang zu tätigen.
Neben dem Verleihen von Geld wollte er die stillen Beteiligungen an Unternehmungen unterschiedlicher Art ausbauen. Sein Vater hatte eine ganze Reihe treuer Sklaven freizulassen. Diese Freigelassenen hatten sich zum Teil schon mit dem, was sie erlernt hatten, selbstständig gemacht. Da es ihnen jedoch an Kapital fehlte, hatte der eine oder andere bei ihm um einen Kredit nachgesucht. Dabei war ihm die Idee gekommen, dies auszubauen. Wenn er ihnen durch das zugewendete Geld ermöglichen würde, mit größeren Räumen, mehr Bedienstetenoder besseren Gerätschaften ihren Gewinn zu steigern, würde ein Teil dieses Gewinns als Zins regelmäßig an ihn zurückfließen. Er dachte dabei besonders an einen dunkelhäutigen Hufschmied, einen Meister seines Fachs, den sein Vater sehr geschätzt und gelegentlich sogar an befreundete Familien ausgeliehen hatte. Sein Vater hatte Wert darauf gelegt, dass dieser Rufus sein Wissen auch an jüngere Gesellen weitergab. Das hatte dieser auch getan. Aus Dankbarkeit hatte ihn der Vater schließlich freigelassen. Als dieser Rufus kürzlich bei ihm vorgesprochen hatte, um ihm stolz von seiner Schmiede in der Nähe des Osttores zu berichten, hatte er auch erwähnt, dass er seine Schmiede aufgrund der vielen Aufträge leicht verdoppeln könne; dafür fehle ihm freilich das Geld. Marcellus hatte ihm eine finanzielle Beteiligung angeboten, auf die Rufus gern eingegangen war. Sie hatten einen Vertrag geschlossen, der die Höhe der jährlichen Gewinnbeteiligung und den Zeitpunkt der Auszahlung festlegte. Rufus war von sich aus gekommen. Auf andere wollte er selbst zugehen. Er war neugierig, ob sich dieser langfristige Geldverleih lohnen würde. Sein Vater hatte zuletzt durch fehlgeschlagene Beteiligungen an Fernhandelsunternehmungen viel Geld verloren. Das wollte er sich eine Lehre sein lassen und solche Anlagen zunächst einmal meiden.
Die Beschäftigung mit der Mehrung seines Vermögens war immer noch recht ungewohnt für Marcellus. Seine politischen und auch die Heiratspläne waren jedoch nicht nur auf den guten Ruf seiner Familie angewiesen, sondern auch auf eine stabile wirtschaftliche Grundlage, die selten zur Sprache kam, von der allerdings stillschweigend ausgegangen wurde. Auch für einen eventuellen Heiratsvertrag wäre es wichtig, über die Einzelheiten des vorhandenen Vermögens Bescheid zu wissen. Er bedauerte, dass ihn der Vater erst sehr spät bei Entscheidungen zugezogen hatte. In die Vermögensverwaltung selbst hatte er keinen Einblick erhalten, wohl weil der Vater nicht vorausgesehen hatte, diese Dinge so früh aus der Hand geben zu müssen. Der Vater hatte ihn ermuntert, seine Jugendjahre zu genießen, weil er selbst dazu wenig Gelegenheit gehabt habe. Marcellus war damit gern einverstanden gewesen. Als er jedoch seit Kurzem – er war dreiundzwanzig Jahre alt – plötzlich alles allein entscheiden musste, hätte er es begrüßt, wenn er von seinem Vater früher gefordert worden wäre. Vor wenigen Tagen erst war er auf eine Aufstellung der Liegenschaften, Unternehmungen, der Barschaft, der Verbindlichkeiten und Außenstände gestoßen, die für ihn seither sehr hilfreich war, aber auch aufzeigte, den Ausgaben auch genügend Einnahmen gegenüberstellen zu müssen.
VI
Hinsichtlich seiner Heiratspläne hatte Marcellus beschlossen, der bis jetzt konkretesten Spur zu folgen, und deshalb Rufinus gebeten, in seinem Namen bei Antonius um die Hand einer Tochter anzuhalten. Dies war inzwischen geschehen. Wie sich dabei gezeigt hatte, war eine der Töchter bereits nach Ostia versprochen. Es konnte deshalb nur noch um Agnes, die etwas jüngere, gehen. Antonius habe sich erfreut gezeigt und geehrt gefühlt, diesen Antrag zu hören, da ihm die Familie des Marcellus und ihre ruhmreiche Vergangenheit natürlich bekannt seien. Auch sein Haus müsse sich nicht verstecken – habe er hervorgehoben –, und er sei durchaus in der Lage, seine Tochter Agnes mit einer großzügigen Mitgift auszustatten. Allerdings kenne er den jungen Herrn nicht und fände es für den weiteren Gang der Verhandlungen förderlich, wenn man sich persönlich kennenlernte. Er lade deshalb Marcellus – und natürlich auch Rufinus – zu einem Besuch in seiner Familie ein. Ein baldiger Termin wäre von seiner Seite aus möglich.
Nun wurden die unbestimmten Pläne plötzlich sehr konkret. Hätte er besser noch warten sollen, bis ihm das Schicksal eine Gefährtin zuführen würde? Da indessen Gelegenheiten, junge Damen zwanglos kennenzulernen, kaum bestanden und fast alle Ehen in seinen Kreisen von den Eltern arrangiert wurden, würde ein Abwarten fast gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine Verehelichung sein. Dennoch wurde ihm bange ums Herz, wenn er sich die verschiedenen Risiken einer Ehe ausmalte. Vielleicht könnte es ein Vorteil sein, dass die Braut noch sehr jung und auch er noch nicht alt war? In ihm wuchs das Bedürfnis, sich mit einem erfahrenen Mann über diese Fragen noch einmal auszutauschen. Zu Rufinus hatte er Vertrauen, und so bat er ihn um ein Gespräch.
Rufinus hatte durchaus Verständnis für die Zweifel, mit denen er konfrontiert wurde. „Du bekommst Angst vor der eigenen Courage?“, stellte er lächelnd fest.
Sie saßen bequem in einem säulengestützten Pavillon auf dem Dach der Villa des Marcellus. Von hier aus hatte man eine schöne Rundsicht auf die große Stadt, ihre Tempel und Paläste, auf die Straßen und Plätze bis zum Stadttor und noch darüber hinaus. Lydia hatte Erfrischungsgetränke und Obst serviert. Sie schauten gemeinsam über die hügelige Stadt.
„Sieh die fast unüberschaubare Anzahl von Häusern mit Männern, die diesen Schritt schon gewagt haben, obwohl auch sie keine Gewähr hatten, dass es gut gehen würde“, nahm Rufinus die Zweifel von Marcellus wieder auf. „Noch besser ist es, du erinnerst dich an die Ehe deiner Eltern, die gut zusammengelebt haben – leider nicht lange genug.“
Es entstand eine längere Pause, in der beide ihren Erinnerungen nachgingen.
„Ein Mann muss viele seiner Freiheiten aufgeben, um sich den Ehefrieden damit zu erkaufen. Lohnt sich das wirklich?“, wandte Marcellus ein.





























