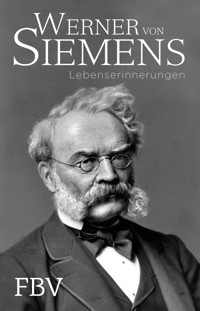
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Werner von Siemens – erfolgreicher Unternehmer, begnadeter Ingenieur und kreativer Erfinder. Ohne seine Erfindungen wäre die Welt heute eine ganz andere. Mit seinen Entdeckungen legte er den Grundstein der modernen Starkstromtechnik und ermöglichte den Bau elektrischer Lokomotiven, Straßenbahnen und Aufzüge. Mit der Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske vernetzte er Deutschland, Europa und die Welt. Seine Telegrafenverbindungen von London nach Kalkutta und durch den Atlantik nach Nordamerika sind nicht nur Meilensteine der Technik, sondern waren zugleich auch Voraussetzung für die beginnende Globalisierung. Mit dieser Ausgabe liegen Werner von Siemens' »Lebenserinnerungen« endlich wieder als hochwertiges Taschenbuch vor. Spannend geschrieben, erhält der Leser einen informativen Einblick in die einzigartige Persönlichkeit eines genialen Erfinders, Ausnahme-Unternehmers und sozial engagierten Bürgers des Deutschen Kaiserreiches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2017
© 2017 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Korrektorat: Hella Neukötter
Umschlaggestaltung: Laura Osswald
Umschlagabbildung: ©Ullstein Bild
Satz: Satzwerk Huber, Germering
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-95972-001-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86248-941-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86248-942-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
INHALT
Vorwort von Matthias Kamp
Vorwort
Kindheit und Jugend
Soldatenzeit
1848
Die ersten Telegraphenlinien
Die russischen Unternehmungen
Seekabel
Wissenschaftliche und technische Arbeiten der 1850er und 1860er Jahre
Öffentliche Tätigkeit
Indolinie und Kaukasus
Dynamomaschine, 1870er Jahre, Lebensabend
Über den Autor
VORWORT
VON MATTHIAS KAMP
Die im Frühsommer 2016 eröffnete Siemens-Konzernzentrale in München ist ein Bau aus viel Glas und weißem Stein. Die offene Bauweise, die großen Fensterfronten und weitläufigen Räume sorgen dafür, dass das Licht den mächtigen Bau nahezu ungehindert durchfluten kann. Der Weltkonzern hat die futuristisch anmutende Zentrale mit Kunst von Baselitz im Foyer so angelegt, dass moderne Arbeitsplatzkonzepte verwirklicht werden können: Viele der Mitarbeiter suchen sich jeden Tag einen anderen Schreibtisch. Kurzum: Die neue Siemens-Zentrale im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt, von wo aus das Traditionsunternehmen seine Aktivitäten in mehr als 200 Ländern steuert, atmet Zukunft – ohne jedoch seine Historie zu vergessen.
Im Erdgeschoss, am Rande einer Passage, die den hellen Bau durchzieht, findet sich ein kleiner, durch die bodentiefe Glasfront von außen gut einsehbarer Raum. Der wuchtige Holzschreibtisch, der Kanonenofen und die Regale aus dunklem Holz mit den angestaubten Schraubenziehern, Zangen und Feilen darin wollen auf den ersten Blick so gar nicht zu der modernen Umgebung des Konzernsitzes passen: Hier hat Siemens die erste Werkstatt des Unternehmensgründers Werner von Siemens nachgebaut, so wie sie einst in Berlin gestanden hat. In dem kleinen Raum konstruierte der Ingenieur 1847 den Zeigertelegrafen, der bereits ein Jahr später auf der Telegrafenlinie von Berlin nach Frankfurt am Main eingesetzt wurde und in den darauffolgenden Jahren für die telegrafische Vernetzung ganzer Erdteile sorgte: Der Grundstein für einen Weltkonzern, der heute mehr als 340.000 Mitarbeiter beschäftigt und zuletzt fast 80 Milliarden Euro umsetzte, war gelegt.
Wie als Erinnerungsanker für die Mitarbeiter, die in München jeden Tag an der wieder hergerichteten Werkstatt vorbeilaufen, hat das Unternehmen an der Vorderseite ein Zitat des Firmengründers aus dem Jahr 1854 angebracht. »In dem ›Ich will‹ liegt eine mächtige Zauberkraft, wenn es ernst damit ist und Tatkraft dahinter steht! Freilich darf man Hindernisse und Umwege nicht scheuen und darf keinen Augenblick sein Ziel aus den Augen lassen!«
200 Jahre nachdem Werner von Siemens zur Welt kam, will die Konzernführung die Mitarbeiter auffordern, sich des Erbes Werner von Siemens’ zu erinnern und sich auf die Wurzeln ihres Unternehmens zu besinnen. Sie sollen sich die Beharrlichkeit des Gründers, der seine Ingenieursausbildung bei der preußischen Armee absolvierte und sein erstes Versuchslabor in einer Gefängniszelle hatte, zu eigen machen. In Haft saß er übrigens, da er sich als Sekundant an einem Duell beteiligt hatte.
Explizit, um in Zeiten dramatischer Veränderungen den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft zu schlagen, stellte der Technologiekonzern im Sommer 2016 der Öffentlichkeit seine neue Einheit zur Förderung und Unterstützung von Start-ups ganz bewusst in der in München nachgebauten Werkstatt Werner von Siemens’ vor. Die Siemens-Tochter trägt den Namen »next47«, eine Reminiszenz an das Gründungsjahr 1847 des Unternehmens.
Angesichts der tiefgreifenden technologischen Umwälzungen, mit denen sich ganze Industrien konfrontiert sehen, tut der Konzern gut daran, die Mannschaft auf die Tugenden, vor allem auf die Hartnäckigkeit ihres Gründers einzuschwören. Das Internet der Dinge revolutioniert die Fertigungsprozesse in der Industrie. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Autos in Zukunft nicht mehr vom Fahrer gesteuert werden, sondern autonom fahren. Die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen wird in den kommenden Jahrzehnten drastisch an Bedeutung verlieren. Dies sind nur einige der Herausforderungen, vor denen der Konzern aus München steht. Um sich an die Spitze der Veränderungen zu setzen und um im immer schärferen Wettbewerb um Innovationen mit neuen Spielern, etwa aus China zu bestehen, braucht es eine große Portion Mut, Fleiß und Beharrlichkeit: Tugenden, ohne die Werner von Siemens seine Idee des Zeigertelegrafen vermutlich wohl nie zur Anwendung gebracht hätte.
Siemens ist bei seinen Bemühungen, sich für diesen Wettbewerb zu wappnen, in den vergangenen Jahren ein gutes Stück vorangekommen. Nach dem Grundsatz, die Aktivitäten des Konzerns entlang der Kette der Elektrifizierung auszurichten, ist das mehr als 160 Jahre alte Unternehmen gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat, so paradox es klingen mag, damit die Weichen für die Zukunft gestellt.
Die Firma hat ihre Aktivitäten grundlegend neu sortiert. Hierarchieebenen wurden gestrichen, um Bürokratie abzubauen und die Geschäfte näher zum Kunden zu bringen. Von manchen Aktivitäten, mit denen kein Geld mehr zu verdienen war, etwa dem Solargeschäft, hat Siemens sich getrennt. Das Geschäft mit der Medizintechnik haben die Münchner in eine separate Einheit ausgegliedert, um auf die rasanten Veränderungen in diesem Bereich, etwa durch den wachsenden Stellenwert der Biotechnologie, schneller reagieren zu können. Das schwierige Geschäft mit der Energieerzeugung aus Windkraft hat Siemens mit einem spanischen Hersteller zu einer neuen Einheit zusammengeführt. Die Größe der neuen Gesellschaft ermöglicht es Siemens, wirksam auf den zunehmenden Druck chinesischer Anbieter reagieren zu können.
Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung: Unter diesen drei Schlagwörtern soll der Traditionskonzern künftig die globalen Märkte erobern. Vor allem der Digitalisierung, die die Art und Weise wie wir in Zukunft leben und arbeiten, grundlegend verändern wird, kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu, primär in der industriellen Fertigung. Industrie 4.0, die digitale Fabrik, das Internet der Dinge sind die Stichwörter. Siemens, das bescheinigen selbst Wettbewerber, ist mit seinen Anlagen und Lösungen gut gerüstet, seine Kunden in die Lage zu versetzen, bei der vierten industriellen Revolution ganz vorne mitzuspielen – so wie Werner von Siemens im 19. Jahrhundert mit der Erfindung seines dynamoelektrischen Prinzips und seines Elektromotors die zweite industrielle Revolution begründete.
Matthias Kamp (Wirtschaftswoche) im September 2016
VORWORT
Harzburg, im Juni 1889
»Unser Leben währet siebenzig Jahr, und wenn’s hochkommt, so sind’s achtzig Jahr« – das ist eine bedenkliche Mahnung für jemand, der sich dem Mittel dieser Grenzwerte nähert und noch viel zu tun hat! Man kann sich zwar im allgemeinen damit trösten, daß andere das tun werden, was man selbst nicht mehr fertigbringt, daß es also der Welt nicht dauernd verlorengeht; doch gibt es auch Aufgaben, bei denen dieser Trost nicht gilt, und für deren Lösung kein anderer eintreten kann. Hierher gehört die Aufzeichnung der eigenen Lebenserinnerungen, die ich meiner Familie und meinen Freunden versprochen habe. Ich gestehe, daß mir der Entschluß zur Ausführung dieser Arbeit recht schwer geworden ist, da ich mich weder historisch noch schriftstellerisch begabt fühle und stets mehr Interesse für Gegenwart und Zukunft als für die Vergangenheit hatte. Dazu kommt, daß ich kein gutes Gedächtnis für Namen und Zahlen habe, und daß mir auch viele Ereignisse meines ziemlich wechselvollen Lebens im Laufe der Jahre entschwunden sind. Andererseits wünsche ich aber, meine Bestrebungen und Handlungen durch eigene Schilderung festzustellen, um zu verhindern, daß sie später verkannt und falsch gedeutet werden, und glaube auch, daß es für junge Leute lehrreich und anspornend sein wird, aus ihr zu ersehen, daß ein junger Mann auch ohne ererbte Mittel und einflußreiche Gönner, ja sogar ohne richtige Vorbildung, allein durch seine eigene Arbeit sich emporschwingen und Nützliches leisten kann. Ich werde nicht viel Mühe auf die Form der Darstellung verwenden, sondern meine Erinnerungen niederschreiben, wie sie mir in den Sinn kommen, ohne andere Rücksichten dabei zu nehmen als die, daß sie mein Leben klar und wahr schildern und meine Gefühle und Anschauungen getreulich wiedergeben. Ich werde aber versuchen, zugleich auch die inneren und äußeren Kräfte aufzudecken, die mich auf meiner Lebensbahn durch Freud und Leid den erstrebten Zielen zuführten und meinen Lebensabend zu einem sorgenfreien und sonnigen gestaltet haben.
Hier in meiner abgelegenen Villa zu Harzburg hoffe ich die zu einem solchen Rückblicke auf mein Leben nötige geistige Ruhe am besten zu finden, denn an den gewohnten Stätten meiner Arbeitstätigkeit in Berlin und Charlottenburg bin ich zu sehr von den Aufgaben der Gegenwart in Anspruch genommen, um ungestört längere Zeit der eigenen Vergangenheit widmen zu können.
KINDHEIT UND JUGEND
Meine früheste Jugenderinnerung ist eine kleine Heldentat, die sich vielleicht deswegen meinem Gedächtnisse so fest einprägte, weil sie einen bleibenden Einfluß auf die Entwicklung meines Charakters ausgeübt hat. Meine Eltern lebten bis zu meinem achten Lebensjahre in meinem Geburtsorte Lenthe bei Hannover, wo mein Vater das einem Herrn von Lenthe gehörige »Obergut« gepachtet hatte. Ich muß etwa fünf Jahre alt gewesen sein und spielte eines Tages im Zimmer meines Vaters, als meine drei Jahre ältere Schwester Mathilde laut weinend von der Mutter ins Zimmer geführt wurde. Sie sollte ins Pfarrhaus zu ihrer Strickstunde gehen, klagte aber, daß ein gefährlicher Gänserich ihr immer den Eintritt in den Pfarrhof wehre und sie schon wiederholt gebissen habe. Sie weigerte sich daher entschieden, trotz alles Zuredens der Mutter, ohne Begleitung in ihre Unterrichtsstunde zu gehen. Auch meinem Vater gelang es nicht, ihren Sinn zu ändern; da gab er mir seinen Stock, der ansehnlich größer war als ich selbst, und sagte: »Dann soll Dich Werner hinbringen, der hoffentlich mehr Courage hat wie Du.« Mir hat das wohl zuerst etwas bedenklich geschienen, denn mein Vater gab mir die Lehre mit auf den Weg: »Wenn der Ganter kommt, so geh ihm nur mutig entgegen und haue ihn tüchtig mit dem Stock, dann wird er schon fortlaufen!« Und so geschah es. Als wir das Hoftor öffneten, kam uns richtig der Gänserich mit hoch aufgerichtetem Halse und schrecklichem Zischen entgegen. Meine Schwester kehrte schreiend um, und ich hatte die größte Lust, ihr zu folgen, doch ich traute dem väterlichen Rate und ging dem Ungeheuer, zwar mit geschlossenen Augen, aber tapfer mit dem Stocke um mich schlagend, entgegen. Und siehe, jetzt bekam der Gänserich Furcht und zog sich laut schnatternd in den Haufen der auch davonlaufenden Gänse zurück.
Es ist merkwürdig, welch tiefen, dauernden Eindruck dieser erste Sieg auf mein kindliches Gemüt gemacht hat. Noch jetzt, nach fast 70 Jahren, stehen alle Personen und Umgebungen, die mit diesem wichtigen Ereignisse verknüpft waren, mir klar vor Augen. An dasselbe knüpft sich die einzige mir gebliebene Erinnerung an das Aussehen meiner Eltern in ihren jüngeren Jahren, und unzählige Male hat mich in späteren schwierigen Lebenslagen der Sieg über den Gänserich unbewußt dazu angespornt, drohenden Gefahren nicht auszuweichen, sondern sie durch mutiges Entgegentreten zu bekämpfen.
Mein Vater entstammte einer seit dem Dreißigjährigen Kriege am nördlichen Abhange des Harzes angesessenen, meist Land- und Forstwirtschaft treibenden Familie. Eine alte Familienlegende, die von neueren Familienhistorikern allerdings als nicht erwiesen verworfen wird, erzählt, daß unser Urahn mit den Tillyschen Scharen im Dreißigjährigen Kriege nach Norddeutschland gekommen sei und Magdeburg mit erstürmt, dann aber eine den Flammen entrissene Magdeburger Bürgerstochter geheiratet habe und mit ihr nach dem Harz gezogen sei. – Wie schon die Existenz eines getreulich geführten Stammbaums, die in bürgerlichen Familien ja etwas Seltenes ist, beweist, hat in der Familie Siemens immer ein gewisser Zusammenhang obgewaltet. In neuerer Zeit trägt die alle fünf Jahre in einem Harzort stattfindende Familienversammlung sowie eine im Jahre 1876 begründete Familienstiftung dazu bei, diesen Zusammenhang der heute sehr ausgebreiteten Familie zu befestigen.
Wie die meisten Siemens war auch mein Vater sehr stolz auf seine Familie und erzählte uns Kindern häufig von Angehörigen derselben, die sich im Leben irgendwie hervorgetan hatten. Ich erinnere mich aber aus diesen Erzählungen außer meines Großvaters mit seinen 15 Kindern, von denen mein Vater das jüngste war, nur noch eines Kriegsrats Siemens, der eine gebietende Stellung im Rate der freien Stadt Goslar innehatte, gerade in der Zeit, als die Stadt ihre Reichsunmittelbarkeit verlor. Mein Großvater hatte den Gutsbesitz des Reichsfreiherrn von Grote, bestehend aus den Gütern Schauen und Wasserleben am nördlichen Fuße des Harzes, gepachtet. Wasserleben war der Geburtsort meines Vaters. Unter den Jugendgeschichten, die der Vater uns Kindern gern erzählte, sind mir zwei in lebhafter Erinnerung geblieben.
Es werden jetzt etwa 120 Jahre her sein, als der Duodezhof des reichsunmittelbaren Freiherrn von Grote durch die Ansage überrascht wurde, daß der König Friedrich II. von Preußen auf der Reise von Halberstadt nach Goslar das reichsfreiherrliche Gebiet überschreiten wolle. Der alte Reichsfreiherr erwartete den mächtigen Nachbar gebührenderweise mit seinem einzigen Sohne an der Spitze seines aus zwei Mann bestehenden Kontingentes zur Reichsarmee und begleitet von seinen Vasallen – meinem Großvater mit seinen Söhnen, sämtlich hoch zu Roß. Als der alte Fritz mit seiner berittenen Eskorte sich der Grenze näherte, ritt der Reichsfreiherr ihm einige Schritte entgegen und hieß ihn in aller Form »in seinem Territorio« willkommen. Der König, dem die Existenz dieses Nachbarreiches vielleicht ganz entfallen war, schien überrascht von der Begrüßung, erwiderte den Gruß dann aber ganz formell und sagte zu seinem Gefolge gewandt: »Messieurs, voilà deux souverains qui se rencontrent!« Dieses Zerrbild alter deutscher Reichsherrlichkeit ist mir stets in Erinnerung geblieben und hat schon frühzeitig die Sehnsucht nach künftiger nationaler Einheit und Größe in uns Kindern angefacht.
An das geschilderte Ereignis schloß sich bald ein anderes von tiefer gehender Bedeutung für den Groteschen Miniaturstaat. Mein Vater hatte fünf Schwestern, von denen die eine, namens Sabine, sehr schön und liebenswürdig war. Das erkannte bald der junge Reichsfreiherr und bot ihr Herz und Hand. Es ist mir nicht bekannt geworden, welche Stellung der alte Freiherr dazu eingenommen hatte; bei meinem Großvater fand der junge Herr aber entschiedene Ablehnung. Dieser wollte seine Tochter nicht in eine Familie eintreten lassen, die sie nicht als ihresgleichen anerkennen würde, und hielt fest an der Ansicht seiner Zeit, daß Heil und Segen nur einer Verbindung von Gleich und Gleich entsprieße. Er verbot seiner Tochter jeden weiteren Verkehr mit dem jungen Freiherrn und beschloß ihr dies durch Entfernung vom elterlichen Hause zu erleichtern. Doch die jungen Leute waren offenbar schon vom Geiste der Neuzeit ergriffen, denn am Morgen der geplanten Abreise erhielt mein Großvater die Schreckenskunde, daß der junge Freiherr seine Tochter während der Nacht entführt habe. Darob große Aufregung und Verfolgung des entflohenen Paares durch den Großvater und seine fünf erwachsenen Söhne. Die Spur der Flüchtigen wurde bis Blankenburg verfolgt und führte dort in die Kirche. Als der Eingang in diese erzwungen war, fand man das junge Paar am Altar stehend, wo der Pastor soeben die rechtsgültige Trauung vollzogen hatte.
Wie sich das Familiendrama zunächst weiterentwickelte, ist mir nicht mehr erinnerlich. Leider starb der junge Ehemann schon nach wenigen, glücklich verlebten Jahren seiner Ehe, ohne Kinder zu hinterlassen. Die Herrschaft Schauen fiel daher Seitenverwandten zu, freilich damit auch die Last, meiner Tante Sabine noch beinahe ein halbes Jahrhundert lang die gesetzliche reichsfreiherrliche Witwenpension zahlen zu müssen. Ich habe die liebenswürdige und geistreiche alte Dame zu Kölleda in Thüringen, wohin sie sich zurückgezogen hatte, als junger Artillerieoffizier wiederholt besucht. »Tante Grote« war auch im Alter noch schön und bildete damals den anerkannten Mittelpunkt unserer Familie. Auf uns junge Leute übte sie einen fast unwiderstehlichen Einfluß aus, und es war für uns ein wahrer Genuß, sie von Personen und Anschauungen ihrer für uns beinahe verschollenen Jugendzeit sprechen zu hören.
Mein Vater war ein kluger, hochgebildeter Mann. Er hatte die gelehrte Schule in Ilfeld am Harz und darauf die Universität Göttingen besucht, um sich gründlich für den auch von ihm gewählten landwirtschaftlichen Beruf vorzubilden. Er gehörte mit Herz und Sinn dem Teile der deutschen Jugend an, der, unter den Stürmen der großen Französischen Revolution aufgewachsen, für Freiheit und Deutschlands Einigung schwärmte. Einst wäre er in Kassel beinahe den Schergen Napoleons in die Hände gefallen, als er sich den schwachen Versuchen schwärmender Jünglinge anschloß, die nach der Niederwerfung Preußens noch Widerstand leisten wollten. Nach dem Tode seines Vaters ging er zum Amtsrat Deichmann nach Poggenhagen bei Hannover, um die Landwirtschaft praktisch zu erlernen. Dort verliebte er sich bald in die älteste Tochter des Amtsrats, meine geliebte Mutter Eleonore Deichmann, und heiratete sie trotz seiner Jugend – er war kaum 25 Jahre alt –, nachdem er die Pachtung des Gutes Lenthe übernommen hatte. Zehn Jahre lang führten meine Eltern in Lenthe ein glückliches Leben. Leider waren aber die politischen Verhältnisse Deutschlands und namentlich des wieder unter englische Herrschaft gekommenen Landes Hannover für einen Mann wie meinen Vater sehr niederdrückend. Die englischen Prinzen, die damals in Hannover Hof hielten, kümmerten sich nicht viel um das Wohlergehen des Landes, das sie wesentlich nur als ihr Jagdgebiet betrachteten. Daher waren auch die Jagdgesetze sehr streng, so daß allgemein behauptet wurde, es wäre in Hannover weit strafbarer, einen Hirsch zu töten als einen Menschen! Eine Wildschädigung durch unerlaubte Abwehrmittel, deren mein Vater angeklagt wurde, war auch der Grund, warum er Hannover verließ und sich in Mecklenburg eine neue Heimat suchte.
Das Obergut Lenthe liegt an einem bewaldeten Bergrücken, dem Benther Berge, der mit dem ausgedehnten Deistergebirge in Zusammenhang steht. Die Hirsche und Wildschweine, die für die prinzlichen Jagden geschont wurden und ihrer Unverletzlichkeit sicher waren, besuchten in großen Scharen die Lenther Fluren mit besonderer Vorliebe. Wenn auch die ganze Dorfschaft bemüht war, durch eine nächtliche Wächterkette die Saaten zu schützen, so vernichtete das in Masse hervorbrechende Wild doch oft in wenigen Stunden die auf die Arbeit eines ganzen Jahres gebauten Hoffnungen. Während eines strengen Winters, als Wald und Feld dem Wild nicht hinlängliche Nahrung boten, suchte es diese oft in ganzen Rudeln in den Dörfern selbst. Eines Morgens meldete der Hofmeister meinem Vater, es sei ein Rudel Hirsche auf dem Hofe; man habe das Tor geschlossen, und er frage an, was mit den Tieren geschehen solle. Mein Vater ließ sie in einen Stall treiben und schickte einen expressen Boten an das Königliche Ober-Hof-Jägeramt in Hannover mit der Anzeige des Geschehenen und der Anfrage, ob er ihm die Hirsche vielleicht nach Hannover schicken solle. Das sollte ihm aber schlecht bekommen! Es dauerte nicht lange, so erschien eine große Untersuchungskommission, welche die Hirsche in Freiheit setzte und während einer mehrtägigen Kriminaluntersuchung das Faktum feststellte, daß den Hirschen Zwang angetan sei, als man sie wider ihren Willen in den Stall trieb. Mein Vater mußte sich noch glücklich schätzen, mit einer schweren Geldstrafe davonzukommen.
Es ist dies ein kleines Bild der damaligen Zustände der »Königlich Großbritannischen Provinz Hannover«, wie meine lieben Landsleute ihr Land gern mit einem gewissen Stolze nannten. Doch auch in den übrigen deutschen Landen waren die Verhältnisse nicht allzuviel besser, trotz Französischer Revolution und der glorreichen Freiheitskriege. Es ist gut, wenn die verhältnismäßig glückliche Jugend der heutigen Zeit mit den Leiden und oft hoffnungslosen Sorgen ihrer Väter hin und wieder die ihrigen vergleicht, um pessimistischen Anschauungen besser widerstehen zu können.
Die freieren Zustände, die mein Vater suchte, fand er in der Tat in dem zu Mecklenburg-Strelitz gehörigen Fürstentum Ratzeburg, wo er die großherzogliche Domäne Menzendorf auf eine lange Reihe von Jahren in Pacht erhielt. In diesem gesegneten Ländchen gab es außer Domänen und Bauerndörfern nur ein einziges adeliges Gut. Die Bauern waren damals zwar noch zu Frondiensten auf den Domänen verpflichtet, doch wurden diese schon in den nächsten Jahren nach unserer Übersiedelung abgelöst und der bäuerliche Grundbesitz von allen Lasten und auch fast allen Abgaben befreit.
Es waren glückliche Jugendjahre, die ich in Menzendorf mit meinen Geschwistern, ziemlich frei und wild mit der Dorfjugend aufwachsend, verlebte. Die ersten Jahre streiften wir älteren Kinder – meine Schwester Mathilde, ich und meine jüngeren Brüder Hans und Ferdinand – frei und ungebunden durch Wald und Flur. Unsern Unterricht hatte meine Großmutter, die seit dem Tode ihres Mannes bei uns wohnte, übernommen. Sie lehrte uns lesen und schreiben und übte unser Gedächtnis durch Auswendiglernen unzähliger Gedichte. Vater und Mutter waren durch ihre wirtschaftlichen Sorgen und letztere auch durch die in schneller Folge anwachsende Schar meiner jüngeren Geschwister zu sehr in Anspruch genommen, um sich viel mit unserer Erziehung beschäftigen zu können. Mein Vater war ein zwar herzensguter, aber sehr heftiger Mann, der unerbittlich strafte, wenn einer von uns seine Pflicht nicht tat, nicht wahrhaft war oder sonst unehrenhaft handelte. Furcht vor des Vaters Zorn und Liebe zur Mutter, der wir keinen Kummer machen wollten, hielt unsere kleine, sonst etwas verwilderte Schar in Ordnung. Als erste Pflicht galt die Sorge der älteren Geschwister für die jüngeren. Es ging das so weit, daß die älteren mit bestraft wurden, wenn eins der jüngeren etwas Strafbares begangen hatte. Das lastete namentlich auf mir als dem ältesten und hat das Gefühl der Verpflichtung, für meine jüngeren Geschwister zu sorgen, schon früh in mir geweckt und befestigt. Ich maßte mir daher auch das Strafrecht über meine Geschwister an, was oft zu Koalitionen gegen mich und zu heftigen Kämpfen führte, die aber immer ausgefochten wurden, ohne die Intervention der Eltern anzurufen. Ich entsinne mich eines Vorfalls aus jener Zeit, den ich erzählen will, da er charakteristisch für unser Jugendleben ist.
Mein Bruder Hans und ich lagen mit oft günstigem Erfolge der Jagd auf Krähen und Raubvögel mit selbstgefertigten Flitzbogen ob, in deren Handhabung wir große Sicherheit erlangt hatten. Bei einem dabei ausgebrochenen Streite brachte ich das Recht des Stärkeren meinem jüngeren Bruder gegenüber zur Geltung. Dieser erklärte das für unwürdig und verlangte, daß der Streit durch ein Duell entschieden würde, bei dem meine größere Stärke nicht entscheidend wäre. Ich fand das billig, und wir schritten zu einem richtigen Flitzbogenduell nach den Regeln, die wir durch gelegentliche Erzählungen meines Vaters aus seiner Studentenzeit kannten. Zehn Schritte wurden abgemessen, und auf mein Kommando »los« schossen wir beide unsere gefiederten Pfeile mit einer angeschärften Stricknadel als Spitze aufeinander ab. Bruder Hans hatte gut gezielt. Sein Pfeil traf meine Nasenspitze und drang unter der Haut bis zur Nasenwurzel vor. Unser darauf folgendes gemeinschaftliches Geschrei rief den Vater herbei, der den steckengebliebenen Pfeil herausriß und sich darauf zur Züchtigung des Missetäters durch Ausziehen seines Pfeifenrohres rüstete. Das widerstritt meinem Rechtsgefühl. Ich trat entschieden zwischen Vater und Bruder und sagte: »Vater, Hans kann nichts dafür, wir haben uns duelliert.« Ich sehe noch das verdutzte Gesicht meines Vaters, der doch gerechterweise nicht strafen konnte, was er selbst getan hatte und für ehrenhaft hielt. Er steckte auch ruhig sein Pfeifenrohr wieder in die Schwammdose und sagte nur: »Laßt künftig solche Dummheiten bleiben.«
Als meine Schwester und ich dem Unterricht der Großmutter Deichmann – geborene von Scheiter, wie sie nie vergaß ihrer Unterschrift beizufügen – entwachsen waren, gab uns der Vater ein halbes Jahr lang selbst Unterricht. Der Abriß der Weltgeschichte und Völkerkunde, den er uns diktierte, war geistreich und originell und bildete die Grundlage meiner späteren Anschauungen. Als ich elf Jahre alt geworden war, ward meine Schwester in eine Mädchenpension nach der Stadt Ratzeburg gebracht, während ich die Bürgerschule des benachbarten Städtchens Schönberg von Menzendorf aus besuchte. Bei gutem Wetter mußte ich den etwa eine Stunde langen Weg zu Fuß machen. Bei schlechtem Wetter waren die Wege grundlos, und ich ritt dann auf einem Pony zur Schule. Dies und meine Gewohnheit, Neckereien immer gleich tätlich zurückzuweisen, führte bald zu einer Art Kriegszustand mit den Stadtschülern, durch deren mir den Rückweg versperrenden Haufen ich mir in der Regel erst mit eingelegter Lanze einer Bohnenstange den Weg bahnen mußte. Dieses Kampfspiel, bei dem mir die Bauernjungen meines Dorfes bisweilen zu Hilfe kamen, dauerte ein ganzes Jahr. Es trug sicher viel dazu bei, meine Tatkraft zu stählen, gab aber nur sehr mäßige wissenschaftliche Resultate. Eine entschiedene Wendung meines Jugendlebens trat Ostern 1829 dadurch ein, daß mein Vater einen Hauslehrer engagierte. Die Wahl meines Vaters war eine außerordentlich glückliche. Der Kandidat der Theologie Sponholz war ein noch junger Mann. Er war hochgebildet, aber schlecht angeschrieben bei seinen geistlichen Vorgesetzten, da seine Theologie zu rationalistisch, zu wenig positiv war, wie man heute sagen würde. Über uns halbwilde Jungen wußte er sich schon in den ersten Wochen eine mir heute noch rätselhafte Herrschaft zu verschaffen. Er hat uns niemals gestraft, kaum jemals ein tadelndes Wort ausgesprochen, beteiligte sich aber oft an unseren Spielen und verstand es dabei wirklich spielend, unsere guten Eigenschaften zu entwickeln und die schlechten zu unterdrücken. Sein Unterricht war im höchsten Grade anregend und anspornend. Er wußte uns immer erreichbare Ziele für unsere Arbeit zu stellen und stärkte unsere Tatkraft und unseren Ehrgeiz durch die Freude über die Erreichung des gesteckten Zieles, die er selbst dann aufrichtig mit uns teilte. So gelang es ihm schon in wenigen Wochen, aus verwilderten, arbeitsscheuen Jungen die eifrigsten und fleißigsten Schüler zu machen, die er nicht zur Arbeit anzutreiben brauchte, sondern vom Übermaß derselben zurückhalten mußte. In mir namentlich erweckte er das nie erloschene Gefühl der Freude an nützlicher Arbeit und den ehrgeizigen Trieb, sie wirklich zu leisten. Ein wichtiges Hilfsmittel, das er dazu brauchte, waren seine Erzählungen. Wenn uns am späten Abend die Augen bei der Arbeit zufielen, so winkte er uns zu sich auf das alte Ledersofa, auf dem er neben unserem Arbeitstische zu sitzen pflegte, und während wir uns an ihn schmiegten, malte er uns Bilder unseres eigenen künftigen Lebens aus, welche uns entweder auf Höhepunkten des bürgerlichen Lebens darstellten, die wir durch Fleiß und moralische Tüchtigkeit erklommen hatten, und die uns in die Lage brachten, auch die Sorgen der Eltern – die besonders in jener für den Landwirt so schweren Zeit sehr große waren – zu beseitigen, oder welche uns wieder in traurige Lebenslagen zurückgefallen zeigten, wenn wir in unserem Streben erlahmten und der Versuchung zum Bösen nicht zu widerstehen vermochten. Leider dauerte dieser glücklichste Teil meiner Jugendzeit nicht lange, nicht einmal ein volles Jahr. Sponholz hatte oft Anfälle tiefer Melancholie, die wohl zum Teil seinem verfehlten theologischen Beruf und Lebenslauf, zum Teil Ursachen entsprang, die uns Kindern noch unverständlich waren. In einem solchen Anfalle verließ er in einer dunklen Winternacht mit einem Jagdgewehr das Haus und ward nach langem Suchen an einer entlegenen Stelle des Gutes mit zerschmettertem Schädel aufgefunden. Unser Schmerz über den Verlust des geliebten Freundes und Lehrers war grenzenlos. Meine Liebe und Dankbarkeit habe ich ihm bis auf den heutigen Tag bewahrt.
Der Nachfolger von Sponholz war ein ältlicher Herr, der schon lange Jahre in adeligen Häusern die Stelle eines Hauslehrers innegehabt hatte. Er war fast in allen Punkten das Gegenteil von seinem Vorgänger. Sein Erziehungssystem war ganz formaler Natur. Er verlangte, daß wir vor allen Dingen folgsam waren und uns gesittet benahmen. Jugendliches Ungestüm war ihm durchaus zuwider. Wir sollten die vorgeschriebenen Stunden aufmerksam sein und unsere Arbeiten machen, sollten ihm auf Spaziergängen gesittet folgen und ihn außerhalb der Schulzeit nicht stören. Der arme Mann war kränklich und starb nach zwei Jahren in unserem Hause an der Lungenschwindsucht. Einen anregenden und bildenden Einfluß hatte er auf uns nicht, und ohne die nachhaltige Einwirkung, die Sponholz auf uns ausgeübt, würden die beiden Jahre, wenigstens für mich und meinen Bruder Hans, ziemlich nutzlos vergangen sein. Bei mir war aber der Wille, meine Pflicht zu tun und Tüchtiges zu lernen, durch Sponholz so fest begründet, daß ich mich nicht irremachen ließ und umgekehrt den Lehrer mit mir fortriß. Es hat mir in späteren Jahren oft leid getan, daß ich dem armen kranken Mann so häufig die nötige Ruhe raubte, indem ich nach Schluß der Unterrichtszeit noch stundenlang auf meinem Arbeitsplatze sitzen blieb und alle kleinen Mittel, die er anwendete, um mich loszuwerden, unbeachtet ließ.
Nach dem Tode des zweiten Hauslehrers entschloß sich mein Vater, Bruder Hans und mich auf das Lübecker Gymnasium, die sogenannte Katharinenschule, zu bringen, und führte diesen Plan aus, nachdem ich in unserer Pfarrkirche zu Lübsee konfirmiert war. Beim Eintrittsexamen wurde ich nach Obertertia, mein Bruder nach Untertertia gesetzt. Wir kamen in keine eigentliche Pension, sondern bezogen ein Privatquartier bei einem Lübecker Bürger, bei dem wir auch beköstigt wurden. Mein Vater hatte so unbedingtes Vertrauen zu meiner Zuverlässigkeit, daß er mir auch das volle Aufsichtsrecht über meinen etwas leicht gesinnten Bruder gab, bei dem die frühere Wildheit so ziemlich wieder zum Durchbruch gekommen war, wie schon der Beiname »der tolle Hans« zeigte, den er sich in der Schule erwarb.
Die Lübecker Katharinenschule bestand aus dem eigentlichen Gymnasium und der Bürgerschule, die beide unter demselben Direktor standen und bis zur Tertia des Gymnasiums Parallelklassen bildeten. Das Gymnasium genoß damals hohes Ansehen als gelehrte Schule. Im wesentlichen wurden auf ihm nur die alten Sprachen getrieben. Der Unterricht in der Mathematik war sehr mangelhaft und befriedigte mich nicht; ich wurde in diesem Gegenstände in eine höhere Parallelklasse versetzt, obschon ich bis dahin Mathematik nur als Privatstudium betrieben hatte, da beide Hauslehrer nichts davon verstanden. Dagegen fielen mir die alten Sprachen recht schwer, weil mir die schulgerechte, feste Grundlage fehlte. Sosehr mich das Studium der Klassiker auch interessierte und anregte, sosehr war mir das Erlernen der grammatischen Regeln, bei denen es nichts zu denken und zu erkennen gab, zuwider. Ich arbeitete mich zwar in den beiden folgenden Jahren gewissenhaft bis zur Versetzung nach Prima durch, sah aber doch, daß ich im Studium der alten Sprachen keine Befriedigung finden würde, und entschloß mich, zum Baufach, dem einzigen damals vorhandenen technischen Fache, überzugehen. Daher ließ ich in Sekunda das griechische Studium fallen und nahm statt dessen Privatstunde in Mathematik und Feldmessen, um mich zum Eintritt in die Berliner Bauakademie vorzubereiten. Nähere Erkundigungen ergaben aber leider, daß das Studium auf der Bauakademie zu kostspielig war, um meinen Eltern in der für die Landwirtschaft immer schwieriger gewordenen Zeit, in der ein Scheffel Weizen für einen Gulden1 verkauft wurde, bei der großen Zahl von jüngeren Geschwistern ein solches Opfer auferlegen zu können.
Aus dieser Not rettete mich der Rat meines Lehrers im Feldmessen, des Leutnants im Lübecker Kontingent, Freiherrn von Bülzingslöwen, der früher bei der preußischen Artillerie gedient hatte. Dieser riet mir, beim preußischen Ingenieurkorps einzutreten, wo ich Gelegenheit erhalten würde, dasselbe zu lernen, was auf der Bauakademie gelehrt würde. Mein Vater, dem ich diesen Plan mitteilte, war ganz damit einverstanden und führte noch einen gewichtigen Grund dafür an, dessen große Wahrheit durch die neuere deutsche Geschichte in helles Licht gesetzt worden ist. Er sagte: »So, wie es jetzt in Deutschland ist, kann es unmöglich bleiben. Es wird eine Zeit kommen, wo alles drunter und drüber geht. Der einzige feste Punkt in Deutschland ist aber der Staat Friedrichs des Großen und die preußische Armee, und in solchen Zeiten ist es immer besser, Hammer zu sein als Amboß.« Ich nahm daher Ostern 1834 im achtzehnten Lebensjahr Abschied von dem Gymnasium und wanderte mit sehr mäßigem Taschengelde nach Berlin, um unter die künftigen Hämmer zu gehen.
1 Das bedeutet heute etwa: 80 Pfund für zwei Goldmark. Und der Monatswechsel eines Studenten war damals etwa 40 Gulden.
SOLDATENZEIT
Als der schwere Abschied von der Heimat, von der innigst geliebten, im Übermaß ihrer Mühen und Sorgen schon kränkelnden Mutter und den zahlreichen, liebevoll an mir hängenden Geschwistern überwunden war, brachte mich mein Vater nach Schwerin, und ich trat von dort meine Wanderung an. Nachdem ich die preußische Grenze überschritten hatte und nun auf gradliniger, staubiger Chaussee durch eine baumlose und unfruchtbare Sandebene fortwanderte, überkam mich doch das Gefühl einer großen Vereinsamung, welches durch den traurigen Kontrast der Landschaft mit meiner Heimat noch verstärkt wurde. Vor meiner Abreise war eine Deputation der angesehensten Bauern des Ortes bei meinem Vater erschienen, um ihn zu bitten, mich, der doch »so ein gauder Junge« wäre, nicht nach dem Hungerlande Preußen zu schicken; ich fände ja zu Hause genug zu essen! Die Bauern wollten es meinem Vater nicht recht glauben, daß hinter dem öden Grenzsande in Preußen auch fruchtbares Land läge. Trotz meines festen Entschlusses, auf eigene Hand mein Fortkommen in der Welt zu suchen, wollte es mir doch jetzt scheinen, als ob die Bauern recht hätten und ich einer traurigen Zukunft entgegenwanderte. Es war mir daher ein Trost, als ich auf der Wanderung einen munteren und ganz gebildeten jungen Mann traf, der gleich mir mit einem Ränzel auf dem Rücken gen Berlin2 wanderte. Er war in Berlin schon bekannt und schlug mir vor, mit ihm in seine Herberge zu gehen, die er sehr lobte.
Es war die Knopfmacherherberge, in der ich mein erstes Nachtquartier in Berlin nahm. Der Herbergsvater erkannte bald, daß ich nicht zu seiner gewohnten Gesellschaft gehörte, und schenkte mir sein Wohlwollen. Er schützte mich gegen die Hänseleien der jungen Knopfmacher und half mir am folgenden Tage die Adresse eines entfernten Verwandten, des Leutnants von Huet, der bei der reitenden Gardeartillerie stand, erforschen. Vetter Huet nahm mich freundlich auf, bekam aber einen tödlichen Schreck, als er hörte, ich sei in der Knopfmacherherberge abgestiegen. Er beauftragte sofort seinen Burschen, mein Ränzel aus der Herberge zu holen und mir in einem kleinen Hotel der neuen Friedrichstraße ein Zimmer zu bestellen, erbot sich auch, nach der notwendigen Verbesserung meiner Toilette mit mir zum damaligen Chef des Ingenieurkorps, dem General von Rauch, zu gehen und ihm meinen Wunsch vorzutragen.
Der General redete mir entschieden ab, da bereits so viele Avantageure auf die Einberufung zur Artillerie- und Ingenieurschule warteten, daß ich vor vier bis fünf Jahren nicht hoffen dürfte, dahin zu gelangen. Er riet mir, zur Artillerie zu gehen, deren Avantageure dieselbe Schule wie die Ingenieure besuchten und bedeutend bessere Aussichten hätten. So entschloß ich mich denn, bei der Artillerie mein Heil zu versuchen, und da bei der Garde kein Ankommen war, wanderte ich mit einer Empfehlung vom Vater des Leutnants von Huet, dem Obersten a. D. von Huet, an den Kommandeur der 3. Artillerie-Brigade, Obersten von Scharnhorst, frohen Mutes nach Magdeburg.
Der Oberst – ein Sohn des berühmten Organisators der preußischen Armee – machte zwar anfangs auch große Schwierigkeiten mit dem Bemerken, daß der Andrang zum Eintritt auf Offiziersavancement sehr groß wäre, und daß er von den fünfzehn jungen Leuten, die sich zum Examen bereits gemeldet hätten, nur die vier annehmen könnte, welche das Examen am besten bestehen würden. Er gab aber schließlich meinen Bitten nach und versprach, mich zum Examen zuzulassen, wenn Se. Majestät der König genehmigen würde, daß ich als Ausländer in die preußische Armee eintreten dürfe. Ihm gefiel offenbar mein frisches, entschiedenes Auftreten, bestimmend war aber doch vielleicht der Umstand, daß er aus meinen Papieren ersah, daß meine Mutter eine geborene Deichmann aus Poggenhagen war, welches an das Gut seines Vaters grenzte.
Da das Eintrittsexamen erst Ende Oktober stattfinden sollte, so hatte ich noch drei Monate zur Vorbereitung. Ich wanderte daher weiter nach Rhoden am Nordabhange des Harzes, wo ein Bruder meines Vaters Gutsbesitzer war, und verlebte dort einige Wochen in traulichem Verkehr mit den Verwandten, von denen namentlich die beiden hübschen und liebenswürdigen erwachsenen Töchter einen großen Eindruck auf mich machten; gern ließ ich mir ihre erziehenden Bemühungen um den jungen, noch etwas verwilderten Vetter gefallen. Dann ging ich mit meinem einige Jahre jüngeren Vetter Louis Siemens nach Halberstadt und bereitete mich dort eifrig auf das Eintrittsexamen vor.
Das Programm des Examens, das der Oberst von Scharnhorst mir eingehändigt hatte, machte mir doch große Bedenken. Außer Mathematik verlangte man namentlich Geschichte, Geographie und Französisch, und diese Fächer wurden auf dem Lübecker Gymnasium sehr oberflächlich getrieben. Die Lücken auszufüllen wollte in ein paar Monaten nur schwer gelingen. Es fehlte mir auch noch die Entlassung vom mecklenburgischen Militärdienst, von dem mein Vater mich erst freikaufen mußte, und die Erlaubnis des Königs zum Eintritt in die preußische Armee. Ich marschierte daher gegen Mitte Oktober recht sorgenschwer nach Magdeburg, wo ich den aus der Heimat erwarteten Brief mit den nötigen Papieren noch nicht vorfand. Als ich dennoch zur festgesetzten Zeit zum Examen gehen wollte, begegnete mir zu meiner großen, freudigen Überraschung mein Vater, der mit einem leichten Fuhrwerk selbst nach Magdeburg gefahren war, um mir die Papiere rechtzeitig zu überbringen, da die Post damals noch zu langsam ging.
Das Examen verlief gleich am ersten Tage über Erwarten günstig für mich. In der Mathematik war ich meinen vierzehn Konkurrenten entschieden überlegen. In der Geschichte hatte ich Glück und schnitt so leidlich ab. In den neueren Sprachen war ich wohl schwächer als die anderen, doch wurde mir bessere Kenntnis der alten Sprachen dafür angerechnet. Schlimmer schien es für mich in der Geographie zu stehen; ich merkte bald, daß die meisten darin viel mehr wußten als ich. Doch da half mir ein besonders günstiges Zusammentreffen. Examinator war ein Hauptmann Meinicke, der den Ruf eines sehr gelehrten und dabei originellen Mannes hatte. Er galt für einen großen Kenner des Tokayer Weins, wie ich später erfuhr, und das mochte ihn wohl veranlassen, nach der Lage von Tokay zu forschen. Niemand wußte sie, worüber er sehr zornig wurde. Mir als letztem der Reihe fiel zum Glück ein, daß es Tokayer Wein gab, der einst meiner kranken Mutter verordnet war, und daß der auch Ungarwein benannt wurde. Auf meine Antwort: »In Ungarn, Herr Hauptmann!« erhellte sich sein Gesicht, und mit dem Ausruf: »Aber, meine Herren, Sie werden doch den Tokayer Wein kennen!« gab er mir die beste Zensur in der Geographie.
So gehörte ich zu den vier Glücklichen, die das Examen am besten bestanden hatten, doch mußte ich noch bange vier Wochen auf die königliche Erlaubnis zum Eintritt in die Armee warten, und als sie Ende November kam, konnte ich doch nicht sogleich eingestellt werden, weil ich erst am 13. Dezember 1816 geboren war, also das siebzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hatte. Ich erhielt aber einen besonderen Exerziermeister, der mich in Zivilkleidung auf dem Magdeburger Domplatz tapfer drillte.
Meine Leistungen gewannen mir bald das Wohlgefallen des gestrengen Bombardiers, nur ein Punkt brachte ihn beinahe zur Verzweiflung. Ich hatte sehr stark gekräuseltes, hellbraunes Haar, welches sich durchaus der militärischen Regel nicht fügen wollte, die verlangte, daß das Haar an den Schläfen glatt anlag. Bei der Inspektion hatte der Hauptmann einen Tadel über das ungeordnete Haar des Rekruten ausgesprochen, und es wurden nun alle möglichen Experimente mit mir angestellt, um diesen militärischen Fehler wenigstens einigermaßen zu vertuschen. Am besten schien sich der Bodensatz des Magdeburger Bräuhahns, eines damals beliebten Bieres, dafür zu eignen. Ich mußte manche Flasche dazu liefern, von der ja leider immer nur der Bodensatz für mich verwendet werden konnte. Es gelang damit auch nach wiederholtem Gebrauche, meine Haare glatt anliegend zu machen, doch nach einiger Zeit revoltierten sie, und in der Regel brachen zum Entsetzen des Bombardiers gerade bei Vorstellungen wieder rebellische Locken aus der glatten Haarschicht hervor.
Ich denke an meine Rekrutenzeit trotz der großen mit ihr verknüpften Anstrengungen sowie grober und scheinbar harter Behandlung durch die Exerziermeister noch heute mit Vergnügen zurück. Die Grobheit ist Manier und ist nicht mit kränkender Absicht verbunden. Sie geht daher auch nicht zu Herzen, hat im Gegenteil etwas Auffrischendes und Anregendes, namentlich wenn sie mit Humor verknüpft ist, wie es bei den berühmt gewordenen Mustern militärischer Grobheit fast immer der Fall war. Ist der Dienst vorbei, so ist die Grobheit vergessen, und das kameradschaftliche Gefühl tritt wieder in sein Recht. Dies kameradschaftliche Gefühl, welches die ganze preußische Armee vom Könige herab bis zum Rekruten durchdringt, macht die strenge Disziplin, die oft bis zur äußersten Grenze der Leistungsfähigkeit gehenden Mühen und Beschwerden erträglich und bildet ihr festes Bindemittel in Freud und Leid. Dem langgedienten Soldaten wird es daher auch in der Regel sehr schwer, sich im Zivildienst zurechtzufinden; es fehlt ihm in diesem die rücksichtslose Grobheit auf kameradschaftlicher Grundlage.
Nach sechsmonatlichem Exerzitium kam das große Ereignis des Avancements zum Bombardier. Es war ein erhebendes Gefühl, jetzt der Vorgesetzte von Hunderttausenden zu sein und von allen Gemeinen pflichtmäßig gegrüßt zu werden. Dann folgte das Kommando zur reitenden Artillerie, darauf die interessante Schießübung, bei der mir zuerst die Erkenntnis meiner technischen Begabung kam, da mir alles selbstverständlich schien, was den meisten schwer wurde zu begreifen. Endlich, im Herbst des Jahres 1835, erhielt ich das ersehnte Kommando zur vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule nach Berlin und damit die Erfüllung meines sehnlichen Wunsches, Gelegenheit zu finden, Nützliches zu lernen.
Die drei Jahre, welche ich vom Herbst 1835 bis zum Sommer 1838 auf der Berliner Artillerie- und Ingenieurschule zubrachte, zähle ich zu den glücklichsten meines Lebens. Das kameradschaftliche Leben mit jungen Leuten gleichen Alters und gleichen Strebens, das gemeinschaftliche Studium unter der Leitung tüchtiger Lehrer, von denen ich nur den Mathematiker Ohm3, den Physiker Magnus und den Chemiker Erdmann nennen will, deren Unterricht mir eine neue, interessante Welt eröffnete, machten diese Zeit für mich zu einer außerordentlich genußreichen. Dazu kam, daß ich in einem meiner Brigadekameraden, William Meyer, einen wirklichen Freund gefunden hatte, mit dem mich fortan innige, opferfreudige Freundschaft bis zu seinem Tode verband.
Ich hatte schon auf dem Lübecker Gymnasium den Anlauf zu einem solchen intimen Freundschaftsbunde genommen, da ich glaubte, in einem Mitschüler einen wirklichen Freund gefunden zu haben, doch als ich ihn einst besuchen wollte, ließ er sich verleugnen, und ich hatte doch deutlich gesehen, daß er zu Hause war und sich vor mir verbarg. Das erschien mir als ein so unverzeihlicher Bruch aufrichtiger Freundschaft, daß ich ihn mit tiefem Schmerze von mir stieß und es niemals wieder über mich gewann, ihm freundschaftliche Gesinnung zu zeigen. William Meyer lernte ich bei der reitenden Artillerie in Burg kennen, wohin er bereits vor mir kommandiert war. Er hatte eine wenig ansehnliche Figur, war in keiner Hinsicht hervorragend oder talentvoll, hatte aber einen klaren Verstand und gefiel mir schon damals durch sein gerades, ungeschminktes Wesen und seine unbeeinflußte Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. Wir schlossen uns auf der Schule innig aneinander an, lebten und studierten zusammen, bezogen ein gemeinsames Quartier und setzten dies später überall fort, wo die Verhältnisse es gestatteten. Unsere notorische Freundschaft und der Umstand, daß ich zuerst gegen die »Tyrannei der Fähnriche« revoltierte, was zu einem Duell mit meinem Stubenältesten führte, bei dem Meyer mir sekundierte, bewirkten sonderbarerweise, daß fast bei allen Paukereien, die im Laufe des ersten Jahres auf der Schule folgten, Meyer und ich zu Sekundanten der gegnerischen Parteien gewählt wurden.
Diese Duelle hatten nur in wenigen Fällen gefährliche Verwundungen zur Folge, übten aber insofern eine sehr nützliche Wirkung aus, als sie einen gesitteten Umgangston unter den jungen Leuten herbeiführten. Unser Jahrgang war der erste, bei dem die Avantageure in beschränkter Zahl auf Grund eines ziemlich strengen Eintrittsexamens eingestellt und dann nach Absolvierung eines Dienstjahres zur Schule kommandiert wurden. Früher machte man keinen Unterschied zwischen Offiziers- und Unteroffizierskandidaten, und es wurden dann oft erst nach Ablauf mehrerer Dienstjahre, die zum Teil in den Kasernen verbracht werden mußten, die Tüchtigsten oder auch wohl die Bestempfohlenen zur Schule kommandiert. Der etwas rüde Umgangston, der von dem langen Verkehr mit ungebildeten Kameraden an den jungen Leuten haften geblieben war, fand in den Duellen das beste und am schnellsten wirkende Heilmittel.
Die dreijährige Schulzeit verlief für mich ohne wesentliche äußere Erlebnisse. Obschon ich sehr an Anfällen von Wechselfieber litt und auch einmal wegen Verletzung des Schienbeins mehrere Monate im Lazarett liegen mußte, gelang es mir doch, die drei Examina – das Fähnrich-, das Armeeoffizier- und schließlich das Artillerieoffizierexamen – glücklich, wenn auch ohne Auszeichnung, zu bestehen. Ich hatte mir mit eisernem Fleiße das für diese Examina nötige Gedächtnismaterial eingepaukt, um es nachher noch schneller wieder zu vergessen, hatte aber alle mir frei bleibende Zeit meinen Lieblingswissenschaften, Mathematik, Physik und Chemie, gewidmet. Die Liebe zu diesen Wissenschaften ist mir mein ganzes Leben hindurch treu geblieben und bildet die Grundlage meiner späteren Erfolge.
Leutnantspatent
Nachdem seine Königliche Majestät von Preußen, unser allergnädigster König und Herr resolvieret haben, den Port du Epée-Fähnrich in der 3. Artillerie-Brigade, Ernst Werner Siemens, zum Sekondeleutnant in Gnaden zu ernennen und zu bestallen und der gedachten Brigade zu aggregieren; so tun Allerhöchst denselben solches auch hiermit und in Kraft dieses Patentes, dergestalt:daß Seiner Königlichen Majestät und Dero Königlichem Hause, derselbe ferner getreu, hold und gehorsam sein, seiner Charge gebührend wahrnehmen, was ihm zu tun und zu verrichten oblieget und aufgetragen wird, bei Tag und Nacht fleißig und treulich ausrichten, bei allen vorfallenden Kriegsbegebenheiten, sich tapfer und unverweislich verhalten, übrigens aber auch alle mit dieser Charge verbundenen Praerogativen und Gerechtsamen genießen solle. Des zu Urkund haben Allerhöchst dieselben dieses Patent mit Dero Insigel bedrucken und autorisieren lassen.
So geschehen und gegeben Berlin, den 29. September 1837
Werner von Siemens als Artillerieoffizier, um 1843 (© Siemens Corporate Archives)
Ein akademisches Studium war für Siemens nicht finanzierbar, sodass er in die preußische Armee eintrat, um Zugang zu einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung zu erhalten. Die Grundlagen der Elektrotechnik erlernte er ab November 1835 als Offiziersanwärter an der Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin, die auf Hochschulniveau lehrte.
Groß war die Freude, als ich nach Absolvierung der Schule mit meinem Freunde Meyer einen vierwöchentlichen Urlaub zum Besuche der Heimat erhielt. Meine Geschwister, deren Zahl schon auf zehn gewachsen war, und auch meine Eltern kannten mich kaum wieder. Das ganze Dorf freute sich mit ihnen über die Wiederkehr des »Muschü’s«, welches der hergebrachte Titel der Söhne »des Hofes« war. Es gab wirklich rührende Wiedersehensszenen mit den braven Leuten unseres und der benachbarten Dörfer, die übrigens großen Respekt vor den preußischen Offizieren hatten, denen sie das gefürchtete Hungerleiden der Preußen allerdings nicht ansehen konnten.
Meine ältere Schwester Mathilde feierte damals ihre Hochzeit mit dem Professor Karl Himly aus Göttingen, der bis zu seinem Tode ein lieber Freund geblieben ist. Hans und Ferdinand waren Landwirte geworden. Der dritte meiner jüngeren Brüder, Wilhelm, war auf der Schule in Lübeck und sollte Kaufmann werden. Die nächstfolgenden, Friedrich und Karl, besuchten ebenfalls die Schule in Lübeck, wo sie bei einem jüngeren Bruder meiner Mutter, dem Kaufmann Ferdinand Deichmann, in Pension gegeben waren.
Daß Wilhelm Kaufmann werden sollte, wollte mir gar nicht gefallen. Einmal teilte ich damals die Abneigung der preußischen Offiziere gegen den Kaufmannsstand, und dann interessierte mich auch Wilhelms eigentümliches, etwas verschlossenes, aber intelligentes Wesen und sein klarer Verstand. Ich bat daher meine Eltern, ihn mir nach meiner künftigen Garnison Magdeburg mitzugeben, um ihn die dortige angesehene Gewerbe- und Handelsschule besuchen zu lassen. Die Eltern willigten ein, und so nahmen wir ihn denn mit uns nach Magdeburg, wo ich ihn in einer kleinen Pensionsanstalt unterbrachte, da ich reglementsmäßig das erste Jahr in der Kaserne wohnen mußte.
Nach Ablauf dieses Jahres, das ich ganz dem strengen Militärdienste zu widmen hatte, bezog ich mit Freund Meyer ein Stadtquartier und nahm den damals sechzehnjährigen Wilhelm nun zu mir. Ich hatte väterliche Freude an seiner schnellen Entwicklung und half ihm in freien Stunden bei seinen Schularbeiten. Auch veranlaßte ich ihn damals, den nicht befriedigenden mathematischen Unterricht auf der Schule aufzugeben und statt dessen Englisch zu treiben. Es ist dies für sein späteres Leben von Bedeutung geworden. Mathematischen Unterricht gab ich ihm selbst jeden Morgen von 5 bis 7 Uhr und hatte die Freude, daß er später ein besonders gutes Examen in der Mathematik machte.
Mir selbst war dieser Unterricht sehr nützlich, auch trug er dazu bei, daß ich allen Verlockungen des Offizierslebens siegreich widerstand und meine wissenschaftlichen Studien energisch fortsetzte.
Leider wurde dieses brüderliche Zusammenleben durch die immer bedenklicher lautenden Mitteilungen des Vaters über den Gesundheitszustand unserer geliebten Mutter sehr betrübt. Am 8. Juli 1839 erlag sie ihren Leiden und ließ den selbst kränklichen, durch Kummer und schwere materielle Sorgen niedergebeugten Vater mit der großen Schar noch unerzogener Kinder in einer höchst traurigen Lage zurück. Ich unterlasse es, den tiefgehenden Schmerz über den Verlust der Mutter zu schildern. Die Liebe zu ihr war das feste Band, das die Familie zusammenhielt, und die Furcht, sie zu betrüben, bildete für uns Geschwister stets die wirksamste Schutzwehr für unser Wohlverhalten. Ich erhielt einen kurzen Urlaub zum Besuche der Heimat und des Grabes der Mutter. Leider flößte mir schon damals die geschwächte Gesundheit des Vaters nur wenig Zutrauen zu der Fortdauer eines geordneten Familienlebens ein, in welchem die jüngeren Geschwister sich gedeihlich würden entwickeln können. Die Richtigkeit meiner trüben Anschauung wurde nur zu bald bestätigt. Kaum ein halbes Jahr später, am 16. Januar 1840, verloren wir auch den Vater.
Nach dem Tode der Eltern wurden vom Vormundschaftsgericht Vormünder für die jüngeren Geschwister bestellt und die Bewirtschaftung der Domäne Menzendorf meinen Brüdern Hans und Ferdinand übertragen. Meine jüngste Schwester Sophie wurde vom Onkel Deichmann in Lübeck an Kindes statt angenommen, während die jüngsten Brüder Walter und Otto unter der Pflege der Großmutter zunächst noch in Menzendorf blieben.
Den Königlich Preußischen Leutnant der 3. Artillerie-Brigade Herrn Werner Siemens in Berlin ersuche und bevollmächtige ich hiermit, über die seiner speziellen Aufsicht übergebenen und zur ferneren Ausbildung bei ihm sich befindenden drei Brüder August Friedrich Siemens Carl Heinrich Siemens Ferdinand Walter Siemens in der Art meine Rechte und Verpflichtungen zu übernehmen, daß er alles, was zu der Ausbildung dieser meiner Curanden erforderlich ist, anordne, ihre Beschäftigungen leite, zu den etwa zu unternehmenden Ferienreisen derselben die nötige Erlaubnis erteile und überhaupt sich der Sorge dieser seiner Brüder so annehme, als ich, wenn ich persönlich in Berlin anwesend wäre, nach den mir obliegenden Pflichten, handeln würde.
Alles was der Herr Leutnant W. Siemens in dieser Hinsicht tun wird, genehmige ich hiermit im voraus völlig.
J. K. Ekengren als gerichtlich bestellter Vormund der Kinder des weiland Domänenpächters Siemens zu MenzendorfWahrsow, den 10. November 1845
Die wissenschaftlich-technischen Studien, denen ich mich jetzt mit verstärktem Eifer hingab, wären mir im folgenden Sommer beinahe sehr schlecht bekommen! Ich hatte gehört, daß mein Vetter, der Hannoversche Artillerieoffizier A. Siemens, erfolgreiche Versuche mit Friktionsschlagröhren angestellt hatte, die anstatt der damals noch ausschließlich gebrauchten brennenden Lunte zum Entzünden der Kanonenladung benutzt werden sollten. Mir leuchtete die Wichtigkeit dieser Erfindung ein, und ich entschloß mich, selbst Versuche nach dieser Richtung zu machen. Da die versuchten Zündmittel nicht sicher genug wirkten, so rührte ich in Ermangelung besserer Gerätschaften in einem Pomadentopf mit sehr dickem Boden einen wässerigen Brei von Phosphor und chlorsaurem Kali zusammen und stellte den Napf, da ich zum Exerzieren fortgehen mußte, gut zugedeckt in eine kühle Fensterecke.
Als ich zurückkam und mich mit einiger Besorgnis nach meinem gefährlichen Präparate umsah, fand ich es zu meiner Befriedigung noch in derselben Ecke stehen. Als ich es aber vorsichtig hervorholte und das in der Masse stehende Schwefelholz, welches zum Zusammenrühren gedient hatte, nur berührte, entstand eine gewaltige Explosion, die mir den Tschako vom Kopfe schleuderte und sämtliche Fensterscheiben samt den Rahmen zertrümmerte. Der ganze obere Teil des Porzellannapfes war als feines Pulver im Zimmer umhergeschleudert, während sein dicker Boden tief in das Fensterbrett eingedrückt war. Als Ursache dieser ganz unerwarteten Explosion stellte sich heraus, daß mein Bursche beim Reinmachen des Zimmers das Gefäß in die Ofenröhre gesetzt und dort einige Stunden hatte trocknen lassen, bevor er es wieder an denselben Platz zurücktrug. Wunderbarerweise war ich nicht sichtlich verwundet, nur hatte der gewaltige Luftdruck die Haut meiner linken Hand so gequetscht, daß Zeigefinger und Daumen von einer großen Blutblase bedeckt waren. Leider war mir aber das rechte Trommelfell zerrissen, was ich sogleich daran erkannte, daß ich die Luft durch beide Ohren ausblasen konnte; das linke Trommelfell war mir schon im Jahre vorher bei einer Schießübung geplatzt. Ich war infolgedessen zunächst ganz taub und hatte noch keinen Laut gehört, als plötzlich die Tür meines Zimmers sich öffnete und ich sah, daß das ganze Vorzimmer mit entsetzten Menschen angefüllt war. Es hatte sich nämlich sofort das Gerücht verbreitet, einer der beiden im Quartier wohnenden Offiziere hätte sich erschossen.
Ich habe infolge dieses Unfalles lange an Schwerhörigkeit gelitten und leide auch heute noch hin und wieder daran, wenn sich die verschlossenen Risse in den Trommelfellen gelegentlich wieder öffnen.
Im Herbst des Jahres 1840 wurde ich nach Wittenberg versetzt, wo ich ein Jahr lang die zweifelhaften Freuden des Lebens in einer kleinen Garnisonstadt genießen mußte. Um so eifriger setzte ich meine wissenschaftlichen Studien fort. In jenem Jahre wurde in Deutschland die Erfindung Jacobis bekannt, Kupfer in metallischer Form durch den galvanischen Strom aus einer Lösung von Kupfervitriol niederzuschlagen. Dieser Vorgang nahm mein Interesse in höchstem Grade in Anspruch, da er offenbar das Eingangstor zu einer ganzen Klasse bisher unbekannter Erscheinungen war. Als mir die Kupferniederschläge gut gelangen, versuchte ich auch andere Metalle auf dieselbe Weise niederzuschlagen, doch wollte mir dies bei meinen beschränkten Mitteln und Einrichtungen nur sehr mangelhaft glücken.
Meine Studien wurden durch ein Ereignis unterbrochen, welches durch seine Folgen die Richtung meines Lebensganges wesentlich änderte. Die in kleineren Garnisonsstädten so häufigen Zwistigkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Waffen hatten zu einem Duell zwischen einem Infanterieoffizier und einem mir befreundeten Artillerieoffizier geführt. Ich mußte dem letzteren als Sekundant dienen. Obgleich das Duell mit einer nur unbedeutenden Verwundung des Infanterieoffiziers endete, kam es doch aus besonderen Gründen zur Anzeige und zur kriegsgerichtlichen Behandlung. Die gesetzlichen Strafen des Duellierens waren damals in Preußen von einer drakonischen Strenge, wurden aber gerade aus diesem Grunde fast immer durch bald erfolgende Begnadigung gemildert. In der Tat wurden durch das in Magdeburg über Duellanten und Sekundanten abgehaltene Kriegsgericht diese zu fünf, jene zu zehn Jahren Festungshaft verurteilt.
Ich sollte meine Haft in der Zitadelle von Magdeburg absitzen und mußte mich nach der eingetroffenen Bestätigung des kriegsgerichtlichen Urteils daselbst melden. Die Aussicht, mindestens ein halbes Jahr lang ohne Beschäftigung eingesperrt zu werden, war nicht angenehm, doch tröstete ich mich damit, daß ich viel freie Zeit zu meinen Studien haben würde. Um diese Zeit gut ausnutzen zu können, suchte ich auf dem Wege zur Zitadelle eine Chemikalienhandlung auf und versah mich mit den nötigen Mitteln, um meine elektrolytischen Versuche fortzusetzen. Ein freundlicher junger Mann in dem Geschäfte versprach mir, nicht nur diese Gegenstände in die Zitadelle einzuschmuggeln, sondern auch spätere Requisitionen prompt auszuführen, und hat sein Versprechen gewissenhaft gehalten.
So richtete ich mir denn in meiner vergitterten, aber geräumigen Zelle ein kleines Laboratorium ein und war ganz zufrieden mit meiner Lage. Das Glück begünstigte mich bei meiner Arbeit. Aus Versuchen mit der Herstellung von Lichtbildern nach dem vor einiger Zeit bekannt gewordenen Verfahren Daguerres, die ich mit meinem Schwager Himly in Göttingen angestellt hatte, war mir erinnerlich, daß das dabei verwendete unterschwefligsaure Natron unlösliche Gold- und Silbersalze gelöst hatte. Ich beschloß daher, dieser Spur zu folgen und die Verwendbarkeit solcher Lösungen zur Elektrolyse zu prüfen. Zu meiner unsäglichen Freude gelangen die Versuche in überraschender Weise. Ich glaube, es war eine der größten Freuden meines Lebens, als ein neusilberner Teelöffel, den ich mit dem Zinkpole eines Daniellschen Elementes verbunden in einen mit unterschwefligsaurer Goldlösung gefüllten Becher tauchte, während der Kupferpol mit einem Louisdor als Anode verbunden war, sich schon in wenigen Minuten in einen goldenen Löffel vom schönsten, reinsten Goldglanze verwandelte. Die galvanische Vergoldung und Versilberung war damals, in Deutschland wenigstens, noch vollständig neu und erregte im Kreise meiner Kameraden und Bekannten natürlich großes Aufsehen. Ich schloß auch gleich darauf mit einem Magdeburger Juwelier, der das Wunder vernommen hatte und mich in der Zitadelle aufsuchte, einen Vertrag ab, durch den ich ihm das Recht der Anwendung meines Verfahrens für vierzig Louisdor verkaufte, die mir die erwünschten Mittel für weitere Versuche gaben.
Inzwischen war ein Monat meiner Haft abgelaufen, und ich dachte wenigstens noch einige weitere Monate ruhig fortarbeiten zu können. Ich verbesserte meine Einrichtung und schrieb ein Patentgesuch, auf welches mir auch auffallend schnell ein preußisches Patent für fünf Jahre erteilt wurde.
Gesuch des Artillerie-Leutnants Siemens um ein Patent.
Ein hohes Ministerium bittet Unterzeichneter ganz gehorsamst um Verleihung eines Patents über die Anwendung einiger von ihm entdeckter, bisher nicht bekannter Goldsalze zu technischen Zwecken und speziell über das Niederschlagen des Goldes in kohärenten Platten aus den Ausflößungen desselben vermittelst des galvanischen Stromes ...
Wittenberg, den 8. Januar 1842
Da erschien unerwartet der Offizier der Wache und überreichte mir zu meinem großen Schrecken, wie ich bekennen muß, eine königliche Kabinettsordre, die meine Begnadigung aussprach. Es war wirklich hart für mich, meiner erfolgreichen Tätigkeit so plötzlich entrissen zu werden. Nach dem Reglement mußte ich noch an demselben Tage die Zitadelle verlassen und hatte weder eine Wohnung, in welche ich meine Effekten und Einrichtung schaffen konnte, noch wußte ich, wohin ich jetzt versetzt werden würde.
Ich schrieb deshalb an den Festungskommandanten ein Gesuch, in dem ich bat, mir zu gestatten, meine Zelle noch einige Tage benutzen zu dürfen, damit ich meine Angelegenheiten ordnen und meine Versuche beendigen könnte. Da kam ich aber schlecht an! Gegen Mitternacht wurde ich durch den Eintritt des Offiziers der Wache geweckt, der mir mitteilte, daß er Ordre erhalten habe, mich sofort aus der Zitadelle zu entfernen. Der Kommandant hatte es als einen Mangel an Dankbarkeit für die mir erwiesene königliche Gnade angesehen, daß ich um Verlängerung meiner Haft gebeten. So wurde ich denn um Mitternacht mit meinen Effekten aus der Zitadelle geleitet und mußte mir in der Stadt ein Unterkommen suchen.





























