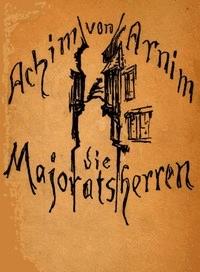Leibnitz' Monadologie Deutsch mit einer Abhandlung über Leibnitz' und Herbart's Theorieen des wirklichen Geschehens E-Book
Freiherr von, Leibniz, Gottfried Wilhelm
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen. Die am Ende des Buches angeführten »Verbesserungen« wurden in den Text eingearbeitet und markiert.
Weitere offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Diese Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Korrekturen findet sich am Ende des Textes.
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Ende des Buches.
Leibnitz'Monadologie.
Deutsch mit einer Abhandlung überLeibnitz' und Herbart's Theorieendeswirklichen Geschehens,vonDr. Robert Zimmermann.
Wien. Braumüller und Seidel. 1847.
Gedruckt bei J. P. Sollinger.
Sr. Excellenz dem hochgeborenen HerrnHieronymus Grafen von LützowDreylützow und Seedorf
Vicepräsidenten des k. k. General-Rechnungs-Directoriums, Commandeur des österr. kaiserl. königl. Leopold-Ordens (S. C. E. K.), k. k. wirkl. Geh. Rath und Kämmerer, Protectors-Stellvertreter bei der wechselseitigen Capitalien- und Renten-Versicherungsanstalt in Wien, stiftenden Mitglied der Gesellschaft des Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes, wirklichen Mitglied der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, Ehrenmitglied des pomologischen und des Schafzüchtervereins, Mitglied des Vereins zur Beförderung der Tonkunst und des nied. österr. Gewerbvereins, Herrn der Herrschaft Lochowic in Böhmen &c. &c. &c.,
ehrfurchtsvoll zugeeignet
vom Verfasser.
Noch vor ganz kurzer Zeit dachte man, wenn von deutscher Philosophie die Rede war, beinahe ausschließlich an Kant und seine Nachfolger, mit welchen das Licht in der Finsterniß aufgegangen sei. Was vor ihm auf diesem Felde geschehen, ignorirte man entweder ganz, oder man glaubte es mit dem Namen Wolffianismus und Dogmatismus hinlänglich abgefertigt zu haben. Selbst Leibnitz, dem es Manche nicht verzeihen konnten, daß er französisch geschrieben, war zu großem Theile Tradition. Seine Monaden waren populär, seine Theodicée nannte man hie und da; von seinem bedeutenden Einfluß auf die Folge- und Neuzeit war wenig die Rede. Kant galt allgemein für die Pforte deutscher Weltweisheit. Allein selbst dieser lief zuletzt Gefahr, über seinen Enkeln in den Winkel gestellt zu werden, und genoß, obgleich man ihm noch immer die Ehre anthat, ihn als Pförtner des philosophischen Hörsaales zu betrachten, kaum ein kärgliches Gnadenbrot.
Dies hat sich im letzten Decennium mit Einemmale geändert. Eine plötzliche bibliographische Thätigkeit ist über die Literatur gerathen; der Deutsche sammelt von allen Seiten die Schätze, die er sonst bisweilen sorglos unbeachtet gelassen, mannigfache Editionen vergriffener Meisterwerke aller Art und jeder Zeit werden veranstaltet, und, den ungünstigsten Fall angenommen, haben diesem literar-historischen Treiben auch die beiseitegelegten Schriften der vorkantischen Periode die Aufmerksamkeit zu danken, die man von Neuem ihnen zugewendet. Leibnitz' philosophische Werke erschienen zum ersten Mal vollständig gesammelt von Erdmann; Guhrauer schrieb dessen Biographie und gab seine deutschen Schriften heraus; eine Auswahl seiner historischen Manuscripte ist auf dem Wege. Sogar Wolff, der lang verunglimpfte, gescholtene, der ehrliche Wolffpar excellence gelangte wieder zu Ehren; wenigstens gab Wuttke dessen interessante Selbstbiographie heraus und verspricht eine ausgewählte Gesammtausgabe seiner zahllosen Schriften. Die Scholastiker werden aufgesucht, gesichtet, und Männer der äußersten Linken wie Feuerbach halten Leibnitz und Bayle der ausführlichen Würdigung und Besprechung werth. Auch die mehrfachen Gesammtausgaben von Kant, die nun vollendete von J. G. Fichte, die Auerbach'sche Uebersetzung Spinoza's, die Ausgaben Mendelssohns gehören hieher.
Es ist möglich, daß hieran das reinhistorische Interesse, das Agens unserer Zeit, das nicht immer nach dem Werthe, sondern nach dem Namen wählt, bisher den größten Antheil hat, es wäre sonst kaum zu begreifen, wie man so plötzlich sollte zur Erkenntniß gekommen sein, nachdem man das Alte so oft geschmäht, verachtet, an den Pranger gestellt hatte; aber daß es das historische Interesse allein gewesen sein sollte, ist doch unwahrscheinlich. Auch innere Gründe, in der Natur der Sache selbst gelegene, müssen mitgewirkt haben, und wenn nichts Anderes, so verräth die Rückkehr zu den alten verlassenen Wohnsitzen wenigstens, daß den Heimkehrenden in den prunkenden Luftschlössern der Speculation, mit welchen sie sich so viel gewußt, nicht heimisch geworden sei. Nachdem sie lang im süßen Wahne gelebt, endlich den Stein der Weisen gefunden zu haben, stiegen auch daran Zweifel auf, und in dem so entstandenen Schwanken und Suchen nach Wahrheit greifen sie endlich auch nach den verrußten Repositorien, die sie so oft in die Rumpelkammer verwiesen zu haben sich gerühmt hatten.
Noch vor einem Jahrzehend gab es eine Schule in Deutschland, welche sich mit stolzem Selbstvertrauen die herrschende nannte; im gegenwärtigen Augenblick ist diese Schule zerstreut, und von Gegnern überflügelt, deren Ansichten sie für längst überwunden erklärt hatte. Es gibt keine herrschende Schule mehr. Monadisten, Monisten und Dualisten stehen sich streitend gegenüber, fast eben so, wie vor anderthalb Jahrhunderten Leibnitz, Spinoza und Descartes. Der Idealismus und die Identitätsspeculation scheinen ihre Rolle ausgespielt, das Denken besonnener, ruhiger, praktischer geworden, scheint Lust zu haben, zum Realismus zurückzukehren, um wenigstens einen sichern Boden unter den Füßen zu fühlen. Eine révolution conciliatrice prophezeit Willm in Straßburg in seiner Preisschrift: »De la philosophie allemande, qu'il est impossible de caractériser tant que Mr. de Schelling n'aura pas achevé l'oeuvre du système definitif, qu'il a promis à l'Europe.« Der bisherige Erfolg desselben scheint nicht zu verrathen, daß es das künftige Schiboleth ausmachen werde. Jene Revolution erwartet der Franzose von dem Realismus Herbart's, der auch seinerseits zum Beweise dienen kann, wie sich ähnliche Ruhepunkte im Laufe des philosophischen Gedankenganges wiederholen. Gegenwärtig hat der philosophische Kreislauf sein Ziel erreicht, er ist in seinen Anfang zurückgekehrt; das wäre eine traurige Erfahrung, wenn es sich buchstäblich so verhielte. Allein auch wenn dem so wäre, und der menschliche Geist wäre auf einem seit siebzig Jahren mit dem angestrengtesten Eifer verfolgten Wege am Ende nur zu der Ueberzeugung gelangt, einen Irrweg eingeschlagen zu haben, ohne darum den Muth zu verlieren, unverdrossen und der erlangten Uebung froh, einen neuen vom Anfang zu beginnen: so wäre dieser kraftvolle Vorsatz um so viele Aufopferung nicht zu theuer erkauft.
Selbst wenn die besondere Veranlassung des im Jahre 1846 gefeierten, und auch in Wien durch die Stiftung der Akademie der Wissenschaften, eines Lieblingsgedankens des großen Mannes, verherrlichten zweihundertjährigen Geburtsfestes Leibnitz', nicht hinzukäme, so dürfte dennoch in einem Zeitpunkte der Art ein Versuch, durch Herausgabe eines seiner wichtigsten Schriftchen ein Schärflein zum Verständniß alter und neuer Richtungen beizutragen, um seiner selbst willen Nachsicht und Entschuldigung verdienen. Niemand ist dazu besser geeignet, als eben dieser allumfassende Denker, welcher den sich anfeindenden Parteien des Idealismus und Realismus gleich nahe steht, in dem sich die Keime aller seiner Nachfolger und die Spuren aller seiner Vorgänger finden. Während seine angebornen Ideen und sein Hauptsatz: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus, sich in Kant zum Kategorienschema ausbildeten, erschien Fichte's streng teleologische Weltordnung als eine natürliche Tochter der Leibnitz'schen Monade, darin sich das Universum spiegelt, und gerade so und nicht anders spiegeln muß, soll der höchste Zweck des Menschen, den der Idealismus in die Selbstständigkeit, Leibnitz aber in die Beförderung des allgemeinen Wohles setzte, erreicht werden. Bei Herbart endlich taucht das ganze Monadensystem mit seiner indifferenten Vielheit und wechsellosen Starrheit wieder auf, an der Stelle des bildlichen Spiegelns sich blos eines anderen Hilfsmittels, der zufälligen Ansichten bedienend. Daß sich von der Identitätsphilosophie wenig bei Leibnitz findet, ist leicht begreiflich; denn er, dem die Mystiker ein Gräuel waren, war auch der Alleinheitslehre so abhold, daß er Spinoza's Werke noch in späteren Jahren als absurdité bezeichnete. Trotzdem hat sich Feuerbach bemüht, auch in ihm die Embryonen des künftigen Pantheismus und Synkretismus nachzuweisen; ob mit Recht, davon kann sich Jeder überzeugen, dem auch nur flüchtig die Hauptumrisse seines großartigen Baues bekannt sind.
Keines seiner Werke bietet dazu eine bessere Gelegenheit, als das nachstehende, dessen Uebersetzung, seit 126 Jahren wieder die erste(1), dem Publicum geboten wird. Während er in den meisten seiner anderen Schriften einen bestimmten Gegner oder eine besondere Richtung vor Augen hat, gegen die er ankämpft oder sich vertheidigt, wodurch selbst seine Hauptwerke, die Theodicée und die nouveaux essais, nicht weniger als die zahlreichen Flugschriften einen polemischen Anstrich und ein persönliches Gepräge erhalten, das dem allseitigen Gesichtspunkte und allgemeineren Verständnisse des Gegenstandes häufig nachtheilig werden kann, gibt er in dieser trefflichen Abhandlung einen vollständigen Ueberblick seines gesammten Systemes, läßt ganz allein die Sache selbst reden, unbekümmert um fremde Meinung und Ansicht, und entwickelt so den großartigen Prachtbau seiner Weltansicht, an dem zwar das unbefangene Auge manche Risse und Spalten entdeckt, dessen Fundamente aber ewig bleiben werden, und der in seiner genialen Unvollendung dem Torso gleicht, den kein Bildhauer zu ergänzen wagte. Was er sonst häufig nur aphoristisch hinwarf mitten unter fremde, bestrittene und geduldete Ideen, oder als geistreiche Axiome aufstellte, seine tiefsten zerstreuten Gedanken und scharfsinnigsten Combinationen, das sammelte er hier wie in einem Brennpunkte, in dem, am Ende eines der Wissenschaft und der Welt wie kein anderes gewidmeten Lebens, alle Strahlen seines Geistes und Wissens zusammenflossen. Er selbst äußert sich über das Verhältniß dieser seiner Schrift zu seinen übrigen auf ähnliche Weise in einem Briefe an seinen Freund Remond de Montmort(2) mit welchem er die Zusendung des Manuscripts an denselben begleitete: »J'ai espéré, que ce petit écrit contribuerait à mieux faire entendre mes méditations en y joignant ce, que j'ai mis dans les journaux de Leipsic, de Paris et de Hollande. Dans ceux de Leipsic je m'accomode assez au langage de l'école, dans les autres je m'accomode davantage au stile des Cartésiens, et dans cette dernière pièce j'ai tâché de m'exprimer d'une manière, qui puisse être entendue de ceux, qui ne sont pas encore trop accoûtumés au stile des uns ou des autres.«
Unbefangen von Vorurtheilen, frei von Systemisirungssucht und unwissenschaftlicher Pedanterei, will er von Unbefangenen gelesen und hofft von solchen verstanden zu werden. Nicht die Wahrheit einer gewissen Schule, die Wahrheit selbst wollte er lehren und vertheidigen, und wie er für seine eigene Person keiner Schule angehörte, hat er auch keine hinterlassen. Dafür ist er auch nicht der einzige redliche Wahrheitsforscher geblieben, der noch bis auf die neueste Zeit von der vornehmen Abgeschlossenheit der Männer von Fach und Kaste an den schlichten, befangenheitslosen Sinn des einfachen Gebildeten appelliren muß, um die Gerechtigkeit zu finden, die von den literarischen Sternkammern ihm vorenthalten wurde. Unwissenschaftlichkeit und falsche Popularitätssucht wird das Bestreben gescholten, auch solche Wahrheiten, die man noch nicht streng bewiesen in ein System einzureihen vermocht, auf das philosophische Gebiet zu ziehen. Lieber soll man engherzig und eitel genug sein, nicht einzugestehen, es gebe noch gar Manches, dessen Grund wir nicht erkennen, dessen Wahrheit aber gleichwohl evident, und dessen Kenntniß nutzbringend für uns ist. Wir sind überzeugt, daß es für jede Wahrheit, sobald sie dies wirklich ist, sie stehe noch so scheinbar isolirt und unvereinbar mit anderen da, einen Platz in der Wissenschaft gibt, an welchen sie eingereiht und ihre Verbindung hergestellt zu werden verdient, auch wenn dieser noch von Niemandem erkannt wird, weil es unmöglich ist, daß eine Wahrheit jemals der anderen widerspreche. Ein übereilter Schluß aber dünkt es uns, aus dem bisherigen Mißlingen, irgend einen Satz auf directem Wege aus einem anderen abzuleiten, kurzweg die Unvereinbarkeit desselben mit den Uebrigen zu folgern, und einen von beiden für irrig zu erklären.
Leider begegnete dieser Fall auch Leibnitz, und dies mag zum Beweise dienen, wie verlockend die Versuchung sei. Sein Lieblingskind, die prästabilirte Harmonie – man könnte sie mit einem kostbar ausgemauerten Marmorteiche vergleichen, den ein König erbaute, um einen Gießbach aufzufangen, über den er mit dem Zehntheil der Kosten keine Brücke zu schlagen wußte – die prästabilirte Harmonie bleibt ein immerwährendes Denkmal des Fehlschlusses: es gebe keine äußere Wirksamkeit, kein thätiges Leben und Schaffen in dieser Welt einfacher Monaden, weil ein solches aus den vorausgesetzten Principien direct abzuleiten nicht möglich war. Diesen letzteren zu Gefallen widersprach er lieber der eigenen Ueberzeugung und machte die augenscheinlichste Thatsache der Erfahrung zum Irrthum, blos weil er keine apriorische Deduction derselben zu geben im Stande war. Um seinem eingebildeten Grundsatze treu zu bleiben, verbannte er sogar die in seinem eigenen Systeme liegenden Antriebe hiezu, die ihn bei einer glücklichen Wendung seines Gedankenganges auf einen, der Wahrheit wenigstens sehr nahe zu liegen scheinenden Weg gebracht haben müßten. Was ihm nicht gelungen war, gelang späteren monadistischen Denkern nicht in höherem Grade. Wie und mit welchem Erfolge sie es versuchten, haben wir bei der Wichtigkeit des Gegenstandes in einer eigenen, am Schlusse hinzugefügten Abhandlung darzustellen uns erlaubt. Wir glaubten, es dabei als einen Act der Pietät gegen den großen Denker ansehen zu dürfen, auf die in seinen eigenen Gedanken liegenden Keime hinzudeuten, welche bei längerem Verweilen und sorgfältigerer Beachtung eine Verstand und Herz mehr befriedigende Lösung anzubahnen versprechen. Inwiefern es uns gelungen ist, dieselben anschaulich zu machen, müssen wir der Prüfung Anderer überlassen.
Nach dieser kurzen Rechtfertigung des Unternehmens erübrigt uns noch die nöthigen literar-historischen Notizen über die nachstehende Schrift, wie wir sie Guhrauer's und Erdmann's gründlichen Forschungen verdanken, hinzuzufügen. Leibnitz verfaßte das Original der Monadologie in französischer Sprache, wie der oben angeführte Brief uns lehrt, während seines Aufenthaltes in Wien in den Jahren 1713 und 1714 zunächst für den Gebrauch und auf Veranlassung des großen Eugen. Der Brief ist von Wien datirt am 26. August 1714. Er sagt darin: Maintenant je vous envoie un petit discours, que j'ai fait ici pour le prince Eugène de Savoie sur ma philosophie. Des Prinzen Interesse an Wissenschaft und Kunst, die er nicht blos aus Liebhaberei, sondern aus wahrer Liebe pflegte, ist bekannt und seine noch vorhandene Büchersammlung in der k. k. Hofbibliothek zu Wien, wie seine reichen Kunstschätze geben genügendes Zeugniß davon. Neben mathematischen und Kriegswissenschaften liebte er die Philosophie und er konnte, sagt Guhrauer, wie Alexander sich glücklich schätzen, daß zu seiner Zeit ein Aristoteles gelebt habe. Er verschloß, fährt Leibnitz' Biograph fort, die philosophische Schrift, die Leibnitz für ihn aufgesetzt hatte, wie eine seiner größten Kostbarkeiten und war zu eifersüchtig darauf, sie auch nur zu zeigen. Demungeachtet ist die Schrift verloren gegangen, und unter den prachtvollen rothen und blauen Maroquinbänden des Prinzen, die einen abgesonderten Theil der kaiserl. Hofbibliothek zu Wien ausmachen, findet sich keine Spur mehr von dem schlichten Manuscripte des deutschen Gelehrten. Ja nicht blos die dem Prinzen geschenkte Abschrift, sondern das Original der Abhandlung selbst schien bis auf die neueste Zeit, wo es Erdmann wieder auffand, von dem Erdboden verschwunden.
Oeffentlich erschien die Schrift zuerst vier Jahre nach Leibnitz' Tode in deutscher Sprache unter dem Titel: »Des Herrn Gottfried Wilhelm von Leibnitz Lehrsätze über die Monadologie; ingleichen von Gott und seinen Eigenschaften, seiner Existenz und der Seele des Menschen. Aus dem Französischen von H. Köhler. Jena (nach Anderen: Frankfurt am Main) 1720.« Derselbe Köhler gab in demselben Jahre auch Leibnitz' Streitschriften mit Clarke in deutscher Uebersetzung heraus. Jene Ausgabe, die sehr selten geworden zu sein scheint, ist mir nicht zu Gesichte gekommen. Christian Wolff bevorwortete sie und 1740 erschien eine neue Auflage von derselben durch Huth. In welchem Verhältnisse sie zu der Handschrift Leibnitz' selbst stand, ist mir nicht bekannt. Wenn es aber wahr ist, was Erdmann, der sie gesehen hat, behauptet, daß die lateinische Uebersetzung in den Actis eruditorum nur eine Version der deutschen Uebersetzung sei, so müssen schon in ihr hie und da Abweichungen stattgefunden haben. Diese lateinische Uebersetzung erschien unter dem Namen: G. G. Leibnitzii principia philosophiae in gratiam principis Eugenii conscripta in den actis eruditorum Lipsiensium, Suppl. tom. VII. 1721 sect. XI. p. 500–514. Sie ist die bekannteste. Völlig gleich mit ihr lauten die Abdrücke bei: M. G. Hansch: Principia philosophiae Leibnitzii geometrico modo demonstrata. Francofurthi. Monath 1728, und Lud. Dutens: Principia philosophiae seu theses in gratiam principis Eugenii in Leibnitzii Opera omnia. Genevae de Fournes. 1768. tom. II. pag. 20–31. Nachdem der Urtext auf der k. Bibliothek zu Hannover unter Fascikeln alter Schriften wieder entdeckt, und auf diese Weise vor fernerer Verwechslung mit einem zuerst 1718 publicirten, stellenweise gleichlautenden Schriftchen: Principes de la nature et de la grâce gesichert worden, nahm ihn Erdmann zuerst in seine Ausgabe: Leibnitzii opera omnia philosophica (Berolini, Eichler, 1840) tom. II. Seite 704–712 unter dem ursprünglichen Titel: la Monadologie, wieder auf. Diesen Text haben wir unserer Uebersetzung zu Grunde gelegt. Die mehr oder minder wichtigen Abweichungen, die sich zwischen ihm und den lateinischen Ausgaben finden, sind unter demselben getreulich angegeben. Woher diese rühren, ist zweifelhaft. Möglich, daß es verschiedene Handschriften von Leibnitz selbst gab, nach deren einer die deutsche Uebersetzung, die Mutter aller übrigen, gefertigt worden. Keinesfalls sind die Varianten bedeutend und bestehen meist in geringfügigen Zusätzen. Der wichtigste ist jener §. 33 über die zufälligen Wahrheiten. Von größerem Interesse, besonders für die Geschichte der Philosophie, sind die Parallelstellen aus der Theodicée, die Leibnitz mit eigener Hand am Rande des Originals bemerkt hat. Doch nahm der Uebersetzer Anstand, dieselben beizufügen, weil sie theils einen sehr ausführlichen Commentar verlangt haben würden, theils längst verlebte Ansichten und Meinungen betreffen. Desto lebhafter müssen wir wünschen, daß recht viele Freunde der Philosophie sich durch die Verdeutschung des Werkchens bewegen ließen, einer Schrift ihre Theilnahme zu schenken, welche der große Eugen so hoch hielt, daß er, wie der Graf Bonneval erzählt, sie den Freund nur küssen ließ und dann wieder in sein Kästchen einschloß, wie Alexander die göttlichen Gesänge des mäonidischen Sängers.
Wien, im Juni 1846.
Leibnitz' Monadologie.
(La monadologie; Monadologia seu principia philosophiae in gratiam principis Eugenii conscripta.)
1.
Die Monade, von der wir hier sprechen werden, ist eine einfache Substanz, welche Verbindungen mit andern eben solchen zu zusammengesetzten Substanzen eingeht; einfache, d. i. ohne Theile.
2.
Einfache Substanzen muß es geben, weil es zusammengesetzte gibt; denn das Zusammengesetzte ist nichts, als eine Anhäufung oder ein aggregatum von Einfachem.
3.
Wo keine Theile sind, da ist auch keine Ausdehnung, keine Gestalt, keine mögliche Theilbarkeit; die Monaden sind die wahren Atome der Natur, mit Einem Worte, die Elemente der Dinge.
4.
Eine Auflösung in Theile ist bei ihnen niemals zu befürchten; so wenig, als sich überhaupt eine mögliche Art und Weise erdenken läßt, auf welche eine einfache Substanz dem Naturlaufe gemäß zu Grunde gehen könnte.
5.
Gleich undenkbar ist es aus demselben Grunde, daß eine einfache Substanz auf natürlichem Wege irgend einen Anfang nehme; weil sie ja nicht durch Zusammensetzung gebildet wird.
6.
Anders als plötzlich kann daher die Existenz der Monaden weder anfangen noch enden; sie muß beginnen durch einen Act der Schöpfung (création), aufhören durch einen Act der Vernichtung (annihilation); während das Zusammengesetzte sich Theil um Theil bildet oder zu Grunde geht.
7.
Zu erklären, wie es möglich sei, daß eine Monade in ihrem Innern durch eine andere einen Wechsel oder eine Veränderung erfahre, haben wir durchaus kein Mittel. Denn es läßt sich weder aus der einen in die andere etwas übertragen, noch in dieser letzteren durch die erstere eine innerliche Bewegung erzeugen, die von außen geweckt, geleitet, vermehrt oder vermindert werden könnte, wie dies bei zusammengesetzten Dingen möglich ist, wo die mehreren Theile eine Vertauschung oder Verschiebung unter einander gestatten. Die Monaden jedoch haben keine Fenster, durch welche irgend etwas ein- oder auszutreten vermöchte. Die Accidenzen dürfen sich von ihren Substanzen nicht ablösen, wenn sie nicht haltlos im leeren Raume, etwa wie die sichtbaren Schemen (espèces) der Scholastiker herumflattern sollen. Weder Substanz noch Accidenz kann von außen her Eingang in eine Monade finden.
8.
Indeß müssen die Monaden nothwendig auch Qualitäten an sich haben, sonst wären sie keine seienden Wesen (êtres; entia). Unterschieden sich die einfachen Wesen nicht durch ihre Qualitäten, so würde uns jedes Mittel fehlen, irgend einen Wechsel an den Dingen wahrzunehmen, weil dasjenige, was am Zusammengesetzten erscheint, nur von den einfachen Bestandtheilen (ingrediens) herrühren kann. Die Monaden aber, sobald sie keine Qualitäten hätten, wären eine von der andern in gar nichts verschieden, weil sie nicht einmal der Quantität nach differiren könnten. Folglich würde, den Raum als erfüllt vorausgesetzt, jeder Ort in der Bewegung beständig nichts anders als ein vollkommenes Aequivalent dessen erhalten, was er schon früher besaß, mithin jeder Zustand der Dinge jedem andern in allen Stücken völlig gleich sein.
9.
Jede Monade muß verschieden sein von jeder andern. Denn schon in der Natur gibt es nicht zwei Wesen, die einander in allen Stücken völlig gleich und wo wir außer Stande wären, eine innere oder auf eine innere Bestimmung sich gründende Verschiedenheit zu finden(3).
10.
Für ausgemacht nehme ich an, daß jedes erschaffene Wesen, folglich auch die erschaffene Monade, ein Gegenstand der Veränderung, wie auch, daß dieser Zustand des Wechsels ein continuirlicher sei.
11.
Daraus folgt, daß die naturgemäßen Veränderungen der Monaden aus einem innern Princip in denselben abfolgen müssen, weil ja eine äußere Ursache keinen Einfluß auf das Innere der Monas auszuüben vermag.
12.
Es ist aber auch nothwendig, daß außer diesem allgemeinen Principe der Veränderlichkeit wirkliche besondere Veränderungen in jeder Monas vorhanden seien, und diese sind es, welche die specifische Verschiedenheit und bunte Mannigfaltigkeit der Monaden unter einander begünstigen (il faut, qu'il-y-ait un détail de ce qui se change ....)(4).
13.
Dieses Besondere (détail) der Veränderung (in jeder einfachen Monas) umschließt eine Vielheit in der Einheit oder ein Vielfaches im Einfachen. Denn da jede natürliche Veränderung stufenweise vor sich geht, so ändert sich Einiges und Anderes bleibt, und dadurch entsteht in jeder einfachen Substanz eine Mehrheit von Zuständen (affections) und Beziehungen (rapports), ungeachtet sie keine Theile hat.
14.
Der vorübergehende Zustand, der eine Mehrheit in der Einheit oder Einfachheit umschließt und vorstellt, ist kein anderer, als den man gewöhnlich Vorstellung schlechtweg (perception, perceptio) nennt, und welcher, wie später klar werden wird, von der bewußten Vorstellung (apperception, apperceptio) unterschieden werden muß. Die Cartesianer haben hier arg geirrt, indem sie alle unbewußten Vorstellungen für ein Nichts erachteten. Dieser Irrthum machte sie dann glauben, die Geister allein seien wahre Monaden, die Thiere aber hätten keine Seelen, oder wenn man es so nennen will, Entelechieen. Deshalb verwechselten sie auch, wie das gemeine Volk, eine bloße lange Betäubung mit dem Tode im strengsten Sinn des Worts, und verfielen zugleich in das scholastische Vorurtheil von dem Vorhandensein gänzlich isolirter Seelen, was manches geängstigte Gemüth im Glauben an die Sterblichkeit der Seelen noch bestärkte.
15.
Jene Thätigkeit des innerlichen Princips, welche die Veränderung oder den Uebergang von einer Vorstellung zur andern bewirkt, kann Begehren (appetition) heißen. Es ist zwar wahr, daß das Begehren nicht immer zum Besitze der ganzen Vorstellung gelangt, auf welche es hinzielt, aber es erreicht doch immer etwas und kommt zu neuen Vorstellungen.
16.
Wir selbst machen die Erfahrung des Vorhandenseins einer Vielheit in der einfachen Substanz, sobald wir an uns wahrnehmen, daß auch der kleinste Gedanke, dessen wir uns bewußt werden, noch eine Mannigfaltigkeit in seinem Objecte enthalte. Wer immer daher nur die Einfachheit der Substanz zugesteht, kann nicht umhin, auch die Vielheit in der Monas anzunehmen und Bayle hätte hierin keine so bedeutenden Schwierigkeiten suchen sollen, wie er es in seinem Wörterbuche (Art. Rorarius) gethan hat(5).
17.
Andererseits muß man gestehen, daß die Vorstellungen, und Alles, was von ihnen abhängt, aus mechanischen Gründen, dergleichen körperliche Gestalten und Bewegungen sind, unmöglich erklärt werden können. Man stelle sich eine Maschine vor, deren Structur so eingerichtet sei, daß sie zu denken, zu fühlen und überhaupt vorzustellen vermöge und lasse sie unter Beibehaltung derselben Verhältnisse so anwachsen, daß man hinein, wie in das Gebäude einer Mühle eintreten kann. Dies vorausgesetzt, wird man bei Besichtigung des Innern nichts Anderes finden, als etliche Triebwerke, deren eins das andere bewegt, aber gar nichts, was hinreichen würde, den Grund irgend einer Vorstellung abzugeben. Die letztere gehört ausschließlich der einfachen Substanz an, nicht der zusammengesetzten, und dort, nicht hier, muß man sie suchen. Auch sind Vorstellungen und ihre Veränderungen zugleich das Einzige, was man in der einfachen Substanz antrifft.
18.
Den Namen der Entelechieen könnte man allen einfachen Substanzen beilegen, denn alle tragen in sich einen gewissen Grad von Vollkommenheit (ἔχουσι τὸ ἐντελές) und ihr vollkommenes Sichselbstgenügen (αὐτάρκεια, suffisance) macht sie zu Urhebern ihrer eigenen innern Thätigkeiten, so zu sagen zu unkörperlichen Automaten.
19.
Kommen wir überein, Seelen alles dasjenige zu nennen, dem in obenerklärtem Sinne die Fähigkeit des Vorstellens und Begehrens zukommt, so sind alle einfachen Substanzen oder geschaffenen Monaden Seelen. Allein da Empfindung schon etwas mehr ist, als eine bloße Perception schlechtweg, so bin ich der Meinung, für diejenigen einfachen Substanzen, welchen nur die letztere zukommt, reiche der Name: Monade oder Entelechie hin, und die Bezeichnung: Seele (âme) solle für diejenigen vorbehalten werden, deren Vorstellungen deutlicher und vom Erinnerungsvermögen begleitet sind.
20.
Denn an uns selbst lernen wir durch die Erfahrung Zustände kennen, in welchen uns weder eine gehörige Erinnerung, noch irgend eine deutliche Vorstellung zu Gebot steht. Dergleichen sind Schwäche, Ohnmacht, oder ein tiefer traumloser Schlaf, der uns gefangen hält. In diesen und ähnlichen Lagen unterscheidet sich die Seele nicht merklich von einer bloßen Monade, und steht nur insofern höher denn diese, als jene Zustände bei ihr von keiner Dauer sind, sondern sie sich durch eigene Kraft aus denselben emporzuraffen vermag.
21.
Hieraus folgt indeß ganz und gar nicht, daß die einfache Substanz, selbst so lange sie in diesen Zuständen befangen ist, jemals ohne Vorstellungen sei. Sie kann es nicht sein, schon aus den früher angegebenen Gründen nicht; denn sie kann weder zu Grunde gehen noch fortbestehen, ohne daß sie dadurch irgendwie afficirt würde, und eben diese Affection ist schon eine Vorstellung in ihr. Ist nun eine große Anzahl dergleichen, wenn auch nur schwacher und unbedeutender Vorstellungen zugleich vorhanden und befindet sich unter ihnen keine deutlich bestimmte, so verliert man (wie man zu sagen pflegt) den Kopf, gerade so, als hätte man sich mehrmahl nach einander und beständig nach derselben Seite hin im Kreise gedreht, wo uns dann der Schwindel ergreift, und die Sinne so vergehen, daß wir nichts deutlich unterscheiden. In einen Zustand dieser Art versetzt die thierischen Organismen für eine gewisse Zeit der Tod.
22.
Weil ferner jeder gegenwärtige Zustand einer einfachen Substanz nothwendigerweise eine Folge ihrer sämmtlichen vorhergehenden Zustände und die Gegenwart daher (so zu sagen) die schwangere Mutter der Zukunft ist:
23.
so ist es offenbar, daß die Seele, die, sobald sie einmal aus der Betäubung wieder erwacht, sogleich Vorstellungen in sich selbst als daseiend wahrnimmt, ihrer auch schon vor diesem Wiedererwachen, obgleich unbewußt, gehabt haben muß. Denn eine Vorstellung kann auf natürlichem Wege nicht anders entstehen, als wieder durch eine Vorstellung, so wie eine Bewegung nicht anders als durch eine andere vorangehende Bewegung dem Gange der Natur gemäß erzeugt werden kann.
24.
Hätten wir also nicht Vorstellungen von einem höheren Grade der Deutlichkeit, die gleichsam über die gewöhnlichen Perceptionen hervorragen, so würden wir uns ununterbrochen in einem Zustande der Betäubung befinden. Ein solcher ist aber der Zustand der gemeinen Monade fortwährend.
25.
Den Thieren dagegen hat die Natur schon höhere Vorstellungen verliehen, wie wir wenigstens aus der Sorgfalt schließen dürfen, mit der sie ihnen Organe zugetheilt hat, die dazu geeignet sind, theils reichlichere Lichtstrahlen, theils zahlreichere Luftschwingungen aufzunehmen, um durch diese Vereinigung größere Wirkungen hervorzubringen. Aehnlich verhält es sich mit ihrem Geruchs- und Geschmackssinne, mit ihrer Anhänglichkeit und vielleicht noch einer Menge anderer Sinne, die uns alle unbekannt sind. Wie aber die Vorgänge in der Seele jene in den Organen abbilden, werde ich sogleich auseinander setzen.
26.
Das Gedächtniß bringt die Seelenthätigkeiten in eine Art regelmäßiger Aufeinanderfolge, die der Vernunft sehr ähnlich sieht, aber von ihr unterschieden werden muß. So sehen wir, daß Thiere, sobald sie eine Vorstellung von Etwas haben, das ihnen auffällt, und wovon sie schon einmal eine ähnliche gehabt haben, auf dasjenige, was damals mit der ähnlichen Vorstellung verknüpft war, aufmerksam und auf diese Weise zu ähnlichen Empfindungen fortgeleitet werden, wie sie damals hatten. Zeigt man z. B. dem Hunde den Stock, so entsinnt er sich der Schmerzen, die er ihm einst verursachte, heult und läuft davon.
27.
Die heftige Einbildung, die ihm hier Schrecken einjagt und ihn aufscheucht, kommt entweder von der Stärke oder der Menge der vorhergehenden Vorstellungen. Oft bringt ein einziger starker und lebhafter Eindruck auf einmal die Wirkung einer langgehegten Gewohnheit oder vieler mit geringer Kraft, aber oft wiederholter Vorstellungen hervor.
28.
So lange nun die Aufeinanderfolge der Vorstellungen vom Gedächtnisse allein abhängt, handeln die Menschen wie die Thiere, ähnlich den roh empiristischen Aerzten, die ohne Theorie bloße Routine besitzen. In drei Viertheilen unserer Handlungen sind wir reine Erfahrungsmenschen. Behaupten wir z. B. es werde morgen wieder ein Tag sein, so urtheilen wir der Erfahrung nach, weil dies bisher immer so der Fall gewesen. Nur der Astronom fällt dieses Urtheil mit Bewußtsein der vernünftigen Gründe.
29.
Was uns von dem gewöhnlichen Thiere unterscheidet, ist allein die Erkenntniß der wirklich nothwendigen und ewigen Wahrheiten. Diese gibt uns Vernunft und Wissen, denn sie erhebt uns zur Erkenntniß Gottes und unser selbst. Diese allein auch nennen wir die vernünftige Seele in uns oder den Geist (esprit).
30.
Mittels der Erkenntniß der nothwendigen Wahrheiten und ihrer Abstractionen erheben wir uns endlich zu den Acten des reflectirenden Denkens, zum Gedanken des Ichs und zu der Betrachtung unseres Innern. Auf dem Wege des Nachdenkens über uns selbst gelangen wir dann zum Begriffe des Wesens, der Substanz, des Stofflosen (immatériel) und endlich Gottes selbst, indem wir einsehen lernen, daß was in uns beschränkt vorhanden ist, in ihm ohne Grenzen sei. Und dieses Denken verschafft uns die Hauptgegenstände unsrer weiteren Untersuchungen.
31.
Unsere Schlüsse stützen sich auf zwei Hauptgrundsätze: jenen des Widerspruchs (principe de la contradiction), kraft dessen wir dasjenige für falsch erklären, was einen Widerspruch enthält, und dasjenige für wahr halten, was dem Falschen entgegengesetzt oder widersprechend ist;
32.
und auf jenen des zureichenden Grundes (principe de la raison suffisante), kraft dessen wir schließen, daß keine Thatsache wahr oder wirklich, kein Satz wahrhaft sein könne, ohne daß ein hinreichender Grund vorhanden ist, warum es sich so und nicht anders verhalte, obgleich diese Gründe sehr häufig uns weder sämmtlich bekannt sind, noch es jemals werden.
33.
So gibt es auch zwei Classen von Wahrheiten, jene der Vernunft- und jene der Erfahrungswahrheiten (verités de fait). Die Vernunftwahrheiten sind nothwendig und ihr Gegentheil ist unmöglich, die Erfahrungswahrheiten zufällig und ihr Gegentheil möglich. Sobald eine Wahrheit nothwendig ist, lassen sich durch Analyse ihre Gründe auffinden, indem man sie in Begriffe (idées) und einfachere Wahrheiten auflöst, bis man zu den Grund- oder primitiven Wahrheiten gelangt(6).
34.
Auf ähnliche Weise führen die Mathematiker ihre speculativen Theorien und praktischen Canones auf Definitionen, Axiome und Forderungen (demandes) zurück.
35.
Endlich gibt es hier auch einfache Begriffe, von denen keine Definition möglich ist, ferner unbeweisbare Lehrsätze und Forderungen, mit Einem Wort, erste Grundsätze, bei denen ein Beweis weder möglich noch nothwendig ist, und dies sind die identischen Sätze, deren Gegentheil einen ausdrücklichen Widerspruch enthält(7).
36.
Ein solcher zureichender Grund muß sich aber auch bei den zufälligen oder Erfahrungswahrheiten aufzeigen lassen, d. i. in der Aufeinanderfolge der Dinge, die durch die geschaffene Welt ausgebreitet liegen. Wo nicht, so könnte die Auflösung in Theilgründe wegen der unendlichen Mannigfaltigkeit der Naturdinge und der unendlichen Theilbarkeit der Körper sich in grenzenlose Einzelnheiten verlieren. So gibt es eine Unzahl von Dingen und Bewegungen, die zusammengenommen die bewirkende Ursache meines gegenwärtigen Schreibens ausmachen, und ebenso eine unendliche Menge gegenwärtiger und vergangener Neigungen und Stimmungen meines Geistes, die alle zur Endursache desselben beitragen.
37.
Weil aber jede dieser Einzelursachen nur wieder weiter auf neue, noch mehr in's Einzelne gehende zufällige Ursachen führt, deren jede, um abermals begründet zu werden, einer ähnlichen Analyse bedarf: so kommt man damit allein nicht vorwärts, und der wahre zureichende Grund muß außerhalb der Reihe (series) der zufälligen Einzelursachen, die sich bis in's Unendliche fortsetzen kann, gelegen sein.
38.
Der letzte Grund der Dinge muß sich daher in einer nothwendigen Substanz vorfinden, in welcher sämmtliche Veränderungen formaliter (éminemment), als in ihrem Urquell, ihren Grund haben, und diese ist es, welche wir Gott nennen.
39.
Weil nun diese Substanz der zureichende Grund des Ganzen und dieses in allen seinen Theilen auf das Engste verbunden ist, so gibt es nicht mehr als Einen Gott, und dieser genügt.
40.
Ferner kann man schließen, daß diese letzte Substanz, einzig, allumfassend und nothwendig, wie sie ist, da sie nichts außer sich hat, das von ihr unabhängig wäre, und selbst nichts ist, als schlechthin die Folge der Möglichkeit ihres eigenen Wesens, auch keiner Grenzen fähig sein darf, und alle nur mögliche Realität besitzen muß.
41.
Hieraus folgt, daß Gott absolut vollkommen ist. Denn die Vollkommenheit ist nichts Anderes, als die Größe aller positiven Realität, absolut genommen, mit Beiseitesetzung aller Grenzen und Schranken der Dinge in der Welt. Und nur dort, wo es keine Schranken gibt, also bei Gott, ist die Vollkommenheit absolut unendlich(8).
42.
Ferner folgt daraus, daß die Geschöpfe ihre relative Vollkommenheit durch den Einfluß Gottes besitzen, ihre Unvollkommenheiten dagegen durch Schuld ihrer eigenen Natur, die sich der Schranken nicht zu entäußern vermag. Darin beruht ihr Unterschied von der Gottheit.
43.
Es ist ferner wahr, daß Gott die Quelle ist nicht allein des Seins (existence), sondern auch des Wesens (essence), so weit es wirklich (réel) ist; also dessen, was wirklich ist in der Möglichkeit (réel dans la possibilité). Denn der göttliche Verstand ist das Reich der ewigen Wahrheiten oder der Begriffe, von welchen diese beherrscht werden, so daß es ohne ihn nichts Reelles in der Möglichkeit, und nicht nur nichts Existirendes, sondern sogar nichts Mögliches gibt.
44.
Dabei versteht sich, daß, wenn es eine Realität gibt, in dem Wesen der Dinge oder in ihren Möglichkeiten, oder selbst in den ewigen Wahrheiten: diese Realität sich stützen muß auf etwas Existentes und Actuelles, folglich auf die Existenz des nothwendigen Wesens, in welchem die Essenz die Existenz einschließt, und für welches es hinreicht, möglich, um auch schon wirklich zu sein.
45.
Gott allein also (das nothwendige Wesen) hat das Privilegium mit Nothwendigkeit zu existiren, sobald er nur möglich ist. Und weil Niemand die Möglichkeit dessen läugnen wird, was weder von Schranken umschlossen, noch durch irgend eine Negation oder einen Widerspruch gestört wird, so reiche das Gesagte hin, Gottes Dasein a priori zu erkennen. Wir haben dasselbe auch aus der Existenz der nothwendigen Wahrheiten bewiesen. Kurz zuvor aber auch a posteriori aus dem Dasein zufälliger Dinge, die ihren letzten oder zureichenden Grund nur in jenem nothwendigen Wesen haben können, das den Grund seiner Existenz in sich selbst trägt.
46.
Dabei braucht man aber gar nicht, wie Einige gethan, sich einzubilden, die ewigen Wahrheiten seien, weil abhängig von Gott, auch willkürlich und seinem Belieben anheimgestellt, wie Descartes und nach ihm Poiret(9) geglaubt zu haben scheinen. Dies gilt nur von den zufälligen (contingentes) Wahrheiten, deren Princip die Zuträglichkeit (convenance) oder die Wahl des Besten ist, während die nothwendigen Wahrheiten einzig von seinem Verstande, dessen innere Objecte sie ausmachen, abhängen(10).
47.
So ist Gott allein die ursprüngliche Einheit oder die einfache ursprüngliche Substanz, deren Productionen alle abgeleiteten oder geschaffenen Monaden sind, welche, wenn man sich dieses Bildes bedienen darf, von Moment zu Moment durch beständige Ausstrahlungen (fulgurations) der Gottheit entstehen, welche in ihrer Thätigkeit nur durch die wesentlich begrenzte Empfänglichkeit der Creatur beschränkt wird.
48.
In Gott ist die Macht, die Quelle von Allem, was ist, die Erkenntniß, die den ganzen Umfang der Begriffe umfaßt, und endlich der Wille, der nach dem Princip der Wahl des Besten Veränderungen bewirkt und Neues schafft. Diese Eigenschaften entsprechen in Gott demjenigen, was in den Monaden das Subject oder die Grundlagen ausmacht, dem Vorstellungs- und Begehrungsvermögen. In Gott aber sind sie absolut, unendlich oder vollkommen, während sie in den Entelechieen oder geschaffenen Monaden (nach Hermolaus Barbarus Uebersetzung: perfectihabiis) bloße Nachbildungen der Seinigen nach Maßgabe der jeweiligen Vollkommenheit der Monade sind.
49.
Das Geschöpf soll nach außen so viel thätig sein, als es Vollkommenheit besitzt, und von Anderen in gleichem Maaße leiden, als es unvollkommen ist. Man legt daher der Monade Thätigkeit (action) in dem Verhältnisse bei, als sie deutliche Vorstellungen hat, und Schwäche (passion) im Verhältniß, je nachdem diese verworren sind.
50.
Ein Geschöpf ist vollkommener als ein Anderes, sobald man an ihm etwas findet, was den vollständigen reinapriorischen Grund dessen abgeben kann, was an einem Anderen geschieht und deshalb sagt man, es wirke auf dies Andere.
51.
Aber unter den einfachen Substanzen herrscht nur ein idealer Einfluß einer Monade auf die andere, und dieser gelangt zu seiner Wirksamkeit nicht anders, als durch die Dazwischenkunft Gottes selbst, indem in seinem Gedankenkreise jede Monade mit Recht verlangen kann, daß er bei Anordnung und Regelung der übrigen von Anbeginn der Dinge her auch auf sie Rücksicht nehme. Denn da keine geschaffene Monade einen physischen Einfluß auf das Innere einer anderen nehmen kann, so bleibt dies als das einzige Mittel übrig, um die eine in der Abhängigkeit von der andern zu erhalten.
52.
Daher sind auch zwischen den geschaffenen Substanzen Thätigsein und Leiden wechselseitig. Denn Gott findet, sobald er zwei einfache Substanzen vergleicht, in jeder derselben Gründe, die ihn bestimmen, die eine derselben der anderen anzupassen, woraus folgt, daß diejenige, die uns von einem Gesichtspunkte aus als thätig erschien, uns von einem anderen aus als leidend erscheinen kann; und zwar thätig, insofern dasjenige, was man an ihr deutlich zu erkennen im Stande ist, dazu dient, den Grund dessen abzugeben, was an der anderen vorgeht; leidend aber, insofern der Grund dessen, was so eben in ihr geschieht, in demjenigen anzutreffen ist, was so eben an der andern Monade mit Deutlichkeit unterschieden werden kann.
53.
Da es aber unter Gottes Vorstellungen eine unendliche Menge möglicher Welten gibt, und doch nur eine einzige davon zur Wirklichkeit gelangen kann, so muß es zu Gottes Wahl einen zureichenden Grund geben, der ihn zu der einen mehr als zu der andern bestimmte.
54.
Dieser Grund konnte sich nur in der Zuträglichkeit vorfinden, in den Stufen der Vollkommenheit, welche diese Welten besaßen, weil jede im geraden Verhältnisse ihrer größeren oder geringeren Vollkommenheit (mehr oder weniger) das Recht hat, eine ihr angemessene Existenz zu begehren.
55.
Dies ist die Ursache des Daseins der besten Welt, welche Gott vermöge seiner Weisheit erkannte, vermöge seiner Güte wählte, und kraft seiner Macht erschuf.
56.
Diese innige Verknüpfung (liaison) oder die (vollkommene) Uebereinstimmung aller geschaffenen Dinge mit jedem einzelnen und jedes einzelnen mit allen übrigen macht, daß jede einfache Substanz Beziehungen (rapports) an sich trägt, die ein Abdruck aller Uebrigen (einfachen Substanzen) sind, und folglich jede einzelne gleichsam als ein lebender immerwährender Spiegel des gesammten Universums erscheint.
57.
Und wie eine und dieselbe Stadt, von verschiedenen Seiten angesehen, immer als eine andere, und gleichsam vervielfältigt erscheint, so kann es geschehen, daß wegen der unendlichen Menge einfacher Substanzen es eben so viele verschiedene Welten zu geben scheint, die, genauer besehen, nichts Anderes sind, als die verschiedenen Ansichten der einzigen von den verschiedenen Standpunkten der einzelnen Monaden angesehenen Welt.
58.
Hierin aber liegt das Mittel, die größtmögliche Mannigfaltigkeit und doch in der größtmöglichen Ordnung zu erhalten, oder, was dasselbe ist, der Weg, die größtmögliche Vollkommenheit herzustellen.
59.
Auch ist es nur diese Annahme allein – ich wage es, sie für bewiesen zu halten(11), – die das Ansehen der Größe Gottes, so wie es sich gebührt, wieder herzustellen vermag. Dies gesteht selbst Bayle und bemerkt zu seinen Einwürfen (Dict. hist. crit. art. Rorarius(12)) blos, ich weise Gott zu viel, und mehr als zu leisten möglich, zu. Aber er vermag nicht einen Grund beizubringen, warum diese allgemeine Uebereinstimmung (harmonie universelle), welche macht, daß jede Substanz mittels ihrer allseitigen Beziehungen ein Bild aller übrigen liefere, unmöglich sein sollte.
60.
Man sieht übrigens aus dem Gesagten die Gründe ein, warum der Lauf der Dinge gerade der und kein anderer sein kann, der er ist. Gott hat bei Anordnung des Ganzen ein Auge auf jeden Theil desselben, auf jede Monas insbesondere, deren einmal vorstellende Natur durch Nichts genöthigt werden kann, gerade nur eine bestimmte Partie der Dinge außer sich vorzustellen. Nichtsdestoweniger ist es klar, daß diese Gesammtvorstellung des ganzen Weltalls im Einzelnen nicht anders als verworren ausfallen und nur ein kleiner Theil der Dinge deutlich vorgestellt werden kann, nämlich derjenige, den jene Dinge ausmachen, welche jeder Monade die nächsten, oder im Vergleiche mit ihr die größten sind; sonst müßte jede Monade Gott sein. Die Beschränktheit der Monade liegt nicht in der Zahl der Gegenstände, welche sie vorstellt, sondern in der besonderen Beschaffenheit ihrer Kenntniß von denselben. Alle Monaden gehen auf die Erkenntniß des Unendlichen, des Ganzen aus, aber sie sind beschränkt und unterschieden von demselben durch die Deutlichkeitsgrade ihrer Vorstellungen.
61.
Hierin kommen zusammengesetzte und einfache Substanzen überein. Denn weil der ganze Raum erfüllt, daher alle Materie dicht ist, ferner im erfüllten Raume jede Bewegung auf entfernte Körper eine dieser Entfernung proportionirte Wirkung ausübt, so daß jeder Körper nicht nur von jenem Körper afficirt wird, der auf ihn wirkt, und gewissermaßen Alles mitempfindet, was diesem zustößt, sondern durch dessen Vermittlung auch an den Zuständen jener Körper theilnimmt, die mit dem ersten, von welchem er unmittelbar berührt wird, in Verbindung gerathen: so folgt, daß diese Mittheilung auf was immer für eine Entfernung hinaus sich fortpflanzen könne. Mithin empfindet jeder Körper Alles mit, was im ganzen Universum geschieht, und der Allsehende liest gleichsam in jeder einzelnen Monade, was in allen Uebrigen geschieht, geschah und geschehen wird. So nimmt er in der Gegenwart Dinge wahr, die der Zeit und dem Orte nach entlegen sind; ihm sind, wie Hippokrates sagte: σύμπνοια πάντα. Aber in sich selbst kann eine Seele nichts Anderes lesen, als was sie deutlich vorstellt. Daher kann sie auch nicht mit Einemmale alle ihre Bilder enthüllen, denn diese gehen in's Unendliche.
62.
Obgleich also jede geschaffene Monade das Universum vorstellt, hat sie doch eine deutlichere Vorstellung nur von dem Körper, der ihr selbst als Individuum angehört, und dessen Entelechie sie ist. Weil aber dieser Körper durch seinen Zusammenhang mit der den Raum erfüllenden Materie auch mit dem ganzen Universum in Verbindung steht, so stellt die Seele, indem sie ihren eigenen Körper vorstellt, das Universum selbst vor.
63.
Der Körper einer Monade, dessen Entelechie oder Seele sie ist, macht mit dieser Entelechie dasjenige aus, was man ein lebendes Wesen (vivant) nennen kann, mit einer Seele verbunden jedoch dasjenige, was wir ein Thier (animal) nennen wollen. Der Körper eines Lebendigen sowohl als der eines Thieres ist immer organisch, denn jede Monade ist in ihrer Art ein Spiegel des Universums; und weil dieses selbst nach einer vollkommenen Ordnung eingerichtet ist, so folgt, daß auch in den auf dasselbe bezüglichen Vorstellungen der Seele, folglich auch im Körper, als dem Mittel, mit Hilfe dessen die Seele das Universum sich vorstellt, eine solche herrschen müsse.
64.
Jeder derartige organische Körper eines lebenden Wesens ist eine Art göttlicher Maschine, ein natürlicher Automat, der alle künstliche Automaten unendliche Mal übertrifft. Denn eine Maschine von Menschenhand hört in ihren kleinsten Theilen schon auf, Maschine zu sein, und der Zahn eines messingenen Rades z. B. hat Theile und Bestandstücke, die für uns nichts Kunstreiches mehr sind und nichts an sich tragen, was noch in Bezug zu dem Nutzen der Maschine stünde, zu welcher das Rad gehört. Die Maschinen der Natur dagegen, die lebenden Körper, sind noch bis in ihre kleinsten Theile, ja bis in's Unendliche herab Maschinen. Dies macht den Unterschied aus zwischen Natur und Kunst d. i. zwischen der göttlichen Kunst und der unseren.
65.
Der Urheber der Natur konnte dies göttliche und unendlich vollkommene Werk vollenden, weil jeder Theil der Materie nicht nur, wie schon die Alten erkannten, in's Unendliche theilbar, sondern auch wirklich ohne Ende in Theile und Theile der Theile untergetheilt ist, deren jeder eigene Bewegung hat. Sonst wäre es unmöglich, daß jeder Theil der Materie das ganze Universum darstellte.
66.
Hieraus sieht man nun, daß es noch in den kleinsten Theilen der Materie eine Welt von Geschöpfen, Entelechieen und Seelen gibt.
67.
Jeder Theil der Materie kann angesehen werden als ein Garten voll Pflanzen oder ein Teich voll Fische. Aber jeder Zweig der Pflanze, jedes Glied des Thieres, jeder Tropfen seiner Säfte ist noch ein solcher Garten und ein solcher Teich.
68.
Und obgleich Erde und Luft, die sich zwischen den Pflanzen eben so wie das Wasser zwischen den Fischen befinden, selbst weder Pflanze noch Fisch sind, enthalten sie deren doch in sich, aber meist von einer für unsere Organe nicht mehr wahrnehmbaren Feinheit.
69.
Also gibt es nichts Unangebautes, nichts Unfruchtbares, nichts Todtes im Universum, kein Chaos, keine Verwirrung, außer im äußeren Scheine; fast wie uns aus der Entfernung gesehen das Treiben in einem Teiche erscheinen würde, worin wir eine verwirrte wimmelnde Bewegung der Fische wahrnehmen, ohne diese selbst zu unterscheiden.
70.
Hieraus wird ferner offenbar, daß jeder lebende Körper eine herrschende Entelechie hat, die im Thiere zur Seele wird; aber die Glieder jedes lebenden Wesens sind voll von anderen lebenden Wesen, Pflanzen und Thieren, deren jedes wieder seine eigene herrschende Entelechie, seine eigene Seele hat.