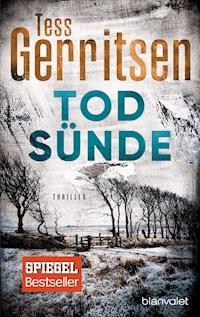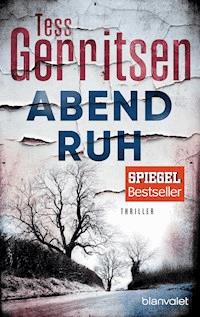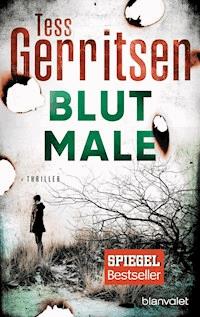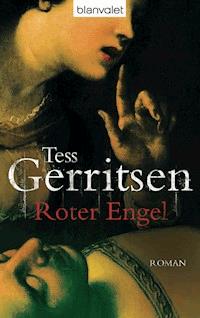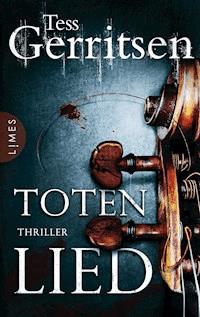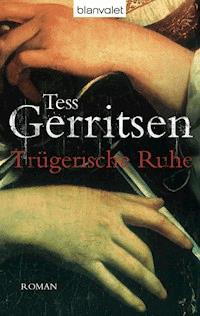9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Im Anfang war der Tod …
Julia Hamill gräbt gerade den Garten ihres kürzlich erworbenen Hauses um, als sie einen grausigen Fund macht: den skelettierten Schädel eines Menschen. Mit den Mitteln der modernen Gerichtsmedizin kann Dr. Maura Isles die harten Fakten schnell bestimmen: Die Leiche ist knapp zweihundert Jahre alt – eine Frau, die ganz offensichtlich einem Mord zum Opfer fiel. Doch wer ist die unbekannte Tote? Und wer hat sie im Garten des alten Hauses verscharrt? Diese Fragen lassen Julia Hamill keine Ruhe, und sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Eine alte Kassette voller Dokumente führt sie dabei in die Vergangenheit Bostons – zu den ersten Versuchen, mithilfe von Forensik, Pathologie und Autopsien einen Kriminalfall zu lösen. Und zu dem Medizinstudenten Norris Marshall, der hofft, einen gefährlichen Frauenmörder zu stellen – und, vom Ehrgeiz verblendet, seine einzige Zeugin in höchste Gefahr bringt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Ähnliche
Tess Gerritsen
Leichenraub
Roman
Deutsch von Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Bone Garden« bei Ballantine Books, an imprint of The Random House Publishing Group,a division of Random House Inc., New York.
1. AuflageCopyright der Originalausgabe © 2007 by Tess GerritsenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2008 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHPublished by Arrangement with Terry Gerritsen Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Umschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Araldo de Luca/Corbis; Detail aus Guido Reni: Die heilige Maria Magdalena, 1632wr · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-02687-5V003www.blanvalet.de
Zum Andenken an Ernest Brune Tom,der mich gelehrt hat,immer nach den Sternen zu greifen
20. März 1888
Liebste Margaret,
ich danke Dir für Deine freundlichen Zeilen, in denen Du mir so aufrichtig Dein Beileid zum Tod meiner geliebten Amelia aussprichst. Dieser Winter ist eine sehr schwere Zeit für mich gewesen – bringt doch, wie es scheint, jeder Monat Nachricht vom Hinscheiden eines weiteren alten Freundes, dahingerafft von Krankheit und Altersschwäche. Nun muss ich mit tiefer Schwermut auf die rasch dahinschwindenden Jahre blicken, die mir noch verbleiben.
Mir ist klar geworden, dass dies vielleicht meine letzte Gelegenheit ist, auf ein schwieriges Thema zu sprechen zu kommen, das ich schon längst hätte anschneiden sollen. Ich habe immer gezögert, es zu erwähnen, da ich wusste, dass Deine Tante es für das Klügste hielt, es Dir vorzuenthalten. Glaube mir, sie hat es allein aus Liebe getan, weil sie Dich schützen wollte. Aber ich kenne Dich seit Deiner frühesten Kindheit, liebe Margaret, und habe Dich zu der furchtlosen Frau heranwachsen sehen, die Du heute bist. Ich weiß, dass Du fest an die Macht der Wahrheit glaubst. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es auch Dein Wunsch ist, diese Geschichte zu hören, sosehr sie Dich auch erschüttern mag.
Achtundfünfzig Jahre sind seit jenen Ereignissen vergangen. Du warst damals noch sehr klein und dürftest keine Erinnerung daran haben. Ich selbst hatte sie fast schon vergessen. Aber dann stieß ich vergangenen Mittwoch auf einen alten Zeitungsausschnitt, der all die Jahre zwischen den Seiten meiner alten Ausgabe von Wistars Anatomie gesteckt hatte, und mir wurde bewusst, dass die Tatsachen höchstwahrscheinlich mit mir untergehen werden, wenn ich nicht bald davon erzähle. Nach dem Tod Deiner Tante bin ich der letzte Verbliebene, der die Geschichte noch kennt. Alle anderen sind nicht mehr.
Ich muss Dich warnen: Die Einzelheiten sind alles andere als erfreulich. Aber es ist auch eine Geschichte von edler Seelengröße und bewegender Tapferkeit. Du hättest vielleicht nicht gedacht, dass Deine Tante diese Eigenschaften besaß. Zweifellos schien sie nicht außergewöhnlicher als irgendeine grauhaarige alte Dame, der man auf der Straße begegnet. Doch ich versichere Dir, Margaret, sie verdiente unseren höchsten Respekt.
Vielleicht mehr als irgendeine Frau, die ich je gekannt habe.
Jetzt ist es spät geworden, und nach Einbruch der Dunkelheit kann ein alter Mann die Augen nicht mehr so lange offen halten. Fürs Erste lege ich Dir den Zeitungsausschnitt bei, den ich bereits erwähnte. Falls Du nichts weiter von der Sache zu hören wünschst, so lass es mich wissen, und ich werde das Thema nie wieder ansprechen. Aber wenn Dich die Geschichte Deiner Eltern ernsthaft interessiert, dann werde ich bei nächster Gelegenheit wieder zur Feder greifen. Und Du wirst die Geschichte – die wahre Geschichte – von Deiner Tante und dem West End Reaper erfahren.
Es grüßt Dich recht herzlich
Dein
O.W.H.
1
Gegenwart
So also endet eine Ehe, dachte Julia Hamill, während sie die Schaufel in die Erde stieß. Nicht mit zärtlich geflüsterten Abschiedsworten, nicht mit dem liebevollen Druck einer arthritischen Hand irgendwann in vierzig Jahren, nicht mit einer Schar trauernder Kinder und Enkelkinder, die sich um ihr Krankenhausbett versammeln. Sie hob eine Schaufel voll Erde heraus und warf sie zur Seite. Kleine Steinchen fielen rasselnd auf den stetig anwachsenden Hügel. Alles nur Lehm und Steine, für nichts zu gebrauchen außer vielleicht für Brombeersträucher. Unfruchtbarer Boden – wie ihre Ehe, aus der nichts Bleibendes hervorgegangen war, nichts, was sich zu bewahren lohnte.
Sie trat auf die Schaufel und hörte einen hellen, metallischen Klang, während ihr die Erschütterung bis ins Rückgrat fuhr. Wieder war das Blatt auf einen Stein gestoßen, einen großen, wie es sich anhörte. Julia setzte neu an, doch aus welchem Winkel sie den Stein auch anging, es wollte ihr nicht gelingen, ihn zu lockern. Frustriert und schwitzend stand sie in der brennenden Sonne und starrte in das Loch hinab. Den ganzen Vormittag hatte sie gearbeitet wie eine Besessene, und unter ihren Lederhandschuhen platzten schon die Blasen auf. Beim Graben hatte sie eine Wolke von Stechmücken aufgescheucht, die sirrend ihr Gesicht umschwärmten und sich in ihren Haaren verfingen.
Es führte kein Weg daran vorbei: Wenn sie auf diesem Grundstück etwas anpflanzen wollte, wenn sie diese von Unkraut überwucherte Wiese in einen Garten verwandeln wollte, musste sie da einfach durch. Und dieser Stein war ihr im Weg.
Plötzlich schien ihr das ganze Unterfangen zum Scheitern verurteilt, mehrere Nummern zu groß für ihre armseligen Anstrengungen. Sie ließ die Schaufel fallen und sank zu Boden, landete unsanft mit dem Po auf dem steinigen Erdhaufen. Wie war sie überhaupt auf die Idee gekommen, sie könnte diesen Garten wieder herrichten, dieses Haus retten? Über das wuchernde Unkraut hinweg starrte sie auf die windschiefe Veranda, die verwitterten Holzschindeln. Julias Schnapsidee – so sollte sie das Ganze nennen. Gekauft zu einem Zeitpunkt, als sie nicht bei klarem Verstand gewesen, als ihr ganzes Leben in Stücke gegangen war. Warum nicht noch mehr Ballast an Bord des sinkenden Schiffs nehmen? Es sollte ein Trostpreis sein dafür, dass sie die Scheidung überlebt hatte. Mit achtunddreißig würde Julia endlich ein Haus haben, das ihr gehörte, ein Haus mit einer Vergangenheit, mit einer Seele. Als sie das erste Mal mit der Maklerin durch die Räume gegangen war und die handgeschnitzten Deckenbalken gesehen hatte, als sie durch einen Riss in den zahlreichen Schichten, die seither dazugekommen waren, ein Stückchen der alten Tapete erspäht hatte, da hatte sie gewusst, dass dieses Haus etwas Besonderes war. Und es hatte nach ihr gerufen, sie um Hilfe angefleht.
»Die Lage ist unschlagbar«, hatte die Maklerin gesagt. »Und Sie bekommen fast viertausend Quadratmeter Grund dazu; so was finden Sie heute kaum noch, so nahe bei Boston.«
»Und warum ist es dann immer noch auf dem Markt?«, hatte Julia gefragt.
»Sie sehen ja, in was für einem schlechten Zustand es ist. Als wir es in unsere Kartei aufgenommen haben, war hier alles bis unter die Decke zugestellt mit Kisten und Kartons voller Bücher und alter Papiere. Die Erben haben einen Monat gebraucht, um alles rauszuschaffen. Wie Sie sehen, muss es von Grund auf renoviert werden, bis auf das Fundament.«
»Na ja, was mir gefällt, ist, dass es eine interessante Vergangenheit hat. Der Zustand würde mich nicht davon abhalten, es zu kaufen.«
Die Maklerin zögerte. »Es gibt da noch etwas, was ich Ihnen sagen sollte. Im Rahmen der Offenlegungspflicht.«
»Was denn?«
»Die Vorbesitzerin war schon über neunzig, und – nun ja, sie ist hier gestorben. Das schreckt manche Interessenten ein wenig ab.«
»Über neunzig? Dann war es also eine natürliche Todesursache, oder?«
»Das nimmt man jedenfalls an.«
Julia runzelte die Stirn. »Man weiß es nicht genau?«
»Es war Sommer. Und es vergingen fast drei Wochen, bis einer ihrer Verwandten sie …« Die Maklerin verstummte. Plötzlich hellte ihre Miene sich auf. »Aber wissen Sie, das Grundstück allein ist schon etwas ganz Besonderes. Sie könnten das ganze Haus abreißen. Sich alles vom Hals schaffen und von vorn anfangen!«
So, wie man sich eine in die Jahre gekommene Ehefrau wie mich vom Hals schafft, hatte Julia gedacht. Dieses prächtige, verfallene Haus und ich, wir haben beide etwas Besseres verdient.
Jetzt, als sie zusammengesunken auf dem Erdhaufen hockte und nach Mücken schlug, dachte sie: Was habe ich mir da eingebrockt? Wenn Richard diese Ruine je zu Gesicht bekäme, würde er alles bestätigt sehen, was er immer schon über sie gedacht hatte: die leichtgläubige Julia, Wachs in den Händen jedes Maklers. Stolze Besitzerin eines Schrotthaufens.
Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen, über die schweißnasse Wange. Dann sah sie wieder in das Loch hinunter. Wie konnte sie auch nur im Entferntesten hoffen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, wenn sie nicht einmal die Kraft aufbrachte, einen blöden Stein aus dem Weg zu räumen?
Sie griff nach einer Pflanzschaufel, beugte sich über das Loch und machte sich daran, die Erde wegzukratzen. Mehr und mehr von dem Stein kam zum Vorschein, wie die Spitze eines Eisbergs, über dessen wahre Dimensionen sie nur Mutmaßungen anstellen konnte. Vielleicht groß genug, um die Titanic zum Sinken zu bringen. Sie grub weiter, immer tiefer und tiefer, ohne auf die Mücken zu achten oder auf die Sonne, die auf ihren ungeschützten Kopf niederbrannte. Der Stein wurde plötzlich zu einem Symbol für all die Hindernisse, all die Herausforderungen, vor denen sie in der Vergangenheit immer gekniffen hatte.
Ich lass nicht zu, dass du mich besiegst.
Mit der Pflanzschaufel hackte sie auf die Erde unter dem Stein ein und versuchte, so viel Platz zu schaffen, dass sie die Schaufel unter den Stein schieben könnte. Die Haare fielen ihr ins Gesicht und klebten in Strähnen an ihrer schweißnassen Haut, während sie schaufelte und kratzte und der Tunnel immer tiefer wurde. Noch bevor Richard das Grundstück zu sehen bekäme, würde sie es in ein Paradies verwandeln. Es blieben ihr noch zwei Monate, bis sie sich das nächste Mal einem Raum voller Drittklässler stellen musste. Zwei Monate, um dieses Unkraut herauszureißen, den Boden zu düngen und Rosen zu pflanzen. Richard hatte ihr prophezeit, wenn sie je in ihrem Garten in Brookline Rosen pflanzen sollte, würden sie mit Sicherheit eingehen. »Da muss man schon ein bisschen Ahnung haben«, hatte er gesagt – nur eine hingeworfene Bemerkung, aber geschmerzt hatte sie dennoch. Sie wusste, was er in Wirklichkeit meinte.
Man muss Ahnung haben – und du hast keine.
Sie legte sich auf den Bauch und hackte unermüdlich weiter, bis ihre Pflanzkelle auf etwas Hartes stieß. O Gott, nicht noch ein Stein. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und starrte den Gegenstand an, auf den ihr Werkzeug gerade getroffen war. Das spitze Metallblatt hatte eine glatte Fläche beschädigt, und feine Risse strahlten von dem Punkt aus, an dem die Kelle aufgetroffen war. Sie wischte Erde und Kiesel beiseite und legte eine unnatürlich glatte Kuppel frei. Flach auf dem Bauch liegend, spürte sie, wie ihr Herz gegen die Erde schlug, und sie hatte plötzlich Mühe, Luft zu bekommen. Doch sie grub weiter, mit beiden Händen jetzt, und ihre behandschuhten Finger wühlten sich durch den hartnäckigen Lehm. Immer größere Teile des kuppelförmigen Objekts kamen ans Tageslicht, gerundete Flächen, zusammengefügt mit einer gezackten Naht. Tiefer und tiefer scharrte sie, und ihr Puls ging schneller, als sie einen kleinen, mit Erde gefüllten Hohlraum entdeckte. Sie zog den Handschuh aus und stieß mit dem bloßen Finger die harte Lehmkruste an. Plötzlich brach der Klumpen auseinander, und die Krümel rieselten herab.
Julia fuhr zurück, schnellte auf die Knie hoch und starrte das Ding an, das sie soeben freigelegt hatte. Das Sirren der Mücken schwoll zu einem Kreischen an, doch sie wedelte sie nicht weg, zu betäubt, um ihre Stiche zu spüren. Ein Windhauch strich über das Gras und ließ den süßlichen Duft von wilden Möhren aufsteigen. Julia hob den Blick und betrachtete ihr unkrautüberwuchertes Grundstück, dieses Stück Land, das sie in ein Paradies verwandeln wollte. Sie hatte von einem üppigen Garten voller Rosen und blühender Stauden geträumt, von einer Gartenlaube, umrankt von rosa Clematis. Doch als sie jetzt den Blick darüber schweifen ließ, sah sie keinen Garten mehr.
Sie sah einen Friedhof.
»Du hättest mich um Rat fragen können, bevor du diese Bruchbude gekauft hast«, sagte ihre Schwester Vicky, die an Julias Küchentisch saß.
Julia stand am Fenster und starrte hinaus auf die zahlreichen Erdhaufen in ihrem Garten, die wie Mini-Vulkane aus dem Boden gesprossen waren. Seit drei Tagen war das Team vom Rechtsmedizinischen Institut nun schon zugange, hatte sich in ihrem Garten quasi häuslich eingerichtet. Sosehr hatte sie sich schon daran gewöhnt, dass sie alle naselang durch ihr Haus stapften, um die Toilette zu benutzen, dass sie sie regelrecht vermissen würde, wenn die Ausgrabungen abgeschlossen waren und sie es endlich wieder für sich allein hatte, dieses Haus mit seinen handgeschnitzten Deckenbalken und seiner Geschichte. Und seinen Geistern.
Dr. Isles, die Rechtsmedizinerin, war gerade eingetroffen und kam auf die Grabungsstätte zu. Julia fand die Frau irgendwie irritierend, mit ihrer Art, die weder freundlich noch unfreundlich war, dem gespenstisch bleichen Teint und dem rabenschwarzen Haar. Sie sieht so ruhig und gefasst aus, dachte Julia, als sie die Frau durchs Fenster beobachtete.
»Das ist doch sonst nicht deine Art, die Dinge so zu überstürzen«, meinte Vicky. »Du schaust dir was an und machst noch am selben Tag ein Angebot? Hast du gedacht, jemand anders könnte es dir wegschnappen?« Sie deutete auf die windschiefe Kellertür. »Die schließt ja nicht mal richtig. Hast du dir mal die Fundamente angesehen? Dieses Haus hat doch sicher seine hundert Jahre auf dem Buckel.«
»Hundertdreißig«, murmelte Julia, ohne den Blick vom Garten zu wenden, wo Dr. Isles jetzt am Rand der Grube stand.
»Ach, Schatz«, sagte Vicky mit sanfterer Stimme, »ich weiß, dass es ein schwieriges Jahr für dich war, und kann mir vorstellen, was du zurzeit durchmachst. Ich wünschte nur, du hättest mich angerufen, bevor du so eine schwerwiegende Entscheidung triffst.«
»Es ist gar nicht so schlecht«, beharrte Julia. »Das Grundstück hat viertausend Quadratmeter. Und es ist nahe an der Stadt.«
»Und im Garten ist eine Leiche vergraben. Das wird den Wiederverkaufswert sicher wahnsinnig heben.«
Julia massierte sich den Nacken, der plötzlich ganz verspannt war. Vicky hatte recht. Vicky hatte immer recht. Ich habe meine ganzen Ersparnisse in dieses Haus gesteckt, dachte Julia, und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Anwesens, auf dem ein Fluch liegt. Durch das Fenster sah sie wieder einen Neuankömmling im Garten eintreffen. Es war eine ältere Frau mit kurzen grauen Haaren, bekleidet mit Bluejeans und schweren Arbeitsstiefeln – nicht gerade das Outfit, das man bei so einem großmütterlichen Typ erwarten würde. Noch so eine schräge Gestalt, die an diesem Tag in ihrem Garten herumspazierte. Wer waren diese Leute, die herbeiströmten, sobald irgendwo eine Leiche gefunden wurde? Warum hatten sie sich für einen Beruf entschieden, der sie tagtäglich mit dem Tod konfrontierte – mit Dingen, die den meisten Menschen schon Gänsehaut verursachten, wenn sie nur daran dachten?
»Hast du mit Richard gesprochen, bevor du es gekauft hast?«
Julia erstarrte. »Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen.«
»Hast du überhaupt mal von ihm gehört in letzter Zeit?«, fragte Vicky. Ihr veränderter Tonfall – plötzlich ganz leise, fast zögerlich – brachte Julia endlich doch dazu, sich zu ihrer Schwester umzudrehen.
»Warum fragst du?«
»Du warst schließlich mit ihm verheiratet. Rufst du ihn denn nicht ab und zu an, einfach nur, um zu fragen, ob er deine Post weiterleitet oder so was in der Art?«
Julia trat an den Tisch und ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Ich rufe ihn nicht an. Und er ruft mich nicht an.«
Einen Moment lang saß Vicky nur schweigend da, während Julia den Blick stoisch gesenkt hielt. »Es tut mir ja so leid«, sagte sie schließlich. »Ich wusste doch nicht, dass es dir immer noch so wehtut.«
Julia lachte auf. »Tja nun, mir tut es auch leid.«
»Es ist jetzt ein halbes Jahr her. Ich dachte, du wärst inzwischen über die Trennung hinweg. Du bist intelligent, du siehst super aus – eigentlich solltest du längst wieder im Geschäft sein.«
Typisch Vicky, so eine Bemerkung. Die unverwüstliche Vicky, die gerade mal fünf Tage nach ihrer Blinddarmoperation wieder im Gerichtssaal aufgekreuzt war und ihr Anwaltsteam zum Sieg geführt hatte. Von so einem kleinen Rückschlag wie einer Scheidung würde sie sich nicht einmal eine Woche lang aus dem Konzept bringen lassen.
Vicky seufzte. »Um ehrlich zu sein, ich bin nicht den ganzen Weg hierhergefahren, nur um das neue Haus zu sehen. Du bist meine kleine Schwester, und es gibt da etwas, was du wissen solltest. Du hast ein Recht, es zu erfahren. Ich weiß nur nicht recht, wie …« Sie brach ab und blickte zur Küchentür, an der es gerade geklopft hatte.
Julia öffnete die Tür und erblickte Dr. Isles, die trotz der Hitze immer noch kühl und beherrscht wirkte. »Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass mein Team heute abziehen wird«, sagte Maura Isles.
Julia warf einen Blick auf die Grabungsstätte und sah, dass die Mitarbeiter schon ihre Werkzeuge einpackten. »Sie sind hier fertig?«
»Wir haben genug gefunden, um sagen zu können, dass dies kein Fall für die Rechtsmedizin ist. Ich habe ihn an Dr. Petrie aus Harvard weitergegeben.« Isles deutete auf die Frau, die gerade eingetroffen war – das Großmütterchen in Bluejeans.
Vicky trat zu ihnen an die Tür. »Wer ist Dr. Petrie?«
»Sie ist forensische Anthropologin. Sie wird die Grabung abschließen, zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Falls Sie nichts dagegen haben, Ms. Hamill.«
»Die Knochen sind also alt?«
»Es handelt sich eindeutig nicht um ein Begräbnis aus der jüngeren Vergangenheit. Warum kommen Sie nicht einfach mit nach draußen und sehen es sich an?«
Maura Isles trat hinaus in den Garten, und Vicky und Julia gingen mit ihr den Hang hinunter. Nach drei Tagen Graben war aus dem Loch eine gähnende Grube geworden. Die Gebeine waren auf einer Plane ausgebreitet.
Obwohl Dr. Petrie mindestens sechzig sein musste, sprang sie behände aus der Hocke auf und trat näher, um ihnen die Hand zu geben. »Sie sind die Hausbesitzerin?«, fragte sie Julia.
»Ich habe das Anwesen erst vor Kurzem gekauft. Letzte Woche bin ich eingezogen.«
»Sie Glückliche«, erwiderte Petrie, und das schien sie tatsächlich ernst zu meinen.
»Wir haben die Erde gesiebt und sind dabei auf verschiedene Gegenstände gestoßen«, erklärte Dr. Isles. »Ein paar Knöpfe und eine verzierte Gürtelschnalle, alles eindeutig sehr alt.« Sie griff in eine Kiste, die neben den Gebeinen stand. »Und heute haben wir das hier gefunden.« Sie nahm einen kleinen verschließbaren Plastikbeutel heraus. Julia sah bunte Edelsteine durch die transparente Hülle schimmern.
»Das ist ein sogenannter Regard-Ring«, sagte Dr. Petrie. »Diese Art von Akrostichon-Schmuck war im frühen Viktorianischen Zeitalter der letzte Schrei. Die Anfangsbuchstaben der verschiedenen Steine bildeten ein Wort. Ein Rubin, ein Smaragd und ein Granat – ruby, emerald und garnet – ergaben zum Beispiel die ersten drei Buchstaben des Worts regard, also ›Hochachtung‹. Solche Ringe verschenkte man als Zeichen der Zuneigung.«
»Sind das echte Edelsteine?«
»O nein. Das ist wahrscheinlich nur farbiges Glas. Der Ring hat keine Gravur – das ist billiger Modeschmuck, Dutzendware.«
»Ob es wohl Aufzeichnungen über die Beisetzung gibt?«
»Das bezweifle ich. Mir scheint, dass es sich hier eher nicht um ein ordentliches Begräbnis handelt. Es gibt keinen Grabstein, keine Sargreste. Sie wurde einfach in ein Stück Leder gewickelt und verscharrt. Eine ziemlich respektlose Art, mit einer Verstorbenen umzugehen.«
»Vielleicht war sie arm.«
»Aber warum dann dieser spezielle Ort? Hier gab es nie einen Friedhof – jedenfalls ist auf den historischen Karten keiner verzeichnet. Ihr Haus ist rund hundert Jahre alt, nicht wahr?«
»Es wurde 1880 erbaut.«
»Regard-Ringe waren in den 1840er-Jahren schon aus der Mode gekommen.«
»Und was war hier vor 1840?«, fragte Julia.
»Soweit ich weiß, war das Grundstück Teil eines Landguts, das einer bedeutenden Bostoner Familie gehörte. Das meiste dürfte Weideland gewesen sein. Landwirtschaftliche Nutzflächen.«
Julia blickte den Hang hinauf, wo Schmetterlinge zwischen den Blüten der wilden Möhren und der Wicken umherflatterten. Sie versuchte, sich das Grundstück so vorzustellen, wie es damals ausgesehen hatte. Ein offenes Feld, das zu dem von Bäumen beschatteten Bach hin abfiel, ein paar grasende Schafe. Ein Ort, an dem sich normalerweise nur Tiere aufhielten. Ein Ort, wo ein Grab schnell in Vergessenheit geraten würde.
Vicky starrte mit angewiderter Miene auf die Knochen herab. »Ist das – ein Mensch?«
»Ein vollständiges Skelett«, antwortete Petrie. »Sie wurde tief genug begraben, um vor Tierfraß geschützt zu sein. An diesem Hang fließt das Wasser ganz gut ab. Und die Lederfragmente, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass sie in eine Art Tierhaut gehüllt war. Die ausgewaschenen Tannine dürften eine konservierende Wirkung gehabt haben.«
»Es war also eine Frau?«
»Ja.« Petrie blickte auf, die wachen blauen Augen in der grellen Sonne zusammengekniffen. »Es handelt sich um ein weibliches Skelett. Nach dem Zahnstatus und dem Zustand der Wirbel zu urteilen war sie noch recht jung, mit Sicherheit noch keine fünfunddreißig. Alles in allem ist sie erstaunlich gut erhalten.« Petrie sah Julia an. »Bis auf den Sprung, der von Ihrer Pflanzschaufel stammt.«
Julia errötete. »Ich habe den Schädel für einen Stein gehalten.«
»Es ist nicht schwierig, zwischen alten und neuen Frakturen zu unterscheiden. Sehen Sie.« Petrie ging wieder in die Hocke und nahm den Schädel in die Hand. »Der Sprung, den Sie verursacht haben, ist genau hier, und die Risse zeigen keinerlei Verfärbung. Aber sehen Sie die Fraktur hier, im Scheitelbein? Und da ist noch eine zweite im Jochbein, unter dem Auge. Diese Flächen sind vom langen Liegen in der Erde braun verfärbt. Das verrät uns, dass es sich um prämortale Frakturen handelt und nicht um Ausgrabungsschäden.«
»Prämortal?« Julia sah sie an. »Wollen Sie damit sagen …«
»Diese Schläge haben mit ziemlicher Sicherheit ihren Tod verursacht. Das war ein Mord, wenn Sie mich fragen.«
In der Nacht lag Julia wach, lauschte auf das Knarren der alten Böden, das Rascheln der Mäuse im Mauerwerk. So alt dieses Haus auch war, das Grab draußen war sogar noch älter. Während Arbeiter diese Balken zusammengehämmert, während sie die Kiefernholzböden verlegt hatten, war nur wenige Dutzend Schritte von hier die Leiche einer unbekannten Frau in der Erde verrottet. Hatten sie von ihrer Existenz gewusst, als sie beschlossen hatten, hier zu bauen? Hatte ein Stein das Grab markiert?
Oder wusste niemand, dass sie hier begraben war? Gab es niemanden, der sich an sie erinnerte?
Sie strampelte die Decke zur Seite und blieb schwitzend auf der Matratze liegen. Obwohl beide Fenster offen waren, war es stickig im Schlafzimmer; nicht der Hauch einer Brise, der die Hitze gelindert hätte. Ein Glühwürmchen blinkte in der Dunkelheit über ihr. Wie ein Irrlicht kreiste es durchs Zimmer und suchte verzweifelt zu entkommen.
Sie setzte sich im Bett auf und schaltete das Licht ein. Das magische Glimmen über ihr verwandelte sich schlagartig in einen gewöhnlichen braunen Käfer, der an der Decke umherflatterte. Sie überlegte, wie sie ihn fangen könnte, ohne ihn zu töten. Fragte sich, ob das Schicksal eines verirrten Insekts die Mühe wert war.
Das Telefon klingelte. Es gab nur einen Menschen, der sie abends um halb zwölf noch anrufen würde.
»Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt«, sagte Vicky. »Ich bin gerade erst von einem dieser endlosen Abendessen nach Hause gekommen.«
»Es ist sowieso zu heiß zum Schlafen.«
»Julia, da war noch etwas, was ich dir sagen wollte, als ich heute Mittag bei dir war. Aber vor all den Leuten konnte ich nicht darüber sprechen.«
»Keine Ratschläge mehr wegen des Hauses, okay?«
»Es geht nicht um das Haus. Es geht um Richard. Es ist mir total unangenehm, dass ich diejenige bin, die es dir beibringen muss, aber ich an deiner Stelle würde es wissen wollen. Du solltest es nicht über zehn Ecken erfahren.«
»Was denn?«
»Richard heiratet wieder.«
Julia umklammerte den Hörer, packte ihn so fest, dass ihre Finger taub wurden. In dem langen Schweigen, das folgte, hörte sie ihren eigenen pochenden Herzschlag in den Ohren.
»Du hast es also nicht gewusst.«
»Nein«, hauchte Julia.
»Der Kerl ist so ein Arschloch«, knurrte Vicky mit genug Bitterkeit für zwei. »Wie ich höre, ist es schon seit einem Monat geplant. Tiffani heißt sie – mit i. Noch kitschiger geht’s ja wohl kaum. Ich habe keine Spur Achtung übrig für einen Mann, der eine Tiffani heiratet.«
»Ich begreife nicht, wie das so schnell gehen konnte.«
»Oh, Schatz, das ist doch wohl offensichtlich, oder nicht? Er muss schon länger was mit ihr gehabt haben, als ihr noch verheiratet wart. Ist dir nie aufgefallen, dass er öfter mal spät nach Hause kam? Und dann waren da die ganzen Geschäftsreisen. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, etwas zu sagen.«
Julia schluckte. »Ich will jetzt nicht darüber reden.«
»Ich hätte es mir denken können. Ein Mann verlangt nicht einfach so aus heiterem Himmel die Scheidung.«
»Gute Nacht, Vicky.«
»Hey, alles in Ordnung?«
»Ich will einfach nicht reden.« Julia legte auf.
Lange saß sie regungslos da. Über ihrem Kopf kreiste immer noch das Glühwürmchen auf der Suche nach einem Ausweg aus seinem Gefängnis. Irgendwann würde es am Ende seiner Kräfte sein. Gefangen ohne Nahrung und ohne Wasser, würde es in diesem Zimmer sterben.
Sie stieg auf die Matratze. Als das Glühwürmchen auf sie zuschwirrte, fing sie es rasch ein. Mit dem Insekt in den hohlen Händen ging sie barfuß in die Küche und öffnete die Hintertür. Draußen auf der Veranda ließ sie das Glühwürmchen frei. Es flatterte in die Dunkelheit davon, ohne sein Licht noch einmal aufglimmen zu lassen, einzig und allein auf Flucht bedacht.
Wusste es, wer ihm das Leben gerettet hatte? Wenigstens eine winzige Kleinigkeit, die sie zustande gebracht hatte.
Sie blieb noch eine Weile auf der Veranda stehen und sog gierig die Nachtluft in ihre Lunge. Der Gedanke, in diese stickig-heiße Schlafkammer zurückzukehren, war ihr unerträglich.
Richard heiratete wieder.
Ihr Atem stockte und entwich dann in einem Schluchzen. Sie packte das Geländer und spürte, wie sich kleine Splitter in ihre Finger bohrten.
Und ich bin die Letzte, die es erfährt.
Sie starrte hinaus in die Nacht und dachte an die Gebeine, die nur wenige Dutzend Meter von hier verscharrt worden waren. Eine vergessene Frau, ihr Name verloren im Nebel der Jahrhunderte. Sie dachte an die kalte Erde, die auf ihr gelastet hatte, während oben die winterlichen Flocken wirbelten, den Wechsel der Jahreszeiten, Jahrzehnt um Jahrzehnt, das verstrich, während das Fleisch verrottete und die Würmer sich daran gütlich taten. Ich bin wie du: auch eine vergessene Frau, dachte sie.
Und ich weiß nicht einmal, wer du bist.
2
November 1830
Der Tod trat ein, begleitet von lieblichem Glockengeläut.
Rose Connolly hatte gelernt, diesen Klang zu fürchten; allzu oft hatte sie ihn schon gehört, wenn sie am Krankenbett ihrer Schwester saß, wenn sie Aurnias Stirn trocknete, ihr die Hand hielt oder ihr einen Schluck Wasser zu trinken gab. Tag für Tag kündigten diese verfluchten Glocken, geläutet von einem Ministranten, die Ankunft des Pfarrers im Krankensaal an, wo er die Kommunion austeilte und das Sakrament der Letzten Ölung spendete. Obgleich erst siebzehn Jahre alt, hatte Rose in den letzten fünf Tagen genug Tragödien für mehr als nur ein Menschenleben mit angesehen. Am Sonntag war Nora gestorben, drei Tage nachdem sie ihr Baby zur Welt gebracht hatte. Am Montag war es das Mädchen mit den braunen Haaren am anderen Ende des Krankensaals gewesen. So bald nach der Niederkunft war sie dem Fieber erlegen, dass Rose keine Gelegenheit gehabt hatte, ihren Namen in Erfahrung zu bringen – nicht, solange die Familie schluchzend am Bett der Toten stand, das Neugeborene schrie wie eine verbrühte Katze und der vielbeschäftigte Sargtischler im Hof hämmerte. Am Dienstag, nach vier Tagen Fieberqualen, die mit der Geburt eines Sohnes endeten, war Rebecca endlich von ihren Leiden erlöst worden, aber erst, nachdem Rose gezwungen worden war, den Gestank des fauligen Ausflusses einzuatmen, der zwischen den Beinen des Mädchens hervorsickerte und die Laken verkrustete. Der ganze Saal roch nach Schweiß, Fieber und Eitergeschwüren. Zu später Stunde, wenn das Stöhnen der Sterbenden durch die Korridore hallte, schreckte Rose oft aus ihrem Erschöpfungsschlaf hoch, nur um festzustellen, dass die Wirklichkeit noch entsetzlicher war als ihre Albträume. Nur wenn sie in den Hof des Krankenhauses hinaustrat und die kalte, neblige Luft tief einatmete, konnte sie den üblen Dünsten der Entbindungsstation entfliehen.
Aber immer wieder musste sie an den Ort des Schreckens zurückkehren. Zu ihrer Schwester.
»Schon wieder die Glocken«, flüsterte Aurnia, und ihre eingefallenen Lider flatterten. »Welche arme Seele ist es diesmal?«
Rose blickte zum anderen Ende der Entbindungsstation, wo man hastig einen Vorhang um eines der Betten gezogen hatte. Vor wenigen Augenblicken hatte sie beobachtet, wie Schwester Mary Robinson den kleinen Tisch vorbereitet und Kerzen und Kruzifix bereitgestellt hatte. Obwohl sie den Pfarrer nicht sehen konnte, hörte sie sein Gemurmel hinter dem Vorhang, und sie konnte das heiße Kerzenwachs riechen.
»Durch die große Güte Seiner Gnade möge der Herr dir alle Sünden vergeben, die du begangen …«
»Wer?«, fragte Aurnia wieder. Voller Unruhe versuchte sie sich aufzusetzen und über die Reihe von Betten hinwegzusehen.
»Ich fürchte, es ist Bernadette«, sagte Rose.
»Oh! Oh, nein!«
Rose drückte die Hand ihrer Schwester. »Sie kann immer noch durchkommen. Hab ein wenig Hoffnung.«
»Das Kind! Was ist mit ihrem Kind?«
»Der Junge ist gesund. Hast du ihn nicht heute Morgen in seinem Bettchen schreien hören?«
Aurnia ließ sich seufzend auf das Kopfkissen zurücksinken, und der Atem, der ihrem Mund entströmte, trug den üblen Geruch des Todes in sich, als ob ihr Körper bereits von innen her verfaulte, ihre Organe sich zersetzten. »Nun, das ist immerhin ein kleiner Segen.«
Ein Segen? Dass der Junge als Waise aufwachsen würde? Dass seine Mutter die letzten drei Tage unentwegt vor Schmerzen gewimmert hatte, mit ihrem vom Kindbettfieber aufgetriebenen Bauch? Rose hatte in den letzten sieben Tagen viel zu viele Beispiele solchen Segens zu Gesicht bekommen. Wenn das ein Zeichen Seiner Güte war, dann wollte sie mit Ihm nichts zu schaffen haben. Aber solche blasphemischen Gedanken sprach sie in Gegenwart ihrer Schwester nicht aus. Es war der Glaube, der Aurnia in den vergangenen Monaten Kraft gegeben, der ihr geholfen hatte, die Nächte durchzustehen, wenn Rose sie hinter der Decke, die zwischen ihren Betten aufgehängt war, leise hatte weinen hören. Aber was hatte ihr Glaube der armen Aurnia letztlich genutzt? Wo war Gott in diesen Tagen, da Aurnia sich vergeblich quälte, um ihr erstes Kind zur Welt zu bringen?
Wenn du die Gebete einer guten Frau hörst, Gott, warum lässt du sie dann leiden?
Rose erwartete keine Antwort, und sie bekam keine. Alles, was sie hörte, war das nutzlose Gemurmel des Pfarrers hinter dem Vorhang, der Bernadettes Bett abschirmte.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, möge alle Macht des Teufels in dir ausgelöscht sein, durch das Auflegen meiner Hände und durch die Anrufung der glorreichen und heiligen Jungfrau Maria, Mutter Gottes …«
»Rose?«, flüsterte Aurnia.
»Ja, mein Herz?«
»Ich fürchte sehr, dass auch für mich die Zeit gekommen ist.«
»Die Zeit wofür?«
»Für den Pfarrer. Die Beichte.«
»Und welche kleinen Sünden können dich denn wohl plagen? Gott kennt deine Seele, mein Herz. Denkst du, Er sieht nicht, wie gut du bist?«
»Ach Rose, du weißt ja nicht, was ich mir alles habe zuschulden kommen lassen! So vieles, was ich mich schäme, dir zu sagen! Ich kann nicht sterben, ohne …«
»Red mir nicht vom Sterben. Du darfst nicht aufgeben. Du musst kämpfen.«
Aurnia antwortete mit einem matten Lächeln und hob die Hand, um ihrer Schwester übers Haar zu streichen. »Meine kleine Rosie. Dir hat man noch nie so leicht Angst machen können.«
Aber Rose hatte Angst. Schreckliche Angst, dass ihre Schwester sie verlassen würde. Panische Angst, dass Aurnia, wenn sie einmal den letzten Segen erhalten hätte, den Kampf aufgeben und sich in ihr Schicksal fügen würde.
Aurnia schloss die Augen und seufzte. »Wirst du heute Nacht wieder bei mir bleiben?«
»Ganz bestimmt werde ich das.«
»Und Eben? Ist er nicht gekommen?«
Roses Finger krampften sich um Aurnias Hand. »Willst du ihn wirklich hier haben?«
»Wir sind einen heiligen Bund eingegangen, er und ich. In guten wie in schlechten Tagen.«
Meistens in schlechten, hätte Rose am liebsten gesagt, doch sie hütete ihre Zunge. Eben und Aurnia mochten ein Ehepaar sein, aber es war besser, wenn er sich hier nicht blicken ließ, denn Rose fand die Gegenwart dieses Mannes schier unerträglich. Die letzten vier Monate hatte sie mit Aurnia und Eben in einem Logierhaus in der Broad Street gewohnt, wo Rose ihr Lager in einem winzigen Alkoven hatte, der an das Schlafzimmer der beiden grenzte. Sie hatte versucht, Eben aus dem Weg zu gehen, doch nachdem Aurnia durch die Schwangerschaft schwerfällig und müde geworden war, hatte Rose mehr und mehr von den Pflichten ihrer Schwester in Ebens Schneiderwerkstatt übernommen. Im engen Hinterzimmer der Werkstatt, zwischen Ballen von Musselin und Wolltuch, hatte sie die verstohlenen Blicke ihres Schwagers aufgefangen, und ihr war nicht entgangen, wie oft er scheinbar zufällig ihre Schulter streifte oder allzu dicht hinter ihr stand, um ihre Stiche zu begutachten, wenn sie sich mit dem Nähen von Hosen und Westen abplagte. Sie hatte Aurnia nichts davon erzählt, denn sie wusste, dass Eben alles leugnen würde. Und am Ende wäre es doch nur Aurnia, die darunter zu leiden hätte.
Rose wrang einen Lappen über der Schüssel aus, und als sie ihn auf Aurnias Stirn drückte, fragte sie sich: Wo ist meine schöne Schwester geblieben? Nach nicht einmal einem Jahr Ehe war das Licht in Aurnias Augen schon erloschen, der Glanz ihres feuerroten Haars verblasst. Geblieben war nur diese teilnahmslose Hülse, das Haar von Schweiß verfilzt, das Gesicht eine stumpfe Maske der Resignation.
Kraftlos zog Aurnia ihren Arm unter der Decke hervor. »Ich möchte dir das hier schenken«, hauchte sie. »Nimm es jetzt, bevor Eben es sich nimmt.«
»Was denn, mein Herz?«
»Das.« Aurnia berührte das herzförmige Medaillon, das sie um den Hals trug. Es hatte den unverkennbaren Glanz von echtem Gold, und Aurnia trug es Tag und Nacht. Ein Geschenk von Eben, nahm Rose an. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte seine Frau ihm immerhin so viel bedeutet, dass er ihr dieses ausgefallene Schmuckstück geschenkt hatte. Warum war er jetzt nicht hier, da sie ihn am meisten brauchte?
»Bitte. Hilf mir, es abzunehmen.«
»Behalt es – es ist noch nicht an der Zeit, es herzugeben«, sagte Rose.
Aber Aurnia hatte sich schon selbst das Halsband abgezogen und drückte ihrer Schwester das Medaillon in die Hand. »Es gehört dir. Als Dank für all den Trost, den du mir gespendet hast.«
»Ich werde es für dich aufbewahren, das ist alles.« Rose steckte das Schmuckstück in ihre Tasche. »Wenn das alles überstanden ist, wenn du dein süßes kleines Baby im Arm hältst, werde ich es dir wieder um den Hals legen.«
Aurnia lächelte. »Ach, könnte es nur so sein.«
»Es wird so sein.«
Das leiser werdende Klingen der Glocken zeigte an, dass der Pfarrer seine Riten für die sterbende Bernadette beendet hatte. Rasch eilte Schwester Robinson herbei, um den Vorhang beiseitezuziehen, denn die nächste Gruppe von Besuchern war soeben eingetroffen.
Erwartungsvolles Schweigen breitete sich aus, als Dr. Chester Crouch die Entbindungsstation betrat. Heute wurde Dr. Crouch von Miss Agnes Poole begleitet, der Oberschwester des Krankenhauses, sowie von einer Entourage aus vier Medizinstudenten. Dr. Crouch begann seine Visite am ersten Bett, bei einer Frau, die erst an diesem Morgen eingeliefert worden war, nach zwei Tagen fruchtloser Wehen zu Hause. Die Studenten standen im Halbkreis und sahen zu, wie Dr. Crouch den Arm unter die Bettdecke schob, um die Patientin diskret zu untersuchen. Sie stieß einen Schmerzensschrei aus, als seine Hand tief zwischen ihre Schenkel eindrang. Als er sie wieder hervorzog, waren die Finger blutverschmiert.
»Handtuch!«, kommandierte er, und Schwester Poole reichte ihm prompt das Verlangte. Während er sich die Hand abwischte, sagte er zu den vier Studenten: »Diese Patientin macht keine Fortschritte. Die Lage des Kindskopfes ist unverändert, und die Cervix hat sich nicht vollständig geöffnet. Wie sollte ihr Arzt in diesem Fall verfahren? Sie, Mr. Kingston! Haben Sie eine Antwort?«
Mr. Kingston, ein gut aussehender und elegant gekleideter junger Mann, antwortete ohne Zögern: »Ich denke, dass hier Mutterkorn in Souchong-Tee zu empfehlen wäre.«
»Gut. Was könnte man sonst noch tun?« Er fixierte den kleinsten der vier Studenten, einen Burschen von koboldhafter Erscheinung, wozu nicht zuletzt die großen Ohren beitrugen. »Mr. Holmes?«
»Man könnte es mit einem Abführmittel versuchen, um die Wehen zu fördern.«
»Gut. Und Sie, Mr. Lackaway?« Dr. Crouch wandte sich an einen Mann mit blondem Haar, dessen Gesicht augenblicklich feuerrot anlief. »Was könnte noch getan werden?«
»Ich – also …«
»Das ist Ihre Patientin. Wie werden Sie vorgehen?«
»Ich würde darüber nachdenken müssen.«
»Darüber nachdenken? Ihr Großvater und Ihr Vater waren beide Ärzte! Ihr Onkel ist Dekan des Boston Medical College. Sie sind intensiver mit der Heilkunst in Berührung gekommen als irgendeiner Ihrer Kommilitonen. Ich bitte Sie, Mr. Lackaway! Haben Sie denn gar nichts beizutragen?«
Hilflos schüttelte der junge Mann den Kopf. »Es tut mir leid, Sir.«
Seufzend wandte sich Dr. Crouch an den vierten Studenten, einen großen, dunkelhaarigen jungen Mann. »Dann sind Sie jetzt an der Reihe, Mr. Marshall. Was könnte in dieser Situation noch unternommen werden? Eine Patientin in den Wehen, die keine Fortschritte macht?«
»Ich würde sie dazu ermuntern, sich aufzusetzen und aufzustehen«, erwiderte der Student. »Und, wenn Sie dazu in der Lage ist, im Saal auf und ab zu gehen.«
»Was noch?«
»Das ist die einzige zusätzliche Maßnahme, die mir angemessen erscheint.«
»Und was halten Sie davon, die Patientin zur Ader zu lassen?
Eine Pause. Und dann die bedächtige Antwort: »Von der Wirksamkeit dieser Behandlung bin ich nicht überzeugt.«
Dr. Crouch lachte verblüfft auf. »Sie – Sie sind nicht überzeugt?«
»Auf der Farm, auf der ich aufgewachsen bin, habe ich mit Aderlass experimentiert, und auch mit Schröpfen. Ich habe mit diesen Maßnahmen genauso viele Kälber verloren wie ohne sie.«
»Auf der Farm? Sie sprechen von Aderlass bei Kühen?«
»Und Schweinen.«
Schwester Agnes Poole kicherte.
»Wir haben es hier mit Menschen zu tun, nicht mit Vieh, Mr. Marshall«, sagte Dr. Crouch. »Nach meiner Erfahrung ist ein therapeutischer Aderlass äußerst wirksam als schmerzstillende Maßnahme. Er sorgt dafür, dass die Patientin sich so weit entspannt, dass der Muttermund sich richtig öffnen kann. Wenn das Mutterkorn und das Abführmittel nicht wirken, werde ich diese Patientin ganz sicher zur Ader lassen.« Er gab Schwester Poole das schmutzige Handtuch zurück und ging weiter zu Bernadettes Bett. »Und diese hier?«, fragte er.
»Ihr Fieber ist zwar abgeflaut«, antwortete Schwester Poole, »aber der Ausfluss ist jetzt sehr übel riechend. Sie hat die Nacht unter großen Schmerzen zugebracht.«
Wieder langte Dr. Crouch unter die Decke, um die inneren Organe abzutasten. Bernadette ließ ein schwaches Stöhnen hören. »Ja, ihre Haut ist ganz kühl«, pflichtete er bei. »Aber in diesem Fall …« Er brach ab und blickte auf. »Sie hat Morphium bekommen?«
»Mehrmals, Sir. Wie Sie angeordnet haben.«
Er zog die Hand unter der Bettdecke hervor. Gelblicher Schleim glitzerte auf seinen Fingern, und die Schwester reichte ihm wieder das Handtuch. »Setzen Sie die Morphiumgaben fort«, sagte er leise. »Versuchen Sie Ihre Beschwerden zu lindern.« Er hätte sie ebenso gut gleich für tot erklären können.
Bett für Bett, Patientin für Patientin, arbeitete Dr. Crouch sich vor. Als er schließlich an Aurnias Bett trat, war das Tuch, mit dem er sich jedes Mal die Hände abgewischt hatte, mit Blut getränkt.
Rose stand auf, um ihn zu begrüßen. »Dr. Crouch.«
Er sah sie stirnrunzelnd an. »Sie sind Miss …«
»Connolly«, sagte Rose, und sie fragte sich, wie es sein konnte, dass dieser Mann sich nicht an ihren Namen erinnerte. Sie war es gewesen, die ihn in das Logierhaus gerufen hatte, wo Aurnia einen Tag und eine Nacht in den Wehen gelegen hatte, ohne dass sich etwas tat. Rose hatte bei jedem von Crouchs Besuchen am Bett ihrer Schwester gesessen, doch stets hatte er sie so verwirrt angeschaut, als sähe er sie zum ersten Mal. Allerdings sah er Rose auch nicht wirklich an; sie war nur eine unbedeutende Weibsperson, die keinen zweiten Blick wert war.
Er wandte seine Aufmerksamkeit Schwester Poole zu. »Und welche Fortschritte macht diese Patientin?«
»Ich glaube, die tägliche Dosis Abführmittel, die Sie ihr gestern Abend verschrieben haben, hat die Qualität ihrer Wehen verbessert. Aber sie hat sich nicht an Ihre Anweisung gehalten, aus dem Bett aufzustehen und im Saal umherzugehen.«
Rose starrte Schwester Poole an; nur mit Mühe konnte sie ihre Zunge im Zaum halten. Im Saal umhergehen? Hatten sie denn alle den Verstand verloren? Über die letzten fünf Tage hatte Rose mit angesehen, wie Aurnia immer schwächer geworden war. Miss Poole musste doch erkennen, dass Roses Schwester sich kaum noch aufsetzen konnte, geschweige denn gehen. Aber die Schwester sah Aurnia überhaupt nicht an; ihr ehrfürchtiger Blick ruhte auf Dr. Crouch, der nun die Hand unter die Bettdecke schob. Als er den Geburtskanal untersuchte, stöhnte Aurnia so gequält auf, dass Rose sich beherrschen musste, um ihn nicht von ihr fortzuzerren.
Er richtete sich auf und sah Schwester Poole an. »Die Fruchtblase ist zwar geplatzt, aber der Muttermund ist noch nicht gänzlich geöffnet.« Er trocknete seine Hand an dem verschmierten Handtuch ab. »Der wievielte Tag ist es?«
»Heute ist der fünfte«, antwortete Schwester Poole.
»Dann ist es vielleicht Zeit für eine weitere Dosis Mutterkorn.« Er griff nach Aurnias Handgelenk und fühlte ihren Puls. »Ihr Herzschlag ist beschleunigt. Und sie macht heute einen etwas fiebrigen Eindruck. Ein Aderlass dürfte den Organismus abkühlen.«
Schwester Poole nickte. »Ich hole die …«
»Sie haben Sie schon genug zur Ader gelassen«, fuhr Rose dazwischen.
Alles verstummte. Dr. Crouch blickte sichtlich verblüfft zu ihr auf. »Wie sind Sie noch mal mit ihr verwandt?«
»Ich bin ihre Schwester. Ich war hier, als Sie sie das erste Mal zur Ader gelassen haben, Dr. Crouch. Und beim zweiten Mal und beim dritten Mal auch.«
»Und Sie können sehen, wie gut es ihr getan hat«, sagte Schwester Poole.
»Ich kann Ihnen sagen, dass es ihr nicht gutgetan hat.«
»Weil Sie keine medizinische Ausbildung haben, Kind! Sie wissen nicht, worauf Sie achten müssen.«
»Wünschen Sie nun, dass ich sie behandle, oder nicht?«, fragte Dr. Crouch gereizt.
»Doch, Sir, aber Sie sollen sie nicht ausbluten!«
Schwester Poole sagte mit eisiger Stimme: »Entweder Sie sind jetzt still, Miss Connolly, oder Sie verlassen die Station! Und lassen Sie den Doktor tun, was notwendig ist.«
»Ich habe heute ohnehin keine Zeit, sie zur Ader zu lassen.« Dr. Crouch sah demonstrativ auf seine Taschenuhr. »Ich habe in einer Stunde einen Termin, und danach muss ich meine Vorlesung vorbereiten. Ich werde gleich morgen früh noch einmal nach der Patientin sehen. Vielleicht wird bis dahin auch Miss, äh …«
»Connolly«, sagte Rose.
»Vielleicht wird bis dahin auch Miss Connolly eingesehen haben, dass eine weitere Behandlung tatsächlich notwendig ist.« Er klappte die Uhr zu. »Meine Herren, wir sehen uns zur Morgenvorlesung um Punkt neun Uhr. Gute Nacht.« Er nickte und wandte sich zum Gehen. Als er davonstolzierte, folgten ihm die vier Medizinstudenten wie gehorsame Entlein.
Rose lief ihnen nach. »Sir? Mr. Marshall, nicht wahr?«
Der größte der Studenten drehte sich um. Es war der dunkelhaarige junge Mann, der zuvor bezweifelt hatte, dass es klug sei, eine Frau in den Wehen zur Ader zu lassen; der Student, der gesagt hatte, er sei auf einer Farm aufgewachsen. Sie musste nur einen Blick auf seinen schlecht sitzenden Anzug werfen, um zu wissen, dass er tatsächlich aus bescheideneren Verhältnissen stammte als seine Kommilitonen. Sie war schon lange genug Näherin, um einen guten Stoff zu erkennen, und sein Anzug war von minderer Qualität, der Wollstoff stumpf und formlos, ohne den Glanz, der feineres Tuch auszeichnete. Während seine Kommilitonen weiter dem Ausgang zustrebten, blieb Mr. Marshall stehen und sah Rose erwartungsvoll an. Er hat müde Augen, dachte sie, und für einen so jungen Mann sieht er sehr abgekämpft aus. Anders als die anderen blickte er ihr offen ins Gesicht, als ob er sie als seinesgleichen betrachtete.
»Ich habe notgedrungen mit angehört, was Sie zu dem Doktor gesagt haben«, begann sie. »Über den Aderlass.«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe mir zu viel herausgenommen, fürchte ich.«
»Aber ist es denn wahr? Was Sie gesagt haben?«
»Ich habe nur meine Beobachtungen geschildert.«
»Und habe ich unrecht, Sir? Sollte ich ihm gestatten, meine Schwester zur Ader zu lassen?«
Er zögerte. Nervös blickte er sich zu Schwester Poole um, die die beiden mit sichtlicher Missbilligung beobachtete. »Ich bin nicht qualifiziert, Ihnen einen Rat zu geben. Ich bin nur ein Student im ersten Semester. Dr. Crouch ist mein Professor, und er ist ein ausgezeichneter Arzt.«
»Ich habe dreimal mit angesehen, wie er sie zur Ader gelassen hat, und jedes Mal haben er und die Schwestern behauptet, ihr Zustand hätte sich gebessert. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe keinerlei Verbesserung. Jeden Tag sehe ich nur …« Sie brach ab; ihre Stimme versagte, und sie musste gegen die Tränen ankämpfen. Leise fuhr sie fort: »Ich will doch nur das Beste für Aurnia.«
Schwester Poole mischte sich ein: »Sie fragen einen Medizinstudenten? Glauben Sie, er weiß es besser als Dr. Crouch?« Sie schnaubte verächtlich. »Da können Sie ebenso gut einen Stallburschen fragen«, sagte sie und rauschte aus dem Krankensaal.
Mr. Marshall schwieg eine Weile. Erst als Schwester Poole den Saal verlassen hatte, sprach er weiter, und seine Worte, so freundlich sie waren, bestätigten Roses schlimmste Befürchtungen.
»Ich würde sie nicht zur Ader lassen«, sagte er leise. »Es würde nichts nützen.«
»Was würden Sie denn tun? Wenn sie Ihre eigene Schwester wäre?«
Der Blick des jungen Mannes ruhte bedauernd auf der schlafenden Aurnia. »Ich würde ihr helfen, sich im Bett aufzusetzen. Ihr kalte Kompressen gegen das Fieber auflegen und gegen die Schmerzen Morphium geben. Ich würde vor allem dafür sorgen, dass sie genug Nahrung und Flüssigkeit bekommt. Und Trost, Miss Connolly. Wenn ich eine Schwester hätte, die so leidet, wäre es das, was ich ihr geben würde.« Er sah Rose an. »Trost und Beistand«, sagte er traurig und ging davon.
Rose wischte sich die Tränen ab und ging zurück zu Aurnias Bett, vorbei an einer Frau, die sich in eine Schüssel erbrach, an einer anderen, deren Bein von der Wundrose rot und geschwollen war. Frauen in den Wehen, Frauen, die furchtbare Schmerzen litten. Draußen fiel der kalte Novemberregen, aber hier drinnen, wo bei geschlossenen Fenstern der Holzofen brannte, war die Luft dumpf und stickig und voll übler Krankheitsdünste.
War es ein Fehler gewesen, sie hierherzubringen?, fragte sich Rose. Hätte ich sie lieber zu Hause behalten sollen, wo sie nicht die ganze Nacht dieses furchtbare Stöhnen, dieses klägliche Gewimmer hören müsste? Das Zimmer in ihrem Logierhaus war eng und kalt, und Dr. Crouch hatte dazu geraten, Aurnia ins Krankenhaus zu verlegen, wo er sich besser um sie kümmern könne. »Für Wohlfahrtsfälle, wie Ihre Schwester einer ist«, hatte er gesagt, »betragen die Kosten nur so viel, wie Ihre Familie aufbringen kann.« Warme Mahlzeiten, ein Stab von Schwestern und Ärzten, die für sie sorgten – all das würde auf sie warten, hatte Dr. Crouch ihnen versichert.
Aber nicht das hier, dachte Rose, als sie die Reihe von leidenden Frauen betrachtete. Ihr Blick blieb an Bernadette haften, die jetzt still und stumm dalag. Langsam trat Rose an das Bett und starrte auf die junge Frau, die erst vor fünf Tagen lachend ihren neugeborenen Sohn im Arm gehalten hatte.
Bernadette hatte aufgehört zu atmen.
3
»Will dieser verfluchte Regen denn gar nicht mehr aufhören?«, rief Edward Kingston und starrte hinaus in den Wolkenbruch.
Wendell Holmes hauchte einen Ring Zigarrenrauch aus, der unter dem Vordach des Krankenhauseingangs hervorquoll und sich im Regen in dünne Kringel auflöste. »Wieso diese Ungeduld? Man könnte meinen, du hättest eine dringende Verabredung.«
»Habe ich auch. Mit einem Glas vom allerbesten Bordeaux.«
»Gehen wir in den Hurricane?«, fragte Charles Lackaway.
»Falls meine Kutsche sich irgendwann blicken lässt.« Edward blickte finster auf die Straße hinaus, wo Pferdehufe klapperten und Kutschen vorüberrollten, von deren Rädern der Matsch in Klumpen aufspritzte.
Obwohl Norris Marshall zusammen mit den anderen auf der Veranda stand, wäre die Kluft zwischen ihm und seinen Kommilitonen für jeden, der auch nur einen flüchtigen Blick auf die vier jungen Männer warf, offensichtlich gewesen. Norris war neu in Boston, ein Farmerssohn aus Belmont, der sich mit geborgten Lehrbüchern selbst Physik beigebracht hatte, der Eier und Milch gegen Privatstunden bei einem Lateinlehrer eingetauscht hatte. Er war noch nie im Hurricane gewesen; er wusste nicht einmal, wo die Schenke war. Seine Kommilitonen, allesamt Absolventen des Harvard College, tauschten den neuesten Klatsch über Leute aus, die er nicht kannte; sie lachten über Witze, die er nicht verstand; und wenn sie es nicht offen darauf anlegten, ihn auszuschließen, dann nur, weil es gar nicht nötig war. Es verstand sich von selbst, dass er nicht zu ihrem gesellschaftlichen Kreis gehörte.
Edward seufzte und stieß dabei eine Rauchwolke aus. »Unerhört, wie dieses Mädchen mit Dr. Crouch geredet hat, findet ihr nicht? Diese Unverfrorenheit! Wenn eins von den Mädchen in unserem Haushalt so zu reden wagte, würde meine Mutter sie mit einem Tritt auf die Straße befördern!«
»Deine Mutter«, bemerkte Charles in ehrfürchtigem Ton, »jagt mir gehörigen Respekt ein.«
»Mutter sagt, es ist wichtig, den Iren ihre Schranken zu zeigen. Nur so kann die Ordnung gewahrt werden, bei den ganzen Zuzüglern, die jetzt die Stadt überschwemmen und nichts als Ärger machen.«
Zuzügler. Norris war einer von ihnen.
»Die Bridgets sind die schlimmsten. Diese Irenweiber kannst du nicht eine Minute aus den Augen lassen, sonst stehlen sie dir die Hemden geradewegs aus dem Schrank. Und wenn du dann feststellst, dass etwas fehlt, behaupten sie, es wäre in der Wäsche verloren gegangen oder der Hund hätte es gefressen.« Edward schnaubte verächtlich. »Ein Mädchen wie die da muss erst mal lernen, was sich gehört.«
»Ihre Schwester liegt vielleicht im Sterben«, bemerkte Norris.
Die drei Harvard-Absolventen drehten sich um, offensichtlich überrascht, dass ihr sonst so schweigsamer Kommilitone sich zu Wort meldete.
»Im Sterben? Das ist eine ziemlich dramatische Behauptung«, meinte Edward.
»Fünf Tage in den Wehen, und sie sieht jetzt schon aus wie eine Leiche. Dr. Crouch kann sie so viel zur Ader lassen, wie er will, aber es sieht nicht gut für sie aus. Die Schwester weiß es. Aus ihr spricht der Kummer.«
»Trotzdem sollte sie nicht vergessen, wer ihr Wohltäter ist.«
»Und ihm für jeden Krümel dankbar sein?«
»Dr. Crouch ist keineswegs dazu verpflichtet, die Frau zu behandeln. Und doch tut die Schwester so, als sei es ihr gutes Recht.« Edward drückte sine Zigarre auf dem frisch gestrichenen Geländer aus. »Ein bisschen Dankbarkeit würde diese Leute schon nicht umbringen.«
Norris spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Er wollte eben zu einer scharfen Erwiderung ansetzten, als Wendell das Gespräch elegant auf ein anderes Thema lenkte.
»Ich glaube, da ließe sich ein Gedicht draus machen, findet ihr nicht? ›Das unerschrockene Irenmädchen‹.«
Edward seufzte. »Bitte nicht. Verschone uns mit deinen scheußlichen Versen.«
»Oder wie wär’s mit diesem Titel«, warf Charles ein. »›Ode an eine treue Schwester‹?«
»Gar nicht übel!«, meinte Wendell. »Mal sehen.« Er hielt inne. »Hier steht die tapf’re Kriegerin, die treue, schöne Maid …«
»Der Schwester Leben gilt die Schlacht«, dichtete Charles weiter.
»Sie – sie …« Wendell grübelte über den nächsten Vers des Gedichts nach.
»… wacht, allzeit bereit!«, endete Charles.
Wendell lachte. »Und wieder triumphiert die Poesie!«
»Während wir anderen leiden«, brummte Edward.
Norris hörte sich das alles mit dem quälenden Unbehagen des Außenseiters an. Wie ungezwungen seine Kommilitonen miteinander lachten. Wie wenig es bedurfte – nur ein paar Zeilen eines Stegreif-Gedichts –, um ihn daran zu erinnern, dass diese drei einer Welt entstammten, zu der er keinen Zugang hatte.
Wendell richtete sich plötzlich auf und spähte hinaus in den Regen. »Das ist doch deine Kutsche, nicht wahr, Edward?«
»Wurde aber auch allerhöchste Zeit.« Edward klappte den Kragen hoch, um sich vor dem Wind zu schützen. »Gehen wir, meine Herren?«
Norris’ drei Kommilitonen eilten die Verandastufen hinunter. Edward und Charles patschten über das nasse Pflaster und kletterten in die Kutsche. Doch Wendell zögerte und blickte sich zu Norris um. Dann machte er kehrt und kam wieder die Stufen herauf.
»Willst du uns nicht Gesellschaft leisten?«, fragte Wendell.
Norris war so verblüfft über die Einladung, dass er nicht sofort antwortete. Obwohl er fast einen ganzen Kopf größer war als Wendell Holmes, gab es doch so manches, was ihn an diesem zierlichen Mann einschüchterte. Und es waren nicht nur Wendells elegante Anzüge oder seine berühmte Schlagfertigkeit, es war auch seine scheinbar unerschütterliche Selbstsicherheit. Dass dieser Mann ihn einlud, sich ihnen anzuschließen, darauf war Norris nicht vorbereitet gewesen.
»Wendell!«, rief Edward aus dem Kutschenfenster. »Wir fahren!«
»Wir gehen in den Hurricane«, sagte Holmes. »Da zieht es uns abends regelmäßig hin.« Er hielt inne. »Oder hast du schon etwas anderes vor?«
»Das ist wirklich sehr freundlich.« Norris’ Blick ging zu den beiden Männern, die in der Kutsche warteten. »Aber ich glaube nicht, dass Mr. Kingston einen vierten Gast erwartet hat.«
»Mr. Kingston«, erwiderte Wendell lachend, »täte es ganz gut, wenn ihm öfter einmal etwas Unerwartetes widerführe. Aber es ist ja auch nicht er, der sie einlädt. Sondern ich. Also, kommst du nun mit auf eine Runde Rum-Flip?«
Norris sah hinaus in den Regen, der immer noch in Strömen fiel, und dachte sehnsüchtig an das wärmende Feuer, das im Hurricane gewiss brennen würde. Und noch mehr lockte ihn die Gelegenheit, die ihm soeben eröffnet worden war – die Chance, in den Kreis seiner Kommilitonen aufgenommen zu werden, einer von ihnen zu sein, und sei es auch nur für diesen Abend. Er spürte, wie Wendell ihn beobachtete. Diese Augen, in denen sonst der Schalk zu blitzen pflegte, hinter denen immer schon die nächste geistreiche Bemerkung zu lauern schien, diese Augen hatten plötzlich etwas unangenehm Durchdringendes.
»Wendell!« Jetzt war es Charles, der von der Kutsche aus rief, die Stimme zu einem ungehaltenen Quäken erhoben. »Wir erfrieren hier noch!«
»Es tut mir leid«, sagte Norris. »Ich fürchte, ich bin heute Abend schon anderweitig verpflichtet.«
»Oh?« Wendell zog eine Braue hoch und musterte ihn schelmisch. »Es handelt sich gewiss um eine ganz reizende Alternative.«
»Es ist keine Dame, fürchte ich. Aber es ist eine Verpflichtung, der ich mich unmöglich entziehen kann.«
»Verstehe«, sagte Wendell, auch wenn er ganz offensichtlich nicht verstand, denn sein Lächeln war abgekühlt, und er wandte sich bereits zum Gehen.
»Es ist nicht so, als würde ich nicht gerne …«
»Ist schon in Ordnung. Ein andermal vielleicht.«
Es wird kein anderes Mal geben, dachte Norris. Er sah Wendell nach, wie er eilig über die Straße lief und zu seinen beiden Gefährten in die Kutsche stieg. Der Kutscher ließ die Peitsche schnalzen, und sie fuhren los. Wasser spritzte auf, als die Räder durch die Pfützen rollten. Norris malte sich die Unterhaltung aus, die sich bald unter den drei Freunden in dieser Kutsche entspinnen würde. Ungläubiges Staunen darüber, dass ein einfacher Farmersbursche aus Belmont es gewagt hatte, die Einladung auszuschlagen. Spekulationen darüber, was das für eine Verpflichtung sein mochte, die so wichtig war, dass er ihr den Vorzug gab – wenn nicht eine Verabredung mit einer Vertreterin des schönen Geschlechts. Norris stand auf der Veranda, die Finger um das Geländer gekrampft, voll Bitterkeit über all das, was er nicht ändern konnte, über all das, was ihm für immer verwehrt bleiben würde.
Edward Kingstons Kutsche verschwand um die Ecke, mit den drei Männern, auf die ein warmes Feuer und ein geselliger Abend mit angeregten Gesprächen und geistigen Getränken warteten. Während sie in der warmen Stube des Hurricane sitzen, dachte Norris, werde ich einer gänzlich anderen Beschäftigung nachgehen. Einer Beschäftigung, auf die ich liebend gerne verzichten würde, wenn ich nur könnte.
Er gab sich einen Ruck und trat hinaus in die Kälte und den strömenden Regen. Entschlossen stapfte er durch die Pfützen zu seiner Unterkunft, wo er rasch in alte Kleider schlüpfen würde, um sich dann noch einmal in den Regen hinauszuwagen.
Sein Ziel war eine Schenke in der Broad Street, nicht weit vom Hafen. Hier traf man keine elegant gekleideten Harvard-Zöglinge, die an ihrem Rum-Flip nippten. Sollte ein Gentleman sich zufällig in das Black Spar verirren, würde er sich nur einmal kurz umsehen müssen, um zu wissen, dass es ratsam wäre, ein Auge auf seine Geldbörse zu haben. Norris hatte an diesem Abend kaum etwas von Wert in seinen Taschen – wie übrigens auch an jedem anderen Abend; sein schäbiger Mantel und seine schlammbespritzten Hosen würden gewiss keinen Taschendieb hinter dem Ofen hervorlocken. Er kannte schon einige der Stammgäste, und sie wussten um seine ärmlichen Verhältnisse; so hoben sie nur kurz die Köpfe, als er eintrat. Ein Blick, um zu sehen, wer da gekommen war, und schon stierten alle wieder in ihre Gläser.
Norris trat an die Theke, wo die mondgesichtige Fanny Burke stand und Bier zapfte. Sie fixierte ihn mit ihren kleinen, bösen Augen. »Du bist spät dran, und er hat üble Laune.«
»Fanny!«, grölte einer der Gäste. »Kriegen wir diese Woche noch was zu trinken oder nicht?«
Die Frau trug die Gläser zum Tisch und knallte sie vor die Gäste hin. Nachdem sie das Geld eingesteckt hatte, machte sie kehrt und zog sich wieder hinter den Schanktisch zurück. »Er ist hinten im Hof, mit dem Wagen«, sagte sie zu Norris. »Er wartet schon auf dich.«
Norris hatte keine Zeit gehabt, etwas zu essen, und er beäugte hungrig den Brotlaib, den sie hinter dem Schanktisch aufbewahrte. Doch er machte gar nicht erst den Versuch, sie um eine Scheibe anzubetteln. Bei Fanny Burke gab es nichts umsonst, nicht einmal ein Lächeln. Mit knurrendem Magen stieß er eine Tür auf, durchquerte den dunklen, mit Kisten und Gerümpel vollgestellten Flur und trat durch die Hintertür ins Freie.
Im Hof roch es nach nassem Stroh und Pferdemist, und der unablässige Regen hatte den Boden in einen matschigen Acker verwandelt. Unter dem Vordach des Stalls wieherte ein Pferd, und Norris sah, dass es bereits vor den Rollwagen gespannt war.
»Das nächste Mal wart ich nicht auf dich, Junge!« Fannys Mann Jack tauchte aus dem Dunkel des Stalls auf. Er trug zwei Schaufeln, die er hinten auf den Karren warf. »Wenn du Wert drauf legst, bezahlt zu werden, dann sei gefälligst zur vereinbarten Zeit hier.« Ächzend schwang er sich auf den Bock und nahm die Zügel in die Hand. »Kommst du jetzt?«
Im Schein der Stalllaterne sah Norris, wie Jack auf ihn herabstarrte, und wie immer war er verwirrt und wusste nicht recht, welches Auge er ansehen sollte. Das linke und das rechte blickten in völlig verschiedene Richtungen. Schielaugen-Jack, so wurde der Mann von allen genannt – allerdings nur hinter seinem Rücken. Niemand hätte es gewagt, ihn so anzureden.
Norris kletterte zu Jack auf den Wagen. Der wartete nicht erst, bis Norris richtig auf dem Bock saß, sondern ließ sofort ungeduldig die Peitsche schnalzen. Das Pferd zog an, und der Wagen rollte über den schlammbedeckten Hof und zum hinteren Tor hinaus.
Der Regen prasselte auf ihre Hüte und rann in kleinen Bächen an ihren Mänteln herab, doch Schielaugen-Jack schien sich überhaupt nicht daran zu stören. Wie ein buckliger Kobold hockte er neben Norris und ließ nur dann und wann die Peitsche knallen, wenn das Pferd seinen Schritt ein wenig verlangsamte.
»Wie weit fahren wir diesmal?«, fragte Norris.
»Aus der Stadt raus.«
»Wohin?«
»Spielt das eine Rolle?« Jack zog einen Batzen Rotz hoch und spuckte ihn auf die Straße.
Nein, es spielte keine Rolle. Was Norris betraf, war dies eine Nacht, die er einfach hinter sich bringen musste, ganz gleich, wie unangenehm es werden mochte. Er hatte nie die harte Arbeit auf der Farm gescheut, und er genoss es sogar, wenn seine Muskeln vom tüchtigen Gebrauch schmerzten, aber von dieser Art von Arbeit konnte man Albträume bekommen. Als normaler Mensch jedenfalls. Er sah seinen Gefährten von der Seite an und fragte sich, wovon einer wie Jack Burke wohl Albträume bekam, wenn überhaupt.
Der Rollwagen holperte über das Pflaster, und das Klappern der Schaufeln hinten auf der Ladefläche mahnte sie unablässig an die unangenehme Aufgabe, die vor ihnen lag. Norris dachte an seine Kommilitonen, die in diesem Moment gewiss in der warmen Stube des Hurricane saßen und sich eine letzte Runde genehmigten, ehe sie alle nach Hause gingen, um noch ein wenig Wistars Anatomie zu studieren.